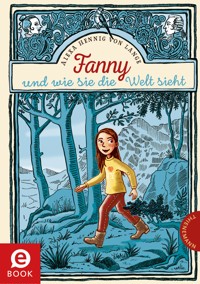9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gestern war es noch für immer Elisabeth und Philip sind glücklich verheiratet. Es gibt nur ein Problem: In drei Jahren Ehe hat die erotische Anziehungskraft dramatisch nachgelassen. Er scheint sich damit arrangieren zu können, während sie entschlossen ist, den alten Zauber wiederzuentdecken. Noch ahnt Elisabeth nicht, dass die Ursache ihres Problems in beider Vergangenheit liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Alexa Hennig von Lange
Warum so traurig?
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Elisabeth und Philip sind glücklich verheiratet. Es gibt nur ein Problem: In drei Jahren Ehe hat die erotische Anziehungskraft dramatisch nachgelassen. Er scheint sich damit arrangieren zu können, während sie entschlossen ist, den alten Zauber wiederzuentdecken.
Noch ahnt Elisabeth nicht, dass die Ursache ihres Problems in beider Vergangenheit liegt.
Über Alexa Hennig von Lange
Alexa Hennig von Lange wurde 1973 in Hannover geboren. Ihr Debütroman «Relax» machte sie auf Anhieb zu einer der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation. Ebenfalls im Rowohlt Verlag erschienen sind die Romane «Lelle», «Ich habe einfach Glück», «Woher ich komme» und «Erste Liebe». 2002 wurde Alexa Hennig von Lange mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.
Inhaltsübersicht
1994–1995 Chris
1996–1998 Markus
1994–2001 Philip
Schließlich war, ein Traum, der wahr geworden ist, das Buch entstanden, das ich bin. Das ich immer schreiben wollte, von dem ich immer dachte, wie könnte es gelingen, das einfach festzuhalten, wie ich denke, lebe, schreibe. Vonseiten des Todes her gesehen.
Rainald Goetz
Für Dich.
1.
Philip klopft leise an die Badezimmertür. Seine Stimme klingt dumpf zu mir herein:
«Elisabeth, wir müssen los.»
«Moment noch.»
Ich sehe in den Spiegel, streiche mir die feuchten Haarsträhnen aus dem Gesicht.
«Was machst du denn da drinnen?»
«Drogen nehmen.»
«Was für Drogen?»
Das bin ich.
«Kokain und LSD.»
«Mach sofort die Tür auf!»
Er drückt die Klinke herunter, ruckelt daran herum. Die Situation kenne ich noch gut von zu Hause. Ständig hämmerte meine Mutter mit den Fäusten an die verschlossene Badezimmertür und rief: «Macht sofort die Tür auf!» Sie befürchtete, meine Schwester und ich könnten uns, auf dem Badewannenvorleger sitzend, die Pulsadern aufschneiden. Jetzt habe ich wieder jemanden, der sich Sorgen macht. Doch in der Zeit, als es wirklich darauf ankam, war niemand da. Ich drehe den Wasserhahn auf, wasche mir die Hände. Dieses Fehlen wird man nicht wieder gutmachen können. Denn es gibt Dinge, die zeigen ihre Wirkung erst Jahre später. Eines Tages werde ich morgens aufwachen und mich fragen, wer Philip ist. Er wird mich in den Arm nehmen, sagen: Elisabeth, ich bin dein Mann. Doch ich werde ihm nicht glauben, mich anziehen und gehen. Tatsächlich werde ich mein Gedächtnis verlieren. Philip drückt die Klinke herunter.
«Mach die Tür auf!»
Endlich tue ich ihm den Gefallen und drehe den Schlüssel herum. Da steht er vor mir, mit hängenden Schultern, und rührt sich nicht. Ich rühre mich auch nicht, sehe ihm nur in die Augen, seine Lippen zucken. Schließlich fragt er:
«Hast du wirklich etwas genommen?»
«Was soll die Frage?»
«Ich will es nur wissen.»
«Mache ich den Eindruck?»
«Nein.»
«Na also.»
Wann versteht er endlich, dass ich kein Interesse mehr daran habe? Ich schlüpfe in meine Schuhe, hänge mir die Jacke über den Arm. Er bleibt mit den Händen in den Hosentaschen neben mir stehen. Wir müssen uns beeilen, wenn wir unseren Flieger noch kriegen wollen. Ich hätte nichts dagegen, ihn zu verpassen. Nur Philip freut sich, endlich wegzukommen. Weil er immer noch unschlüssig herumsteht, drehe ich mich zu ihm um:
«Was ist, willst du nicht mehr fliegen?»
«Doch, natürlich.»
Wir nehmen unsere Koffer. Philip wirft einen letzten prüfenden Blick in die Küche, ich knipse das Licht im Badezimmer aus. Dann laufen wir die Treppe mit dem dunkelblau lackierten Geländer nach unten. Ich würde lieber hier, bei meinen Sachen, bleiben. Als Philip mir die schwere Haustür aufhält, ich an ihm vorbei auf die sonnige Straße trete, fragt er:
«Und was ist mit dir, Lizzy?»
«Nichts. Wieso?»
«Du siehst so komisch aus.»
«Das tue ich doch immer.»
Zum Flughafen nehmen wir ein Taxi. Damit wir zusammen sitzen können, steigen wir beide hinten ein. Während der Fahrt liegen Philips schmale Hände auf seinen Knien, am linken Zeigefinger steckt sein mattgoldener Ehering. Immer wenn seine Hände so liegen, versuche ich mir vorzustellen, was für ein Junge er mit sechzehn wohl gewesen ist. Ich sehe ihn in seinem Schweizer Jugendzimmer auf einem blaugrauen Bettüberwurf sitzen. Um ihn herum ist es still und dämmrig. Bewegungslos schaut er aus dem weiß gerahmten Fenster in den blau schimmernden Garten hinaus, in dessen Mitte ein einzelner blühender Apfelbaum steht. Die letzten Amseln zwitschern leise. Auf dem Schreibtisch liegen ein paar Taschenbücher, Bleistifte, Anspitzer. Die Super-8-Kamera seines Vaters steckt auf dem Stativ daneben. Eine kleine selbst getöpferte Vase mit zwei zart rosa Rosen steht auf dem Nachtschränkchen. Die hat seine Mutter dort hingestellt. Oder seine Freundin. Beides ist möglich, über seine Jugendlieben weiß ich nichts. Dafür aber über die Vision, die er damals von sich und seinem zukünftigen Leben hatte. Er wünschte sich, Stricher zu werden. Heroin wollte er auch nehmen. Nichts dergleichen hat er gemacht. Philip sieht mich an:
«Manchmal geht es eben nicht anders.»
«Was meinst du?»
«Da muss man fliegen.»
Ich nicke. An diesem Tag, an dem mir die Stadt so einladend erscheint, diese Welt da draußen, dass ich es schade finde, mich heute von ihr verabschieden zu müssen. Unfreiwillig, wahrscheinlich für immer. Schon mit sechs Jahren wollte ich mich lieber umbringen, als darauf zu warten, dass der Tod eines Tages zu mir kommt. Doch so überraschend wird er nicht kommen, ich ahne ja, was mit mir passieren wird. Tatsächlich gibt es Kinder, die das Leben nicht aushalten. Sie bringen die Kraft auf, sich mit Gürteln zu strangulieren, bis der Tod eintritt. Habe ich in einem Buch über Autismus gelesen. Später gab ich es an Philip weiter. Ob er sich noch an die Passage über lebensmüde Kinder erinnern kann? Mit Sicherheit. Alles, was mich berührt, berührt auch ihn. Als Jugendlicher hatte er fest vor, sich umzubringen. Er hat sich nur nicht getraut. Ich lehne die Schläfe gegen den schwarzen Fensterrahmen. Glitzernd spiegelt sich das Licht auf der Wasseroberfläche des Kanals, den ich aus dem Blick verliere, als wir nach rechts abbiegen, die breite, vierspurige Straße hinunterfahren, in den Kreisel hinein, weiter an der riesigen Anzeigentafel mit den gelben Ziffern vorbei, die Rampe hinauf. In unserer Nachbarschaft gab es einen Jungen, der es wirklich vollbrachte. Ich sage:
«Als Kind wollte ich Sängerin werden.»
«Hm?»
Ich ging sogar in den Chor. Manchmal, kurz vor dem Einschlafen, singe ich Philip etwas vor. Dabei liegt meine Hand auf seiner grau behaarten Brust, mit den Gedanken bin ich ganz woanders: im Gemeindehaus vor meinem Stuhl stehend, mit den Noten in Händen. Rechts und links von mir singen die anderen Kinder.
Das Taxi hält vor der Haupthalle. Ich will nicht aussteigen. Der Gurt über Schulter, Brust und Bauch gibt mir das Gefühl von angenehmer Sicherheit. Beinahe von heimischer Geborgenheit. Philip und ich haben beide den Verlust unserer Jugend nicht überwunden. Das heißt, in allem, was wir tun, suchen wir nach tröstendem Ersatz. So golden und sexy, wie wir es uns erträumten, wird es nie wieder werden. Als wir einmal miteinander schliefen, sagte er: «Dreh dich um.» Wie drückt man erträglich aus, was dann passierte? Er redete dabei und bekam den entscheidenden, verletzenden Punkt nicht mit. Redete einfach weiter. Sowieso redet Philip sehr viel, wenn wir miteinander schlafen, was inzwischen nur noch selten vorkommt. Als ich wieder klar wurde, fing ich an zu jammern. Vielleicht war es eher ein krampfhaftes Stöhnen. Ich hatte Schmerzen, krümmte mich unter der Decke auf unserem dunkelblauen Laken. Ich nahm es ihm nicht übel, so etwas kann passieren.
Philip zahlt, ich warte im Schatten des Vordaches, bis der Fahrer unsere Taschen aus dem Kofferraum holt und neben uns abstellt. Nie wieder wage ich es, die Klappe selber zu öffnen. In dieser Stadt bekommt man sofort Ärger dafür, sogar, wenn die eigenen Koffer darin liegen.
«Los, komm.»
Philip geht mit dem Gepäckwagen an mir vorbei. Ich folge ihm durch die Drehtür in die Halle. Überall stehen Menschen an den Abflugschaltern, bereit, ins nächste Flugzeug zu steigen. Wie kann es sein, dass nur ich mich sträube? Als wir uns am richtigen Schalter in die Warteschlange stellen, sage ich:
«Philip, ich würde lieber mit dem Zug fahren.»
«Nach Lissabon? Das ist doch albern!»
Natürlich ist das albern. Vor allen Dingen unmöglich, schließlich haben wir nur drei Tage Zeit. Aber die Vorstellung, in der Luft, im Flugzeug zu sitzen, finde ich noch alberner. Philip legt den Arm um mich:
«Es wird alles gut gehen, Lizzy!»
«Ich habe aber so ein ungutes Gefühl!»
«Sollen wir lieber hier bleiben?»
«Nein, das will ich auch nicht.»
«Dann müssen wir fliegen.»
Als wir uns letzte Woche entschlossen, ein paar Tage in Lissabon zu verbringen, fand ich die Vorstellung noch schön. Jetzt würde ich lieber umkehren. Lohnt doch nicht, das Leben wegen ein bisschen Portugal zu gefährden. In diesem einen Punkt stimmen wir nicht überein. Philip sucht unsere Tickets in der Innentasche seines Jacketts, dabei stecken sie hinten in der Hosentasche. Ich gebe sie ihm, weil meine Hand sowieso gerade darüber fährt, meine Finger über seinen Gürtel krabbeln, als könnte ich mich im Falle eines Absturzes daran festhalten. Die Dame hinter dem gelb gestrichenen Tresen lächelt. Kein Wunder, sie bleibt ja auch am Boden. Dafür dürfen wir wählen, wo wir sitzen wollen. Ich beuge mich vor, um mit ihr gemeinsam auf den Monitor zu sehen:
«Hinten … hinten bitte.»
In einer Sendung über sicheres Fliegen habe ich gelernt: Flugzeuge stürzen generell mit der Schnauze nach vorne ab. Da ist es besser, hinten zu sitzen, meistens rammt sich der Flieger nicht so tief in die Erde, dass sogar der Rumpf verschwindet. Bei einer Explosion hilft das allerdings auch nicht weiter. Wir bekommen unsere Tickets wieder.
Mit unserem Handgepäck gehen wir rechts am Schalter vorbei zur Sicherheitskontrolle. Weil wir in unserem Leben schon sehr oft geflogen sind, kennen wir den Ablauf. Alles, was piept, gehört in die kleinen blauen Plastikkörbchen, die uns die Flughafenangestellten entgegenhalten. Die größeren Gepäckteile platzieren wir direkt auf dem Laufband. Anschließend warten wir, bis wir aufgefordert werden, durch den Metalldetektor zu gehen. Bei mir piept nichts. Bei Philip nur die Armbanduhr. Ich weiß nicht, warum er sie dieses Mal am Handgelenk gelassen hat. Er ist doch sonst so zuverlässig. Danach dürfen wir unsere Taschen wieder an uns nehmen, das Kleingeld, die Kugelschreiber einstecken. Als das erledigt ist, stehen wir im tristen Warteraum herum, wo all die anderen Passagiere mit ihren Handys sitzen und telefonieren. Ich wüsste nicht, wen ich jetzt noch anrufen sollte. Außer meiner Mutter. Bei allen anderen Telefonaten entsteht bei mir automatisch der Eindruck, gerade sehr viel Lebenszeit zu verlieren. Philip hat nichts dagegen. Er telefoniert gern. Jetzt hätte es allerdings wenig Sinn, noch ein Gespräch anzufangen. Gleich geht es los. Bis zum Boarding stellen wir uns an die große Fensterscheibe, gucken nach draußen zu unserem angedockten Flieger. Wie ein müder Dackel an der Leine kommt er mir vor. Ich sage:
«So klein ist der?»
«Wer?»
«Unser Flieger.»
«Macht doch nichts. Hauptsache, er fliegt.»
«Philip. Ich will nicht einsteigen.»
«Elisabeth!»
«Ich habe Angst.»
«Weißt du, wie viele Flugzeuge täglich starten und landen?»
«Ja, ja, ich weiß: Millionen.»
Aber mich gibt es eben nur einmal. Aus diesem Grund wird das Ding mit mir vom Himmel fallen. So einfach lasse ich mich nicht beruhigen. Philip gähnt, dreht sich um und holt einen Kaffee am Automaten. Als er mit dem grauen Becher wiederkommt, fragt er:
«Möchtest du auch einen?»
«Nein, danke.»
Ich nehme lieber etwas Sanftes zur Beruhigung. Das tue ich sonst nie, nicht mal, wenn ich unter Kopfschmerzen leide. Früher war das anders. Ständig, so scheint es mir jetzt, war ich high. Nachts, im tanzenden Gedränge, sagte mein Freund Chris zu mir: «Nimm’s mit auf die Toilette.» Ohne nachzufragen, tat ich, was er sagte. Zog es mir einfach rein. Noch heute wundere ich mich über diesen Leichtsinn. Ich war ganz anders erzogen worden. Mir war beigebracht worden, vorsichtig zu sein. Nichts Unbekanntes zu essen oder zu trinken. Niemals Rauschmittel einzunehmen. Ich vermute, ich wollte endlich mal entspannen. Heute versuche ich, mich mit Baldrian zu beruhigen. Sofort fühle ich mich wieder wie eine Abhängige, sowieso hält Philip mich für abhängig. Er sagt: «Einmal abhängig, immer abhängig.» Stimmt gar nicht. Ihm gefällt der Gedanke einfach nur gut, mit einer Süchtigen verheiratet zu sein. Wenn er es schon nicht so weit gebracht hat, soll wenigstens seine Frau ein Junkie sein. Ich sage:
«Du weißt nicht, wie es ist, neben jemandem mit Nierenkoliken zu liegen.»
Keineswegs romantisch. Philip nippt an seinem dampfenden Kaffee, sieht zu unserem Flugzeug hinüber. Gleich sitzen wir da drinnen, starten in den Himmel und glotzen ungläubig auf die sich immer weiter entfernende Heimatstadt.
«Wie bitte?»
Er beugt sich etwas zu mir nach unten, so, als sei er riesig und ich sehr klein. Warum ist es für mich unmöglich zu sagen: «Ich fliege nicht»? Stattdessen gebe ich ihm einen Kuss auf seine festen Lippen. Sage:
«Ist schon gut.»
Nie sind sie locker, so, als würde er mich gar nicht küssen wollen. Ich nehme das nicht persönlich. Mehr geben seine Lippen eben nicht her.
«Ich komme gleich wieder.»
«Nein, du bleibst jetzt hier, sonst fliegt die Maschine ohne uns weg.»
«Macht doch nichts.»
«Ich möchte aber nach Lissabon.»
«Und ich auf die Toilette.»
«Willst du etwa was nehmen?»
«Jetzt hör doch mal auf damit!»