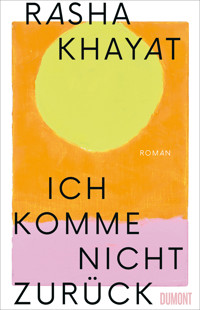
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hanna, Zeyna und Cem – eine leuchtende Freundschaft, die in einem Sommer in den späten Achtzigerjahren ihren Anfang nimmt. Gemeinsam wachsen sie in einer Arbeitersiedlung im Ruhrgebiet auf, bilden eine Wahlfamilie, in der Herkunft keine Rolle spielt. Zuhause ist, wo sie zusammen sein können. Doch je älter die Kinder werden, umso sichtbarer die Unterschiede zwischen ihnen. Mit dem 11. September 2001 wird ihre Freundschaft endgültig vor eine Zerreißprobe gestellt, bis sich die Risse zwischen Hanna und Zeyna zum Bruch ausweiten. Jahre später kehrt Hanna zurück in die Wohnung ihrer verstorbenen Großeltern. Die Stadt steht still, und Hanna fühlt sich einsam. Cem, ihr Fels, ist immer noch da, aber Zeyna schon seit Jahren aus ihrem Leben verschwunden. Hanna begibt sich auf die Suche – nach Zeyna, nach Spuren ihrer Geschichte, nach dem, was damals zwischen sie fiel. Sprachlich zupackend und gleichzeitig poetisch erzählt Rasha Khayat von den Leerstellen in unserem Leben und wie wir sie zu überwinden suchen, von der unendlichen Liebe in einer ungewöhnlichen Familienkonstellation und einer tiefen Freundschaft in einer Welt, die aus den Fugen gerät. »In einer feinen, lyrischen Sprache erzählt Khayat die berührende Geschichte einer großen Freundschaft.« DANIEL SCHREIBER »Dieses Buch ist wie eine ausgestreckte Hand. Ein traurigschöner Protest gegen all das, was Menschen trennt, statt zu verbinden.« DANIELA DRÖSCHER
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Hanna, Zeyna und Cem – eine leuchtende Freundschaft, die in einem Sommer in den späten Achtzigerjahren ihren Anfang nimmt. Gemeinsam wachsen sie in einer Arbeitersiedlung im Ruhrgebiet auf, bilden eine Wahlfamilie, in der Herkunft keine Rolle spielt. Zuhause ist, wo sie zusammen sein können.
Doch je älter die Kinder werden, umso klarer treten die Unterschiede zwischen ihnen hervor. Mit dem 11.September 2001 wird ihre Freundschaft endgültig vor eine Zerreißprobe gestellt, bis sich die Risse zwischen Hanna und Zeyna zum Bruch ausweiten.
Jahre später kehrt Hanna zurück in die alte Heimat, in die Wohnung ihrer verstorbenen Großeltern. Die Stadt steht still, und Hanna fühlt sich einsam. Cem, ihr Fels, ist immer noch da, aber Zeyna schon seit Jahren aus ihrem Leben verschwunden. Hanna begibt sich auf die Suche – nach Zeyna, nach Spuren ihrer Geschichte, nach dem, was damals zwischen sie fiel.
Sprachlich zupackend und gleichzeitig poetisch erzählt Rasha Khayat von den Leerstellen in unserem Leben und wie wir sie zu überwinden suchen, von der unendlichen Liebe in einer ungewöhnlichen Familienkonstellation und einer tiefen Freundschaft in einer Welt, die aus den Fugen gerät.
© Anika Büssemeier
Rasha Khayat, geboren 1978, studierte Vergleichende Literaturwissenschaften, Germanistik und Philosophie in Bonn. Seit 2005 arbeitet sie als freie Autorin, Übersetzerin und Dozentin. 2016 erschien ihr Debüt ›Weil wir längst woanders sind‹. Sie erhielt für ihre Arbeit zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das Grenzgänger-Stipendium der Robert Bosch Stiftung sowie das Werkstipendium des Deutschen Literaturfonds. Außerdem hostet sie den feministischen Literatur-podcast ›Fempire – der Podcast über Frauen, die schreiben‹. Sie lebt im Ruhrgebiet.
Rasha Khayat
ICH KOMME NICHT ZURÜCK
Roman
Von Rasha Khayat ist bei DuMont außerdem erschienen:
Weil wir längst woanders sind
Die Arbeit an diesem Roman wurde gefördert mit einem Werkstipendium des Deutschen Literaturfonds e.V.
E-Book 2024
© 2024 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Etel Adnan, Planète 26, 2020 © VG Bild-Kunst, Bonn 2024
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1064-3
www.dumont-buchverlag.de
Gehen die Freunde vorbei: Keine Spur außer der Spur.
I
An frühen Winterabenden an Bushaltestellen drückt sie am härtesten zu. Sie drückt auf die Schultern und kriecht in den Nacken, umfasst diese Stelle im Brustkorb und macht das Atmen schwer. An frühen Winterabenden an Bushaltestellen ist die Einsamkeit am kältesten.
Im Hochhaus gegenüber der Haltestelle sind die Fenster erleuchtet, und ich stelle mir vor, wie sie dahinter Abendbrottische decken, Sportschau gucken, wie Mütter ihren Kindern die Nutellabrote in kleine Häppchen – in Schäfchen, hat Felizia immer gesagt – schneiden, wie Musik läuft und jemand dazu die Melodie versucht mitzupfeifen, während er Wäsche in den Trockner lädt, wie Familien sich von ihrem Tag erzählen, lachen und sich die Butter über den Tisch reichen.
Ich zupfe an dem in Papier eingewickelten Blumenstrauß neben mir auf der eisigen Stahlbank. Immerhin ein Zeichen, denke ich, immerhin ein Zeichen, dass ich zu jemandem fahre, jemandem, dem ich den Blumenstrauß mitbringe. Wenigstens das, ein Zeichen, dass ich nicht vollkommen allein bin.
Juliane hat eingeladen, Geburtstag in ganz kleiner Runde, so wie gerade erlaubt und wie es »okay ist für euch«, hat sie geschrieben. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich zuletzt unter so vielen Menschen war. Absichtlich unter Menschen, mit denen man absichtlich Zeit verbringt. An der Kasse am Supermarkt, ja, auf den kurzen Runden über den Friedhof, ja, beim Joggen am Morgen, ja, aber sonst – Stille. Stille. Stille.
Als der Bus kommt, greife ich in die Manteltasche, greife die Maske, streife sie übers Gesicht, sofort beschlägt die Brille, na klar, warum auch sehen können, wenn einen niemand sieht – Mütze, Schal, Maske, dicker Mantel –, wir sind nur noch Fellberge, die zwei, drei Leute, die gleich einsteigen: Ich und ein älterer Mann mit Alditüte in der Hand, und ein Junge, vielleicht vierzehn, fünfzehn, die Kapuze tief in der Stirn, den Blick auf das Smartphone in seiner Hand, durch die Kopfhörer hämmern Beats in seinen Kopf und an unsere Ohren. Menschliche Zeichen in Zeiten der Unsichtbarkeit.
Und dann schon wieder – im hinteren Drittel des Busses, da sitzt die kleine Frau, maskiert, und die dunklen kurzen Haare fransen unter einer gelben Mütze hervor. Sie schaut nach draußen, auf das Hochhaus, und ich bilde mir ein, diese Wangenknochen zu erkennen. Spitze Züge, große Augen, leicht zugekniffen gegen das grelle Licht im Bus, den Blick fokussiert auf die Hochhausfenster.
Ich schiebe mich durch den anfahrenden, fast leeren Bus, verdächtig und verstohlen wie eine Diebin, verlangsame den Schritt kurz vor dem Sitz der Mützenfrau und versuche, so unauffällig wie möglich ihren Blick zu erhaschen. Kann doch nicht sein, denke ich, kann doch nicht sein, dass mir das fast jeden Tag passiert. Fast jeden Tag eine kleine dunkelhaarige Frau irgendwo auf meinem Weg, egal wohin, egal zu welcher Uhrzeit. Zuletzt sah ich sie vorgestern an der Tankstelle, wie sie einen blauen Renault betankte.
Konnte das wirklich sein? Konntest du es wirklich sein?
Natürlich bist du es auch diesmal nicht. Der Bus ruckelt um eine Ecke, ich stolpere leicht gegen den Sitz der Frau und komme ihr unabsichtlich so nah, dass kein Zweifel mehr besteht. Nein, du bist es nicht.
»Sorry«, nuschle ich durch die Maske, sie nickt nur wortlos, und ich setze mich auf den Behindertensitz an der Tür. Was muss die Arme denken, da stolpert eine Frau durch einen kaum besetzten Bus und in sie hinein, nur um sich dann auf den Klappsitz neben der Tür niederzulassen. Meinen Blumenstrauß balanciere ich auf dem Schoß, halte mich mit einer Hand an der grünen Stange fest und schaue verschämt auf den abgelaufenen Boden.
Der Bus sieht noch genauso aus wie zu unserer Schulzeit. Du konntest es gar nicht sein, das hätte mir klar sein müssen. Schließlich saßt du immer auf der hinterletzten Bank. Und wenn da kein Platz war, stelltest du dich so dicht neben die Sitzenden, dass sie irgendwann freiwillig ihren Platz räumten.
Ich versuche, die Erinnerung abzuschütteln. Und doch – glaubt man an Zufall, glaubt man an Wahnsinn – zähle ich im Kopf nach, wie viele kleine dunkelhaarige Frauen mir in den letzten Wochen über den Weg gelaufen sind.
Der Effekt ist immer der gleiche – kurz klopft das Herz im Hals und hüpft, dann der Schreck und das Zucken, der Drittelschritt zurück und die Frage: »Soll ich was sagen? Was soll ich sagen?« Einfach deinen Namen sagen? Den Namen fragen, mit Fragezeichen dahinter, die Stimme heben? Zeyna? Zanzoun?
Nächster Halt: Haydnstraße
Glück gehabt, muss nicht weiter nachdenken. Raffe mich auf, lasse beinahe Julianes Blumenstrauß fallen, bekomme das Papier so gerade noch zu fassen und kann das Winterensemble vor dem Trittbrett retten. Die kleine Straße, die zur Neubausiedlung führt, ist hell erleuchtet mit ganz neuen Laternen, keine flackert, keine steht schief. Aufgereiht wie Soldaten, hätte Felizia gesagt, stehen die nagelneuen Laternen und weisen mir leuchtend die Richtung über den nagelneuen Weg in die nagelneue Siedlung. Tim und Juliane haben hier ein Haus gekauft, »schon erstaunlich«, hatte Tim gesagt, »dass sie hier in der Stadt mal so viele neue Häuser bauen.« Tim redet gerne von Aufwertung, von Immobilienpreisen, von Strukturwandel, von Dienstleiterregion, er papageit all das zurück, was in den Zeitungen steht über dieses triste Fleckchen Welt, in dem wir aufgewachsen sind.
Aber auch die neuen Laternen, die neuen Häuser, die neu geteerten Straßen können nicht überschminken, wer wir hier sind. Wer wir immer waren.
Ja, wer eigentlich? Wer waren wir? Ich denke an die Frau im Bus und an die Frau an der Tankstelle vom Vortag, an die Frau an der Kasse bei Lidl. Denke an uns und an die Jahre, die hinter uns liegen. Denke, beim nächsten Mal sage ich deinen Namen. Vielleicht. Wo bist du? Was willst du mir sagen?
Tims und Julianes Vorgarten ist eingefasst von einer dieser mit Steinen gefüllten Zaunmauern, ich weiß nicht einmal, wie man das nennt. Steine in einem Metallkäfig, der einen mit Kies aufgeschütteten Vorgarten umstellt, ein Vorgarten, der den Namen völlig verhöhnt, darf sich irgendwas Garten nennen, wo nicht eine einzige Blume wächst? Juliane sagt, sie hätte Tim einfach machen lassen, und Tim, der fand das praktisch. Und ordentlich. Und gut sauber zu halten. Denke an Felizias und Theos verwilderten Garten. An unsere Parzelle zwischen den anderen Schrebergärten, an das Salatbeet, die Tomaten, die Rhododendren, Hortensien, die alten Bäume (die Magnolie), die kleine Bank unter Efeuranken. Ich denke an uns, wie wir dort Unkraut gejätet haben, und an Nabil und Theo, die Stunden, Tage, Wochen dort im Schuppen Möbel repariert, Stühle gebeizt, Schubladen zusammengeschraubt haben. Unser Garten, der auch längst Geschichte ist. Aufgegeben schon vor vielen Jahren. Hoffe, dass der neue Besitzer ihn so hegt und pflegt, wie wir es getan haben. Will lieber nicht nachsehen, es lieber nicht wissen.
»Hey, Johanna, da bist du ja!« Juliane hat die Tür geöffnet, noch ehe ich klingeln kann. »Ich hab dich schon die Straße runterkommen sehen. Komm rein, komm rein. Ist ja wahnsinnig kalt draußen!«
Die Wände im Inneren des Hauses atmen Juliane, atmen ihre zwei kleinen Mädchen, blond gelockte Putten in Latzhosen, wie hießen sie noch mal, und wieder dieses Drücken auf die Schultern, der Krampf zwischen Zwerchfell und Bauchnabel. Presse ein Lächeln zurecht, während wir uns im Flur umarmen, erleichtert einerseits, nicht schon wieder allein vor dem Fernseher Pommes essen zu müssen, erleichtert, dass mich jemand an sich drückt, auch wenn’s nur Juliane ist.
Dieses ordentliche Leben, denke ich. Dieses ordentliche Leben mit Steinvorgarten, Puttenkindern und der heimeligen Gemütlichkeit, um die ich schon meine Schulfreundinnen beneidet habe. Erinnere mich, mir nichts sehnlicher gewünscht zu haben, damals schon, dass alles geometrisch sein möge in unserem Leben, und ordentlich. Mütter, die zu Hause Kartoffeln kochen und Schnitzel. Väter, die bei der Sparkasse arbeiten oder beim Elektriker Borchert. Geometrische Gärten, geometrische Kinder, ihre Jeans, während wir … in Pluderhosen, in bunten Farben, genäht von Felizia.
Ich überreiche Juliane die Blumen – »Ach, danke, die sind ja schön! War doch nicht nötig! Komm rein, komm rein, Tim, mach doch mal den Sekt auf«, ruft sie den Flur hinunter. »Und du gib mir mal deinen Mantel und geh durch. Tim ist im Wohnzimmer, Marie ist schon da, wir warten jetzt nur noch auf Lars.« Sie schiebt mich weiter in Richtung Wohnzimmer, während sie in die Küche abbiegt.
Mein Blick streift die Wände und den warm getünchten Holzboden. Überall Zeichen von Familie. Ein Bobbycar, kleine Hausschuhe mit Einhörnern drauf und Nilpferden, Legomännchen und ein lila Rucksack mit kleinen Flügeln dran. Die Garderobe quillt über von Mänteln und Jacken, auf dem kleinen Regal darunter mindestens zwanzig Paar Schuhe – Stiefel und Sneaker, Joggingschuhe und Sandalen, Gummistiefel in allen Größen –, niemand ist hier allein, denke ich. Zwanzig Paar Schuhe als Beweis.
»Da bist du ja!« Tim streckt beide Arme in die Höhe, als er mich sieht, in der einen Hand noch die Sektflasche. Über die Jahre haben Juliane und Tim sich optisch immer weiter angenähert. An der Wand hängt ein Familienfoto vom Lago-Maggiore-Urlaub, da tragen tatsächlich alle vier identische Outfits – rote Ringelpullis, jeder Erwachsene ein Kind auf dem Arm, auch die Kinder in roten Ringeln, vier beige Chino-Hosen, Mokassins ohne Strümpfe. Vier Strohhüte. Ich stelle mir vor, wie der Fremde oder die Fremden, die sie angesprochen und gebeten haben, ein Familienfoto vor dem Seepanorama zu schießen, innerlich die Augen verdreht und sich ein God, you guys look stupid verkniffen haben. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht war es ein älteres Ehepaar, und der Mann hat das Foto gemacht, während seine Frau in Sportblouson die rechte Hand auf einem ausladenden Busen hat ruhen lassen, geseufzt und an ihre eigenen Enkelkinder gedacht hat. Vielleicht waren es andere Eltern, die sich wünschten, die eigenen Kinder ließen so ein Kostümfest auch zu, oder sie dachten, wartet mal ab, bis die älter sind.
Tim umarmt mich, ohne mich zu umarmen. Er lehnt die rechte Schulter vor, gegen meine linke, klopft mir dreimal leicht mit der rechten Hand auf den Rücken, dreht seinen Kopf dabei so weit nach links, dass unsere Gesichter sich auf gar keinen Fall, nicht einmal zufällig, berühren. Ich kann sein scharfes Aftershave riechen und dass er schon den einen oder anderen härteren Drink hinter sich hat als den Sekt. Tim hält mich aus als Gast, weil Juliane drauf besteht. Weil es eines der wenigen Dinge ist, auf die sie besteht.
»Hier, auf Julchens Vierzigsten!« Er hat sich schnell aus der Nichtumarmung gelöst und hält mir ein Glas Sekt hin.
»Auf Julianes Vierzigsten«, antworte ich. Julchen bringe ich nicht über die Lippen.
Marie und ich begrüßen uns auch mit Nichtumarmungen, wir kennen uns kaum, stoßen noch mal auf Juliane an, die in der Küche Schmorbraten kocht, und stehen uns eine Weile schweigend, die Arme vor der Brust verschränkt, gegenüber.
»Wo wohnst du noch mal jetzt?«, setzt Marie zu einem Gespräch an.
»Immer noch in der Nähe vom Bahnhof, hinten im Ostviertel.«
»Ach, hast du da was gefunden?«
Soll ich jetzt wirklich die ganze Geschichte erzählen?
»Nein, ich bin noch immer in der alten Wohnung meiner Großeltern. Ich habe nichts Neues gesucht.«
»Oh.« Marie dreht den Kopf zur Seite, in der Hoffnung, Tim mit dem neuen Gast, Juliane oder wenigstens eines der Kinder zu sehen, und stürzt den letzten Schluck ihres Sekts herunter.
»Ich geh mal gucken, ob Jule Hilfe braucht«, sagt sie, dreht sich vollständig um und geht.
Zurück bleibe nur ich, alleine, mal wieder, in dem großen Wohnzimmer, in dieser Erwachsenenwohnung, neben dem gedeckten Esstisch mit dem guten Geschirr, den grauen Stoffservietten mit Silberkante, den teuren Weingläsern. Alles hier ist modern und neu und teuer.
Ich wohne in alten Dingen, die mich inzwischen auch alt aussehen lassen. Ich wohne in alten Dingen, an einem alten Ort, in einer alten Siedlung.
»So, es ist angerichtet!« Juliane und ihr Schmorbraten reißen mich aus meinen Gedanken. Sie kommt mit einer Platte in der Hand und Marie im Schlepptau zurück ins Wohnzimmer.
Wir essen von schweren Tellern, trinken sicherlich teuren Rotwein, stoßen immer wieder auf Juliane und ihre Vierzig an, zwischendurch steht eines der Mädchen schläfrig und mit einem Kuscheltuch in der Hand in der Tür, Mama, ihr seid so laut, und Juliane hebt das Kind vom Boden auf, drückt es an sich und trägt es fort, vermutlich zurück ins Bett. Sie drückt das blonde Köpfchen an ihr Gesicht, ich kann sehen, dass sie den Lockengeruch einatmet und das Köpfchen küsst.
Zum Digestif setzen wir uns in den Wintergarten, Tim serviert Grappa.
»Sag mal, wie geht’s dir überhaupt?« Juliane lässt sich neben mir in einen Korbsessel fallen. Sie nimmt unvermittelt meine Hand, und ich zucke zusammen unter der ungewohnten Intimität.
»Gut, gut«, sage ich reflexhaft. »Gut. Okay. Ganz gut.«
Sie glaubt mir nicht.
Ich sehe mich kurz nach den anderen um, niemand beachtet uns oder hört uns zu, sie fachsimpeln über Grappa oder Brandy, oder was weiß ich, und schwenken ihre Gläser, halten sie gegen das Licht und nicken.
Durchatmen.
»Mir passieren ganz komische Sachen grad«, setze ich an. Ich will versuchen, es Juliane zu erklären. Oder sie bitten, es mir zu erklären.
Sie schaut mich aufmerksam an, hat meine Hand nicht losgelassen. Kurz konzentrieren, will nicht irre klingen.
»In letzter Zeit sehe ich ständig dieselbe Frau. Überall. Also nicht dieselbe Frau. Nur Frauen, die alle so aussehen wie eine Frau, wie eine Freundin. Von früher. Eine alte Freundin. Ständig sehe ich meine alte Freundin überall. Gerade eben noch im Bus. Ich hätte fast deine Blumen fallen gelassen vor Schreck.«
Juliane sagt nichts, streichelt mit ihrem Daumen über meinen Handrücken, ganz zart, kaum merklich. Sagt nichts, schaut mich weiter aufmerksam an.
»Letztens an der Tankstelle auch. Immer dieselbe Frau. Weißt du, so klein und zierlich, dunkle kurze Haare, so als Bob, bisschen dunklere Haut. Überall taucht sie auf, verstehst du, was ich meine? Bin ich einkaufen, steht sie hinter mir an der Kasse. Gehe ich joggen, kommt sie mir entgegen. Mache ich die Runde über den Friedhof, entfernt sie Unkraut auf einem der Gräber. Das ist doch komisch, oder?«
»Aber du meinst, es sind immer andere Frauen, die dich an deine Freundin erinnern? Nicht irgendeine verrückte Stalkerin oder so was, ja?«
Ich nicke und nippe Grappa. Juliane nickt und nippt synchron.
»Meinst du, das ist ein Zeichen? Dass sie tot ist oder so?«, frage ich. Ich möchte, dass sie meinen Kopf an ihren drückt, wie sie es vorhin bei ihrem Kind getan hat.
Nach einer Minute oder zehn schaut sie mich wieder an, in die Augen. »Ich glaube, das ist gerade normal.«
»Normal?«
»Man sieht so wenige Menschen jeden Tag, ist viel allein«, nett, dass sie man sagt und nicht du. Nicht Du bist viel allein. »Und dann diese Vermummung und die Winterklamotten, man kommt sich ja gar nicht mehr nah, bleibt schon automatisch auf Armlänge.«
Unsere Finger sind ineinander verwoben jetzt, nicht gemerkt, wie meine Hände sich in ihre gegraben haben. Halt mich fest, ich werde wahnsinnig.
»Wann hast du deine Freundin denn zuletzt gesehen?«, fragt sie. »Ruf sie doch einfach mal an, ich wette, sie freut sich! Man freut sich doch grad über jeden, der an einen denkt.«
Ja, wenn das so einfach wäre.
Kann nicht. Kann ihr nicht sagen, warum ich nicht kann. Dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Was ich alles nicht weiß. Was ich weiß. Zu viel. Lieber den Blick wieder auf den Grappa. Auf die Sukkulenten auf der Fensterbank. Auf die verwobenen Hände. Ziehe meine Hand langsam aus der Vernetzung und greife nach meiner Tasche.
»Stimmt, vielleicht mache ich das morgen einfach mal«, lüge ich. Besser so. Einfacher. »Kann ich da mal raus und eine rauchen?«, frage ich und deute mit der Zigarettenschachtel in der Hand auf die Tür des Wintergartens.
»Klar, warte, ich hole dir einen Aschenbecher.« Sie wirkt gekränkt von meinem abrupten Rückzug, versucht tapfer, es sich nicht anmerken zu lassen. Ach, da hatte sie gehofft, mich endlich geknackt zu haben. Ihre Worte, von Anfang an. »Du bist nicht leicht zu knacken. Aber warte mal ab, du wirst mich bald schon lieben und dich gar nicht mehr erinnern, wie du ohne mich ausgekommen bist!«, hatte sie gesagt bei einer Grillparty von Kollegen und gelacht.
Später, viel später, zu Hause. Kopf schwer vom Grappa, den Zigaretten und ungeteilter Erinnerung. Ruf sie doch einfach mal wieder an. In der Stille des alten Wohnzimmers hallen Julianes Worte nach, setzen sich auf das Sofa, starren mich an. Denke, dass da mal ein Telefon stand, auf dem schweren hölzernen Ecktisch zwischen Sofa und Sessel, ein Telefon mit Schnur und Tasten und Hörer, in Olivgrün, da hat es gestanden. Julianes Worte könnten den Hörer jetzt abheben und mir in die Hand drücken. Ruf sie doch einfach mal wieder an.
Irgendwo im hintersten Eck meines Kleiderschranks liegt ein alter Laptop. Ob der sich noch anschalten lässt? Fische ihn heraus, unter einem Berg von Halstüchern, alten Handtüchern, einem Gymnastikband, nehme ihn mit aufs Sofa, Knopf gedrückt. Es piept und leuchtet auf. Kurz bleibt das Herz im Hals stecken. Da bist du drin. Da sind wir drin. Da sind wir alle drin.
Klicke mich durch die Ordner, auf der Suche. Jahre von Bildern. Jahre und Erinnerungen. Stimmen, die plötzlich wieder durch die Wohnung klingen. Ich erinnere mich, dich vergessen zu haben.[1]
Wir zwei. Wir drei. Wir alle. Neun Jahre alt, zwölf Jahre alt, achtzehn Jahre alt, fünfundzwanzig Jahre alt, dreiunddreißig Jahre alt. Versuche zu rekonstruieren, welches wohl die letzten Bilder sind. Schaue mir die Mädchen an, die jungen Frauen und denke – ihr wusstet gar nicht, wie frei ihr wart, wie glücklich. Ihr wart zu unglücklich, um das zu sehen. Gemeinsam am Meer, zwei neue Sonnenbrillen für nicht einmal einen Euro zusammen, billige Dinger mit vielen Strasssteinen, aber wir strahlen, als trügen wir Cartier. Liegen uns in den Armen in einem kleinen Fischkutter in Griechenland. Kann mich noch an diesen Kapitän erinnern, der seinen Joint mit uns geteilt hat. Videos auch. Klicke, da lachst du, dein rückhaltloses Lachen, schaust an der Kamera vorbei, auf einem Karussellpferd. Du lachst und schaust kokett an mir vorbei. »Guck doch mal!«, höre ich mich selbst rufen, hinter der Kamera, und du streckst mir die Zunge raus, und ich höre mich lachen.
All die Frauen in den letzten Tagen, sie sahen dir so unglaublich ähnlich.
Augen feucht, Kloß im Hals. Ziehe den Ärmel meines Pullovers über die Hand und wische mir über die Wange. Klappe den Laptop zu. Zu viel.
In der Küchenschublade neben dem Kühlschrank liegt Felizias altes Adressbuch. Schwarzes Kunstleder mit geprägtem Aufdruck: Glückauf Apotheke. Blättere durch die Seiten. In ihrer engen, kurvigen Handschrift stehen sie alle da – immer mit blauem Kugelschreiber –, Namen, Adressen, Telefonnummern, sogar Geburtstage. Diejenigen, die schon verstorben waren, sind sorgsam und mit Lineal und schwarzer Tinte durchgestrichen. Bei Adressänderungen steht die neue Anschrift mit Datum des Umzuges neben dem Namen. Archivierte Leben, ganz klein, viel Sorgfalt. Erinnere mich, wie sie mit ihrer großen Brille am Tisch saß, gebeugt über dieses kleine Buch. »Jetzt ist die Agnes auch nicht mehr da«, seufzte sie, setzte das Lineal an und schickte die Agnes zur Himmelspforte.
Blättere weiter. Da. Eine sehr lange Handynummer mit ausländischer Vorwahl. Das Datum zur Telefonnummer ist etwas über zwei Jahre alt. Vielleicht. Vielleicht stimmt sie ja noch.
Nehme mein Handy aus der Tasche, das Display leuchtet auf. Tippe. Denke, vielleicht habe ich ja Glück und die Nachricht geht gar nicht durch. Man weiß ja nie mit ausländischen Nummern. Dann habe ich es zumindest versucht, ohne Erfolg, und kann aufhören, im Einst und Früher zu kramen. Im selben Moment erscheinen die zwei blauen Häkchen.
Hallo Nabil. Ich weiß nicht, ob das noch deine Nummer ist, ich habe sie aus Felizias Adressbuch. Wie geht es dir? Ich habe in letzter Zeit oft an euch gedacht. Weißt du zufällig, wie ich Zeyna erreichen kann? Würde sie gern anrufen. Danke schön! Viele Grüße, Hanna
II
Der Sommer war still in unserer Stadt. Die Menschen krochen schleichend durch die Straßen der Siedlung, wie Raupen durchs Gebüsch. Die alten Frauen zogen ihre klapprigen Einkaufswägelchen hinter sich her, blieben alle paar Meter stehen, hielten sich an den morschen, bemoosten Zäunen fest, rieben sich den müden Rücken, hockten sich vielleicht für ein paar Minuten auf ein Gartenmäuerchen, tupften sich mit blütenweißen Stofftaschentüchern den Schweiß von der Stirn und aus dem Ausschnitt. Sie stöhnten und atmeten leise, schlossen kurz die Augen, als würde es helfen, sich den Rest ihres Weges innerlich auszumalen. Nur das melancholische Heulen vom Wagen des Klüngelskerls perforierte die Stille. Muss i’ denn zum Städele hinaus heulte es, verzerrt, ohne Text, in einer mir unbekannten Tonart, so schrill, dass man Zahnschmerzen davon bekam. Gemächlich zockelte der kleine Laster durch die Siedlung, verlangsamte sein Tempo an den Gartentoren, wartete, ob jemand noch Schrott abzugeben hatte. Auf der Ladefläche ratterten ein paar Wellblechstücke.
Es hatte seit Tagen nicht geregnet, die Luft flirrte über dem Asphalt, und alle warteten sehnlich auf Abkühlung. Cem und ich bummelten langsam an der Böschung über den Bahngleisen entlang, auf dem Weg nach Hause. Es waren Sommerferien und wir die einzigen Kinder aus unserer Klasse, die zu Hause bleiben mussten. Alle anderen waren mit ihren Familien in Italien oder an der Ostsee oder im Ferienlager im Sauerland. Wir nicht. Wir gingen täglich zur Stadtranderholung, dem Ferienprogramm »für die Arme-Leute-Kinder«, wie Frau Busch von nebenan es nannte, und machten Ausflüge mit anderen Zuhausebleibern.
An dem Tag, an dem wir dich zum ersten Mal sahen, waren wir Minigolf spielen gewesen, was nicht besonders aufregend gewesen wäre, hätte Pascal nicht versehentlich mit seinem Schläger so weit ausgeholt, dass er Sabrina Rohne am Kopf getroffen und ihr eine fette Platzwunde verpasst hätte. Sabrina Rohne hatte geschrien und geblutet, Zlatko, der Betreuer, war ganz weiß im Gesicht geworden, und Cem und ich mussten uns auf die Zunge beißen, um uns das Kichern zu verkneifen. Sabrina Rohne konnten wir nämlich überhaupt nicht leiden.
Auf dem Heimweg in die Siedlung machten wir einen Umweg über den Garagenhof in der Hoffnung, den Eiswagen noch zu erwischen. Wir hatten unser Taschengeld beim Minigolf nicht vollständig ausgegeben und jeder noch ein bisschen was übrig für eine Kugel Schokolade.
Und da warst du, saßt allein auf der kleinen Mauer, in blauen Baumwollshorts und einem weißen T-Shirt. Deine Haut war braun wie die von Cem, deine schwarzen Haare ganz offensichtlich schon länger nicht geschnitten. Du saßt auf der Mauer und spieltest mit einem Feuerwehrauto und zwei Legofiguren und sahst ganz versunken aus, ehe du uns bemerktest.
»Schuh?«
Das war das erste Wort, das ich aus deinem Mund hörte.
Wir hatten dich noch nie gesehen, das kam eigentlich nicht vor im Viertel. Wir kannten hier alle Kinder, alle Erwachsenen, alle, die irgendwo dazwischen waren. Cem stieß mich an der Schulter an und deutete mit dem Kinn in deine Richtung. »Guck mal, die da, auf der Mauer, wer ist das?«, sollte das heißen.
Du musstest ungefähr genauso alt gewesen sein wie wir, das hatten wir verstanden, sonst wären wir wohl nicht so einfach auf dich zugegangen. Für die kleinen Kinder interessierten wir uns noch weniger als für fremde Erwachsene. Wir kamen dir langsam näher, schauten uns ein bisschen um. Es sah nicht so aus, als wären deine Eltern in der Nähe.





























