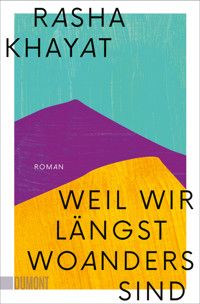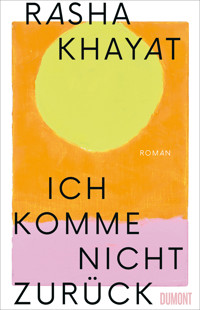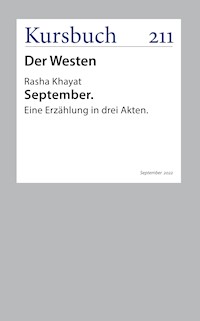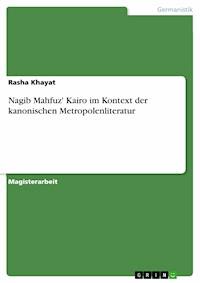
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Note: 1,5, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Untersuchung von so genannter Metropolenliteratur ist in den letzten Jahren zu einem der bevorzugten Themen der Literaturwissenschaft geworden. Die Forschung bezieht sich bei ihren Betrachtungen jedoch allzu häufig auf kanonische Autoren der westlichen Weltliteratur wie Dickens, Balzac, Zola oder Döblin. Werke aus anderen Kulturkreisen und literarischen Traditionen werden leider oft außer Acht gelassen. Die vorliegende Arbeit möchte deshalb einen beliebten und viel bearbeiteten Bereich der Literaturwissenschaft mit dem Werk eines in der westlichen Forschung weniger populären Autors in Zusammenhang bringen. Es sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieses Werkes mit so genannten „kanonischen“ Texten der Großstadtliteratur im Hinblick auf ihre Metropolenreflexion untersucht werden. Nagīb Mahfūz, um dessen Arbeiten es im Folgenden gehen wird, zählt in der arabischen Welt seit über 60 Jahren zu den bekanntesten und meist gele-senen Autoren. Sein Stellenwert in der arabischen Literaturwissenschaft kommt etwa dem von Thomas Mann in der deutschen Forschung gleich und seine Bücher gehören an den ägyptischen Universitäten nicht nur in literaturwissenschaftlichen, sondern auch in geschichts- und politikwissenschaftlichen Fächern zu den Standardwerken . Erdmute Heller schreibt sehr treffend über Mahfūz: „Wenn, um mit Georg Lukac zu sprechen, die Stadt die Wiege des Romans ist, so kann man sagen, Nagib Machfus ist der Romancier der größten, faszinierendsten Stadt des Orients: Kairos“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 1
Page 3
I. Einleitung
Die Untersuchung von so genannter Metropolenliteratur ist in den letzten Jahren zu einem der bevorzugten Themen der Literaturwissenschaft geworden. Die Forschung bezieht sich bei ihren Betrachtungen jedoch allzu häufig auf kanonische Autoren der westlichen Weltliteratur wie Dickens, Balzac, Zola oder Döblin. Werke aus anderen Kulturkreisen und literarischen Traditionen werden leider oft außer Acht gelassen.
Die vorliegende Arbeit möchte deshalb einen beliebten und viel bearbeiteten Bereich der Literaturwissenschaft mit dem Werk eines in der westlichen Forschung weniger populären Autors in Zusammenhang bringen. Es sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieses Werkes mit so genannten „kanonischen“ Texten der Großstadtliteratur im Hinblick auf ihre Metropolenreflexion untersucht werden.
Nagīb Mahfūz, um dessen Arbeiten es im Folgenden gehen wird, zählt in der arabischen Welt seit über 60 Jahren zu den bekanntesten und meist gelesenen Autoren. Sein Stellenwert in der arabischen Literaturwissenschaft kommt etwa dem von Thomas Mann in der deutschen Forschung gleich1und seine Bücher gehören an den ägyptischen Universitäten nicht nur in literaturwissenschaftlichen, sondern auch in geschichts- und politikwissenschaftlichen Fächern zu den Standardwerken2. Erdmute Heller schreibt sehr treffend über Mahfūz:
„Wenn, um mit Georg Lukac zu sprechen, die Stadt die Wiege des Romans ist, so kann man sagen, Nagib Machfus ist der Romancier der größten, faszinierendsten Stadt des Orients: Kairos“.3
1911 in Kairo geboren ist Mahfūz ein Zeitzeuge aller wichtigen politischen
Page 4
Ereignisse des 20. Jahrhunderts in seiner Heimat. Von der Befreiung von der britischen Besatzung über die zwei Weltkriege bis zur endgültigen Unabhängigkeit Ägyptens hat er die Entwicklung seiner Geburtsstadt auf dem Weg zu einer der modernsten Metropolen der arabischen Welt miterlebt. Sein gesamtes Werk ist geprägt von diesen Eindrücken der Veränderung und Entwicklung in Kairo, vom Wandel der Menschen, dem Verfall alter Traditionen und dem Hereinbrechen neuer Ordnungs- und Wertesysteme. Der Stellenwert von Mahfūz’ Heimatstadt Kairo, die er mit Ausnahme von drei kurzen Aus-landsbesuchen nie verlassen hat, ist kaum zu übersehen. Dennoch ist die Bedeutung, die diese Stadt in seinrm Werk spielt, erstaunlicherweise bislang nur am Rande untersucht worden4. In den Interpretationen der Mahfūz’schen Texte kommt ihr im Allgemeinen nicht mehr als die Rolle des Settings zu. Die vorliegende Arbeit möchte die Relevanz der Stadt Kairo für die Interpretation des Werkes von Nagīb Mahfūz analysieren. Außerdem soll auch das Verhältnis seiner Werke zu denen der klassischen Großstadtliteratur beleuchtet werden. In wie weit findet Mahfūz für seine Heimatstadt eine eigene Poetik, und wie sehr orientiert er sich an den westlichen Vorbildern? Welche Rolle spielen klassische Großstadtmotive der abendländischen Literatur, und in wie weit werden sie, um der Andersartigkeit des orientalischen Kulturkreises gerecht zu werden, modelliert? Dies sind die Fragen, mit denen sich diese Arbeit vornehmlich beschäftigen wird.
Natürlich stellt sich für ein derartiges Vorhaben auch die Frage nach der Textauswahl. Das Werk von Mahfūz umfasst nicht weniger als 50 Romane und Erzählbände, hinzu kommen unzählige Artikel, Essays und drei autobiographische Schriften5. Die Wahl eines geeigneten Textes wird außerdem dadurch erschwert, dass der Großteil seiner fiktionalen Texte im Kairo des 20. Jahrhunderts angesiedelt ist.
Die Entscheidung, die Kairo-Trilogie als repräsentativen Text aus dem Werk von Nagīb Mahfūz auszuwählen und sie auf ihre Metropolenreflexion hin zu untersuchen, ist aus mehreren Gründen nahe liegend. Ihr Umfang von fast 1500 Seiten bietet ausreichend Raum für Darstellung und Beschreibung von
Page 5
großstädtischen Phänomenen und Charakteren. Mahfūz erzählt in den drei Büchern „Bain al-Qasrain“ (Zwischen den Palästen), „Qasr asch-Schauq“ (Palast der Sehnsucht) und „As-Sukkarria“ (Das Zuckergässchen) die Geschichte der Kairener Kaufmannsfamilie Abd-Al-Gawwad. Die Romane umfassen einen Zeitraum von fast 27 Jahren zwischen 1917 bis 1944, in dem sich in Kairo vieles bewegt und verändert hat. Die 1956 in Ägypten erschienene Trilogie bildet ein breites Panorama der Stadt Kairo in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab. Sie bietet ein weites Spektrum an Eindrücken, nicht nur von den Menschen und ihrem Leben, sondern auch von der Stadt selbst. Innerhalb von Mahfūz’ Werk stellen die drei Bände den idealen „Stadt-Text“6dar.
Außerdem ist die Trilogie eines der bekanntesten Werke des Autors und in der Wissenschaft vielfach untersucht worden. Der Zugang zu diesen Romanen ist daher leichter als zu anderen, kleineren Werken. Die Trilogie gilt neben dem Roman „Awlād Haritina“ (Die Kinder unseres Viertels) als dasjenige Werk, das Nagīb Mahfūz 1988 den Literaturnobelpreis einbrachte.
Als Vergleichstexte aus der klassischen Metropolenliteratur sollen Erzählungen von James Joyce, Edgar Allen Poe und Nikolaj Gogol sowie die Romane „Petersburg“ von Andrej Belyj und „Manhattan Transfer“ von John Dos Passos herangezogen werden. Diese Autoren sind in diesem Zusammenhang von besonderem Belang, da Mahfūz selbst sie als seine literarischen Vorbilder bezeichnet7. Es wird interessant sein, zu prüfen, in wie weit Nagīb Mahfūz Einflüsse aus diesen Texten der Weltliteratur für seine Darstellung der Stadt aufgreift und modifiziert, wie er Motive und Poetik dem Rhythmus seiner Heimatstadt anpasst und so seine Werke unverwechselbar zu Kairener Romanen werden.
Vor einer Erörterung der Stadtmotive und der spezifischen Poetik der Metropolentexte in den Kapiteln IV und V soll jedoch ein Überblick über die ägyptische Literaturtradition gegeben werden, um das Werk von Nagīb Mah-
Page 6
fūz adäquat verorten und betrachten zu können. Eine literarhistorische Ein-ordnung scheint in diesem Fall besonders wichtig, um auch die Zusammenhänge mit der europäischen und amerikanischen Literaturgeschichte hinreichend verdeutlichen zu können.
Im Kapitel III soll intensiver darauf eingegangen werden, welche abendländischen Einflüsse im Werk von Nagīb Mahfūz zu finden sind und wie sich der literarhistorische Zusammenhang der Kairo-Trilogie mit den hier herangezogenen Vergleichstexten gestaltet.
Am Schluss der Arbeit wird der Zusammenhang zwischen den so genannten kanonischen Texten der Großstadtliteratur und der Kairo-Trilogie deutlich sichtbar sein und es wird evident, dass die Großstadt als erlebtes Moment nicht nur in der europäischen und amerikanischen Literatur ihre Spuren hinterlassen hat.
II. Impuls und Tradition: Ägyptische Literatur des 20. Jahrhunderts
Vergleicht man Artikel, Aufsätze oder Rezensionen zu den Werken von Nagīb Mahfūz in der deutschen und der arabischen Kritik, so lässt sich eine interessante Divergenz feststellen. Besonders auffällig ist dies in Artikeln anlässlich der Verleihung des Nobelpreises 1988. In deutschen und englischen Zeitungen wird zwar die Fülle des Mahfūz’schen Gesamtwerks gelobt, doch ist eine allgemeine kritische Tendenz erkennbar, die den vermeintlich traditionalistischen Stil des Autors bemängelt. Ihm wird vorgeworfen, zwar Themen aus der europäischen Literatur zu übernehmen, ja zu kopieren, aber nicht die angemessene Poetik zu finden. Mangelnde Sprachexperimente und Sprachreflexion sind die Hauptangriffspunkte, die die Kritik vorzubringen hat8. Sein Stil, so der allgemeine Tenor, sei am Ende des 20. Jahrhunderts nicht mehr zeitgemäß.
Betrachtet man nun die arabische Gegenseite, so sollte man unter den Journalisten und Intellektuellen einstimmige Freude und Stolz darüber erwarten, dass zum ersten Mal einem arabischsprachigen Autor der Nobelpreis für Lite-
Page 7
ratur zuerkannt wird. Doch dies ist nicht ausschließlich der Fall. Eine zweite, ebenfalls verbreitete Position wirft dem neuen Nobelpreisträger vor, sich zu sehr an der westlichen Kunstauffassung orientiert und nur deshalb den Geschmack der Schwedischen Akademie getroffen zu haben. Kritiker in den eigenen Reihen feinden Mahfūz wegen seines „unarabischen“ Stils an, und bezichtigen ihn, in seinem Werk seine literarischen Ursprünge zu verleugnen. Sie sehen den Nobelpreis als „einen Preis, mit dem […] die Anerkennung und Befolgung westlicher ästhetischer Kriterien belohnt werde“.9
Beide Seiten greifen Nagīb Mahfūz aus demselben Grund, jedoch mit gegensätzlichen Argumenten an. Es ist offensichtlich, dass sowohl die europäische, als auch die arabische Kritik es versäumt hat, die literarischen Zusammenhänge, Traditionen und Einflüsse von Mahfūz’ Werk adäquat zu untersuchen. Während die europäischen Rezensenten dem Missverständnis erliegen, ein arabischer Autor des 20. Jahrhunderts müsse ebenso schreiben wie ein europäischer Zeitgenosse, verweigert die arabische Kritik die Annahme modernerer Techniken und Themen, die jede ästhetische Entwicklung letztlich mit sich bringt.
Nagīb Mahfūz selbst hat bei verschiedenen Gelegenheiten zu diesen Vorwürfen Stellung genommen und seinen Stil erklärt und verteidigt:„Ich wusste, dass ich in einem konventionellen Stil schreibe, dem Virginia Woolf unlängst einen Nachruf geschrieben hat. Aber die Erfahrung, die ich dichterisch vermitteln wollte, brauchte diese Form der Darstellung. Ich fühlte, ich würde nur ein Epigone sein, wollte ich versuchen, in einem Neo-Stil zu schreiben. Ich entschied mich für die realistische Erzählweise, die wir in Ägypten bis dahin nicht kannten“.10
Angesichts dieser Aussage von Mahfūz und der Positionen seiner Kritiker scheint mir eine ausführliche Betrachtung sowohl der europäischen Einflüsse als auch der genuinen orientalischen Traditionen gleichermaßen bedeutsam. Lediglich mit Hilfe der angemessenen Folie kann eine korrekte komparatistische Analyse der Kairo-Trilogie gewährleistet werden. Der arabischen Litera-
Page 8
tur des 20. Jahrhunderts liegt eine Tradition zu Grunde, die sich in vielerlei Hinsicht von der westlichen unterscheidet, und die literarische Entwicklung in Ägypten kann mit der der abendländischen Literatur nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden. Aus diesem Grund soll das folgende Kapitel einen kurzen Überblick über die moderne ägyptische Literaturgeschichte geben. Es soll aufgezeigt werden, von welchen Vorbildern Nagīb Mahfūz gelernt hat, und wie er seinerseits später die arabische Literatur beeinflusste.
II. 1 Europas Einfluss: Neue Wege des geistigen Lebens
Das Ende des Osmanischen Reiches und die Besetzung Ägyptens durch die Franzosen im Jahre 1798 markieren den Zeitpunkt der Öffnung des Landes nach Europa. Die Jahre der osmanischen Herrschaft waren für das intellektuelle Klima in Ägypten keine sehr fruchtbare Phase11, und so wurden die neuen Möglichkeiten für technische Entwicklung, Bildung und Information, die die französischen Besatzer aus Europa mit in das Land brachten, dankbar aufgenommen12. Die literarischen Traditionen Ägyptens aus der vorislamischen und mamelukischen Zeit, die hauptsächlich auf lyrischen Texten basierten, waren unter den Osmanen nahezu der Vergessenheit anheim gefallen. Während sich im Europa des 16., 17., und 18. Jahrhunderts verschiedenste literarische Strömungen entwickeln konnten, unterlag die ägyptische Literatur dem Stillstand. Das geschriebene Wort hatte künstlerisch keinerlei Wert und besaß lediglich in Form von Texten zur religiösen und geschichtlichen Erziehung eine Daseinsberechtigung.13
Bis zum beginnenden 19. Jahrhundert gab es in Ägypten keine Möglichkeiten zum Buch- oder Zeitungsdruck. Manuskripte wurden handschriftlich vervielfältigt und waren nur zu sehr hohen Preisen erhältlich, eine regelmäßig erscheinende Presse existierte nicht. Erst Napoleon lässt 1799 die erste arabi-
Page 9
sche Druckerpresse ins Land bringen, um französische Proklamationen in arabischer Sprache zu drucken.14
Die kurze Zeit der französischen Besatzung dient gleichsam als Vorbereitung für die Begründung der ägyptischen Herrscherdynastie durch Mohammed Ali im Jahre 1805. Das Vorbild der fortschrittlichen Franzosen vor Augen, begann Mohammed Ali, die Neustrukturierung und Modernisierung der ägyptischen Gesellschaft voran zu treiben. Technische Standards der westlichen Welt wurden in Ägypten eingeführt, ein strukturierter Verwaltungsapparat in Kairo und Alexandria etabliert und das Militärwesen nach dem europäischen Vorbild reformiert.15
Auch das intellektuelle Leben und das Bildungswesen erfuhr unter der Herrschaft Mohammed Alis wieder stärkere Förderung. Er gründete eine Reihe technischer Schulen und Militärakademien, die sich in ihren Schwerpunkten stark von dem traditionellen, religiösen Erziehungssystem der Azhar unterschieden.
Mohammed Ali holte Lehrer aus Frankreich, Italien und England nach Ägypten, um die Schüler in Naturwissenschaften und Fremdsprachen zu unterrichten. Zuvor war die Lehrtätigkeit an den ägyptischen Schulen fast ausschließlich Geistlichen vorbehalten.