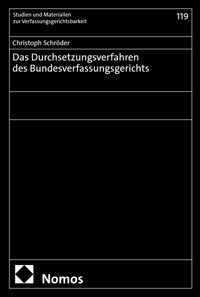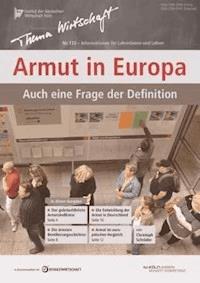13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was ein Fußballschiedsrichter in den Amateurklassen erlebt, ist nicht die große Show, es ist das echte Leben. Hier kickt der Bäcker gegen den Schornsteinfeger und nach dem Abpfiff gibt's erstmal einen Kasten Bier. Authentisch und mit viel Ironie wirft Christoph Schröder einen ganz anderen Blick auf unseren Volkssport Nummer 1. Christoph Schröder steht als Amateurschiedsrichter Wochenende für Wochenende auf zugigen Dorfsportplätzen und lässt sich beschimpfen. Er wird als Wichtigtuer abgekanzelt, als Blinder und Versager. Dabei ist er doch im eigentlichen Leben Literaturkritiker. Was ist das für eine Freizeitbeschäftigung, deren höchstes Ziel darin besteht, nicht aufzufallen? Was muss man für ein Mensch sein, um sich das Hobby des Fußballschiedsrichters auszusuchen und dann auch noch, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, dabeizubleiben? Christoph Schröder erzählt skurrile, faszinierende und rührende Geschichten von merkwürdigen Ritualen, absurden Regeln, Sportplätzen mit Schieflage und von der Schönheit des wahren Fußballspiels.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
CHRISTOPH SCHRÖDER
ICH PFEIFE!
AUS DEM LEBEN EINESAMATEURSCHIEDSRICHTERS
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Tropen
www.tropen.de
© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Herburg Weiland, München
Unter Verwendung eines Fotos von © Martin Fengel
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-50494-1
E-Book: ISBN 978-3-608-10799-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
INHALT
AufstehenPrüfung. Ein Anfang
Tasche packenDer Schnürsenkeltick.Über Rituale, Alpträume und Ausrüstung
PlatzbegehungSportplätze. Eine Heimatkunde
WarmlaufenKondition. Über den Körper
AnpfiffDie Regeln. Ein Erkundungsversuch
HalbzeitpauseErfahrungen sammeln. Über Person und Persönlichkeit
Die zweite HalbzeitDie und wir. Von Trainern, Spielern und Fans
Spielanalyse Auf und ab. Über das Beobachten und Beobachtetwerden
Die dritte HalbzeitAlte Zeiten. Ein Lob des Amateurwesens
Schlaf findenDie Pfeife schweigt. Über Fehlentscheidungen
Der Morgen danachFingerspitzengefühl.Die Medien, der Fußball und die Schiedsrichter
Epilog20 Jahre später. Ein Waldgang
AUFSTEHEN
Prüfung. Ein Anfang
Es fing an im Hinterzimmer einer Vereinsgaststätte. Dort fängt so etwas immer an. Eine braune, abgeschabte Raumabtrennung aus Plastik, dahinter zwei lange Tischreihen. Von der anderen Seite dringen die Geräusche herüber, die sich demjenigen, der seit seiner frühen Kindheit in Gaststätten dieser Art verkehrt, zu einem vertrauten Klangteppich, zu einem Sound des geselligen Lebens verdichten: das Klappern von Würfelbechern, das Klirren der Gläser im Spülbecken, der auf mittlere Lautstärke eingestellte Fernseher, der irgendeine Sportübertragung zeigt, das gedämpfte Gerede der Stammgäste, die, wenn eine neue Runde serviert wird, mit ihren dickbauchigen Biergläsern anstoßen, in denen sich Pfungstädter oder Eichbaum oder Licher Pils befindet.
Hier, auf unserer Seite des Raumteilers, wird gearbeitet. Da sitzt eine Gruppe von 30, 40 Jugendlichen und einigen Erwachsenen, schaut nach vorne an die Wand, an die mit einem Overheadprojektor Zeichnungen und Diagramme geworfen werden, hört dem Mann mit dem sorgfältig ondulierten Haar und dem Schnurrbart zu, der von der Regel 12, von verlorener und vergeudeter Zeit (die philosophische Dimension dieser Begriffe wird sich erst später erschließen) erzählt, von Abseits, absichtlichem Handspiel und den Maßen des Spielfeldes. Es ist das Jahr 1988, es ist noch eine andere Epoche, ein anderes Land als das, in dem wir heute leben. Die alte Bundesrepublik der Kohl-Ära. Es gibt schlimmere Zeiten und schlimmere Orte, um groß zu werden. Es ist ein Land, das es sich in seiner Friedlichkeit und in der perfekten Simulation wirtschaftlicher Grundgesundheit bequem gemacht hat. Ein Land, in dem die Renten sicher sind. Andererseits sind die autoritären Strukturen, die sich gehalten haben, deutlich zu spüren. Die Funktionäre, die hier vor uns stehen, sind keine Tyrannen, sie züchtigen nicht körperlich. Aber sie treten Jugendlichen mit dem selbstverständlichen Anspruch absoluter Autorität entgegen. Die Atmosphäre ist konzentriert. Wer stört, wird ermahnt oder gefragt, ob er antiautoritär erzogen worden sei (eine Frage, die einer Beschimpfung gleichkommt). Hier, in diesem abgetrennten Raum, an langen Tischen, geht es um eine ernste Sache: die Prüfung zum Fußballschiedsrichter.
Ich bin 14 Jahre alt. Und ich sitze hier, um mich ausbilden zu lassen. Der Fußball hat mich beschäftigt, seit ich denken kann. Mein Vater, ein geborener Hamburger, hat seine Liebe zum HSV an meinen älteren Bruder vererbt. Bei mir ist er damit nicht weit gekommen. Ich war Bayern-Fan, ja, wirklich, Bayern München, bevor ich angesteckt wurde von Klassen- und Mannschaftskameraden und zur Frankfurter Eintracht konvertierte. Ein harter Schwenk, ich gebe es zu, sportpolitisch auch nicht korrekt, aber hoffentlich mittlerweile verjährt. Mein erster richtiger Stadionbesuch allerdings war in der Saison 1978/79 das Spiel zwischen Darmstadt 98 und – selbstverständlich – dem HSV, zu dem mein Vater und mein Bruder mich mitgenommen hatten. Das Darmstädter Stadion am Böllenfalltor war pickepackevoll, es hatte und hat, heute erst recht, da es seit Jahrzehnten aus den üblichen Gründen, leere Stadtkasse, leere Vereinskasse, nicht saniert worden ist, eine Atmosphäre von leicht morbidem Charme.
An jenem Bundesligaspieltag am 24.März 1979 konnte ich selbstverständlich nicht ahnen, dass ich mich einmal, nach diversen Abstiegen des Vereins Darmstadt 98, als Schiedsrichter in den Katakomben des Stadions umziehen und die Tür, die direkt in einen schmalen dunklen Gang unter die Haupttribüne des Stadions führt, öffnen würde, das Raunen und Stampfen der Zuschauer über mir, und tatsächlich mit der ersten Mannschaft dieses Vereins zu einem Punktspiel auf den Rasen laufen würde, auf dem 25 Jahre zuvor Horst Hrubesch, Manfred Kaltz, Kevin Keegan und Felix Magath für den späteren Deutschen Meister Hamburger Sportverein standen (die Darmstädter stiegen als Tabellenletzter umgehend wieder ab).
Das Spiel, ich musste nicht nachschauen, endete 1:2, und meine einzige Erinnerung daran, außer dem Ergebnis, ist die, dass die Darmstädter Anhänger nach einem Tor des HSV, gemäß dem Vereinswappen der 98er, das eine Lilie zeigt, lautstark ihren Schlachtruf »Lilien, Lilien« anstimmten und der Fünfjährige, der ich war, sich wunderte: Warum rufen die alle Linie? Der Ball war doch klar im Tor. Ich traute mich nicht, meinen Vater oder meinen Bruder zu fragen, weil es mir wie eine dumme Frage vorkam. Was es auch war. Das Spiel wurde geleitet von Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder aus Oberhausen, einem Mann, der schon zu aktiven Zeiten zur Kultfigur geworden war, weil er einmal die erste Halbzeit eines Bundesligaspiels 13 Minuten zu früh abgepfiffen hatte – er war vollkommen betrunken. Später wurde er mit dem Satz zitiert: »Wir sind Männer, wir trinken keine Fanta«. In Bremen, wo sich jenes denkwürdige Ereignis zugetragen hat, kann man noch heute in den Kneipen einen Ahlenfelder bestellen und bekommt ein Gedeck aus einem Bier und einem Malteser.
Bis zu seinem Tod im Jahr 2014 erzählte er immer davon, wie schön es war, nach den Spielen mit den Mannschaften zusammen ein Bier zu trinken. Oder er erzählte, dass er, wenn er einen Spieler streng ermahnen wollte, diesen daran erinnerte, dass man doch später schließlich noch gemeinsam ein Bier trinken wolle. Darauf war er stolz. Als man ihm die Öffentlichkeit nahm und von der Bundesligaliste strich, hat man ihm sein Leben genommen. Alleine Bier trinken ist auf Dauer deprimierend.
Seit ich sechs Jahre alt war, stand ich im Tor meines Dorfvereins, des SV Nauheim 07. Nauheim, Kreis Groß-Gerau, Südhessen, ziemlich genau im Dreieck zwischen Mainz, Darmstadt und Frankfurt gelegen, hörbare Flughafennähe, Rüsselsheim nebenan. Wer hier keinen Opel fuhr, kam in Erklärungsnot. Nauheim hat heute etwas mehr als 10000 Einwohner, in meiner Kindheit, vor den Neubaugebieten, waren es weit weniger, eine jener Ortschaften, die nach dem Krieg zu sogenannten Vertriebenendörfern wurden, in denen sich die Flüchtlinge aus den Ostgebieten, aus Sudetendeutschland hauptsächlich, ansiedelten. Die Gaststätten hießen »Zum Odenwälder« oder »Zum Egerländer« (so heißen sie noch heute, nur wird dort mittlerweile griechisch oder italienisch gekocht); die Leute fuhren zum Opel nach Rüsselsheim oder zum Frankfurter Flughafen zur Arbeit oder, wenn sie Vertriebene waren, bauten Instrumente. Noch heute rühmt man sich dafür, dass das Saxophon, auf dem Bill Clinton spielt, in Nauheim gebaut wurde.
Es war keine Frage, ob ich einmal zum Fußball und in den Verein gehen würde oder nicht. Tennisspielen war damals noch so wie FDP wählen: Das taten die Neureichen aus dem Neubaugebiet, die glaubten, etwas Besseres zu sein. Mein fünf Jahre älterer Bruder spielte beim SV 07, meine Kindergarten- und Erstklässlerfreunde traten dort ein, weil auch ihre Eltern bereits Mitglieder waren; schon in der Vorschulzeit habe ich mit meinem Bruder oder Freunden in Höfen, Gärten oder auf den seinerzeit noch wenig befahrenen Straßen Nauheims gegen mehr oder weniger brauchbare Bälle getreten, Fensterscheiben zerdeppert und Beulen in parkende Autos geschossen. Die Sportschau am frühen Samstagabend zu verpassen, war ebenso undenkbar, wie am folgenden Sonntagmorgen nicht in den Gottesdienst zu gehen. Der Gleichklang einer friedlichen bundesrepublikanischen Bürgerkindheit.
Ich wollte nicht im Tor stehen, aber wenn eine Mannschaft sich neu formiert, muss es einer tun, und zumeist ist es dann derjenige, der sich nicht in jedem Training aufs Neue wehrt, wenn der Trainer ihn dorthin stellt. Im Nachhinein betrachtet allerdings ist die Torhüterposition der Beginn einer Kontinuität, die sich durch mein Leben hindurch fortsetzen sollte: Es ist die Haltung des etwas beiseite Stehenden, das Geschehen vom Rand her Betrachtenden. Die eines Menschen, der nicht ganz dazugehört und doch mitmacht. Ich weiß bis heute nicht, ob Souveränität oder mangelndes Talent mich in diese Position gebracht haben: Ich wurde kein Fußballspieler, sondern Torhüter und dann Schiedsrichter. Ich wurde kein Schriftsteller, sondern Kritiker. Adorno hätte dafür wahrscheinlich eine Formulierung gefunden wie: immer ganz knapp am Eigentlichen vorbei. Auf dem Platz selbst kommt das freimütige, halbironische Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit im Übrigen immer bestens an. Klassischer Spieler-Schiri-Dialog: »Wohl nie selbst gegen den Ball getreten, was?« »Doch, aber nicht lange und auch nicht so gut wie du, sonst würden wir ja jetzt das gleiche Trikot tragen.« Ahlenfelder hätte sich nach dem Spiel für seine eigene Schlagfertigkeit umgehend mit einem Bier belohnt.
In der F-Jugend wurden wir Kreismeister. Einige Jahre später, als Zwölfjährige, spielten wir zwei Jahre in der seinerzeit höchsten hessischen Jugendklasse. Und auch da hielten wir mit. Ich war kein schlechter Torwart, aber auch kein überragender. Meine Reflexe auf der Linie waren überdurchschnittlich gut, meine Strafraumbeherrschung eher nicht. Ich litt an einer nicht abstellbaren Nervosität. Ich machte Fehler, tauchte unter Bällen hindurch, so dass am langen Pfosten der Stürmer nur noch den Kopf hinhalten musste.
Erst viele Jahre später, als Schiedsrichter, hatte ich die Einsicht, dass etwas nicht stimmt, wenn diese Nervosität vor dem Anpfiff nicht mehr da ist. Aber ich merkte auch, dass sie mit dem Anpfiff verfliegen, sich in eine produktive Anspannung verwandeln und einer – wenn auch konzentrierten – Leichtigkeit weichen muss. Das geschah bei mir als Fußballer nicht. Irgendwann war einer da, der besser war als ich. Deutlich besser. Soweit ich weiß, steht er noch heute, im Alter von rund 40 Jahren, im Tor der ersten Mannschaft des SV Nauheim 07 in der Kreisoberliga Groß-Gerau/ Darmstadt. Sie haben noch keinen gefunden, der ihn ersetzen könnte. Ich landete auf der Ersatzbank, immer öfter. Ein eher unangenehmer Ort für einen 14-Jährigen. Schließlich will man mitmachen, spielen. Und somit war ich einer der Kandidaten, die eines Tages von unserem Jugendleiter angesprochen und gefragt wurden, ob sie es nicht einmal mit einem Schiedsrichter-Neulingslehrgang versuchen wollten.
Die Fragen kommen immer wieder: Wie kommt denn so etwas? Wie wird man denn Schiedsrichter? Muss man da nicht ein Masochist sein und ein Sadist vielleicht noch dazu? Die Antwort auf die Frage »Warum wird man Schiedsrichter?« ist relativ einfach: Jeder Verein ist verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Schiedsrichtern zu stellen, proportional zur Zahl der Mannschaften, die am Spielbetrieb teilnehmen. Geschieht das nicht, drohen Strafen, die bis zum Punktabzug gehen können. Fehlende Schiedsrichter können im Amateursport im Extremfall Auswirkung auf Ab- und Aufstieg haben. Also setzen die Vereine alles daran, Kandidaten für das wenig populäre Amt zu finden. Und das sind meistens diejenigen, die als Fußballer nicht gebraucht werden. Also wurde auch ich angesprochen und sagte erst einmal ja.
Kurz darauf fuhr ich zusammen mit meinem Mannschaftskameraden Dogan (Linksaußen, ebenfalls zweite Wahl; da ist es wieder, das Klischee von Torhütern und Linksaußen, die angeblich einen an der Klatsche haben) eine Woche lang Abend für Abend mit dem Fahrrad durch die Novemberkälte in die benachbarte Kreisstadt, in das Hinterzimmer des Vereinsheims, um dem Mann mit dem Schnurrbart zuzuhören. Viel interessanter als die Frage, warum man Schiedsrichter geworden ist, ist die, warum man es auch geblieben ist. Dass es Menschen gibt, die freiwillig einen Problemberuf ergreifen, ist bekannt. Ich habe einmal ein Porträt über einen Mann geschrieben, der den ganzen Tag in Kläranlagen tauchte, wenn sie verstopft waren. Er sprach nicht gerade mit brennender Begeisterung über seinen Arbeitsalltag, aber doch in einem Tonfall, der ein gewisses Restmaß an Freude ausdrückte. Nun ist das Schiedsrichterdasein erstens kein Hauptberuf und zweitens nicht vergleichbar damit, tagtäglich in einem Becken voller Scheiße zu baden, aber der verbale Shitstorm, der einen treffen kann (nicht muss, und schon gar nicht jede Woche), muss auch erst einmal weggesteckt werden. Man macht trotzdem weiter. Aber warum? Die Antwort ist komplex und vielschichtig. Ich hätte schon lange ein ganzes Buch darüber schreiben können. Jetzt mache ich es.
Der Mann mit Schnurrbart vor den beiden langen Tischreihen, im Hauptberuf Ingenieur und Dozent an einer Fachhochschule, wie wir später erfuhren, konnte, das waren wir aus dem Fußballumfeld so nicht gewohnt, reden, in ganzen, geschliffenen Sätzen. Er war nicht auf den ersten, aber auf den zweiten Blick sympathisch und er ließ keinen Zweifel daran, dass er mehr wusste als jeder andere, dass er es besser wusste, dass er ein Spezialist war. Und genau dazu wollte er uns auch machen. Er sollte derjenige sein, der mich später erstmals als jungen Linienrichter, wie es seinerzeit noch hieß, zu einem seiner Spiele mitnahm. Er war es auch, der mich nach einem groben Anfängerfehler, den ich in diesem Spiel beging (ich hob tatsächlich bei einem Abstoß die Fahne zum Abseits, obwohl es gerade die Ausnahmen waren, die man uns ganz besonders eingebleut hatte: Eckstoß, Abstoß, Einwurf), trotzdem noch einmal an die Seitenlinie stellte. Er war ein warmherziger Mann in einer kühlen Hülle, kein Instinktschiedsrichter, sondern ein Regelintellektueller. Rund 15 Jahre später setzte er seinem Leben selbst ein Ende; die Todesanzeige habe ich bis heute aufbewahrt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Noch sind wir im Hinterzimmer des Vereinsheims, viermal vier Stunden in einer Woche. Eine Woche, in der ich nicht nur innerlich Abbitte geleistet habe für diverse Reklamationen gegen Entscheidungen auf dem Platz, sondern auch gelernt habe, den Sport, meinen Sport, aus einer vollkommen neuen Perspektive zu betrachten und mit einem vollkommen neuen Vokabular zu beschreiben. Es gibt viele Gründe, warum nicht wenige frisch ausgebildete Schiedsrichter nach kurzer Zeit wieder das Handtuch werfen. Ein entscheidender Grund ist, dass sie den Rollenwechsel nicht leisten können, sosehr sie auch wollen. Genau darum hat wohl auch der DFB die Idee, ehemalige Fußballprofis zu Schiedsrichtern umzufunktionieren, schnell wieder aufgegeben – sie könnten es schlicht und einfach nicht.
Einen Schiedsrichter-Neulingslehrgang zu besuchen, ist, als würde man eine Fahrschul-Theoriestunde besuchen. Der Unterschied ist nur der, dass man in der Fahrschule auch mal in ein Auto steigt, bevor man den Führerschein ausgestellt bekommt. Ein Schiedsrichter wird ohne praktische Einweisung (außer der, die er sich in seinem Vor- oder Parallelleben als Fußballer ohnehin erworben hat) auf die Plätze geschickt. Die Prüfung ist in diesem Fall lediglich der Nachweis, dass man in der Lage sein könnte, ein Spiel zu leiten. Wie sollte es auch anders gehen? Heute werden die Absolventen zumindest noch auf die Laufbahn geschickt, um ihre körperlichen Fähigkeiten nachzuweisen.
Der Fußball wurde in dieser einen Woche zum Abstraktum. Abseits der staubigen Hartplätze, auf denen wir sonst zu spielen pflegten, zerlegte der Mann mit dem Schnurrbart unser Hobby in ein System aus Regeln, Vorschriften und Geboten. Alles andere, was außerhalb dieser Vorschriften liegt und einen guten Schiedsrichter in mindestens gleichem Maße bestimmt, lernt man nicht auf einem Neulingslehrgang, sondern auf dem Platz. Und das braucht Zeit. Und mit der Zeit füllten sich dann tatsächlich auch all diese Abstrakta mit Inhalt, mit Bedeutung, mit Leben.
Ein Neulingslehrgang ist ein Anfang, dem kein Zauber innewohnt; er hat nichts Mythisches an sich. Die neue Perspektive auf das Spiel und die praktischen Erfahrungen verbinden sich nicht in einer blitzartigen Erkenntnis. Es gibt nicht den Schiedsrichtermoment; es gibt ganz viele davon, und jeder ist überraschend. Der Satz, der, ich habe es überprüft, auf jedem Lehrgang aufgesagt wird, lautet: »Du musst in jedem Moment auf dem Platz damit rechnen, dass etwas völlig Überraschendes geschieht.« Das kann man wissen und sich vorbeten, ob man in diesem Moment dann trotzdem die richtige Entscheidung trifft, steht auf einem völlig anderen Blatt.
Am fünften und letzten Tag des Lehrgangs füllten wir dann einen Fragebogen aus. Auswendig gelerntes Wissen, das nun in Diagrammen und in einem Ankreuztest abgefragt wurde. Es ging um die Mindesthöhe der Eckfahnen, um die Spielzeit für ein D-Jugend-Spiel und darum, wie man einen indirekten Freistoß auszuführen hat. Basiswissen. Auf späteren Lehrgängen in höheren Klassen hat sich der Lehrwart einmal den Spaß erlaubt, nicht irgendwelche komplizierten, komplex konstruierten Regelfragen, sondern genau dieses Basiswissen abzufragen. Das Ergebnis war einigermaßen erstaunlich – die Durchfallquote lag weit über dem Durchschnitt. Doch nun wusste ich also, welchen Umfang der Ball zu haben hat und wie viele Hilfsflaggen oder Hütchen aufgestellt werden müssen, wenn es völlig überraschend anfangen sollte zu schneien und die Seitenlinien nicht mehr erkennbar sind. 100 Punkte gab es zu erreichen. Ich schaffte 96,5. Demnächst, nach dem Besuch der Pflichtsitzung, würden wir unsere ersten Spiele bekommen, hieß es. Und in ein paar Monaten dann auch den begehrten Ausweis, mit dem man in jedes Stadion in Deutschland hineinkommt, ohne Eintritt bezahlen zu müssen.
Ich war 14 Jahre alt und Fußballschiedsrichter. Ich war neugierig auf meine ersten Einsätze. Und ich hatte keine Ahnung, was es für mein weiteres Leben bedeuten würde.
TASCHE PACKEN
Der Schnürsenkeltick.Über Rituale, Alpträume und Ausrüstung
Ich sitze in einer Umkleidekabine und bereite mich auf das Spiel vor. Durch ein Fenster kann ich nach draußen in Richtung Spielfeld blicken. Es sind eine Menge Zuschauer da. Die beiden Mannschaften stehen bereits auf dem Platz. Es ist angerichtet. Nur ich bin noch nicht fertig, nicht annähernd. Ich habe noch kein Trikot an, noch keine Stutzen und keine Schuhe. Vor mir auf dem Tisch liegt mein Mäppchen mit den übrigen Utensilien: gelbe und rote Karte, die beiden Pfeifen, Stutzenhalter, Stift, Spielnotizkarte.
Im Normalfall läuft alles in der so oft erprobten Reihenfolge ab, instinktiv. Und gerade jetzt müsste ich mich beeilen, ich sehe noch einmal durch das Fenster nach draußen, langsam kommt Unruhe auf; es soll losgehen, man wartet auf mich. Aber es geht nicht: Was auch immer ich tue, geht nur in Zeitlupe vor sich. In Zeitlupe streife ich die Stutzen über, wie immer erst den linken, dann den rechten; in Zeitlupe greife ich nach dem Trikot, das ich bereits auf dem Tisch vor mir bereitgelegt habe.
Da draußen, vor dem Fenster, bewegt sich alles in normaler Geschwindigkeit; die Zuschauer werden wütend, die Spieler gestikulieren zunehmend aggressiv in meine Richtung, sie sind nervös, es soll losgehen, ich streife ganz langsam das Trikot über den Kopf, bleibe dabei noch hängen, sehe kurz nichts, bin desorientiert und zunehmend panisch; jetzt ist wieder Licht da, und ich muss wieder durch das Fenster schauen, da draußen kicken sie jetzt ohne mich den Ball hin und her, und das geht doch nicht, denke ich, die können doch nicht ohne mich, und greife zu meinen Schuhen, in Zeitlupentempo, versteht sich, habe die Schnürsenkel zwischen den zittrigen Fingern; versuche mich zu erinnern, wie man eine Schleife bindet … und schrecke aus dem Schlaf hoch.
Dieser Traum, wieder einmal. Er ist eine Konstante in meinem Leben; seit vielen Jahren träume ich ihn, beinahe wöchentlich, in immer den gleichen Bildern, in immer der gleichen quälenden Langsamkeit.
Ein klassischer Schiedsrichteralptraum. Mein bester und ältester Schiedsrichterfreund, mit dem gemeinsam ich die Prüfung abgelegt habe, hat ebenfalls einen wiederkehrenden Traum: Er steht auf dem Platz, ein Spieler begeht ein sehr schlimmes und schweres Foul; der Schiedsrichter nimmt die Pfeife in den Mund, um aus voller Kraft hineinzublasen – und kein Ton kommt heraus. Beides sind Träume, die vom Versagen handeln, vom eigenen Versagen und vom Versagen der, nennen wir es so, Technik.
Ja, Schiedsrichter wirken möglicherweise auf Menschen, die sich auf andere Weise mit Fußball beschäftigen, also Fans, Spieler oder Trainer, sehr merkwürdig. Sie machen etwas, was nicht vernünftig scheint: Sie übernehmen freiwillig und noch nicht einmal für eine sonderlich gute Bezahlung einen Job, der ihnen nur Ärger einbringt. Schiedsrichter sind für Nichtschiedsrichter per se erst einmal schrullige Menschen, Exzentriker, Wichtigtuer sogar. In jedem Fall übernimmt ein Schiedsrichter ein Amt, das mit Verantwortung verbunden ist und damit, die Kontrolle zu behalten. Wer die Kontrolle über ein Fußballspiel behalten will, muss zuerst einmal die Kontrolle über sich selbst behalten, zumindest für 90 Minuten.
Ein Schiedsrichter muss also, wenn er erfolgreich sein will, ein disziplinierter Mensch sein. Spieler dürfen undiszipliniert sein. Man verzeiht es ihnen im schlimmsten Fall, im besten Fall entstehen dabei genialische Momente. Wenn ein Schiedsrichter aus der Rolle fällt, ist das nicht genialisch, sondern peinlich. Ein Fußballschiedsrichter ist aber auch Sportler. Er braucht Routine und Sicherheit in dem, was er tut. Dabei helfen Rituale. Sportler haben Rituale: Der eine läuft nur auf den Platz, wenn er stets dasselbe Pfennigstück unter der Sohle in seinem Schuh verstaut hat.
In dem grandiosen Film Referees at work gibt es eine Szene unmittelbar vor einem Spiel der Europameisterschaft 2008: Das Schiedsrichterteam sitzt schweigend und in tiefster Konzentration versunken nebeneinander auf der Bank der Umkleidekabine. Und im Waschbecken liegt die Pfeife, das Arbeitsinstrument des Schiedsrichters, das dieser in wenigen Minuten brauchen wird. Der Wasserhahn ist aufgedreht, über die Pfeife läuft also permanent Wasser. Ich habe mir den Kopf zerbrochen über diese Szene. Die Pfeife ist das gleiche Modell, das auch ich benutze; ich sehe nicht den geringsten Sinn darin, sie vor einem Spiel feucht zu halten und durchzuspülen. Es sei denn, dahinter stecken ein bestimmter Aberglaube und die Angst, die Pfeife könnte während des Spiels plötzlich nicht mehr funktionieren.
Am Tag eines Spiels habe ich einen beinahe bis auf die Minute genau durchchoreographierten Ablauf. Wenn der durcheinandergerät, werde ich nervös. Klar weiß ich, dass man auch alles anders machen könnte und es trotzdem gut gehen würde, andererseits kann man ja nie wissen … Nach dem Aufstehen packe ich meine Tasche, und zwar immer in derselben Reihenfolge, ich kann sie heruntersingen, ehrlich gesagt mache ich das auch innerlich. Ganz ehrlich gesagt, mache ich das sogar laut, wenn ich alleine bin: Duschschuhe, Handtücher, Schuhe, Stutzen, Hosen, Trikots, Unterziehshirt, Warmmachshirt, Trainingsjacke. In die Seitentasche der Sporttasche das Mäppchen mit den Utensilien. Bequem muss alles sein, praktisch, schnell greifbar. Und natürlich alles mindestens doppelt oder dreifach, weil einer der Assistenten oder auch beide ihre Trikots ja zu Hause vergessen haben könnten. Oder ihre Hose. Oder alles zusammen. Da bin ich Kontrollfanatiker und gewappnet. In der anderen Seitentasche Verbandszeug, Blasenpflaster, Salben.
Kürzlich hatte einer meiner Assistenten sich beim Brotschneiden für das späte Frühstück (die Nacht hatte er durchgefeiert, so winkte er auch) in den Finger geschnitten, aber richtig. Viel Zeit zum Verbinden hatte er nicht, weil er sonst zu spät zum Treffpunkt gekommen wäre, was bei mir wiederum mittlere Panikattacken auslöst. Da war es dann praktisch, dass Dr. Paranoia mit einem schicken Verband aushelfen konnte. Und wenn man diesen Kram 100 Mal vergeblich mitgeschleppt hat – beim 101. Mal ist er dann doch nützlich.
Als ich meine Prüfung abgelegt habe, gab es nur eine Farbe für den Schiedsrichter: schwarz. Als 1993 das grüne Alternativtrikot auf den Markt kam, war das eine Revolution. Über Jahrzehnte hatten die Schiedsrichter Schwarz getragen und sich die damit verbundenen Schimpf- und Rufnamen aufrichtig verdient (»Schwarzkittel«, »schwarze Sau«, der Klassiker, aber auch eine so originelle Kreation wie »katholischer Kinderf***er«, auch die gerne als Schimpfname verwendete Pfeife war damals noch schwarz, während man sie heute in 30 unterschiedlichen Farbtönen erwerben kann). Nun, mit der Einführung des grünen Trikots, mussten die Zuschauer sich neue Bezeichnungen ausdenken; das taten sie auch, aber seien wir offen: »Grüner Laubfrosch« kommt nicht annähernd an »schwarze Sau« heran, oder?
Wenn ich mir auf YouTube Spiele vergangener Weltmeisterschaften oder auch alte Bundesligaspiele angucke, stelle ich fest, dass der Schiedsrichter seine modische Ausnahmestellung auf dem Platz im Lauf der Jahrzehnte verloren hat. Während die Spieleroutfits immer exotischer wurden, bis hin zu den Papageienoutfits mancher Teams in den 80er- und 90er-Jahren, war es den Schiedsrichtern erst recht spät erlaubt, überhaupt Kurzarmtrikots zu tragen. Bis dahin waren die Ärmel lang und endeten mit Manschetten, so wie das erste Trikot, das ich mir im Jahr 1988 kaufte, auch noch. Schiedsrichter waren die Gentlemen auf dem Platz, sie trugen Hemden, keine Sportswear. Das ist heute anders und hängt auch mit den veränderten körperlichen Anforderungen zusammen.
Die neuen Trikots, mittlerweile auch in den Farben Gelb, Blau oder Rot erhältlich, sind wahrscheinlich aus irgendeinem Hightech-Astronautenmaterial gefertigt; jedenfalls kann man in ihnen schwitzen, so viel man will, sie werden nicht richtig feucht. Keine Ahnung, wo der Schweiß hingeht; vielleicht wird er von aggressiven Bakterien an der Trikotinnenseite aufgesogen oder zurück in den Körper gedrängt.
Auch das Design und die Wirkungsweise des wichtigsten Arbeitsgeräts, der Pfeife, haben sich grundlegend geändert. Kein Schiedsrichter, den ich kenne, benutzt noch eine Trillerpfeife, also eine Pfeife mit einer Kugel, die sich im entscheidenden Moment verklemmen und einen kläglichen Piepton erzeugen kann. Das gängige Modell ist seit Mitte der 90er-Jahre die sogenannte Fox 40, eine Hochtonpfeife ohne Kugel, dafür aber mit einem etwas futuristischen Aussehen, in Kanada entwickelt und zunächst in Sporthallen eingesetzt. Die Fox, die auch in sämtlichen Profiligen zum Einsatz kommt, ist unglaublich laut; mittlerweile haben das auch die Spieler bemerkt. Zumeist hält sich derjenige, der beim Anstoßpfiff dem Schiedsrichter am nächsten steht, die Ohren zu. Manche Schiedsrichter binden sich ihre Pfeife während des Spiels ans Handgelenk, um sie nicht zu verlieren; ich hänge immer zwei Pfeifen aneinander und behalte sie lose in der Hand.
Keinesfalls empfiehlt es sich, während des Spiels die Pfeife permanent im Mund zu tragen, und zwar aus drei Gründen: Erstens bringt es einen aus dem Atemrhythmus, zweitens verleitet es zum überhasteten Pfiff, weil man die halbe Sekunde, die man braucht, um die Hand zum Mund zu führen, nicht zur Verfügung hat, um auf einen eventuell entstehenden Vorteil zu achten. Und drittens kann es ja auch doch einmal passieren, dass man als Schiedsrichter einen Ball ins Gesicht bekommt. Wenn man dann die Pfeife noch im Mund hat, kann das für die Zahnreihen unangenehm werden.
Unverändert in der Farbgebung sind seit ihrer Einführung zur Weltmeisterschaft 1970 die gelben und roten Signalkarten. Zuvor hatte der Schiedsrichter lediglich die Möglichkeit, eine Verwarnung (gelbe Karte) oder einen Feldverweis (also rot) mündlich auszusprechen und mit entsprechender Gestik die Strafmaßnahme nach außen hin zu demonstrieren.
Bei der Weltmeisterschaft 1966 stellte der deutsche Schiedsrichter Rudolf Kreitlein im Spiel zwischen England und Argentinien den argentinischen Kapitän Antonio Rattin nach einer vermeintlichen Beleidigung vom Platz. Der Mann wollte allerdings nicht gehen, es ist nicht klar, ob er sich schlicht weigerte, weil er mit dem Ausschluss nicht einverstanden war, oder ob er überhaupt nicht verstanden hatte, dass er soeben des Feldes verwiesen worden war. Es dauerte jedenfalls mehrere Minuten, bis zwei Polizisten auf den Platz kamen und Rattin in die Kabine führten. Dem englischen Schiedsrichterbetreuer kam einige Zeit später an einer Verkehrsampel die Idee, wie derartige Situationen in Zukunft vermieden werden könnten – die Geburtsstunde der gelben und roten Karte.
Die rote Karte ist in Wahrheit gar nicht rot, sondern neondunkelorange. Das kann jeder nachprüfen: Die Signalkarten sind im Schiedsrichterfachhandel für jedermann frei erhältlich, zum Stückpreis von einem Euro. Sie sind universal verwendbar – unser Mathematiklehrer in der Oberstufe, ein glühender Fußballfan aus Duisburg, verwendete sie im Unterricht zur Disziplinierung seiner Schüler. Ich glaube, er hat in drei Jahren Unterricht in unserem Kurs häufiger rot gezogen als ich in 26 Jahren auf dem Fußballplatz.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz (und die Bekleidungshersteller halten sich daran, indem sie die Schiedsrichterhosen mit besagter Tasche ausstatten), dass der Schiedsrichter die rote Karte in der rechten hinteren Gesäßtasche trägt. Der Griff an den Hintern ist für Spieler und Zuschauer ein Alarmsignal: Gleich fliegt einer. Der Begriff der »Arschkarte«, die man angeblich gezogen hat, und der Eingang gefunden hat in den allgemeinen Sprachgebrauch, stammt exakt aus diesem Kontext. Mittlerweile machen manche Kollegen sich einen Spaß daraus, ab und an die Position der Karten zu vertauschen und die gelbe Karte aus der Gesäßtasche zu ziehen. Das hat gerade unter den betroffenen Spielern einen gewissen Schockeffekt.
Sollte man die Karten einmal vergessen haben, muss man sich zu helfen wissen: In meinem Schiedsrichtermäppchen trage ich noch immer eine selbstgebastelte rote Karte mit mir herum: Ein Schiedsrichterkollege, mit dem ich oft gemeinsam bei Spielen unterwegs war, ich als sein Assistent oder er als meiner, bemerkte einmal in der Kabine, dass seine kleine Tochter ihm die rote Karte aus dem Mäppchen gemopst haben musste. In seiner Jackentasche fand der Kollege zufällig eine Postkarte, ganz in Rot gehalten. Er faltete sie einmal in der Mitte, klebte sie mit Tesafilm zusammen und nahm sie mit aufs Feld. Er musste das Provisorium an diesem Tag sogar benutzen; es soll nicht weiter aufgefallen sein. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn schenkte er mir die Karte; »Mund- und fußmalende Künstler« steht in kleiner Schrift in einer der Ecken. Noch lustiger hätte ich gefunden, wenn die Karte von der Blindenmission gewesen wäre.
Während der letzten Fußballweltmeisterschaft habe ich festgestellt, dass die Signalkarten nicht nur auf Kinder offenbar eine faszinierende Wirkung haben. Dass ich den gesamten Nachwuchs meines Freundeskreises mittlerweile mit Gelb und Rot ausgestattet habe (finanziell ist das zu verschmerzen), versteht sich von selbst. Aber in diesen vier WM-Wochen kam es dann doch häufiger einmal vor, dass auch die Erwachsenen, wenn gerade einmal eine Karte im Fernsehen verteilt wurde, beiläufig fragten: »Hast du eigentlich auch so Karten hier?« Und dann mussten die geholt werden, ich habe immer vier gelbe und vier rote Karten vorrätig, und in die Hand genommen werden, und selbstverständlich musste jeder, der die Karte in die Hand nahm, die klassische Geste vollziehen: die in die Luft gereckte Signalkarte. Und ebenso selbstverständlich machten meine Freunde dabei dieses ironische Gesicht, das mir zeigen sollte: Ich finde das ja ein bisschen lächerlich, dieses Machtgehabe. Aber mitnehmen wollten sie sie alle. Mein letztes gelbrotes Kartenpaar ging im Sommer 2014 an den Redakteur einer großen deutschen Tageszeitung, hinter der sich sonst kluge Köpfe verstecken. Er trug meine Arbeitswerkzeuge voller Freude aus meiner Wohnung hinaus. Heute liegen sie in der Redaktion auf seinem Schreibtisch.
Also, die Tasche ist gepackt, selbstverständlich habe ich die Schuhe geputzt, bevor ich sie eingepackt habe, und ich packe auch alles selbst ein; es gibt tatsächlich noch ältere Schiedsrichterkollegen, denen ihre Frau die Tasche packt und die sich dann ärgern, wenn etwas fehlt. Das ist eine Frage der Generationen und der Milieus, beides ist bei der Schiedsrichterei kräftig durchmischt. Ein älterer Kollege, der seine aktive Laufbahn beendete, hielt bei seiner Verabschiedung eine Rede, in der er auch seine Frau lobte: In den 40 Jahren bis zu seiner Pensionierung sei das Essen kein einziges Mal kalt gewesen, wenn er in der Mittagspause nach Hause gekommen sei. Das ist doch auch mal eine Lebensleistung.
Es gibt noch drei Dinge, die unabänderlich zur Spielvorbereitung gehören: Ich rasiere mich, ich spüle meine Nase mit Emser Salz durch, ich esse einen großen Teller Spaghetti Bolognese, und zwar nach Möglichkeit exakt drei Stunden vor Spielbeginn, es sei denn, die Anreise ist so weit, dass ich früher losfahren muss. Ich weiß nicht, warum es Spaghetti Bolognese sein müssen; vielleicht, weil es auf Lehrgängen in der Hessischen Sportschule in Grünberg immer vor den Leistungstests Spaghetti Bolognese gibt; vielleicht auch, weil ich glaube, gelesen zu haben, dass die deutsche Nationalmannschaft seit den 80er-Jahren sich während internationaler Turniere von nichts anderem als Spaghetti Bolognese, Bananen und (inoffiziell natürlich) Bier ernährt hat, und wenn die deutsche Nationalmannschaft in den 80er-Jahren etwas hatte, dann war es Kraft.
Die Anreise zu einem Spiel versuche ich immer so zu planen, dass ich 75 Minuten vor Spielbeginn am Spielort eintreffe. Früher ist schlecht, weil ich dann nicht weiß, was ich tun soll; später ist auch schlecht, weil die Zeit dann nicht reicht für das, was zu tun ist, also: im Vereinsheim einen Kaffee trinken, ein bisschen Atmosphäre aufnehmen, den Platz kontrollieren, sich umziehen, warmlaufen, dehnen. Wie gesagt: Der gesamte Spieltag bis zum Anpfiff hat im Grunde einen bis auf die Minute genau eingespielten Ablauf. Bei anderen Schiedsrichtern geht es weitaus lockerer zu; sie bleiben bis 30 Minuten vor Spielbeginn beim Kaffee sitzen, plaudern mit Kollegen, alten Bekannten oder dem Wirt der Vereinskneipe, gehen dann betont lässig in ihre Kabine und anschließend auf den Platz, ohne sich warmgelaufen zu haben. So könnte ich das nicht. Ich finde, die Spieler, ganz egal in welcher Klasse, haben ein Recht darauf, ernst genommen zu werden. Sie bereiten sich auf das Spiel vor, sie haben trainiert und sich eine Taktik ausgedacht. Und all das dürfen sie auch von mir als Schiedsrichter erwarten, selbst dann, wenn sie nur in der B-Klasse spielen.