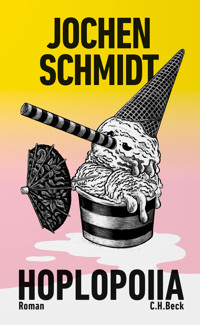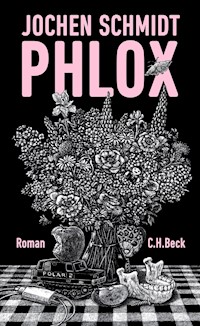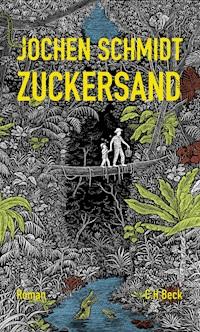16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jochen Schmidt ist der Meister des Stutzens und Staunens, einer stets leicht irritierten Selbsterforschung und der ewigen Sehnsucht, endlich so entdeckungsfreudig und unbelangbar spielen, lesen und sammeln zu dürfen, wie man es eigentlich schon als Kind nie durfte. In den Geschichten dieses Bandes, geschmückt mit Foto-Essays und Cartoons, kommt die Lust, nur so zu tun, als wäre man erwachsen geworden, in ihrer ganzen Tragweite zur Geltung. Schmidt zu lesen ist das reine Vergnügen.
Was macht man nur, wenn die Freundin einem vor dem Gehen noch einen ganz dringenden Auftrag erteilt und man ihn gleich wieder vergessen hat? Warum musste man als Kind immer ins Grüne, wenn doch Fernsehen viel interessanter war, und in welchem Maße haben diese Ausflüge das Verhältnis zur Natur dauerhaft beschädigt? Und was macht Lesereisen, etwa ins beschauliche Pufen, so unvergesslich? Dass man wieder einmal das Buch eines anderen, aber gleichnamigen Autors nach der Lesung signieren durfte?
Die Geschichten dieses Bandes, ergänzt um Cartoons des Autors und Foto-Essays, arbeiten sich mit störrischem Humor an den Konventionalitäten des Lebens ab, etwa dem berüchtigten Ausflug ins Grüne oder ganz allgemein der Notwendigkeit, erwachsen werden zu müssen. Jochen Schmidt, ein grandioser Beobachter, Sammler und Leser, arbeitet in seinen Büchern schon lange daran, sich endlich wie das Kind fühlen zu können, das man schon früher nie sein durfte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jochen Schmidt
Ich weiß noch, wie King Kong starb
EIN FLORILEGIUM
C.H.Beck
Zum Buch
Jochen Schmidt ist der Meister des Stutzens und Staunens, einer stets leicht irritierten Selbsterforschung und der ewigen Sehnsucht, endlich so entdeckungsfreudig und unbelangbar spielen, lesen und sammeln zu dürfen, wie man es eigentlich schon als Kind nie durfte. In den Geschichten dieses Bandes, geschmückt mit Foto-Essays und Cartoons, kommt die Lust, nur so zu tun, als wäre man erwachsen geworden, in ihrer ganzen Tragweite zur Geltung. Schmidt zu lesen ist das reine Vergnügen.
Was macht man nur, wenn die Freundin einem vor dem Gehen noch einen ganz dringenden Auftrag erteilt hat, auch weil man das gemeinsame Kind versorgt, und man ihn gleich wieder vergessen hat? Warum musste man als Kind immer ins «Grüne», wenn doch Fernsehen viel interessanter war, und in welchem Maße haben diese Ausflüge das Verhältnis zur Natur dauerhaft beschädigt? Und was macht Lesereisen, etwa ins beschauliche Pufen, so unvergesslich? Dass man wieder einmal das Buch eines anderen, aber gleichnamigen Autors nach der Lesung signieren durfte?
Über den Autor
Jochen Schmidt ist 1970 in Berlin geboren und lebt dort. Bei C.H.Beck sind die Erzählbände «Triumphgemüse» (2000), «Meine wichtigsten Körperfunktionen» (2007) und «Der Wächter von Pankow» (2015), die Romane «Müller haut uns raus» (2002), «Schneckenmühle» (2013), «Zuckersand» (2017) und «Ein Auftrag für Otto Kwant» (2019) und, gemeinsam mit Line Hoven, «Schmythologie» (2013) und «Paargespräche» (2020) erschienen.
Inhaltsverzeichnis
Meine Philosophie
Mein Unwort des Jahres
Wenn man kein Hungertuch hat
Und nicht den Eierlikör ans Fenster schmieren
Sprung nach unten
Hypnotiseure in Soest
Kritik der reinen Natur
I
II
III
IV
Ach so!
Die Kindheit des anderen
Ein Bild von Picasso
Zwischen Weihnachten und Silvester
Die Altstadt von Prag
Fragen zur Oper
Oblomow
Die Geschichte vom aussterbenden Saurier, dem ausbrechenden Vulkan, dem einbrechenden Einbrecher, dem Wettlauf zwischen Feuerwehrmann und Gepard und dem Piraten, der sich nicht verkleidet hatte
Top 10 der Schriftstellerfrauen, Platz 1: Céleste Albaret
Digital ist schlechter
Auf Tour
Dr. Darwin und Mr. Gott
Stehplatzhotel
Budapest April 2016
Tiefenpsychologische Psychotherapie
Konsumversagen
Alle Dichter lügen
Fritzchen schreit
Jubiläums-Endspurt bei Möbel Kraft
Diese Wohnung ist zu klein für uns beide
Bommelmütze
Grüne Bananen
Union von Oben
Was Bestimmtes machen
Großstadt-Feeling
Weihnachtsgeschenk
Stör ich?
Olympisches Flair
Die Lücke, die der Buchhändler läßt
In der Videothek
Made in Romania – mein Glückstag
Meine Mutter
Ich wär’ so gerne: mein Sohn
Meine Philosophie – das Zuspätwerk
Bildnachweis
Fußnoten
Meine Philosophie
Mein Kopf ist voller Fragen, bin ich deshalb ein Philosoph? Oder müßte ich die Fragen auch beantworten können?
Soll ich meinen Kakao umrühren, oder lohnt es sich, auf die Entropie zu warten?
Was ist, wenn der Schiedsrichter einfach nie abpfeift?
Wie wäre es, wenn ich bei «Durch die Nacht mit …» um halb zwölf schlafen gehe?
Sollte es nicht Produkte geben, auf denen steht: «Neu! Jetzt genau wie vorher!»
Was ist ein Senkel, den man nicht schnürt?
Ist es pedantisch, daß ich sogar bei einem Wort, das ich löschen will, zuerst die Rechtschreibung korrigiere?
Wieso habe ich in der Videothek immer nur Lust auf den Film, der ohne Ton auf dem Bildschirm über der Kasse läuft?
Bin ich für meine Frau noch mitreißend? Oder nur mitreisend?
Ich habe mal das älteste Haus von Oslo gesehen, hätte ich am nächsten Tag noch einmal hingehen sollen, denn da war es ja noch älter?
Warum ist mir noch nie ein Tier zugelaufen?
Warum kann man Fernseher nicht auspusten?
Finden langweilige Menschen alle anderen Menschen interessant?
Sollte man nicht einen Tag vor seinem Tod aus seiner Wohnung ziehen und die Kaution verprassen?
Gibt es Parasiten, die Parasiten haben?
Bringt es Unglück, abergläubisch zu sein?
Warum waren Schlafanzüge früher gestreift?
Wenn ich einen Rollstuhlfahrer an der Ampel über die Straße schiebe, muß ich mich dann mit «Gute Fahrt» verabschieden?
Gibt es M&M’s auch getrennt?
Kann man das Enfant terrible einer Femme fatale sein?
Darf man mit seiner Liebkosung aufhören, nur weil die Ampel umschaltet?
Wäre Pornocchio ein guter Pornofilmtitel?
War Casanova ein Casanova?
Warum muß ich auf dem Bahnhof immer denken: Warum steht ihr hier alle? Euer Zug ist doch längst abgefahren.
Wie oft läßt sich Klopapier falten, wenn man zu faul ist, ein neues Stück abzureißen?
Mein Unwort des Jahres
Ich habe im letzten Jahr wieder viele schöne Wörter gelernt, zum Beispiel «Quetzalcoatlus», das ist ein ausgestorbener Flugsaurier aus Nordamerika, es gibt ihn aber noch als Schleich-Tier, wobei mir der Brachiosaurus von Schleich lieber ist, weil man sich mit seinem langen Hals so gut den Rücken kratzen kann, genau an der «Acnestis». Das Wort kommt aus dem Griechischen und bezeichnet die Stelle zwischen den Schulterblättern, an die die meisten Vierfüßler nicht heranreichen. Ohne die Griechen hätten wir für diese Stelle kein Wort! Wahrscheinlich hat uns die Natur mit einer Acnestis ausgestattet, weil wir dadurch gezwungen sind, uns einen Partner zu suchen, der uns dort kratzt, sonst würden wir womöglich ein Dasein als Einsiedler führen und uns nicht vermehren. Wenn man sich vermehrt hat, braucht man einen antibakteriellen Mundpflege-Fingerling mit Silber-Natriumhydrogen-Zirconium-Phosphat im Faser-Polymer, ein weiteres Wort, das ich im letzten Jahr gelernt habe. Man benutzt den Fingerling, um Babys die ersten Zähne zu putzen, aber auch schon, bevor sie Zähne haben, soll man ihnen vorsichtig das Zahnfleisch damit massieren. Ob sie davon auch früher sprechen lernen? Noch viele andere Wörter hat mir das Jahr geschenkt, was ein «Milanaise-Armband» ist, habe ich bei «Bares für Rares» gelernt, aber für so etwas wird mein Geld fürs erste nicht mehr reichen, man muß sich entscheiden, Kinder oder Milanaise-Armbänder. «Bares für Rares» verdanke ich auch die Wörter «Schnürnecessaire», «Tremolierstrich», «Toi-et-moi-Ring» und «Rattenschwanzkette». Die Sendung, lange unsere Lieblingssendung, ist eine Fundgrube für neue Wörter, trotzdem gucken wir inzwischen sogar noch lieber die «Küchenschlacht», hauptsächlich wegen der Begriffe, die man dort lernt («sous-vide-garen», «Gremolata», «plattieren», «poelieren»).
Ich freue mich immer, neue Wörter kennenzulernen, denn man kann sie einfach benutzen, ohne dafür zu bezahlen, dasselbe Wort kann sogar gleichzeitig von vielen Menschen benutzt werden, im Grunde von allen, die es gibt. Man kann das im Fußballstadion erleben, wenn alle Zuschauer im Chor «Schieber!» rufen, das geht problemlos, anders, als wenn alle gleichzeitig dieselbe Bratwurst zu essen versuchen, das würde nicht ohne Gerangel abgehen. Es gibt aber nicht nur Wörter, die alle gleichzeitig benutzen können, sondern auch Wörter, die alle gleichzeitig nicht benutzen sollten, das sind Unwörter.
Horst Lichter hält sich bei «Bares für Rares» nicht daran, denn er sagt gerne «ein Träumchen», worauf wir uns jedesmal kurz wieder fassen müssen. Genauso geht es uns bei der «Küchenschlacht», wenn in bezug auf ein Risotto der Begriff «schlotzig» fällt. Für meine Tochter sind es Begriffe wie «erläutere» und «begründe» in Testaufgaben. Für meine Freundin ist es «Menschenskinder!», dieses Wort darf mir nicht über die Lippen kommen, auch wenn der Reißverschluß vom Schneeanzug wieder klemmt, sonst beschwert sie sich, ich würde vor den Kindern fluchen. «Menschenskinder!» ist für sie ein Unwort. Ich darf es bei uns nur im Wäscheschrank benutzen, wenn ich die Tür von innen schließe und mir hinterher den Mund mit Seife auswasche. Meine Freundin mag es auch nicht, wenn ich «naschen» sage oder «leckerschmecker», dann bekommt sie innerlich eine Gänsehaut, und ich muß schnell ein paar Verse von Rilke rezitieren, damit sich ihre Ohren erholen. Ich mag diese Wörter eigentlich auch nicht und würde nie darauf kommen, sie zu benutzen, wenn sie sich nicht so schön darüber ärgern würde. Ich für meinen Teil finde es schrecklich, wenn jemand mein freundliches «Vielen Dank» mit «Gerne» beantwortet statt mit «Gern geschehen». «Danke für die Auskunft.» «Gerne.» «Bitte ein Mümmelbrötchen und einen Zimt-Wuppi.» «Gerne.» «Nein, ich habe keine Zeit für eine Telefonumfrage.» «Gerne.» Oder wenn jemand eine Mail an mehrere Adressaten mit den Worten «Ihr Lieben» beginnt, dann kann ich nicht mehr weiterlesen. (Wobei ich auch nicht weiß, was man statt dessen schreiben sollte? Vielleicht schreibt man lieber an jeden einzeln?)
Leider sprechen sich Unwörter ungeheuer schnell rum, kaum habe ich eines zum ersten Mal gehört, kann ich mich schon nicht mehr davor retten («zielführend», «zeitnah», «vollumfänglich», «gefühlt» + irgendwas, irgendwas + «affin», «definitiv», «Geld in die Hand nehmen», «engführen», «das ist nicht so meins», ein «Pott» Kaffee). Manchmal ist es auch gar kein Unwort, das mich stört, sondern eine Betonung, sozusagen eine Unbetonung. Meine Unbetonung des Jahres ist die Art, wie Kassiererinnen seit noch nicht allzu langer Zeit «Hallo» sagen, nämlich nicht mehr auf der ersten Silbe betont «Hallo», sondern, indem sie beim «Ha» den Ton heben «Ha-llo». Ich hoffe immer, daß niemand von unseren ausländischen Gästen, die gerade bei uns Deutsch lernen, das mithört und denkt, man dürfe so sprechen.
Ein Ding kann ein Unding sein, eine Tat eine Untat, ein Mensch ein Unmensch, ein Wetter ein Unwetter, ein Tier ein Untier, ein Fug kann leicht zum Unfug werden, manches Ungeheuer wäre lieber ein Geheuer, ich bin lieber unverfroren als verfroren und ziehe Tote Untoten vor, ich drücke mich lieber verblümt als unverblümt aus und mag Wörter mehr als Unwörter, das gebe ich zu, unumwunden und umwunden. Es gibt so viele schöne Wörter, zum Beispiel «Aperçu» oder «Knalleffekt» oder «Kontermutter», «gelbbindige Furchenbiene» (Wildbiene des Jahres), «schwarzer Schnurfüßer» (Höhlentier des Jahres) und «Klebsormidium» (Alge des Jahres), da kann man auf die Unwörter doch leicht verzichten, und es bleiben immer noch genug für jeden.
Wenn man kein Hungertuch hat
In der kurzen Zeit, die das Essen auf dem Eßtisch verbringt, sind meine Eltern nervös, sie haben Angst vor unaufgegessenem Essen. Wenn das Essen einmal aus den Töpfen befreit und in Schüsseln serviert worden ist, muß es vollständig verspeist werden. Kaum, daß sich alle aufgetan haben, bemerkt meine Mutter erstaunt: «Und ich dachte, es reicht nicht, dann hätte ich doch nicht noch mehr Kartoffeln aufgesetzt!» Wenn es allerdings einmal dazu kommt, daß alle Schüsseln geleert sind, sagt meine Mutter: «Und ich dachte, es ist zuviel! Hätte ich doch noch mehr Kartoffeln aufsetzen sollen!» Daß das Essen immer zuviel oder zuwenig ist und nur ganz selten genau so viel gekocht worden ist, wie die anwesenden Personen schaffen oder vernünftigerweise zu sich nehmen, will ihr nicht in den Kopf. Aber was heißt schon zuviel? Man kann die Gäste ja zum Essen nötigen. Ein Ostpreuße, den wir nicht kannten, aber oft zitieren, antwortete einmal auf die Frage, ob es ihm bei seinen Gastgebern geschmeckt habe: «Ja, aber es fehlte an der Nötigung.» Bei uns wird immer ausgiebig genötigt, man sieht sich irgendwann von Schüsseln mit Resten umstellt, die man essen soll, obwohl man satt ist.
«Laß mal, das können wir doch morgen essen», sagt mein Vater.
«Da gibt es aber was anderes.»
«Dann kriegen es die Hühner.»
«Und ich dachte, es reicht nicht!»
«Ich könnte ja noch, aber ich will nicht», sage ich.
«Gestern hat es nicht gereicht.»
«Dann machen wir das eben zum Abendbrot warm.»
«Das lohnt sich doch nicht, nun iß mal.»
«Ich will aber selbst entscheiden dürfen, wann ich genug habe.»
«Und ich dachte, es reicht nicht.»
Meine Eltern werfen kein Essen weg, es wird alles noch verwertet. Wenn ich bei ihnen bin, sortiere ich immer erst einmal verschimmelte Brotkanten aus, aber ohne daß sie es merken, sonst würden sie die noch irgendwie zurechtschneiden. Saure Milch existiert praktisch nicht, die schmeckt eben nur ein bißchen anders als frische. Mein Vater hat früher das Fett aus Milchtüten gekratzt. Verfallsdaten spielen sowieso keine Rolle. Meine Oma hat zu ihrer Hochzeit sogar vergammeltes Fleisch mit Kaliumpermanganat abgerieben, bis es zumindest nicht mehr giftig war. Vom Geschmack her ist es ohnehin egal, weil sie alles so stark salzen.
«Die Haferflocken sind leider ziemlich salzig.»
«Ich hab aber nur einen Löffel Salz rangemacht.»
«Du mußt gar kein Salz ranmachen.»
«Aber man braucht täglich Salz.»
«Aber das ist ja schon in der Gemüsebrühe drin, die du überall dazutust.»
«Weil die Nudeln sonst nicht schmecken.»
«Mir schon.»
«Wart mal ab, wenn dich deine Kinder immer kritisieren.»
In meiner Kindheit dachte ich, es gäbe nur eine sehr übersichtliche Anzahl von Gerichten:
Nudelauflauf mit Dosengemüse, mit einem Becher süßer Sahne übergossen und zentimeterdick mit Käse überbacken
Hühnerfrikassee mit Champignons aus dem Glas
Reissalat mit Käsewürfeln
Rosenkohl mit Béchamelsauce
Kartoffelpuffer mit Apfelmus
(Und zum Abendbrot aufgebratene Nudeln mit Zucker und Zimt.)
Alles, wovon ich träumte, Fondue, Schaschlik, Scheibletten, Käpt’n-Iglo-Fischstäbchen, Hefeklöße, Schnitzel, Pommes, Flambiertes, Salzcracker, Pilzpfanne, Hirschrücken, Zwiebli-Tubenzwiebelwürfel von Thomy («Zwiebeln ohne Tränen»), Paradiescreme, Ketchup, Gänsebraten mit Klößen, Eisbombe, Krabbencocktail, Unox Heiße Tasse, gab es nur zu Weihnachten oder im Fernsehen. Meine Mutter sagte dann: «Ihr könnt euch gerne am Fleischstand anstellen!» Aber ich wollte mich nicht am Fleischstand anstellen, denn ich hätte sowieso nicht gewußt, worauf man dort zeigen mußte. Die Frauen am Fleischstand mit ihren dicken, rosigen Unterarmen warfen immer so begehrliche Blicke auf meine zarten Kinderfingerchen, wenn sie das schwere Fleischerbeil in ein Kälberrückgrat jagten. Es lagen allerhand blutige Fleischbatzen hinter der Theke, Sachen mit Knochen, Sachen mit weißen Schichten drin, Sachen, die zugeschnitten werden mußten, manche sogar in Einzelteile zerhackt. Aber was davon vom Rind oder vom Schwein war oder gar vom Lamm, das wußte ich nicht. Nackensteak, Kammfleisch, Wellfleisch, Geschnetzeltes, Filet, Mischhack, das würde ich als Erwachsener alles lernen müssen. Und dann gab es ja auch noch das Rumpsteak. Um das zu bekommen, mußte man rumstehen. Beim Fleischer rumstehen, beim Bäcker Rumkugeln und im Museum Bilder von «Rumms».
Nach der Wende füllte sich der Kühlschrank meiner Eltern mit bitterer Orangenmarmelade, Blaubeerjoghurt, Hagebuttenmarmelade, gefüllten Oliven, Zazikisalat, neuseeländischem Straußenfleisch, Serrano-Schinken, es gab Vinschgauer, Fleur de Sel aus der Camargue, Äpfel aus Tirol und Wein aus Grönland. Aber irgendwann vermißte ich unser Hühnerfrikassee und das Jägerschnitzel mit Spirelli und Tomatensauce. Natürlich mit panierter Jagdwurst und nicht mit Schnitzelfleisch.
Weil ich erwachsen bin, nehme ich mir immer nur so viel, wie ich schaffe. Die Kinder nehmen sich immer so viel, daß die anderen möglichst weniger bekommen, und dann schaffen sie es nicht, auch nicht, wenn alles in Ketchup ersäuft. «Wer hat denn da schon wieder so viel übriggelassen?», sagt mein Vater dann beim Abwaschen. «Wer hat denn da sein halbes Glas Wasser nicht ausgetrunken?» «Der schöne Apfelmus.» (Seit einer Weile sagt mein Vater als einziger Mensch auf der Welt «der Apfelmus» statt «das Apfelmus» und behauptet, das schon immer getan zu haben. Er sagt auch «der PC» statt «der Computer» und «Ah-ta» statt «Ata», was angeblich mit den deutschen Lautgesetzen zu tun hat, zunehmend wird auch wieder von «Mark» statt von «Euro» gesprochen, und auch vom «Grammophon» ist manchmal wieder die Rede.)
Meine Eltern haben Angst vor unaufgegessenem Essen, vielleicht denken sie, es könnte uns beim anderen Essen verpetzen, so daß kein Essen mehr zu uns kommen will.
Oder weil von unaufgegessenem Essen das Wetter schlecht wird.
Oder weil unaufgegessenes Essen einem nachläuft.
Ich lebte in zwei Welten: Bei der Schulspeisung landete das Essen manchmal mitsamt Alubesteck direkt in der Tonne.
Man sollte Kinder nicht mit Erziehungsversuchen behelligen, das Komische ist ja, daß man jahrelang erfolglos versucht, ihnen etwas beizubringen, was sie später als Erwachsene sowieso ganz von selbst richtig machen. Alles, was mir als Kind nicht geschmeckt hat, Quark, Spargel, Käse (Roquefort!), Auberginen, Erbsen, Linsen, Bohnen, Datteln, Feigen, Mayonnaise, warme Milch, Haferflocken, Mohrrübensaft, Graupensuppe, Kohlrabisuppe, Anchovispaste, Eintopf, Milchnudeln, Griebenschmalz, Letscho, Bierschinken, Spritzkuchen, Radieschen, Lakritze, Bier, Bitterschokolade, Wein, Wirsingkohl, Spinat, Mohnkuchen, Marzipan, Paprika, Sülze, Rosenkohl, esse ich heute sehr gerne. (Außer Lakritze.)
Manchmal habe ich nichts zu essen im Haus und keine Lust, einkaufen zu gehen. Diese immer gleichen Bewegungsabläufe und Denkvorgänge. Ich bin ja leider gegen Konsumeuphorie immun, und es bräuchte eine millionenschwere Werbekampagne, um mich dazu zu bewegen, irgendeinen neuen Brotaufstrich im Regal auch nur zu bemerken. Der Anblick dieser riesigen Auswahl ermüdet mich so, daß ich mich am liebsten mit in die Feinkosttruhe legen würde. Ich weiß es ja schon vorher: Zu Hause koste ich einmal von dem neuartigen Zeug in der pfiffigen Verpackung, und am nächsten Tag befindet es sich schon in diesem Schwebezustand, wahrscheinlich ist es noch gut, aber probieren wäre mir zu riskant, weshalb ich es stehenlasse, bis es eindeutig verschimmelt ist und ich es wegwerfen kann. Es langweilt mich, dieses aufdringlich bunte Zeug in den Wagen zu schaufeln, wenn ich doch eigentlich viel lieber eine Schnittlauchstulle möchte, aber mit echtem, selbstgezogenem Schnittlauch vom Dorf und mit dem Brot meiner Jugend, das so gut geschmeckt hat, daß man schon auf dem Weg von der Kaufhalle nach Hause die halbe Kruste abgepult hat. Das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen, wie Brot früher geschmeckt hat, man roch es kilometerweit, ich habe oft auf jeden Belag verzichtet, um den Geschmack nicht zu verfälschen, eine daumendicke Schicht Butter war alles, was ich zur Verfeinerung brauchte. Weil ich so ungern einkaufe, muß ich mich manchmal tagelang von meinen Vorräten ernähren, und wie bei der Zahnpasta, aus der immer noch etwas rauskommt, selbst wenn sie leer ist, wie bei den Hosentaschen, in denen sich einfach immer noch irgendwo eine Ein-Euro-Münze für den Korb findet, wie bei den Brusthaaren, von denen man bei jedem Griff hinein immer ein paar erntet, so ist es auch mit der Wohnung, man kann in einer modernen Wohnung gar nicht verhungern, es findet sich immer noch etwas zu essen.
Ich muß nur im Krümelfach des Toasters nachsehen, das habe ich das letzte Mal vor Jahren geleert, als der Toaster wegen der vielen Krümel Feuer gefangen hatte. Was sich da an Krümeln findet, reicht immer für eine Brotsuppe oder einen ganzen Semmelpudding, wenn man es mit Wasser ansetzt und um die Krümel von unter der Wachsdecke ergänzt.
Das Eisfach des Kühlschranks mache ich normalerweise nie auf, weil es zugewachsen ist und die Klappe festklebt. Aber wenn man es abtaut, entdeckt man manchmal eine Packung Gefrierspinat und dahinter einen angefangenen Becher Speiseeis, die sind ja immer viel zu groß.
Wenn man Kinder hat, gibt es eigentlich immer Süßigkeiten in der Wohnung, entweder in ihren verschiedenen Verstecken oder in den eigenen, in denen man die opulenten Süßigkeitenmischungen mit den seltsam unvertrauten No-Name-Namen verschwinden läßt, die von den Großeltern stammen. Es ist auch viel besser, wenn man überlagerte Gummibärchen lutscht, weil die so hart sind, daß man für jedes eine Weile braucht, während man neue sofort runterschluckt. Man kann auch an der Nudelkette knabbern, die das Kind damals im Kindergarten gebastelt hat.
Es lohnt sich immer, in der Schultasche nachzugucken, vor allem am Wochenende, da ist oft noch das Essen vom Freitag drin. Wenn man Glück hat, war das Kind am Freitagmorgen bei der Mutter, dann gibt es vielleicht sogar eine Cherrytomate oder eine Stulle mit frischen Radieschen. Das geht natürlich nur, wenn man getrennt lebt.
In diesen Hängekörben aus Draht, die mal Ordnung beim Obst schaffen sollten, findet sich eine ganze Banane, die ich erst übersehen hatte, weil sie schwarz ist, aber das heißt gar nichts, heutige Bananen vergammeln nur noch äußerlich, innen schmecken sie ganz normal. Und selbst, wenn sie schon braun sind, ändert das höchstens etwas am Geschmack. Unter der Banane verbirgt sich auch noch eine Zwiebel, die kann man anbraten, vielleicht mit den Brotkrümeln aus dem Toaster. Die Knoblauchzehen lösen sich ja komischerweise immer mit der Zeit in Luft auf, da bleibt nur die Hülle, wie bei Raupen, die sich verpuppen. Noch mehr Brotkrümel findet man übrigens häufig im Bett. («Wer nie sein Brot im Bette aß, weiß nicht, wie Krümel pieken.») Aber ich habe ja ein Doppelbett und kann die Krümel immer auf die andere Seite fegen. Und in meiner DDR-Schublade liegt noch der «Atomkeks», ein Kekskomprimat in einem Metallbehälter, vom VEB Wikana, Süß- und Dauerbackwarenfabrik Wittenberg Lutherstadt, die eiserne Ration, die ich beim NVA-Dienst geklaut habe. Der Keks ist zwar seit dreißig Jahren abgelaufen, aber er hätte ja sicher auch schon vorher nicht geschmeckt.
Man kann wohl auch Tapete essen, weil im Kleister Stärke ist, aber das habe ich gar nicht nötig, weil sich meistens noch eine Kartoffel findet, die in die Kiste mit den Pfandflaschen gekullert ist, ich gebe sie nur alle paar Jahre ab.
In der Winterjacke mit dem Loch in der Tasche sind noch Kaugummis und ein paar Fisherman’s, die rutschen immer ins Futter.
Fleisch ist schwieriger aufzutreiben, aber am Fahrradlenker klebt ein bißchen Rotkohl und mit etwas Glück am Schutzblech ein Schnipsel vom letzten Döner.
Am Ende bleibt manchmal allerdings auch mir nichts übrig, als doch wieder meine Eltern zu besuchen, bei denen ich wie eine Made bin, die keine andere Funktion hat als zu fressen. Hatte ich als Kind noch den Ehrgeiz, etwas Besonderes im Leben zu erreichen, etwa die Regierungen des Ostblocks zu stürzen oder alle unvollendeten Symphonien zu Ende zu komponieren, so weiß ich heute, daß das alles nur für kurze Zeit Spaß machen würde und man sich bald, nachdem man alle Regierungen gestürzt hätte, wieder langweilen würde. Meine Mutter fragt mich, ob ich Bohnen und Kartoffeln oder auch ein Würstchen will. Ich versuche dann immer, wie bei Burger King, so zu antworten, daß ich ein Minimum an Zusatzfragen gestellt bekomme: «Mach einfach, was dir am wenigsten Mühe macht, Mutti.»
«Also kein Würstchen?»
«Doch, eins.»
«Eins oder zwei?»
«Zwei.»
«Dann muß ich noch mal einkaufen gehen.»
«Dann nur eins.»
«Du kannst aber auch zwei haben.»
«Aber wenn du dann extra einkaufen mußt?»
«Ach, ich bin’s gewohnt, euch zu bedienen.»
Während ich mit meinem Vater Fußball gucke, guckt meine Mutter im anderen Zimmer Eiskunstlauf. Sie schafft es irgendwie immer, genau dann rüberzukommen, um etwas zu sagen, wenn im Spiel gerade etwas Spannendes passiert. Da die meisten Fußballspiele aber langweilig sind, bleibt das ein ewiges Paradox. Es erinnert mich an die Karikatur von Henry Büttner, in der ein Mann seiner Frau eine Art vergitterten Laufgang wie für Tiger gebaut hat, durch den sie auf Knien robben muß, wenn sie am Fernseher vorbei will. Meine Mutter hat sich abgewöhnt, darauf zu warten, daß man ihr zuhört, wenn sie etwas sagen will, sie kommt schon redend herein. Deshalb haben sich alle anderen angewöhnt, nicht hinzuhören. Später streiten sich meine Eltern dann, ob sie etwas gar nicht gesagt oder ob mein Vater es überhört hat. Ich denke, es stimmt beides: Sie hat es nicht gesagt, und er hat nicht hingehört.
Im Nebenzimmer guckt meine Mutter Eiskunstlauf und ärgert sich, daß «die kleinen Chinesen» neuerdings alles gewinnen. Die guckten immer so ernst, sagt meine Mutter, das sei nur Athletik bei denen. Die sprängen zwar alles vierfach, aber sie gäben sich mit dem Drumherum keine Mühe, obwohl es doch Eiskunstlauf heiße. Wir gucken seit vierzig Jahren Eiskunstlauf, können aber ohne Hilfe des Moderators keinen Rittberger von einem Salchow oder einem doppelten Lutz unterscheiden. Mich fasziniert noch immer, daß die Läufer rückwärts nicht an die Bande prallen, sondern kurz vorher die Richtung wechseln. Ich vermute, daß sie sich auf der großen Leinwand in der Arena selbst beobachten. Meine Mutter hat festgestellt, daß die Amerikaner seit neuestem häufig deutsche Namen haben. Sie denkt, das liege daran, daß die Nachkommen der deutschen Einwanderer wieder «in die Städte drängen», wie sie das nennt. Ich sage, daß Eiskunstlauf wahrscheinlich eher ein Sport für die Mittelschicht ist. Sie sagt: «Ja, aber Sandra Bullock war in München auf einer Waldorfschule», als wäre das irgendein Argument. «Na eben, sag ich doch», antworte ich. «Und der mit dem italienischen Namen, Caprioti oder so, hat eine deutsche Großmutter», legt sie nach. Das hat zwar im engeren Sinne nichts mit unserem Thema zu tun, aber meine Mutter führt Gespräche in Gedanken einfach weiter und teilt einem dann etwas mit, was erst viel später gesagt worden wäre oder was sich auf etwas bezieht, das jemand anders vor ein paar Wochen gesagt hat.
Nach dem Ende der Eiskunstlaufübertragung kommt meine Mutter zu uns, um uns während des Elfmeterschießens das Ergebnis zu verkünden: «Das kanadische Paar ist zu Unrecht auf dem dritten Platz.»
«Zu Unrecht, weil sie zu hoch bewertet sind oder zu tief?», fragt mein Vater.
«Und die Chinesen haben wieder so ernst geguckt.»
«Zu hoch bewertet oder zu tief?», fragt mein Vater noch einmal.
«Nein, die waren zu Recht Zweite.»
«Warum zu Unrecht bewertet, das skandinavische Paar?», fragt mein Vater und wird langsam ärgerlich.
«Nicht skandinavisch, kanadisch», sagt meine Mutter, als sei das eine Antwort. Und zu mir sagt sie: «Willst du die Würstchen gebraten oder gekocht?»
«Wie’s dir bequem ist.»
«Mir macht es nichts aus.»
«Na dann gebraten.»
«Und lieber Bratkartoffeln oder gekochte?»
«Bratkartoffeln.»
«Dann muß ich aber erst Kartoffeln kochen.»
Das Abschiedsgespräch ist dann immer meinen Stullen gewidmet. «Wie viele Stullen soll ich machen? Drei oder vier?»
«Drei.»
«Also drei Stullen oder drei doppelte?»
Das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was sie mit «doppelt» meint. Wir haben uns bis heute nicht auf eine Klappstullenterminologie einigen können.
«Und ein Säftchen?»
«Ja, eins.»
«Oder lieber zwei?»
«Dann zwei.»
«Beide Apfelsaft oder eins von jedem?»
«Was ist denn das andere?»
«Orangensaft, aber ich weiß nicht, ob noch welcher da ist.»
«Dann Apfelsaft.»
«Na, gut, daß ich so viel Apfelsaft gekauft habe.»
Wir gucken gerne «Seinfeld», die Lieblingsfigur meiner Mutter ist die Mutter von George. Eigentlich sind in allen Serien die Mütter ihre Lieblingsfiguren. Ihre Lieblingsserie ist «Roseanne». Und bei «Sopranos» spult sie bei Gewaltszenen vor, begeistert sich aber für die Mutter von Tony Soprano, die einen Killer auf ihn ansetzt, weil er sie ins Altersheim stecken will. Meine Lieblingsfigur bei «Seinfeld» ist George, und bei «King of Queens», der Serie mit dem «kleinen Lastwagenfahrer», wo meine Mutter nicht versteht, daß der so dick ist und trotzdem so eine hübsche Frau hat, ist der aufbrausende, leicht senile Schwiegervater Arthur mein Favorit. Ich identifiziere mich also mit sozial unverträglichen Männern, meine Mutter mit ihren Müttern. Vielleicht ist sie ja deshalb Mutter geworden, und ich Sohn, das paßt schon gut zusammen.
Dies alles schreibe ich, während ich in der Wohnung meiner Eltern auf dem Klo sitze, dem einzigen Raum, in dem keine Bücher stehen, sondern nur drei Dutzend Putzmittelsorten. Zu jeder Verschmutzung gibt es ein passendes Putzmittel, man muß sie nur einander zuzuordnen wissen, sogar Kalbslederreinigungsmittel ist vorrätig (obwohl ich bei ihnen nie Kalbsleder gesehen habe). Nur auf dem Klo finde ich in der Wohnung meiner Eltern ein bißchen zu mir.
«Ist wer auf’m Klo?», fragt meine Mutter. Dabei sieht man das an der roten Farbe, die von außen anzeigt, daß jemand die Tür verriegelt hat. Sie rüttelt an der Tür. «Ist wer auf’m Klo?», fragt sie, obwohl die Tür zu ist.
«Ja!»
«Na, laß dich nicht stören.»