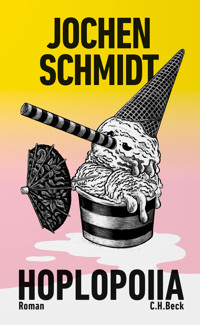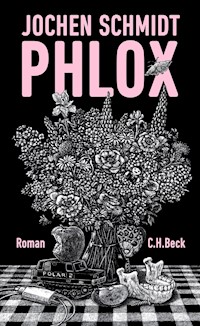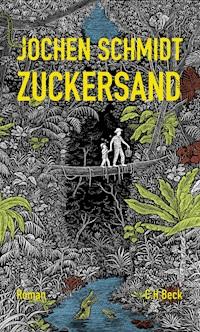14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Jochen Schmidts erstem Roman befindet sich der Ich-Erzähler in einer fatalen Situation: Er leidet an einer halbseitigen Gesichtslähmung, kann deshalb nur noch grinsen und muß ins Krankenhaus. Die Ursache für diese Erscheinung kann entweder Streß oder die Entspannung nach Streß sein, und ähnlich klar fällt auch die Selbstanalyse des Helden aus. Irgendetwas ist schief gelaufen, und weil sein Körper nicht mehr weiterzuwollen scheint, läßt er die Jahre nach der Wende noch einmal Revue passieren.
Er wollte so geheimnisvoll wirken wie Heiner Müller, oder wenigstens so traurig wie J.D. Salinger, aber gleichzeitig in einer Punk-Band Gitarre spielen. Dabei gerät er in einen Kreis von Künstlern und Pseudokünstlern um den Maler Anselm und lernt dort Judith kennen, was sein Leben vom ersten Tag an verkompliziert. Er geht mit ihr in die französische Provinz, trifft dort Lucía, sein spanisches Schlamassel, und verliebt sich in Deborah, weil sie wie Woody Allen und der Break-Dance aus New York kommt. Aber seine Suche nach der Liebe scheitert immer wieder an seiner Unfähigkeit, sich zu entscheiden, und die angehäuften Erinnerungen machen ihm zusehends zu schaffen.
Mit entwaffnender Selbstironie, einer bestechenden Beobachtungsgabe, mit Schwung und voller Komik erzählt Jochen Schmidt in diesem Roman, wie schwer und wie kurios es ist, in Zeiten universeller Ironie und gegen alle Widerstände sein Ziel zu verfolgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jochen Schmidt
Müller haut uns raus
Roman
Verlag C. H. Beck
Zum Buch
In Jochen Schmidts erstem Roman befindet sich der Ich-Erzähler in einer fatalen Situation: Er leidet an einer halbseitigen Gesichtslähmung, kann deshalb nur noch grinsen und muß ins Krankenhaus. Die Ursache für diese Erscheinung kann entweder Streß oder die Entspannung nach Streß sein, und ähnlich klar fällt auch die Selbstanalyse des Helden aus. Irgendetwas ist schief gelaufen, und weil sein Körper nicht mehr weiterzuwollen scheint, läßt er die Jahre nach der Wende noch einmal Revue passieren. Er wollte so geheimnisvoll wirken wie Heiner Müller, oder wenigstens so traurig wie J.D. Salinger, aber gleichzeitig in einer Punk-Band Gitarre spielen. Dabei gerät er in einen Kreis von Künstlern und Pseudokünstlern um den Maler Anselm und lernt dort Judith kennen, was sein Leben vom ersten Tag an verkompliziert. Er geht mit ihr in die französische Provinz, trifft dort Lucía, sein spanisches Schlamassel, und verliebt sich in Deborah, weil sie wie Woody Allen und der Break-Dance aus New York kommt. Aber seine Suche nach der Liebe scheitert immer wieder an seiner Unfähigkeit, sich zu entscheiden, und die angehäuften Erinnerungen machen ihm zusehends zu schaffen. Mit entwaffnender Selbstironie, einer bestechenden Beobachtungsgabe, mit Schwung und voller Komik erzählt Jochen Schmidt in diesem Roman, wie schwer und wie kurios es ist, in Zeiten universeller Ironie und gegen alle Widerstände sein Ziel zu verfolgen.
Über den Autor
Jochen Schmidt ist 1970 in Berlin geboren und lebt dort. Er liest jede Woche in der Chaussee der Enthusiasten, hat bei C.H.Beck die Erzählbände „Triumphgemüse“ (2000), „Meine wichtigsten Körperfunktionen“ (2007) und „Der Wächter von Pankow“ (2015) sowie die Romane „Müller haut uns raus“ (2002) und „Schneckenmühle“ (2013) und, gemeinsam mit Line Hoven, „Schmythologie“ (2013) veröffentlicht.
Inhalt
Prolog
Periphere Facialis Parese
I
II
III
Teil I
Eine halbe Träne
I
II
III
IV
Jetzt hilft nur noch Musik!
In der Strafkolonie
Himmel und Hölle
I
II
Die Immanenz der Transzendenz
I
II
Veni creator spiritus
I
II
III
IV
V
Doreen
I
II
III
C’est too much
I
II
In der Zeit des Verrats sind die Landschaften schön
Auf und davon
Teil II
Das Schaf und der Leuchtturm
Das sind ihre Zwiebeln
Paul Chacun
Paris, c’est la France!
Le Club Franco-Allemand
Telefon für dich
Carte de séjour
I
II
Unter Wasser hat man seine Ruhe
Dezember
Weihnachten im Irrenhaus
I
II
III
Donne-moi la paluche!
I
II
Tu l’aimes?
I
II
L’amour physique est sans issue
Deutscher Bunker
Erdmandelmilch
Teil III
Eine Kohlenzange für Deborah
I
II
Was mache ich hier?
I
II
III
New York is fun!
Gefielskribblig
Hundert Jahre Einsamkeit
Bei den Hamptons
I
II
III
Marias Fingernägel
Trixie Tiger
Meiner Familie
«Weil ich entschlossen bin, die künstliche Fiktion,ich sei ich selbst, aufzugeben, zugunsten der echten,befriedigenden Täuschung, ich sei jemand anderes.»
(Philip Roth, Gegenleben)
Prolog
Periphere Facialis Parese
I
Als ich dann eines Tages aufwachte und nur noch grinsen konnte, lag das nicht daran, daß ich irgend etwas komisch fand, sondern daran, daß sich meine linke Gesichtshälfte nicht mehr bewegen ließ. Es mangelte nicht an möglichen Ursachen für so einen Fall, denn eine Periphere facialis parese konnte durch Schwangerschaft, Röteln, Meningitis, Zugluft, Zeckenbiß, Aids, Gehirntumor, Tuberkulose, Tollwut, Herpes, Streß und Entspannung nach Streß ausgelöst werden. Es war schwer zu erahnen, was in meinem Fall die Ursache war, denn bis auf Schwangerschaft kam alles in Frage. Vor allem an Streß litt ich keinen Mangel, dafür sorgten schon meine Ex-Freundinnen. «Du bist ein kläglicher Mensch», hatte mir Peggy am Telefon gesagt. «Ich werfe dein Buch aus dem Fenster.»
«Das darfst du nicht. Du hast versprochen, mir alles zurückzugeben!»
«Aber ich tue keinen Schritt in deine Wohnung! Wie kommst du darauf, aus mir eine großbusige amerikanische Jüdin zu machen?»
«Das ist doch reine Phantasie!»
«Ach was! Du hast gar keine Phantasie! Und ich habe keinen großen Leberfleck, den hat mein Meerschweinchen!»
«Ich sage doch, daß das nicht du bist, hast du die Geschichte denn nicht bis zu Ende gelesen?»
«Du hast mir immer gesagt, du arbeitest an einem historischen Roman! Ich bereue jede Minute mit dir!»
Es stimmte, ich hatte ihr immer von meinem Projekt vorgeschwärmt, einen Roman über eine Mathematikerfamilie aus Ostpreußen zu schreiben, die es in alle Winde verschlug – der eine diente bei der preußischen Artillerie, der andere opferte sich für die Elektrifizierung Rußlands auf, der jüngste Sohn der Familie war Autist und hatte die Fermatsche Vermutung bewiesen, konnte es aber keinem mitteilen.
«Es ist doch alles aus der Perspektive einer ziemlich unsympathischen Figur erzählt. Wenn er sich von seiner Freundin wegen ihrer Unterwäsche trennt, hat das doch nichts mit mir zu tun.»
«Ich habe überhaupt keine Lust zu lesen, was du dir ausgedacht hast. Mir reichen die Stellen, wo ich vorkomme, und ich werfe das Buch jetzt aus dem Fenster! Du bist ein kläglicher Mensch!»
Es war sicher ein Fehler gewesen, ihr mein Manuskript zu geben, aber ihre Reaktion überraschte mich dennoch. Nach so langer Arbeit hätte ich es verstehen können, wenn man mich für meine Orthographie gesteinigt hätte, daß die Leser auch auf den Inhalt achten würden, hatte ich dabei wohl ein wenig aus den Augen verloren. Aber der Inhalt wurde doch bei Büchern völlig überschätzt.
Zu meinem Ärger mit Peggy kam, daß ich inzwischen so stark rauchte, daß mich manchmal morgens das Pfeifen meiner eigenen Lunge weckte. Von Tieren war ich oft gebissen worden, vor allem natürlich von den Meerschweinchen meiner Freundinnen, Herpes war mir ein treuer Begleiter, Aids bekam man angeblich schon beim Zahnarzt, und Zugluft blies mir in meiner Wohnung aus allen Richtungen entgegen. Das alles hatte ich ohne eine Gesichtslähmung überstanden, aber dann kam die gefürchtete Entspannung nach dem Streß dazu, denn Deutschland verlor gegen Kroatien im WM-Viertelfinale mit 3:0, die höchste Niederlage seit ’45.
Unsere Vorbereitungen auf dieses Turnier waren äußerst akribisch verlaufen. Wir hatten alle Sonderhefte zur Geschichte des Fußballs studiert und, um uns die Wartezeit zu verkürzen, so lange die WM-Edition von Trivial Pursuit gespielt, bis wir die Antworten singen konnten. Außenstehende faßten sich an den Kopf: «Warum verschwendet ihr euer bißchen Restintelligenz an so einen Schwachsinn?» «Psst! Wie heißt die älteste deutsche Fußballzeitschrift?» «Was weiß ich? ‹Der Stürmer›?»
Ich hatte sogar begonnen, ein WM-Tagebuch zu führen, um den Überblick über meine Gefühle nicht zu verlieren, und es war das erste Mal gewesen, daß ich beim Schreiben so etwas wie einen Rausch erlebte. Ich hatte mich in die Vorfreude auf diesen Monat, in dem ich gemeinsam mit einer Milliarde Menschen 64 Fußballspiele sehen wollte, so verbissen hineingesteigert, weil er eine Entschuldigung für mich war, alle Lebensentscheidungen auf die Zeit nach dem Finale zu vertagen. So ein Turnier fand nur alle vier Jahre statt, und ich hatte ein Recht darauf, für seinen Verlauf die Sorgen über meine Zukunft zu vergessen und mich dem dumpfen Genuß von drei Spielen am Tag hinzugeben.
Am Morgen nach der Niederlage war ich plötzlich wieder auf mich zurückgeworfen und gönnte mir zum Trost einen luxuriösen Einkauf im Bio-Markt, der vor kurzem in unserem Haus eröffnet hatte, dem 99-Pfennig-Shop war die Kundschaft abhanden gekommen. Aber irgend etwas stimmte nicht: Der Eiersalat schmeckte nach Niveacreme, die Tomaten waren fade, und mit dem Pfeffer hätte ich gurgeln können. Ich überlegte, ob ich irgend jemanden mit Mundfäule geküßt hatte, aber dann mußte ich lange nachdenken, um mich überhaupt an meinen letzten Kuß zu erinnern. Im Büro begann mein linker Mundwinkel zu zucken, ich ließ mir aber nichts anmerken, was mir nicht schwerfiel, weil ich dort sowieso immer guckte wie auf meiner eigenen Beerdigung.
Am nächsten Morgen konnte ich schon nicht mehr mit dem Löffel essen, mein linkes Auge starrte mich im Spiegel ausdruckslos an, während der Mund sich bei jeder Bewegung zu einem Grinsen verzog. Ich beschloß, zum Arzt zu gehen, heutzutage war doch sogar Lepra heilbar. Ich sah im Telefonbuch nach und staunte, wie viele Neurologen sich in meiner Gegend angesiedelt hatten. Ich entschied mich für die nächstgelegene Praxis, ich wollte in diesem Zustand nicht erst lange durch die Stadt irren. Im Wartezimmer war ich mit Abstand der Jüngste. Ich hatte fast das Gefühl, einen Blick in meine Zukunft zu werfen.
Die Neurologin sah mir tief in die Augen und ließ mich einen Kußmund machen. Danach sollte ich mich ausziehen. Sie prüfte mit einem Hammer meine Reflexe und empfahl mir eine Nervenwasseruntersuchung im Rückenmark. Das ginge natürlich nur stationär. Ich staunte, wie schnell ich mich mit dem erschreckenden Vorschlag einverstanden erklärte. Tatsächlich könnte ich so endlich meinen langjährigen Verdacht bestätigen, unter der heimtückischen Zeckenbißkrankheit zu leiden. Manche Zeckenbisse, hatte ich gelesen, führten noch nach 20 Jahren zu Lustlosigkeit und Müdigkeit. Man wurde vergeßlich und hatte Pech in der Liebe. Ich war seit langem überzeugt davon, daß sich mein Gehirn schneller als mein Körper auflöste, weil ich mir keine Namen merken konnte, wichtige Verabredungen vergaß und zunehmend jeder geistigen Anstrengung aus dem Weg ging. Der letzte Roman, den ich gelesen hatte, hatte ausschließlich von Fußball gehandelt, und ich hatte ihn nicht bis zu Ende geschafft.
Als die Neurologin mir drei Tage Kopfschmerzen ankündigte, glaubte ich ihr kein Wort und freute mich fast ein bißchen auf die Zeit im Krankenhaus. Dort würde es auf jeden Fall nicht so staubig sein wie bei mir. Erst kurz vor der Abfahrt überkam mich eine Art Testamentsstimmung. Was wäre, wenn ich nicht mehr zurückkehren würde? Dann wäre mein ganzes Leben nichts wert gewesen, im Grunde auch das meiner Vorfahren. Es war Juli, der Sommer begann gerade richtig. In einer Woche wollte ich nach Brest fahren, um dort das Endspiel zu sehen. Seit meinem Jahr dort hatte ich die Stadt nicht wiedergesehen. Ich rauchte eine Zigarette und notierte meine letzten Worte: «Schade, kurz vor dem Finale das Aus, das ist bitter. Aber man muß nach vorne sehen. Es wird neue Talente geben, daran besteht kein Zweifel. Die Literatur wird nie sterben, und wenn doch, dann gibt es ja noch die Bundesliga.»
Vor der Abfahrt rief ich meine Mutter an.
«Ich glaube, ich habe eine Art Gesichtslähmung.»
«Das kommt bestimmt von der Zugluft.»
«Es ist doch warm jetzt.»
«Na, trotzdem.»
«Vielleicht habe ich Borreliose.»
«Deine Urgroßmutter hat das auch bekommen, mitten auf der Flucht vor den Russen. Sie haben ihr alle Zähne ziehen und den Nerv durchschneiden müssen, weil sie solche Schmerzen hatte. Aber die Schmerzen sind nur noch schlimmer geworden. Ich hoffe, das ist nicht erblich.»
Unterwegs fing es an zu gewittern, und ich war völlig durchgeweicht, als ich mein Fahrrad neben der Notaufnahme anschloß und auf den grell beleuchteten Eingang zuschritt. Mir schien es ganz folgerichtig, wieder hier zu landen, in diesem Krankenhaus war ich schließlich geboren worden. Im dunklen Warteräumchen sackte ich auf einer Bank zusammen und beschloß, mich von nun an treiben zu lassen. Ich dachte an meine bisherigen Krankenhausaufenthalte. Mit vier Jahren die Stimmlippenknötchen, ich hatte nachts zu oft nach meiner Mutter geschrien. Dann mit 17 meine schreckliche Gürtelrose. Wir waren durch Rumänien gewandert und hatten auf der Rückfahrt in Budapest aus einer herumliegenden Bildzeitung erfahren, daß uns unsere Landsleute massenhaft entgegenkamen. Statt auch die Gelegenheit zur Flucht zu ergreifen, verbrachte ich eine Sommernacht mit einem Mädchen und einem Nebenbuhler in meinem winzigen Fichtelbergzelt, mit dem beißenden Geruch unserer Socken in der Nase. Während wir versuchten, meinen Nebenbuhler nicht zu wecken, dachte ich an meine Freundin, die zu Hause auf mich wartete, um mit mir zu einem katholischen Sommertreffen zu fahren. Meine Abenteuerlust, die mich in diese Situation gebracht hatte, gab vor unseren Ausdünstungen klein bei. Am Morgen schwollen die Lymphknoten an, und ich bekam Fieber. Um mich zu trösten, kaufte ich mir an jeder Ecke Fruchteiskugeln, ich kannte von zu Hause nur Softeis. Man entdeckte immer neue Sorten, die man aber nur noch aß, um den Geschmack der letzten loszuwerden. Vom Mohnaroma mußte ich mich fast übergeben.
Zu Hause war meine Zunge so entzündet, daß ich mir selbst weiches Brot in den Gaumen krümeln mußte. Und zwei Wochen später bekam ich diesen Ausschlag. Die Ärzte behielten mich im Krankenhaus und gaben mir Antibiotika, um zu sehen, ob das etwas nützte. Mitten in den Ferien war ich den Selbstgesprächen eines alten Genossen ausgesetzt, der dauernd über den Wirtschaftsminister Günter Mittag schimpfte. Beide Beine seien ihm schon amputiert worden, und er komme trotzdem nicht zur Vernunft. Ich hatte bis dahin nicht geahnt, wie schlecht es um unsere Wirtschaft stand. Im Bett zwischen uns lag ein schweigsamer junger Soldat, dem sie auf Ausgang wegen seiner Uniform die Nase zertrümmert hatten. Mein Wehrdienst würde in wenigen Wochen beginnen … Der dritte Zimmernachbar las in einem Reclam-Band mit mittelalterlichen Anekdoten, den ihm seine Frau geschenkt hatte, weil er «Zeitverkürzer» hieß. Aber was er dort fand, ließ ihm keine Ruhe, eine Geschichte über einen Vater, der seine Tochter nur einem Mann zur Frau geben wollte, der es schaffte, bis zum Abend weiterzumähen, als seine Tochter «brunzen» konnte, «denn sie hatte eine so enge, daß sie schier eine ganze Meile brunzte». «Ditt kann doch wohl nich Warzenschwein!» sagte mein Bettnachbar und las laut für uns alle: «Nun kam die Jungfrau um die Mittagszeit auf die Wiese spazieren, sah den Mäher nackend und seinen Zipfel an dem Bauch, der begann ihm zu wachsen, als die Jungfrau vor seinen Augen herumging. Er ließ ihn auf ihrem Bauch herumkrabbeln, dann kam er baß hinab und fand etwas, darein er kroch. Da sprach die Jungfrau: ‹Ei, was sucht er da drinnen?› Antwortete der Mäher: ‹Es ist ein Körnlein hineingefallen, dem sucht er nach.›» Am Abend «brunzte» sie sich dann auf die Schuhe, und er durfte sie heiraten.
Ich schlief zwei Nächte aus, dann lag ich nur noch wach, hörte die Männer schnarchen und litt unter dem Geruch der Matratze, den keiner sonst bemerken wollte. Sie schien von süßlichem Urin durchtränkt zu sein. Um einschlafen zu können, drehte ich mich ans Fußende, aber der Geruch verfolgte mich auch als Erinnerung.
Wenn der Chefarzt Visite machte, legte er den täglichen Tropf selbst. Er hatte keine Übung darin und mußte mehrmals einstechen. Danach beobachtete ich, wie es immer langsamer aus der Flasche tröpfelte, bis die Tropfen sich nur noch widerwillig lösten. Erst wenn die Flüssigkeit durchgelaufen wäre, sollte ich nach der Schwester klingeln. Mein Arm ließ sich nicht mehr bewegen, er brannte und wurde immer dicker. Der Chefarzt hatte wieder ins Gewebe gestochen, statt in eine Vene. Und während ich hier litt, fuhr meine Freundin ohne mich zu den Katholiken.
Was würden sie diesmal mit mir anstellen? War eine Nervenwasseruntersuchung nicht so etwas wie eine Punktion? Das Schreckgespenst meiner Jugend, eine Stopfnadel, die einem ins Rückgrat gerammt wurde, bis man schrie wie am Spieß? Würde ich mich davon bis zum Sonntag wieder erholt haben und das Finale genießen können?
Aus meinen trüben Gedanken schreckten mich zwei Pfleger auf, die ein Bett ins Warteräumchen schoben. Der Patient sah nicht sehr lebendig aus. War das hier wirklich das Warteräumchen? Nach einer bangen Ewigkeit, in der ich mich noch weniger bewegte als der Mann, rief mich die diensthabende Ärztin zu sich in ihr helles Behandlungszimmer. Als sie mich fragte, ob ich in den letzten drei Monaten Geschlechtsverkehr gehabt habe und wieviel ich rauche, war ich ein bißchen stolz, das Bild eines Mannes abzugeben, der hart im Nehmen war. «Nein. Eine Schachtel», war meine knappe Antwort.
Fast war ich enttäuscht, daß ich zu Fuß auf die Station gehen mußte. Ich hatte mir das spektakulärer vorgestellt. Das Gewitter war abgeklungen, die Vögel zwitscherten, und die Blätter der Bäume leuchteten saftig grün. Die Station befand sich in einem renovierten Klinkerbau direkt an der Mauer zum Volkspark Friedrichshain. Aus dem Fenster sah man die Köpfe der Spaziergänger. Mit einem Luftgewehr hätte man sie treffen können. Auf den Gängen war es so still, als würde überhaupt niemand hier liegen. Erst als wir in meinem Zimmer einen alten Mann aus dem Schlaf aufschreckten, wurde mir wirklich bewußt, daß ich in einem Krankenhaus war. Er richtete sich im Bett auf und sah mich verwundert an. Er hatte wirres Haar und nur noch ein Auge. «Herr Hennig, das ist Herr Schmitt», sagte die Schwester zu ihm «Wir werden uns doch vertragen?» «Mmh, ach, na prima», antwortete Herr Hennig und schlief wieder ein. Er hatte in einer Bahnhofskneipe einen epileptischen Anfall bekommen, weil er Alkohol getrunken hatte, obwohl er zuckerkrank war. Sie gaben ihm Faustan, weshalb er fast rund um die Uhr schlief. Immer wenn er aufwachte, wunderte er sich über die vielen Tabletten, die er schlucken sollte: «Schwester, äh, w-was sind denn das für Tabletten? W-wie lange wird das denn noch dauern?» Daraufhin bekam er eine höhere Dosis. Manchmal versuchte er aus Langeweile aufzustehen, setzte sich auf die Bettkante, überlegte, ob sich der Aufwand überhaupt lohnte, und fiel mangels Alternativen mit einem abschätzigen «na prima» wieder ins Bett.
Auf dem Nachttisch lag ein Stoß Formulare, die ich durchlesen und unterzeichnen mußte. Für den Fall, daß ich nach dem Eingriff querschnittsgelähmt oder tot sein sollte, nahm ich die Schuld auf mich. Ein Zivi brachte mir eine durchsichtige Plasteschale, die man sich aufs Auge klebte, um es vor dem Austrocknen zu schützen. «Hier, Ihre Rennbrille», meinte er und verschwand.
Dann war ich allein mit meinem neuen Freund, es war ganz still, nur der Wind rauschte in den Bäumen. Ich war seit Jahren nicht so früh schlafen gegangen. Es war absurd, hier zu liegen, aber ich hatte auch das Gefühl, daß es für mich angemessen war, in einem Krankenhaus zu übernachten, und daß ich mir den Status eines Leidenden verdient hatte.
II
Am nächsten Tag wurde ich in eine Eisenröhre geschoben, manche bekämen darin Platzangst und müßten sich übergeben, ich könne mich vorher spritzen lassen. Ich verzichtete mutig und mußte mich in der Röhre zusammenreißen, nicht nach der Schwester zu klingeln. Aggressives Knattern und chaotische Knackgeräusche stürzten auf mich ein. Es war zu eng, um notfalls allein wieder herauszurobben. Jeder hätte mir die Füße abschneiden können. Zur Beruhigung spielten sie ein Best-of von Andrew Lloyd Webber.
Wieder befreit, kaufte ich mir am Kiosk Zigaretten und suchte die oberen Stockwerke nach dem Raucherzimmer ab. Kaum hatte ich die Nase hineingesteckt, wurde ich schon freudig von ein paar Patienten in Bademänteln begrüßt, die hier Karten spielten. Einem hatte man eine runde Klappe auf den Kopf montiert, er war auffällig gut gelaunt und führte das Wort. Sie scherzten über die Schwestern, manche seien jung und nett, andere dick und streng, aber alle zogen die jungen und strengen den dicken und netten vor. Als ich ging, mußte ich ihnen versprechen, bald wiederzukommen.
Am Nachmittag wurden meinem Rückgrat drei Röhrchen wasserklarer Flüssigkeit entnommen. Es war mir fast unheimlich, wie wenig ich dabei spürte. Die Nadel drang widerstandslos durch eine Wirbelöffnung in mein Rückenmark.
Die Nacht über lag ich auf dem Bauch, langweilte mich und überlegte, ob ich Hennigs Tabletten durcheinanderbringen sollte. Am nächsten Morgen ging es mir so gut, daß ich aufstand, um über das Gelände zu schlendern und mir eine Chip-Karte für den Fernseher zu holen. Ich setzte mich in die Sonne auf eine Bank und wußte gar nicht, was ich als erstes mit der vielen Zeit anfangen sollte.
Auf dem Zimmer füllte ich die Essenbestellungen für die nächsten Tage aus und kreuzte überall volle Portionen an. Gegen Abend begann mein Kopf leise zu brummen. Ich schob es aber nicht auf die Punktion, sondern auf die Band City, die nebenan im Park ein dröhnendes Jubiläumskonzert gab.
Am Sonntag, dem Tag des Endspiels, wachte ich mit Kopfschmerzen auf. In der Nacht hatten etwas oberhalb des Einstichs Rückenschmerzen begonnen. Bis zum Mittag wurde es nicht besser. Ich setzte mich an den Tisch und schlang hastig meine Bohnen hinunter. Weil ich dabei Schweißausbrüche bekam, ließ ich den Rest stehen, um erschöpft aufs Bett zu fallen. Im selben Moment erschienen Judith und Lore in der Tür. Ich hatte nicht damit gerechnet, daß mich hier jemand besuchen würde, schon gar nicht Judith, die ich, seit sie mit Anselm zusammen war, nicht mehr gesehen hatte. Ich schickte die beiden nach draußen und zog mich an. Hennig fragte: «Sind das Ihre Verlobten? Sind ja schicke Dinger.» «Ja, ein paar davon», scherzte ich, aber da war er schon wieder eingeschlafen.
Wir setzten uns auf eine Bank, und Judith massierte mir den brennenden Nacken, während Lore immer wieder den Trick mit meinem Gesicht sehen wollte. Eigentlich hatte ich eine Zigarette rauchen wollen, aber ich mußte in den Büschen verschwinden, weil mir die Bohnen mit dem Joghurt vom Morgen hochkamen. Ich schaffte es kaum wieder die Treppen hoch und legte mich im Zimmer sofort auf den Bauch.
Abends versuchte ich, das Finale zu sehen. Aber ich mußte die Kopfhörer gleich wieder absetzen, ich ertrug die Geräusche nicht und konnte nach 20 Minuten nichts mehr erkennen, weil alle Farben verschwammen. Als der französische Torwart so rücksichtslos in einen der Brasilianer hineinrannte, daß der kopfüber auf dem Boden landete und leblos liegenblieb, kam mir das Spiel zum ersten Mal im Leben dumm vor. Mein Kopf platzte, und nach der ersten Halbzeit mußte ich abschalten. Ein Glück, daß ich nicht mitspielen durfte, dann hätte ich mich noch mehr geärgert.
Am nächsten Tag wurde Hennig in ein anderes Zimmer geschoben, und ich bekam einen neuen Nachbarn, der den weiten Weg aus Rußland gekommen war, um den ganzen Tag über begeistert RTL zu sehen. Ich konnte ihn aber nicht einmal begrüßen, weil ich jetzt einen völlig steifen Rücken hatte, mein Genick brannte und ich nur noch röchelte. Die Schwestern hielten es für eine komische Angewohnheit. Manche hielten mich auch für Herrn Hennig.
Ich mußte meine Geschichte immer wieder anderen Ärzten erzählen und verlor völlig den Überblick. Immer wenn ich einem mein Leid geklagt hatte, fragte er mich, ob ich Motorrad fahre, wegen der Zugluft. Am Montagnachmittag erschien dann Doktor Klose zur Chefvisite. Der kleine, kernige Mann erinnerte an einen General, schon von seinem festen Händedruck ging es einem besser. Er hielt mir für sein Gefolge einen Vortrag über Kortison. Sie lauschten gebannt, der Vortrag war so tiefsinnig, daß ich ihn auch hätte halten können: «Kortison kann helfen, muß aber nicht. Es kann zu Magengeschwüren führen, muß aber nicht. Die Lähmung kann alle möglichen Ursachen haben, sie kann aber auch gar keine Ursache haben.» Trotzdem beruhigte mich seine Unbekümmertheit, was hatte er nicht schon alles erlebt? Wenn Krieg wäre, hätte er mich natürlich sicher sofort an die Front zurückkommandiert. Kopfschmerzen? Firlefanz, seien Sie froh, daß die Rübe noch dran ist, solange Sie noch was fühlen, sehen wir uns nicht wieder, Abmarsch.
Die Schwestern fragten mich jeden Tag, ob ich Stuhl gehabt hätte. Es war mir genauso peinlich, das zu bejahen wie zu verneinen. Nach dem dritten Tag drohten sie mir Maßnahmen an, wenn ich nicht bald Stuhl bekäme, und ich begann, sie zu belügen. Aber was sollte ich denn verdauen? Ich aß ja nichts und leerte nur eine Seltersflasche nach der anderen.
Eine Schwester beschwerte sich beim Putzen über meinen Nachttisch: «Sieht ditt bei Ihnen zu Hause ooch so aus?» Als sie zufällig mein Gesicht zu sehen bekam, brachte sie mir ein Schmerzmittel. Warum war ich nicht selbst darauf gekommen? Paracetamol nahm dem Schmerz für eine Stunde die Spitze. Ich stellte ihn mir als Söldnerheer vor, das unzufrieden in der Etappe rumorte und auf Doktor Kloses Befehl wartete, um endlich wieder anzugreifen. Wenn die Wirkung nachließ, ging es anschließend noch heftiger wieder los. Ich lag die ganze Nacht wach und wartete auf den Morgen, als hätte der mir helfen können. Ich dachte an meine Mutter und ihre tagelangen Migräneanfälle. Damals hätte ich gern mit ihr getauscht, jetzt erfuhr ich, was das bedeutet hätte. Aus Verzweiflung versuchte ich, mit meinem Schmerz zu reden, ich stellte ihn mir nicht mehr als Söldnerheer, sondern als gewissenhaften Arbeiter vor, der auch nichts für seinen Scheißjob konnte. Das war allerdings ziemlich untertrieben, in Wirklichkeit handelte es sich um einen kleinen Adolf-Hennecke-Streber, der den Preßlufthammer sogar mit ins Bett nahm.
Obwohl ich nichts aß, freute ich mich auf jede Mahlzeit, weil mich dann jemand leiden sah. «Bricht’s von den Bratkartoffeln?» fragte die Schwester, wenn sie das Tablett, das ich nicht angerührt hatte, wieder mitnahm. Ich trank der Station ihren ganzen Selterswasservorrat weg. Mit dem Arm nach der Flasche zu tasten war die einzige Bewegung, die ich zustande brachte, und gleichzeitig meine einzige Unterhaltung. Ich wechselte laufend die Position, Rücken, Seite, Bauch, als würde das helfen. Der Rückenschmerz kroch Richtung Kopf, löste sich dort in Stirnschmerz und Hirnstammschmerz auf und kroch wieder zurück in den Rücken. Dazu kam der unerträgliche, wahrscheinlich für andere kaum wahrnehmbare Klogeruch, der mich zwang, nur durch den Mund zu atmen. Am Dienstag klingelte das Telefon an meinem Bett sechsmal, alle wollten wissen, ob es mir besser ging. Kaum hatte ich «Hallo» gesagt, meinten sie, sie würden wohl lieber später noch einmal anrufen.
Mittags bestellte mich eine Frau Dr. Wunsch in den Keller zur elektrophysiologischen Messung. Ich schluckte zwei Paracetamol und steckte zur Sicherheit noch eins in die Tasche. Dann balancierte ich meinen Kopf wie ein Ei beim Eierlauf zum Fahrstuhl. Im Keller bibberte ich, während sie mir ausführlich den Aufbau des befallenen Nervs erklärte, ohne einen Satz zu beenden. Sie beklebte mein Gesicht mit Elektroden und stellte fest, daß kein Strom floß. Dabei war das gar kein Wunder, schließlich war ich ein Mensch und kein Kabel. Nach einer Weile fragte sie mich, warum ich so blaß sei, ich versuchte, etwas zu antworten, und sie ließ mich murrend gehen.
Am Mittwoch gab es kein Selterswasser mehr, und ich bekam statt dessen kalten Tee. Mein russisch-deutscher Nachbar brachte mich zur Verzweiflung, er sah bis zehn Uhr abends fern und blätterte dabei in einer Zeitschrift. Ich litt unter dem Krach, die Geräusche aus seinen Kopfhörern, das knisternde Papier, die knirschenden Kekse. Jedesmal, wenn er sich am Hals kratzte, hätte ich ihn umbringen können. Viele solcher Nächte würde ich nicht mehr durchstehen. Ich betete sogar ein paarmal, ich hatte das seit dem Nato-Doppelbeschluß nicht mehr getan.
Am nächsten Tag wurde ich in ein anderes Zimmer geschoben. Ich zwang mich, an einem Zwieback zu lutschen, und beobachtete, wie der Schmerz etwas nachließ, wenn ich mich darauf konzentrierte, in Gedanken mit kühlenden Pinseln über mein Gehirn zu streichen. Das Wummern blieb zwar, und der Druck nahm nicht ab, aber ich konnte fast ohne Rückenschmerzen liegen.
III
«Lesen Sie das bitte und unterschreiben Sie», sagte die Schwester zu meinem neuen Zimmernachbarn. Jeder Satz von ihm begann stotternd und langsam, um laut und vorwurfsvoll zu enden.
«I-isch habe eine Lese-Rechtschreibschwäche.»
«Wie ist die Adresse von Ihren Eltern?»
«W-weeß ick nich.»
«Und von irgendwelchen Angehörigen?»
«I-ick habe den Kontakt abgebrochen.»
«Und jemanden, den wir benachrichtigen könnten?»
«A-also ick habe in Berlin niemanden.»
«Naja, das können wir ja später klären, jetzt nehmen wir erstmal Blut ab.»
«I-isch bin aber nicht mehr nüschtern.»
«Ich glaube, bei diesem Test ist das nicht so wichtig.»
«Also ich weiß nur, ditt man beim Blutabnehmen eigentlich nüschtern sein sollte.»
Da die Sätze so lange dauerten, übertönten ihre Enden mögliche Antworten in einem vorwurfsvollen Crescendo. Bei der Visite beschwerte er sich: «Also ick muß sagen, ditt ditt mir hier nich jefällt.»
«Warum denn das, Herr Lehmann?»
«Weil die Sch-schwestern unfreundlisch sind. Hier, die Ehne, also ick sage mal, hat sisch jleich uffjejeilt, weil ick die Tabletten nu nich jleich jenommen habe.»
«Was meinen Sie mit ‹aufgegeilt›?»
«Na also, wir ham uns jezofft.»
Er mußte die Tabletten unter Aufsicht nehmen, weil er suizidgefährdet war. Ein Onkologe sah nach ihm, sie hatten in den Akten etwas von einer früheren Hodentumoroperation gefunden. Lehmann aß auch fast nichts von seinem Diabetikeressen. Immerhin brauchte er keine Brille. Vielleicht hatte er sie aber auch verbummelt.
Am Nachmittag konnte ich mir vorsichtig eine Scheibe Schwarzbrot auf die Zunge bröseln. Was für ein Genuß! Die Welt sollte aus Schwarzbrot bestehen!
Eine Praktikantin stellte sich neben mein Bett, rollte mir einen stachligen Gummiball übers Gesicht und ließ ihre Fingerkuppen auf meine Haut regnen. Ich sollte mir Mühe geben, die gelähmte Seite zu bewegen, mir war das peinlich, weil sich dabei nur die andere Seite verzerrte. Einen Kußmund bekam ich auch nicht mehr hin. Nein, ich habe kein Motorrad. Sie malte mir ein Gesicht auf und erklärte mir damit, wie ich die einzelnen Muskeln zehnmal am Tag hochziehen und zurückschnipsen lassen sollte, um sie zu reaktivieren. Ich fand die Praktikantin ganz hübsch, aber das Gesicht, das sie gemalt hatte, sah so stümperhaft und häßlich aus, daß ich froh war, als sie wieder ging. Den Abend verbrachte ich allein mit Lehmann, der regelmäßig nach oben ins Raucherzimmer verschwand und die übrige Zeit mit bitter-ironischem Lächeln auf der Bettkante hockte, weil er noch keine Fernsehkarte besaß.
Am nächsten Tag tauchte Frau Dr. Wunsch wieder auf und bestellte mich in den Keller, um eine neue Diagnose auszuprobieren. Mit einem Magnetfeld induzierte sie über meiner Schädelplatte Ströme, die mit Elektroden an der Nasenspitze gemessen wurden. Sie hielt mir das Gerät an den Kopf, ihr Beeper ging, sie telefonierte, und ich lauschte frierend ihrem Gespräch: «Nein, ich übernehme keine Verantwortung, der Apparat war defekt. Vorsicht, nicht erschrecken.» Ich zuckte zusammen, ein Stromschlag direkt in die Schädeldecke, so stark, daß es mir die Knie hochriß. «Sehr gut, aber noch kein Signal, ich erhöhe die Stromstärke, Vorsicht, nicht erschrecken.» Wieder ein Einschlag in der Schädeldecke, die Zähne schlugen aufeinander, meine Arme flogen hoch wie bei einer Marionette. Ich kam mir vor wie auf dem elektrischen Stuhl und hatte Angst, daß es aus meinem Kopf dampfen würde, wenn sie sich mit den Knöpfen vertat. Ich bekam ein Dutzend solcher Stromschläge, während ihr Beeper immer wieder ging und sie versuchte, mit dem Diagnosegerät klarzukommen. Sie drückte nervös irgendwelche Tasten und schimpfte auf den Apparat. Das Diskettenlaufwerk rumpelte, und sie mußte die Messung wiederholen, weil sie nicht richtig abgespeichert hatte. «Dieser, ähem, Nerv, verläuft durch den, ähem Hirnstamm, so nennt man das, das sage ich Ihnen jetzt einfach mal so, auch wenn Ihnen das nichts sagt, und ähem, um die Schädigung nun zu lokalisieren, also, das heißt, die Stelle zu bestimmen, wo der Nerv geschädigt ist, muß ich diese Messungen vornehmen. Vorsicht, nicht erschrecken.»
Zurück auf dem Zimmer, sah ich mit Lehmann «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». «Ditt is m-meine Serie», sagte er und starrte glücklich auf den Bildschirm. Für einen Moment vergaß er seine Lese-Rechtschreibschwäche, seine Epilepsie, sein Stottern, seinen Hodentumor, seine Zuckerkrankheit, seine Einsamkeit, seine Schwindsucht, seine Arbeitslosigkeit und seine Suizidgefährdung. Eigentlich hätte seine Serie «Schlechte Zeiten» heißen müssen.
Am nächsten Tag durfte ich spazierengehen und sackte fast zusammen, meine Beine hatten schon gedacht, sie wären aus dem Schneider und müßten mich nicht mehr tragen. Ich ging einmal ums Haus, mehr schaffte ich nicht. Danach setzte ich mich aufs Bett und genoß die Aussicht auf den Park. Wirklich, ein Luftgewehr müßte man haben. Ich lauschte den Vögeln, schmunzelte über Lehmann und las die Zeitung. Das Frühstückstablett stand noch da, das Mittagstablett würde in zwei Stunden kommen, zwischendurch ein Plausch mit der Putzfrau oder ein Spaziergang über das Krankenhausgelände, um auf einer Bank in der Sonne zu sitzen, neben einer schwangeren Frau oder einem lungenkranken Raucher. Ein Farbfernseher über dem Bett, Telefon auf dem Nachttisch, eine eigene Putzfrau, Blick ins Grüne, hübsche, sauber gekleidete Mädchen, die einem das Essen und den Kamillentee brachten: «Na, reicht uns heute eine Tasse?» und die sich für meinen Stuhl interessierten. Zu Hause würde ich von all dem nur den Kamillentee haben. Ich überlegte schon, den Sommer über hierzubleiben, da erfuhr ich durch Zufall, daß das Krankenhaus für meinen Aufenthalt eine Kostenbeteiligung erhob. Ich hatte doch geahnt, daß die Sache einen Haken hatte! Ich fragte eine der Ärztinnen: «Wann kann ich denn wieder raus?»
«Ich glaube, wir entlassen Sie am Montag.»
«Warum nicht morgen?»
«Ach so, naja, wenn Sie meinen, dann sehen wir morgen früh noch mal nach Ihnen.»
Als ich mich am nächsten Tag anzog, fühlte ich mich mit jedem Kleidungsstück etwas würdiger. Ich mußte nur noch das Problem mit dem kleinen Trinkgeld für die Kaffeekasse lösen, das machte man sicher so. Die Schwestern frühstückten gerade und erkannten mich gar nicht wieder. Sie hatten mich bisher nur im Nachthemd und mit einem Arm vor dem Gesicht gesehen. Ich versprach ihnen, beim nächsten Mal wieder zu ihnen zu kommen, und legte einen Umschlag neben die Kaffeemaschine. Mein Fahrrad stand immer noch treu vor der Notaufnahme, als wäre ich nur kurz einkaufen gewesen. Die Sonne schien, die Luft war mild. Ich mußte ganz langsam fahren, weil zum Treten die Kraft noch nicht reichte. Aber es war ein friedliches Gefühl, schmerzfrei zu sein. Ich freute mich plötzlich wieder, in Berlin zu leben. Und es war mir recht, daß das Leben noch ein bißchen weitergehen würde.
Zu Hause las ich meine testamentarische Notiz. Es war zwar Galgenhumor gewesen, aber ich konnte nicht mehr lachen. Die nächsten Stationen hießen Herzinfarkt, Prostatakrebs und Schlaganfall. Daß es mit mir nicht so weiterging, war nichts Neues. Aber bisher hatte ich mir meine Krankheiten immer nur eingebildet. Und war Hypochondrie nicht nur ein anderes Wort für Phantasie und damit für einen Schriftsteller eine Pflichtübung? Wir hatten schon in der Schule begeistert Freud gelesen und bei uns nach Anzeichen von psychischen Defekten gesucht, die uns vor den anderen ausgezeichnet und ein Seelenleben bescheinigt hätten. Aber jetzt hatte mein Gesicht beschlossen, sich nicht mehr zu bewegen, und die Ärzte konnten keinen Grund dafür finden. Das nächste Mal würde vielleicht mein Herz stehenbleiben. Es mußte eine Erklärung für so eine Reaktion geben, ich hatte kein Motorrad.
Wenn einer meiner Nerven an einer Stelle anschwoll, an der er durch einen schmalen Knochengang führte, und sich damit selbst abklemmte, dann konnte ich das nicht auf sich beruhen lassen. Bei seinen Qualitäten belog man sich, oder man teilte sie mit vielen, aber die Defekte machten einen aus. Vielleicht hatte mein Körper etwas dagegen, daß ich wieder nach Brest fahren wollte? Das Jahr dort, das ich als das wichtigste Jahr in meinem Leben empfand, war immer tiefer in meinem Gedächtnis versunken. Ich vermied es fast, daran zu denken, um nicht wehmütig zu werden. Aber solange ich solche Angst vor meinen Erinnerungen hatte, würde ich mich auch nicht auf etwas Neues einlassen können. Vielleicht wollte mein Körper mir das damit sagen.
Ich öffnete das Fenster. Die Nachmittagssonne blendete, obwohl ich nur ihr Spiegelbild in der Scheibe gegenüber sah. Ich schloß die grünen Vorhänge und beobachtete, wie der Wind mit ihnen spielte. Im Grunde war ich mit allem einverstanden.
Teil I
«Sollen wir das Leben nur haben,um die Freunde zu begraben?»
(Inge Müller, Rendezvous 44)
«Herr, brich mir das Genick im Sturz von einer Bierbank.»
(Heiner Müller, Hamletmaschine)
Eine halbe Träne
I
Kurz nach der Wende, ich kam gerade in ein Alter, in dem es für mich an der Zeit gewesen wäre, erwachsen zu werden, lernte ich Anselm kennen. Er wohnte noch bei seiner Mutter und verbrachte die meiste Zeit in seinem Zimmer, das er als Atelier benutzte. Jedesmal, wenn ich ihn dort besuchte, hatte er neue irritierende Bilder gemalt, denen er so seltsame Namen wie «Sokrates II», «Wohltemperiertes Klavier» oder «Mondgeröll» gab. Mit Wasserbechern und zerknautschten Farbtuben eroberte er die ganze Wohnung, bis seine alleinstehende Mutter aufgab und in ihre Gartenlaube zog. Es war für mich immer etwas Besonderes, Anselm zu treffen, weil er so zielstrebig wirkte, wie ich es gern gewesen wäre. Er gab einem auch das Gefühl, daß diese Begegnungen nicht nur für uns bedeutungsvoll waren, sondern daß ihr genauer Verlauf später einmal von dazu ausgebildeten Spezialisten erforscht werden würde. Am meisten imponierten mir seine festen Ansichten zu allem. Weil er sich den Gesetzen des Markts entziehen wollte, war er entschlossen, nie ein Bild zu verkaufen, sondern sie alle zu verschenken. Es ging ihm vor allem darum, den richtigen Ort für die Bilder zu erobern. Oft standen diese Orte schon fest, lange bevor die Bilder fertig waren. Wenn er Zweifel hatte, ob der Beschenkte bis zur Fertigstellung noch leben würde – denn für ein Bild konnte er ein paar Jahre einplanen–, begann er mit ihm zu korrespondieren, um ihn davon zu überzeugen, daß dieses Che-Guevara- oder Klaus-Kinski-Porträt unbedingt in seine Bibliothek gehörte. Es konnte sich aber auch um den Panzersafe einer Bank, die Waffenkammer einer Kaserne, den Probenraum eines Orchesters oder ein spanisches Kloster handeln.
Um mich für ein Treffen mit Anselm zu qualifizieren, hatte ich behauptet zu schreiben. Ich war auch arrogant genug, es mir zuzutrauen, aber es waren bisher nur schwermütige Monologe herausgekommen, in denen ein Ich auf Sternen durchs Weltall ritt und nach einem anderen Ich suchte. Aber ich war jung und mußte nichts übers Knie brechen. Im Moment mochte ich es vor allem, an der alten Maschine meines Großvaters zu sitzen, sie machte so ein entschlossenes Geräusch, wenn man auf ihr seitenlang seinen Namen hämmerte.
Es war nicht das erste Mal, daß ich mich voreilig zum Schriftsteller erklärt hatte, schon in einer Schulpause, als Olaf zu mir sagte: «Dieser Typ, der aussieht wie Jesus, macht heute eine Party, er hat eine Druckerpresse organisiert und druckt sein Buch», hatte ich, ohne zu überlegen, geantwortet: «Ich schreibe auch ein Buch.» Vielleicht wollte ich das Gespräch nur in Gang halten, denn ich war jedesmal stolz, wenn Olaf etwas zu mir sagte, weil er bei uns zu den Prominenten gehörte. Sein Vater war ein erfolgreicher Kanute und hatte nach Olafs Geburt nichts mit der Mutter zu tun haben wollen. Aus Rache hatte sie ihren Sohn nach ihm benannt.
Mein erstes Buch wurde nicht lang. Ich setzte mich an den Schreibtisch meines Vaters und nahm mir vor, jeden Tag eine Seite hinzuzufügen. Aber schon als ich die Hauptfigur einführte, für die mir kein passender Name einfallen wollte, merkte ich, wie unsinnig es war zu schreiben: «Er hatte eine dicke Nase und schütteres Haar.» Ich hätte auch schreiben können: «Er hatte eine schüttere Nase und dickes Haar», es war mir völlig gleich, was er hatte, woher sollte ich das auch wissen? Ein paar Zeilen weiter ließ ich den Helden sagen: «Ich hasse Straßenbahnen. Sie sind so gelb.» Daß mein Held alles gut oder schlecht finden mußte, hatte ich mir von Salinger abgeguckt. Ich strich den Satz durch und schrieb: «Ich liebe Straßenbahnen. Sie sind so gelb.» Aber ich konnte auch dazu nicht wirklich stehen.
Später versuchte ich es mit écriture automatique, ich konzentrierte mich darauf, ohne nachzudenken, Blatt für Blatt zu füllen. Der Reiz dieser Methode hätte darin bestanden, sich das Geschriebene am nächsten Tag durchzulesen wie den Text eines nicht unbegabten Fremden. So hatten die Surrealisten gearbeitet, und die bewunderten wir, weil es in ihren Texten plötzlich Hühner regnete oder herumliegende Hände nach einem griffen. Das hatte damals eine ungeheure Sprengkraft: «Stell dir vor, du betrittst einen Saal, höher als breit, dein Blut spannt dich auf die Folter, Engel aus Schnee setzen dir zu, Rädelsführer ringen um die Zeit. Die Lage der Toten ist bedrohlich, man schüttet Sandhaufen auf und beginnt mit der Kultivierung von Ameisenkolonien. Jede Bewegung wird registriert, du bist verpflichtet, deine Spuren unter Verschluß zu halten. Dein Gesicht liegt an der Garderobe, es dauert seine Zeit, bis sich die Erkenntnis zum Gehirn durchfrißt. Wer bezahlt mich dafür, daß ich mich am Geruch eines angerissenen Streichholzes berausche?» Leider erwies es sich als kaum machbar, etwas wirklich Sinnloses zu schreiben, mir unterliefen immer wieder Sätze, die so aussahen, als seien sie so gemeint.
II
Als ich später von Lore, die ich an der Schule bei unseren Kulturfunktionärssitzungen kennengelernt hatte, erfuhr, daß ihr Freund mit Heiner Müller korrespondierte und ihn sogar porträtiert habe, stockte mir vor Neid der Atem. Diese Sagengestalt, deren beiläufige Bemerkungen man sich mühsam zusammensuchen mußte, weil er sie zu einem vergriffenen Fotoband oder einem Ausstellungskatalog beigesteuert hatte, und die so paradox und zutreffend waren, daß sie einem für eine Weile als Wegweiser dienen konnten. Was hatte er mit einem Vierzehnjährigen zu schaffen, der noch bei seiner Mutter lebte?
Lore erzählte mir, daß Anselm, der, weil man konsequent sein müsse, mit zwölf beschlossen habe, nur noch zu malen und nicht mehr zu schreiben, sogar die Proben zu Müllers Hamlet-Inszenierung besuchen dürfe. Das war zuviel, ich konnte nicht anders, als Anselm zu schreiben. Seine Antwort erhielt ich noch bei der Armee, sie war wie alle seine späteren Briefe kaum zu entziffern, dadurch hielt man sich lange mit ihnen auf. Sie waren mir so wichtig, daß ich sie durchnumerierte. Müller kaue viel Kaugummi, ernähre sich nur von Cola und Mars und habe ungeschickte Frauenhände. Ich lernte den ersten Brief fast auswendig, weil er so viel Neues enthielt. Und dabei war er in einem Ton verfaßt, als langweile den Schreiber dieses nebensächliche Zeug. Manche Sätze standen wie bei unserem Idol in großen Buchstaben, am Ende sogar etwas, das noch niemand zu mir gesagt hatte: «SCHREIB BITTE TEXTE!»
Noch bevor ich nach meiner Entlassung zum ersten Mal über den Ku’damm ging, besuchte ich Anselm. Die vielen bunten Suhrkamp-Bände in seinem Regal bildeten ein ausgewogenes Farbprisma. Daneben Klaus Kinski, Udo Lindenberg und Erich Honecker. Was hatten die drei gemeinsam? Ich betrachtete lange eine Radierung mit drei Steinen am Strand. Ich fragte ihn, wie er sicher sein könne, daß sie genau so gemalt werden müßten. Er antwortete: «Weil ich bei den 74 Versuchen davor nicht sicher war.» Er hatte immer genau die richtige Antwort parat, als hätte er sich die Frage längst selbst gestellt. Bevor ich ging, bat er mich wieder um Texte. Ich versprach sie ihm für das nächste Mal und tippte zu Hause noch am selben Abend ein paar Seiten mit meinem Namen voll.
Lore hatte mir erzählt, daß Anselm gerne Menschen zusammenbringe, um zu studieren, wie sie aufeinander reagierten. Er selbst setze sich dabei in eine dunkle Ecke, um alles durch eine Sonnenbrille zu beobachten. Deshalb war ich sehr stolz, als er mich im Sommer zu einem Wochenende nach Mecklenburg einlud. Er wollte diejenigen seiner Bekannten einander aussetzen, die am wenigsten zueinander paßten. Ein paar schwermütige Mädchen, ein junger bisexueller Philosoph, ein Betonfacharbeiter und ein Kampfsportler hätten sich schon angekündigt. Ich fragte mich ein bißchen, wer davon nicht zu mir passen sollte, fühlte mich aber geehrt von der Einladung und fuhr mit der Bahn nach Mecklenburg. Es war Hochsommer, die letzten Kilometer ging ich zu Fuß auf einer Chaussee, meine gesammelten Zettel schleppte ich im Rucksack mit. Ich bog in einen Hohlweg ab, der durch goldene Felder führte. Am Ende des Weges lagen ein paar Katen, die zu einem schloßartigen, halbverfallenen Gutshaus gehörten, dessen verwilderter Park unmerklich in den Wald überging. Da wohnt der Schriftsteller X und da die Schauspielerin Y, hieß es. Genauso hatte ich mir das immer vorgestellt in der DDR: In jedem gottverlassenen Winkel lebten der Schriftsteller X und die Schauspielerin Y. Und ich durfte endlich sagen, daß ich auch einmal ganz in ihrer Nähe übernachtet hatte.
Ich war glücklich, unter so vielen Gleichgesinnten zu sein. Tagsüber lief im Garten ein Rekorder mit den Goldbachvariationen, die für mein Ohr allerdings kaum variierten, und nachts saß man am Feuer und hatte Respekt voreinander. Erst als Anselm beim Baden im Faulsee zu mir sagte: «Du müßtest heute abend auch was lesen», wurde mir klar, worauf ich mich eingelassen hatte. Ich hatte zwar ein Heftchen begonnen, aber wenn ich mein Tempo hochrechnete, hätte ich es frühestens zur WM 2010 vollgehabt. Ich bekam es mit der Angst zu tun. «Evelin habe ich schon überredet. Ich will aber, daß sie aufhört zu schreiben.» «Wieso?» «Sie soll lieber ihre Buchhändlerlehre zu Ende machen. Sie ist nicht konsequent genug.»
Gegen Abend tauchte René auf, der bisexuelle Philosoph. Er war völlig erschöpft, weil er die richtige Station verpaßt und sich auf dem Weg über die Felder mit seinem Schrankkoffer auf der Schulter verirrt hatte. René malte auch manchmal, aber er kannte nur ein Motiv: seinen idealisierten Brustkorb. Die Bilder hießen «Anspruch und Wirklichkeit, offene Serie». Im Koffer schleppte er für das Wochenende eine Gesamtausgabe von C. G. Jung mit. Viele seiner philosophischen Kurzbetrachtungen drehten sich um das Thema Individuum. Was zum Beispiel ein Regentropfen empfand, wenn er an der Busscheibe herunterglitt und plötzlich mit einem anderen Regentropfen verschmolz. Das stellte er sich für den Regentropfen schrecklich vor. Außerdem fragte er sich, ob es von einem vollkommenen Individuum verlangt werden könne, ein Mädchen zu lieben, das Hemden trage, die nicht zu seinen Strümpfen paßten. Ich konnte ihm nicht weiterhelfen, ich hätte auch eine Freundin mit Tennissocken genommen. Und weil er die Gespräche mit einem teuren Walkman aufzeichnete, wagte ich sowieso kaum etwas zu sagen. Auf einer Wanderung durch die Felder fragte er Evelin, ob ihr für ihre Arbeit van Gogh immer noch nichts bedeute. Was für Sorgen! Wir verliefen uns und suchten zwischen verrotteten LPG-Ställen und verwunschenen Lichtungen nach dem Weg, Anselm ging uns dabei immer fünfzig Meter voraus. Damit machte er deutlich, daß er mehr als wir alle getrieben wurde von dunklen Mächten. Er trug bei der Hitze eine Strickjacke, die fast bis zum Boden reichte. Mit dieser Jacke könne er nur im Deutschen Theater zu Premierenfeiern auftauchen. Wo hatte ich eigentlich die ganze Zeit gelebt? Ich brannte ja immer noch darauf, mehr über meine Schauspieler zu erfahren, wer konnte wen nicht leiden, wer gehörte zu wessen Anhang, was für Stücke waren geplant, und vor allem: hatten sie mich je im Publikum bemerkt? Anselm wußte über alles Bescheid, aber es schien ihn zu langweilen, mir darüber Auskunft zu erteilen. Er nahm dieses Milieu anscheinend gar nicht richtig ernst. Der säuft nur noch, hieß es, und die steht seit Jahren mit einem Bein in der Klapsmühle. Der hat den damals wegen einer Frau vergrault, und eigentlich sollte die die Rolle gar nicht spielen, aber dann war die andere ausgefallen, weil sie sich den Text nie merken konnte.
Wir stapften über die Hügel, die Sonne brannte, es gab überhaupt nichts, was mehr zählen konnte als so ein Sommer, aber Anselm fragte René: «Was macht Experiment 4?» «Ich habe seinen Ablauf modifiziert», antwortete René, «es war nicht konsequent genug.» Niemand wußte, wovon sie sprachen, und niemand hätte sich zu fragen getraut. Als wir im Dunkeln wieder zur Kate zurückfanden, setzte sich Anselm mit Sonnenbrille in eine Kammer und hörte, so laut es ging, die Aufnahme einer Heiner-Müller-Lesung: «Immer noch rasiert Woyzeck seinen Hauptmann, ißt die verordneten Erbsen, quält mit der Dumpfheit seiner Liebe seine Marie, staatgeworden seine Bevölkerung, umstellt von Gespenstern…» Er trank eine Flasche Wodka aus und rannte durchs Dorf, bis er völlig beherrscht, aber mit rotem Kopf wieder die Kate betrat. Es ging wohl um Lore. Oder um die Kunst. Wer wußte das schon, vielleicht war es ja für ihn dasselbe.
Am Feuer brach René einen Streit von Zaun. Er hatte bei Freud eine Stelle entdeckt, in der Schwule als Invertierte bezeichnet wurden. Wie konnte Freud so etwas schreiben! Die meisten wußten zwar nicht, was «invertiert» hieß, aber niemand traute sich, das zuzugeben. René erklärte, daß er Freud wegen dieser Stelle im Ganzen ablehne. Anselm sprach ihm das Recht ab, Freud im Ganzen abzulehnen. Die anderen dachten nach, ob sie Freud im Ganzen ablehnen würden. Dabei hatte man das Gefühl, die beiden stritten sich eigentlich über etwas ganz anderes. Um die Situation zu entspannen, las ich einen meiner automatisch geschriebenen Texte vor: «Wenn über Nacht der Regen kommt und sich in deinem Haar verkriecht, versammeln sich die Nornen zu einer letzten Unglückssymphonie, sie speisen an lebenden Tischen und zücken ihre Unterweltsunterwäsche zur unbegrenzten Unterhaltsamkeit.» Anselm meinte, er wolle es sich als Maler nicht herausnehmen, sich dazu zu äußern, aber ich könne sicher noch konsequenter werden.
Als es abkühlte und wir uns in die Kate zurückzogen, die meisten waren schon schlafen gegangen, gab er mir die Gedichte einer Klassenkameradin zu lesen, die seine Einladung nicht angenommen habe, weil sie sehr scheu sei. Die Texte waren sorgfältig auf einer Schreibmaschine getippt, die Zeilen lagen dabei so versetzt, daß keine unter der vorigen anfing. Zwischen den Worten ließ sie immer verschieden viele Leerzeichen. Auf jede Seite paßten mehrere dieser kurzen Abschnitte. Aber auch unter denen, die nur zwei Zeilen lang waren, standen mit Bleistift ein Datum und ein Namenskürzel. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, weil Anselm mir beim Lesen zusah. Ich verstand kaum, worum es ging, aber es war klar, daß man Worte schon deshalb respektierte, weil jemand sie auf einer Schreibmaschine getippt hatte. Nur an einer Stelle, an der von einer halben Träne die Rede war, stutzte ich, was sollte das sein?
Am Morgen der Abfahrt standen wir vor der Kate und sahen uns den Graben an, den Lores Vater ausgehoben hatte, um das Haus an die Wasserleitung anzuschließen. Das gehörte eben auch dazu, wenn man auf dem Land leben wollte. Anselm nahm mich zur Seite: «Ich habe mit dir ja noch etwas vor, Meister.»
«Etwas vor?»
«Ich habe Müller einen Vorschlag für einen Text gemacht, den ich auch dir machen will. Um zu sehen, wie sich eure Texte aneinander reiben.»
Man kann sich kaum den wohligen Schauer ausmalen, den ich bei dieser Eröffnung empfand.
«Was für ein Text denn?»
«Der Monolog eines DDR-Beamten, dessen letzte Arbeit vor der Entlassung es ist, das Lenindenkmal zu verkaufen.»
«O Gott.»
«Du mußt dich nicht daran halten, aber ich bin sehr gespannt auf deinen Text. Ich glaube, du hast dazu einen ganz anderen Zugang.»
Ich hatte keine Ahnung von Lenin und keine Lust, welche zu haben. Aber wenn Heiner Müller mitmachte, konnte ich nicht nein sagen. Ich ließ meine automatischen Texte, die ich abends in der Küche bei Kerzenlicht und Wein schrieb, ein paar Wochen lang um Lenin kreisen. Dabei hörte ich immer wieder die gerade neu erschienene «Songs for Drella», die ich im Radio mitgeschnitten hatte. Lou Reeds Stimme hämmerte mir ein: «It’s work, the most important thing is work.»
Mein Anfang geriet sehr Heiner-Mülleresk: «Er stand versteinert der Klippe gleich, an der das eigne Wort zerschellt. Und ich verstreue ihn in alle Winde, Stein für Stein und dem zu eigen, der das Geld besitzt und die Moral.» Danach ging es wie gewohnt apokalyptisch weiter, tote Tauben fielen vom Himmel, die Zeit drehte sich im Kreis, Lenin irrte auf Händen durch die Stadt. Ich achtete vor allem auf den Rhythmus und suchte nach möglichst geheimnisvollen, undurchschaubaren Bildern, getreu dem Motto: «Der Text ist klüger als der Autor». Beim Titel schwankte ich noch zwischen «Lenins erster Tod» und «Lenins letzter Tod».
III
Unser Treffen in Mecklenburg hatte mir neue Bekannte gebracht, die ich abwechselnd besuchen konnte, um mir die Ergebnisse ihrer Arbeit anzusehen. Wie Anselm wohnte René noch bei seiner Mutter, in einer Wohnung, die genau so aussah, wie ich es mir im Prenzlauer Berg immer vorgestellt hatte: alte selbst restaurierte Möbel, schwere Grafikschränke, Radierungen mit Hinterhofansichten, umfassende Gewürzsammlungen in der Küche, handgedruckte Silvestergrußkarten befreundeter Künstler an der Tür, vorne der Blick vom Balkon auf eine alte Straße, hinten auf einen verwilderten Friedhof.
René führte mich in sein Zimmer und goß mir aus einer Kristallkaraffe Sherry ein. Er klagte über den schlechten Geschmack seiner Mutter, die es ihm nicht erlauben wolle, die Bilder im Flur gegen eine Fotoserie vom Schlachthof auszutauschen. Dann zeigte er mir eines seiner Werke. Ich sollte raten, was darauf zu sehen war. Es sah aus wie eine alte Mischpalette. In Wirklichkeit hieß es «Die Gegenwart im Würgegriff von Vergangenheit und Zukunft». Auf einem anderen Bild schwebte ein großes Ohr über dem Meer, es hieß: «Der Klang», das hätte ich mich nicht zu raten getraut. Dann gab es noch eine eher grau-weiße Mischpalette, «Das vollkommene Individuum», ich sah nur Farbschlieren. «Es liebt sich so sehr», führte René mit einem beleidigten Zug um die Lippen aus, «daß es seine eigenen Exkremente frißt.»
Ich erzählte ihm die Episode, wie Dalí als Kind zwei Melonen zertrümmerte, nachdem er durchs Fenster die Brüste des Dienstmädchens gesehen hatte. Wir waren ja beide große Dalí-Verehrer. Ich hatte zum ersten Mal bei einem Dia-Vortrag in der Jungen Gemeinde von ihm gehört. Am meisten gefiel mir damals «Der Schlaf», ich mußte nämlich selbst die ganze Zeit gegen meine Müdigkeit ankämpfen, weil ich von der Schule völlig überfordert war. Trotzdem hatte ich die Farben der Wüste nie wieder vergessen. Wenn Spanien so aussah, lohnte es sich, davon zu träumen. Und wer ein Bild von der überdimensionalen Gebärmutter seiner Mutter malte, die darauf aussah wie ein als Spielplatzattraktion vergrößerter Schweizer Käse, gehörte auch zum engeren Kreis. Man war etwas, wenn man seinen Namen kannte. Man war noch mehr, wenn man ihn falsch aussprach: «Dalí».
Aber Renés Verhältnis zu Dalí war seit neuestem getrübt. Er hielt mir mit gerümpfter Nase eine Ansichtskarte von Dalís Wohnzimmer hin und verlangte, daß ich ihm zustimme. «Siehst du das denn nicht?» «Was denn?» «Dalí ist für mich gestorben.» Ich suchte das Bild ab. Hatte er vielleicht irgendwo einen Invertierten beleidigt? Warum mußte René ihn plötzlich verachten? «Siehst du nicht diese Kommode neben diesem Sessel? Völlig geschmacklos. Dalí ist ein Scharlatan.»
Weil ich ihn so sehr darum bat, schenkte er mir zum Abschied ein Bild. Ich war mir nicht sicher, ob es in diesem Fall nicht wirklich eine Mischpalette war und er mich nur auf die Probe stellen wollte. Ich sagte aber nichts und schleppe das Bild seitdem durch mein Leben.
Wenig später kam René in psychiatrische Behandlung und dann an die Kunsthochschule. Noch während des Studiums begann er seine idealisierten Brustkörbe an die Deutsche Bank zu verkaufen. Als er mich einmal besuchte, war er ganz wild auf einen alten Spiegel, den meine Mutter mir überlassen hatte. Er hielt ihn für Jugendstil, ich mußte meine Mutter anrufen, weil er so verrückt danach war. Sie wollte ihn aber nicht hergeben, weil sie ihn als Kind von einem französischen Kriegsgefangenen geschenkt bekommen hatte, der sich die Zeit mit Holzarbeiten vertrieb. Mir war es peinlich, René darüber aufzuklären.
Wie es unter uns Sitte war, widmete ich ihm auch einen Text. Er endete mit dem Satz: «Das Gerippe karikiert den Mythos von der toten Magd.» Lange Zeit versuchte er, aus mir herauszubekommen, wen ich mit der toten Magd gemeint hätte. Ich verriet es nicht. Wenn ich es gewußt hätte, hätte der Satz mir ja nicht so gefallen.
IV
«Der Schluß läßt Dinge offen, die offen gelassen werden müssen», meinte Anselm, als ich ihm meinen Lenin-Monolog präsentierte, ich hatte ihn extra zweimal mit den beiden verschiedenen Titeln abgetippt. «Außerdem ist der Text erfreulich konsequent.»
Ich war natürlich vor allem gespannt, was Heiner Müller dazu sagen würde. Unvorstellbar, daß er wirklich ein Stück Papier berühren sollte, das ich in den Händen gehalten hatte. Ein paar Wochen später berichtete mir Anselm, Müller habe gesagt: «Wenn man einmal in New York auf dem Empire State Building gestanden hat, bekommt man einen anderen Blick auf die Welt.» Ich war etwas enttäuscht, weil ich gehofft hatte, er würde mich zu sich einladen. Ich hätte gern gesehen, warum er aus Pankow in eine Neubauwohnung gezogen war, wo ich doch froh war, es aus dem Neubaugebiet weggeschafft zu haben.
Bald darauf meinte Anselm, daß es für meine Entwicklung gut wäre, die Konfrontation mit anderen Autoren zu suchen, und schlug mir vor, mich mit einem Mädchen aus seiner Klasse zu treffen. Ich hätte ja in Mecklenburg schon ein paar ihrer Gedichte gelesen. Wir seien so verschieden, daß man unsere erste Begegnung eigentlich filmen müßte. Im übrigen habe sie ihre Texte bisher nur ihm zu lesen gegeben, und er habe sie lange drängen müssen, so einem Treffen zuzustimmen.
Er arrangierte eine Verabredung zwischen Judith und mir vor der Volksbühne, wo an diesem Nachmittag eine neue Theaterära begann. Als ich dort mit meinem grünen Rucksack ankam, in dem ich immer noch mein Gesamtwerk mit mir herumtrug, irrte ich mit gemischten Gefühlen zwischen den vielen Leute umher, die vor dem Theater warteten. Ich war gespannt, wer von ihnen sich als die geheimnisvolle Judith entpuppen würde, die in ihren Gedichten mit den einfachen Farben nicht mehr auskam, weswegen sie auf abenteuerliche Farbkombinationen auswich: «Meine silbergelben Träume liegen zwischen den blauen Blättern deiner Seele.» Ich genoß die Spannung und hatte es nicht eilig. Ich sah gerade einem kleinen Mann mit schwarzem Zopf zu, der, von einem Bein aufs andere tretend, zwischen den Stücken einer Blechbläsergruppe witzige Ansagen machte, ohne daß man hier draußen etwas davon verstehen konnte, da kam aus der Menge ein Mädchen auf mich zu. Anselm hatte Judith ein Foto von mir gezeigt, deshalb erkannte sie mich zuerst. Ich war vollkommen überrumpelt und sah nur, daß sie sehr lange Haare hatte und daß ihr ein Stück vom Schneidezahn fehlte.