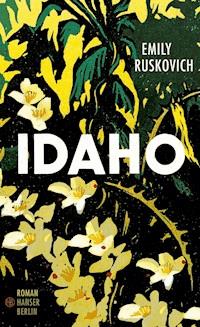
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein flirrender Sommertag in Idaho, USA: eine Familie im Wald, die beiden Mädchen spielen, die Eltern holen Brennholz für den Winter. Die Luft steht, die Mutter hat ein Beil in der Hand – und innerhalb eines Augenblicks ist die Idylle zerstört. Ist es Gnade, dass der Vater, Wade, langsam sein Gedächtnis verliert? Bald wird er nicht mehr wissen, welche Tragödie sich an jenem Tag abgespielt hat, wie seine Töchter hießen und seine Frau, Jenny, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Auch Ann, die Frau, deren Liebe groß genug ist, um zu Wade in das leere Haus zu ziehen, wird nie den Hergang der Tat erfahren. Aber mit jedem Tag an Wades Seite erkundet sie genauer, was damals geschehen ist, und nimmt schließlich Kontakt zu Jenny auf. Ein atemberaubender Roman über das Unbegreifliche in uns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
An einem einzigen Tag hat Wade alles verloren, was er liebte. May, die kleine Tochter ist tot, ihre ältere Schwester June verschollen, seine Frau Jenny zu lebenslanger Haft verurteilt im Gefängnis. Und nun raubt eine früh einsetzende Demenz ihm auch die Erinnerung. Bald wird er nicht mehr wissen, welche Tragödie sich an jenem Augusttag im Wald abgespielt hat, wie seine Töchter hießen und seine Frau. Auch Ann, deren Liebe groß und wahrhaftig genug ist, um zu Wade in das schrecklich leere Haus im Bergland von Idaho zu ziehen, wird nie den Hergang der Tat erfahren. Aber mit jedem Tag, den sie mit Wade teilt, begibt sie sich tiefer in die Erkundung dessen, was damals geschehen ist, fügt Bruchstücke und Splitter zusammen und nimmt schließlich Kontakt zu Jenny auf.
Hanser Berlin E-Book
Emily Ruskovich
IDAHO
Roman
Aus dem Englischen von Stefanie Jacobs
Hanser Berlin
Für den Liebsten und Fa
IDAHO
2004
Sie fuhren den Pick-up eigentlich nie, nur ein, zwei Mal im Jahr zum Holzholen. Er war oben am Hügel vor dem Schuppen geparkt, und in den Dellen auf der Motorhaube sammelte sich Regenwasser und im Regenwasser Mückenlarven. So war es, als Wade mit Jenny verheiratet war, und so ist es jetzt, wo er mit Ann verheiratet ist.
Ann geht manchmal hin und setzt sich hinein. Sie wartet, bis Wade beschäftigt ist und ihre Abwesenheit nicht bemerkt. Heute kommt sie unter dem Vorwand, Brennholz zu holen, und zieht einen blauen Schlitten über Schlamm, Gras und die tauenden Schneereste. Der Schuppen ist nicht weit vom Haus entfernt, aber hinter ein paar Gelbkiefern verborgen. Sie kommt sich vor wie ein Eindringling, als hätte sie hier eigentlich nichts zu suchen.
Der Pick-up ist auf einer der wenigen ebenen Flächen geparkt, ein unerwarteter Sockel, wie in den Berg gehauen. Um den Pick-up herum, im Gras und im Schnee vor dem Schuppen, liegen ein paar einzelne Ziegelsteine verstreut. An den Bäumen lehnen Spindeln mit verworrenem Draht. An einem langen Lärchenast hängen zwei dicke Seile, die jetzt nebeneinander pendeln, aber aussehen, als wären sie vielleicht einmal durch ein Brett verbunden gewesen – eine Schaukel.
Es ist März, sonnig und kühl. Ann setzt sich auf den Fahrersitz und zieht leise die Tür zu. Sie schnallt sich an, kurbelt das Fenster herunter, und ein paar Tröpfchen spritzen ihr in den Schoß. Mit der Fingerspitze berührt sie die nassen Flecken auf ihrem Schenkel, verbindet sie in Gedanken mit Linien zu einem Bild. Es erinnert sie an eine Maus, zumindest die Kinderzeichnung einer Maus, mit einem Dreieck als Gesicht und einem langen Schnörkel als Schwanz. Vor neun Jahren, als Wade mit Jenny verheiratet war und seine beiden Töchter noch lebten, war eine Maus durch den Auspuff in den Motorraum gekrochen und hatte auf dem Abgaskrümmer ein Nest gebaut. Wie seltsam es doch ist, denkt Ann, dass Wade sich an diese Maus und das Geräusch, mit dem sie unter der Motorhaube herumhuschte, wahrscheinlich noch erinnert, den Namen seiner ersten Frau aber vergessen hat. Die Maus dagegen – die ist in seiner Erinnerung noch sehr lebendig.
Ein paar Jahre nachdem Ann und Wade geheiratet hatten, fand Ann in einer Werkzeugkiste auf einem der oberen Wandschrankregale ein Paar Hirschlederhandschuhe. Sie waren viel schöner als die Arbeitshandschuhe, die Wade für gewöhnlich trug, und offenbar nagelneu, außer dass sie irgendwie verbrannt rochen. So erfuhr sie überhaupt erst von der Maus. Sie fragte ihn, warum er die Handschuhe im Schrank liegen ließ, anstatt sie zu tragen. Um den Geruch zu bewahren, sagte Wade.
Was ist das für ein Geruch?
Der eines brennenden Mäusenests.
Der letzte Geruch im Haar seiner Tochter.
Doch solche Dinge sagt er jetzt schon lange nicht mehr. Er erwähnte keinerlei Details mehr über den Tod seiner Tochter, als er merkte, wie sehr Ann sich an sie klammerte. Wahrscheinlich glaubt er, sie hätte die Handschuhe nach so vielen Jahren vergessen. Weit gefehlt. Sie liegen im Aktenschrank bei seinen Unterlagen, oben in seinem Arbeitszimmer, und sie hat die Schublade gerade so weit aufgezogen, dass sie sie sehen kann.
Die Maus hatte im letzten Jahr von Wades Ehe mit Jenny wahrscheinlich schon den ganzen Winter über im Motor gehaust, in jenem letzten Jahr, in dem May am Leben und June in Sicherheit war. Ann stellt sich vor, wie die Maus zwischen dem Pick-up und dem Schuppen durch den Schnee gelaufen war, hin und her, in ihrem Schnäuzchen Heu, Dämmstoff oder kleine Büschel der Füllung aus den Hundebetten herangeschleppt, ihr Nest damit ausgebaut und im Frühjahr schließlich Junge geworfen hatte. Einige starben sicher früh und wurden Teil des Nests, die winzigen, feinen Knochen wie Strohsplitter. Es kamen noch andere Mäuse; wenn man das Ohr auf die Motorhaube legte, hörte man sie darunter herumtrippeln. Das taten die Mädchen gern.
So stellt Ann es sich zumindest vor.
An einem Augusttag stieg die ganze Familie in den Pick-up. Wade am Steuer, wo Ann jetzt sitzt, Jenny neben ihm und ihre Töchter June und May, neun und sechs Jahre alt, dicht zusammengedrängt auf der Rückbank, mit einem Krug Limonade und Styroporbechern, in die sie mit den Fingernägeln Bilder ritzten. Die Mädchen wären wohl lieber auf der Ladefläche mitgefahren, aber ihre Mutter hatte sicher gesagt, das sei auf dem Highway zu gefährlich. Sie saßen also einander gegenüber im Fahrerhaus, den Rücken jeweils ans Fenster gelehnt, die Knie aneinander, und zankten sich wahrscheinlich.
An die Mäuse dachte keiner mehr. Zuerst merkten sie nichts, fuhren langsam über die Feldwege. Aber als sie in die Stadt, nach Ponderosa, kamen und auf den Highway auffuhren, drang durch die Lüftung ein Geruch von Fäulnis, versengten Haaren, von Haut und Samen, die zischend auf einem heißen Motor verbrannten, und verbreitete sich im ganzen Führerhaus, bis die Mädchen würgend und lachend die sommersprossigen Nasen zum Fenster hinaussteckten.
Sie mussten mit heruntergekurbelten Fenstern weiterfahren und den Gestank aushalten, die ganze einstündige Fahrt durch das Nez Valley, an Athol und Careywood vorbei und dann die lange Straße hinauf bis fast zum Gipfel von Mount Loeil, jenem Berg, auf dem das Birkenholz lag, zu Kloben gesägt und fix und fertig zum Aufladen. Der brandige Geruch setzte sich in ihrem Haar, in ihrer Kleidung und in Wades Handschuhen fest. Ann stellt sich June und May vor. Sie warten in der Sonne, während ihre Mutter die Birkenkloben auf die Ladefläche rollt, wo ihr Vater sie stapelt. An die Räder gelehnt, schlagen die Mädchen nach den Pferdebremsen auf ihren Beinen und verschütten Limonade in den Staub.
Der Geruch muss auch auf der Rückfahrt noch da gewesen sein. Er ist die Konstante. Er verbindet in Anns Vorstellung zwei Dinge, zwischen denen sie ansonsten keine Verbindung herstellen kann – die Fahrt den Berg hinauf und die Fahrt zurück ins Tal. Ann kommt hierher, um die Rückfahrt zu verstehen.
Wade hatte einiges zu beachten gehabt, bevor er losfahren und Hilfe holen konnte. Praktische Dinge. Die Ladeklappe schließen zum Beispiel, damit das Holz nicht hinunterrollte. Um sie zu verriegeln, musste er daran denken, den Schieber erst anzuheben und dann einzudrücken – es gab da einen Trick. Dass er sich so etwas merkt, dass ihm seine Finger selbst mitten in einem Alptraum gehorchen, ist einer der Gründe, warum Ann ihn liebt. Eines Tages wird er sich vielleicht an nichts mehr erinnern, außer an den Trick mit der Ladeklappe, und Ann wird ihn immer noch lieben.
Sie überlegt sich, wie leicht man sich auf dem Weg den Berg hinunter hätte verfahren können, zumal sie schon auf dem Weg nach oben so gründlich die Orientierung verloren hatten. Wie konnte ihnen irgendetwas bekannt vorkommen? Die schmalen, grasüberwachsenen Waldwege. Die grob gezimmerten, an die Bäume genagelten Schilder: dass er sie eine Stunde zuvor gelesen hatte, erschien ihr unmöglich. Das alles erschien ihr unmöglich. Der Sommerhimmel, die knackenden Zweige unter den Rädern des Pick-ups. Der Geruch von Schmieröl und Geißblatt. Jennys Atem, der die Scheibe beschlagen ließ.
Das meiste musste sich Ann zusammenreimen, alles was über die Fakten hinausging, die Wade ihr erzählt oder die sie im Fernsehen gehört hatte. Am Anfang war sie eisern gewesen, hatte weder Radio noch Fernsehen eingeschaltet, damit alles, was sie wusste, von Wade kam. Was Wade ihr erzählen wollte, würde sie behalten. Aber sie würde nicht zulassen, dass sie loszog und suchte; würde sich keine Frage gestatten.
Aber jetzt, wo Wade immer mehr vergisst, ist das anders. Bevor er sich an gar nichts mehr erinnert, würde sie ihn am liebsten fragen, ob Jenny und er irgendwelche Worte gewechselt haben. Hat Jenny zum Seitenfenster hinausgesehen oder geradeaus? Oder hat sie ihn angesehen?
Und wann genau hat er den Rückspiegel heruntergerissen?
Nein, denkt Ann, es ist gar nicht mal die Rückfahrt. Vielmehr die Tatsache, dass er überhaupt in den Pick-up gestiegen ist. Die Tür geöffnet und sich hineingesetzt hat. Jenny mit dem Becher Limonade in der zitternden Hand – oder vielleicht auch nicht zitternd, sondern ganz ruhig. Der Becher vielleicht leer. Vielleicht war ihr etwas von der Limonade in den Schoß getröpfelt wie das Wasser auf Anns Schenkel, ein Fleck mit dem Umriss von irgendetwas Harmlosem, das das Kind auf dem Rücksitz hätte gezeichnet haben können.
Ann streicht über das Armaturenbrett, und an ihrer Hand haftet der weiche, feuchte Pollen von vergangenem Sommer. Alles ist hier wieder wie für sie zusammengefügt. Der Rückspiegel wurde wieder angeklebt, und daran hängt ein Traumfänger mit zwei fluoreszierenden Federn. Die Bodenmatten wurden gewaschen und der rechte Rücksitz durch einen neuen ersetzt, blau wie der Originalsitz links, nur etwas heller und ohne die kleinen Löcher, aus denen der Schaumstoff herausquoll und in die die Mädchen früher vielleicht die Finger hineingebohrt haben.
Ann dreht den Zündschlüssel und lässt den Motor laufen. Sie atmet tief ein. Nach neun Jahren ist der Geruch des Mäusenests verflogen, aber ab und zu, wenn sie sich auf dem Fahrersitz bewegt und Staub aus dem Polster aufsteigt, erhascht sie eine Ahnung dieses alten Geruchs, fern und leicht süßlich, nach Leder und brennendem Gras. Obwohl es natürlich auch die kontrollierten Frühjahrsfeuer sein könnten, weit weg unten auf den Feldern im Dorf.
■
Ann und Wade sind seit acht Jahren verheiratet. Sie ist jetzt achtunddreißig und Wade fünfzig. Im vergangenen Jahr hatte Ann auf dem Dachboden eine Kiste mit alten Hemden von ihm gefunden. Sie hatte sie heruntergeholt und sich damit in ein warmes Trapez aus Sonnenlicht auf den Boden gekniet. Sie faltete ein Hemd nach dem anderen auseinander, hielt es hoch und legte es entweder auf den Stapel für die Heilsarmee oder auf den zum Behalten.
Wade kam ins Zimmer und sah, was sie tat.
»Passt das noch?«, fragte sie. Sie drehte sich nicht um, weil sie gerade einen Ölfleck begutachtete. Sie hielt das Hemd ins Licht.
Wade antwortete nicht. Sie glaubte, er hätte sie nicht gehört, legte das Hemd zusammen und nahm das nächste.
Aber ehe sie wusste, wie ihr geschah, drückte Wade ihren Kopf nach unten und stieß ihn energisch in den Karton mit den Hemden. Zuerst war sie so erschrocken, dass sie lachte. Aber er ließ nicht los. Der Kartonrand scheuerte an ihrem Hals, aus ihrem Lachen wurde ein Röcheln und schließlich ein Schrei. Sie griff nach seinen Beinen, schlug blind um sich. Sie hämmerte mit den Fäusten auf seine Schuhe, rammte ihm die Ellbogen gegen die Knie. Er sprach mit einer Stimme zu ihr, die ihr bekannt vorkam – sie wusste nur nicht, woher –, aber die er ihr gegenüber noch nie benutzt hatte. »Nein! Nein!« Er knurrte es fast.
Seine Hunde. So klang er, wenn er seine Hunde abrichtete.
Dann ließ er sie los. Er trat einen Schritt zurück. Langsam und vorsichtig hob sie den Kopf. Er seufzte tief, dann berührte er sie an der Schulter, als wollte er sie um Verzeihung bitten oder – das kam ihr selbst unter Schock in den Sinn – um ihr zu verzeihen. Kurz darauf fragte er sie, ob sie seine alten Arbeitsschuhe gesehen habe.
»Nein«, sagte sie und starrte in den Karton mit den Hemden. Zitternd kniete sie auf dem Boden und strich immer wieder ihr elektrisch aufgeladenes Haar glatt, als würde das irgendetwas ändern. Wade fand seine Schuhe, zog sie an und ging nach draußen. Ein paar Minuten darauf hörte sie den Traktor. Wade befreite die Weide von Flockenblumen.
In den zwölf Monaten vor der seltsamen Episode mit dem Hemdenkarton hatte er schon andere Dinge getan, die Ann alarmiert hatten. Er hatte Kunden angerufen und sie beschuldigt, ungedeckte Schecks geschickt zu haben, obwohl Ann ihm auf den Kontoauszügen die Gutschriften gezeigt hatte. Er hatte seine Schnürsenkel so eingefädelt, dass er sie unten zubinden musste statt oben. Er kaufte dreimal in einer Woche die gleiche Zange. Er warf Anns frisch gebackenes Brot noch ofenwarm in den Mulcheimer für die Hühner, als hätte sie es für die Tiere gebacken. Und einmal in der letzten Januarwoche fällte er eine wunderschöne Weymouth-Kiefer und zog sie eine ganze Meile durch den Schnee. Ann war gerade im Garten, als er damit ankam. Lächelnd deutete er darauf: »Was meinst du, ist die zu groß?«
Ein Weihnachtsbaum.
»Aber – Weihnachten war doch schon, vor einem Monat, Wade.«
»Was?«
»Weißt du das etwa nicht mehr?« Sie lachte, ein entsetztes Lachen. »Was meinst du, woher du den Mantel hast, den du gerade trägst?«
Aber als er sie an jenem Tag in den Karton stieß, war das etwas ganz anderes; es war das erste Mal, dass sich seine Krankheit in Form von Gewalttätigkeit offenbarte, die ihm normalerweise so fernlag, dass Ann einen solchen Vorfall selbst in den Sekunden unmittelbar danach für ausgeschlossen hielt.
Aber nachdem es einmal passiert war, passierte es wieder. Ein paar Monate später drückte er sie gegen den Kühlschrank, bis ihr ein Gutschein für ein Diner namens Panhandler Pies an der Wange klebte. Sie wehrte sich, aber genau wie beim ersten Mal verursachte ihr das Kämpfen nur noch mehr Schmerzen. Als er von ihr abließ, schob sie ihn von sich weg und schrie ihn an, aber er stand bloß da und sah sie traurig an, als hätte sie ihn enttäuscht. An einem anderen Tag, gar nicht lange nach diesem Vorfall, schüttete Ann einen Eimer Kiefernzapfen auf den Küchentisch. Sie wollte sie mit Erdnussbutter und Vogelfutter füllen und für die Finken in den Baum hängen. Aber kaum dass sie sich gesetzt hatte und an die Arbeit machen wollte, spürte sie seine Hand auf dem Kopf, die sie in die Kiefernzapfen drückte.
Sie hinterließen unzählige winzige Schnitte auf ihrer linken Wange, wie einen Ausschlag.
Und irgendwann danach stieß der Wind die Tür von einem der ehemaligen Kinderzimmer auf, die seinen beiden Töchtern gehört hatten. Wade glaubte, Ann hätte sie geöffnet. Als die Tür wieder geschlossen war, presste er Ann mit der Stirn dagegen und sagte: »Nein, nein, nein«, bis sie in ihrer Angst und ihrem Schrecken antwortete: »In Ordnung.«
Sie verstand all das nicht, aber weil sie wusste, dass Wade es auch nicht verstand, konnte sie ihre Wut nicht zum Ausdruck bringen. Konnte nichts dagegen tun, dass sich solche Episoden wiederholten. Mit der Zeit schockierten und verletzten sie sie immer weniger, und so nahm sie seine Angriffe schließlich einfach hin, weil sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte. Sie achtete darauf, wodurch genau sie ihn provoziert hatte, und tat es nie wieder. Keine Kiefernzapfen mehr, kein Panhandler Pies, keine Kartons mit alten Sachen und kein Schritt in die Zimmer seiner Töchter. Nicht so schwer. Diese Dinge wurden für sie zu einer Art Sammlung, einer Liste, die sie innerlich durchging, irgendwann nicht mehr aus Schmerz, sondern voller Staunen, als wartete in den Randbezirken ihres Lebens irgendetwas nur darauf, entdeckt zu werden. Nachts, wenn er schlief, dachte sie an diese Dinge und betrachtete sein geliebtes Gesicht. Die blassen Lider inmitten sonnengegerbter Haut. Die rissigen Lippen, seine unrasierten Wangen. Diesem Körper wohnte eine solche Sanftmut inne, dass sie sich unmöglich vorstellen konnte, wie dieser Mann getan haben sollte, woran es keinen Zweifel gab. Sie berührte sein dichtes Haar mit den Lippen und schloss ebenfalls die Augen.
Schon als Junge hatte Wade Hunde abgerichtet. Jagdhunde, Rettungshunde, Blindenhunde und Assistenzhunde für Kriegsveteranen. Jetzt zieht er Bluetick-Coonhound-Welpen auf, immer nur eine Handvoll, und konditioniert sie auf Waschbären und andere Tiere, die er aber nie schießt, denn die Jagd interessiert ihn nicht. Ihn interessiert nur das Abrichten. Und jetzt interessiert es auch Ann. Sie sieht ihm dabei zu, als könnte sie dabei etwas über ihre Ehe lernen. Wenn er einem Hund eine Lehre erteilt, ihn mit der Schnauze kräftig in die blutigen Federn eines Huhns drückt, das er gerade totgebissen hat, und dann in den frisch aufgewühlten Boden unter dem Hühnerzaun, sieht sie, dass er es mit Liebe tut. Liebe, Enttäuschung und aus der Verpflichtung heraus, ihm zu seinem eigenen Besten etwas beibringen zu müssen, so als könnte sich der Hund seine Fehler nur einprägen, wenn sie mit einem bestimmten Sinneseindruck verknüpft sind, einen Geruch und Geschmack haben. Eigentlich ist es keine Bestrafung; eher eine Gedächtnisstütze. Und vielleicht ist es ihr gegenüber dasselbe. Es scheint, als würde sein Handeln jetzt seinem Gefühl der letzten Jahre entsprechen, nämlich dass zwischen ihm und Ann eine Sprachbarriere besteht, die er nun nur durch Gewalt, rohe Liebe und ein paar harte, wiederholte Worte überwinden kann. Nein. Pfui. Aus. Immerhin möchte er zu ihr durchdringen.
Wobei es ihr manchmal natürlich das Herz bricht.
Einmal lief im Fernsehen eine Werbung für Weichspüler. Eine Mutter nimmt mit ihren beiden Töchtern nach einem Gewitterguss Wäsche von der Leine. Sie ziehen daran, Wäscheklammern schnappen, und die Leine springt hoch, lässt einen Tröpfchenregen auf die drei niedergehen. Die Szene wühlte ihn auf. Er erinnerte sich nicht, warum oder wem er die Schuld geben sollte, aber genau wie damals, als die Pinienzapfen auf dem Tisch gelegen hatten, trat dieser ganz bestimmte panische Ausdruck auf sein Gesicht. Ann berührte seine Hand, als wollte sie sagen: »Ich bin es, die dir das antut«, um es ihm leichter zu machen. Er sah sie an. Sie kniete sich vor den Fernseher. Er drückte sie mit einer Gesichtshälfte grob gegen den Bildschirm und sagte in seinem routinierten Ton: »Nein! Nein!«
Auf diese Art und Weise zeigte sie ihm jetzt ihre Liebe.
Sie spürte seine raue Hand auf dem Kopf, das statische Knistern im Haar und die kleinen Stromschläge des Monitors an der Schläfe. In solchen Momenten hatte sie endlich das Gefühl, etwas für ihn tun zu können, etwas, das ihm wirklich half, so als wäre es Teil des Eheversprechens, von dem sie erst jetzt erfahren hatte, wie sie es einlösen konnte. Den Kopf zwischen seiner Hand und dem Bildschirm, nickte sie – (»Tut mir leid, Wade, es tut mir so leid«) – und versprach ihm, es werde nie wieder vorkommen.
■
Von seiner jüngeren Tochter May hat Ann zwei Fotos gesehen. Das erste im Fernsehen. Das zweite, ein Polaroid, hatte sie vor fünf Jahren mit einem Besen unter dem Kühlschrank hervorgeholt. Sie hatte es von Staub und Haaren befreit und irgendetwas Klebriges von der Oberfläche gekratzt, kleine rote Späne wie getrocknete Marmelade.
Das Foto zeigte May mit einer Stoffpuppe, die ihr Ebenbild war: blonder Pagenschnitt mit schnurgeradem Pony, bonbonrote Lippen. Sie trug ein Bikinioberteil und einen kurzen Hosenrock, und ihr runder weißer Bauch war von Katzenkratzern übersät. Die stämmigen Beinchen übergeschlagen, saß sie in perfekter Mimikry von Erwachsenheit auf einem hohen Baumstumpf, um sie herum eine Lichtung, die rosa Sandalen vor sich im Staub.
May lächelte nicht, obwohl sie sehr wohl wusste, dass sie fotografiert wurde. Stattdessen sah sie mit halbgeschlossenen Augen beinahe theatralisch zu ihrer Puppe hinab und zog sie halb an sich, als wollte sie das schmuddelige Stoffgesicht gleich mit leidenschaftlichen Küssen bedecken. Sie hatte den Kopf schräg gelegt und die Lippen leicht geöffnet, der Pony fiel ein wenig über ihr eines Auge, und sie sah die Puppe an, nicht in die Kamera, legte behutsam wie eine Liebende den Finger auf den kleinen rosa Fadenmund. Sie war fünf oder sechs Jahre alt, fühlte sich hübsch und war voller Leidenschaft.
In ihrer Vorstellung ist es diese May, die an jenem Augusttag vor neun Jahren auf dem Rücksitz des Pick-ups saß, als das Mäusenest Feuer fing.
In der Szene vor Anns innerem Auge fühlt sich May von den Pferdebremsen, die sie in die Arme stechen, persönlich gekränkt. Sie ist auf den Rücksitz geklettert, aber die Bremsen sind ihr von draußen gefolgt. Ihre Mom und ihr Dad laden immer noch Holz auf. Ihre große Schwester stromert durch den Wald. May wirft die Lippen auf, küsst die kleinen Bisse auf ihrer bleichen Haut und murmelt dabei etwas, so als wären es die Lippen von jemand anders, die sie trösteten, berührten und den Bremsen sagten, sie sollen abhauen.
Sobald die Bremsen landen, schlägt sie nach ihnen. Ihre Handabdrücke leuchten auf der Haut. Zuerst versucht sie, die Plagegeister in ihrem Limobecher zu fangen, aber es sind zu viele. Sie gewöhnen sich an ihren Rhythmus und versuchen sie auszutricksen, landen an schwer erreichbaren Stellen wie in ihrem Nacken, wo sie sie auf dem flaumigen Haar kaum spürt. Das Gesurre um ihren Kopf herum reizt sie genauso sehr wie die Stiche selbst. Die Bremsen und sie sind gleichermaßen in Gefahr: die Tiere durch ihre tückischen kleinen Hände – sie durch ihre Attacken, jede einzelne ein unerwarteter Nadelstich, der sie förmlich erstarren lässt. Es ist ein aufreibendes Spiel, das sie da treiben, bestehend aus Dutzenden Mutproben, voller Anspannung und Vorahnungen.
Ann sieht May vor sich, wie sie statuenstill mit erhobener Hand dasitzt und darauf wartet, dass sich die Bremse in Sicherheit wiegt und sie sie totschlagen kann, und dann endet alles, wird schwarz. Als hätte sie direkt in die Sonne gesehen und unvermittelt die Augen geschlossen, so dass im Dunkel unter ihren Lidern nur noch die letzten bunten Silhouetten dahintreiben. Das Summen der Fliegen, das Rascheln schneller Schritte, das träge Glucksen gelangweilter Krähen im Bergwald: All das schmilzt zu einem knisternden Rauschen zusammen, und das Bild ist schwarz.
Als Ann wieder ein Bild vor Augen hat, als hätte sie sie wieder geöffnet, fällt vor allem auf, wie friedlich die Szene jetzt wirkt. May sitzt vollkommen reglos auf der Rückbank, den Kopf auf den Knien. Die Bremsen landen auf ihren Armen, jetzt, wo ihre Hände nicht mehr nach ihnen schlagen. Ihr Haar ist voller Blut, warm und klebrig. Das Surren verstummt, und die Bremsen lassen sich auf ihren Armen nieder, fast schon friedfertig wie müde Kinder, die das Streiten satthaben und nur noch ins Bett wollen. Einige wissen nicht, ob sie dem Frieden trauen sollen oder ob das nicht vielleicht nur ein kindischer Trick ist und ihre Hände, im Moment so still, nicht plötzlich doch wieder zum Leben erwachen. Diese Bremsen fliegen noch einmal auf, prallen surrend gegen die Fensterscheibe und landen woanders. Doch schließlich kommen auch sie zur Ruhe, hören auf zu stechen und sitzen auf Mays reglosen Armen, als wären sie dort zu Hause, putzen die Fühler und lassen die Welt für eine Weile vor den Hunderten Facetten ihrer Augen verschwimmen, während das dicke gelbe Licht vom Fenster durch ihre netzartigen Flügel sickert und sie wärmt, jetzt, wo ihnen keine Gefahr mehr droht.
■
Vor ein paar Jahren war Ann einmal erst spät nach Ponderosa zurückgekommen. Sie war unterwegs gewesen und hatte Besorgungen gemacht, als der Wagen liegenblieb. Sie rief Wade an und sagte ihm Bescheid, dann wartete sie in der Stadt, bis der Wagen repariert war.
Als sie an jenem Abend den steilen Waldweg hinauffuhr, sah sie aus der Ferne das Haus. Es war dunkel bis auf das Fenster von Wades Arbeitszimmer oben links und, was seltsam war, zwei leuchtende Rechtecke unten neben der Eingangstür. Auch links und rechts der Tür zu seiner Werkstatt, in einem separaten Gebäude am Ende des Gartens, leuchtete es hell. Die Lichter verwirrten sie. Sie hatte nicht die leiseste Ahnung, was das sein konnte. Laternen? Aber wozu? Erst als sie direkt vor der Haustür stand, begriff sie, dass die Rechtecke Löcher waren, die er in das Holz gesägt hatte und durch die das Licht von drinnen fiel.
Was hatte das zu bedeuten? Ann bekam Angst. Beladen mit den Einkaufstüten, ging sie ins Haus, und im trüben Licht der Stehlampe offenbarten sich noch eine ganze Menge weiterer Löcher, die in die Astkieferwände gesägt worden waren und ins Freie führten. Die Löcher waren allesamt rechteckig, jeweils einen Fuß hoch und einen halben Fuß breit. Eins der Bücherregale war leer geräumt worden; in der Wand dahinter befanden sich ebenfalls Löcher. Ein Loch klaffte direkt über dem Küchentresen, so dass sich das Mondlicht auf die Arbeitsplatte ergoss.
Ihr Herz raste. »Wade?«
Der Wind pfiff durch die Löcher. Über der Lampe an der Wand saßen fünf oder sechs Pfauenspinner, einige davon handtellergroß, und öffneten und schlossen ihre Flügel mit den großen Augen. Über die Bodendielen schleppte sich ein großer Käfer, glänzend wie ein Messer. Überall lag Sägemehl, und darin sah man Spuren von Katzenpfoten.
Sie schaltete das Deckenlicht ein. Die Isolierung war aus den Wänden gezogen und in akkurat ausgesägten Quadern fein säuberlich neben den gläsernen Schiebetüren aufgestapelt worden. Auch die Innenwände zwischen den Zimmern hatten Löcher. Einige davon führten nirgendwohin, nur noch tiefer in die Wände hinein. Ein Loch in der Badezimmertür.
»Wade –« Mehr brachte sie nicht heraus. Hinter ihr miaute es.
Sie drehte sich um. Ein Kater rieb sich an einem Stuhl genüsslich die Flanke, sah sie aus seinen grünen Augen schnurrend von unten an und blinzelte langsam. Sie kannte ihn nicht, aber sie hob ihn hoch und nahm ihn auf den Arm. Sein schwerer, warmer Körper beruhigte sie. Energisch rieb er das Köpfchen an ihrem Kiefer.
Sie nahm den schnurrenden Kater mit nach oben, ging schnell an den beiden leeren, verschlossenen Zimmern vorbei – in beide Türen war unten säuberlich eine rechteckige Öffnung gesägt worden –, öffnete die dritte Tür und sah Wade an.
Er saß in seinem Arbeitszimmer auf einem Hocker und beugte sich über seinen Schreibtisch, auf dem blaue und gelbe Quittungen lagen. Er trug einen Mantel. Der Holzofen stand ebenfalls auf dem Schreibtisch, und es roch nach Kiefernrauch.
»Da bist du ja«, sagte er, drehte sich auf seinem Hocker um und nahm ihre Hand. Zwischen Daumen und Zeigefinger hatte er Blasen, vom Sägen. »Tut mir leid, dass du so lange in der Stadt warten musstest.« Er zog sie sanft auf seinen Schoß; sie hielt immer noch den Kater auf dem Arm. Als sie in sein Gesicht sah, kamen ihr die Tränen. Die übliche Erschöpfung war aus seinem Blick gewichen. Er wirkte jünger, auch wenn es seltsam und nicht logisch zu erklären war. Er sah aus wie der Mann, den sie damals vor Jahren kennengelernt hatte – wie Jennys Mann.
Er lächelte und sah hinunter zu dem Kater. »Ein Streuner«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Aber er ist Menschen gewohnt. Ich war draußen in der Werkstatt, und auf einmal saß er vor der Tür und miaute, also hab ich ihn reingelassen. Und dann dachte ich, warum soll er nicht auch ins Haus?« Er lachte.
Mit dem Daumen wischte sie etwas Sägemehl von seinem Ärmel, eine Geste, für die sie die Konzentration ihres ganzen Körpers brauchte. Auch im Haar hatte er Sägemehl. »Was ist mit dem Haus passiert?«, fragte sie, leise und vorsichtig. Verwirrt sah er sie an. »Die Löcher«, sagte sie.
»Na, das sind Katzentüren«, erwiderte er, als erstaunte es ihn, dass sie das nicht erkannte. »Jetzt kann er kommen und gehen, wann er will.«
»Oh«, sagte sie nur. Der Kater sprang von ihrem Schoß. Sie stand auf. »Katzentüren.« Sie hörte die Aggression in ihrer Stimme, und erst in diesem Moment wurde ihr klar, dass sie wütend war. »Du hast also Türen ausgesägt, Dutzende von Katzentüren.« Sie empfand, was er empfunden haben musste, als er ihr Gesicht gegen den Fernseher gedrückt hatte: Enttäuschung und einen tiefen, hoffnungslosen und seit langer Zeit nagenden Schmerz, der nichts mit ihm zu tun hatte, für den sie ihn jedoch voll und ganz verantwortlich machte.
Sie war kurz davor, noch etwas zu sagen, tat es dann aber doch nicht. Stattdessen drehte sie sich um und ging an den beiden leeren Zimmern vorbei nach unten. Er bemerkte ihren Ärger offenbar gar nicht und ließ sie gehen. Gut. Sie suchte eine Taschenlampe. Draußen funkelten die Sterne, und der Wind war eigenartig warm und zerwühlte ihr das Haar. Die Hunde schnüffelten an ihren Taschen, aufgeregt, weil nachts jemand draußen war, und liefen ihr den Hügel hinunter bis zum größeren der beiden Schuppen nach, der bis auf etwas Bauholz und ein paar Werkzeuge leer war. Sie dachte einzig und allein an das, was sie jetzt zu tun hatte. Sie kletterte über die Leiter auf den Dachboden, wo noch etwas Sperrholz und einige Fassadenverkleidungsplatten lagen, beides noch übrig von damals, als Wade und Jenny das Haus gebaut hatten. Sie warf das Material hinunter in den Schuppen. Der Dachboden war von Mäuse- und Taubendreck übersät, Pollen und Staub klebten ihr im Gesicht. Bald liefen ihr Tränen über die Wangen. Noch immer weinend, stieg sie schließlich die Leiter hinunter, steckte den Stecker der Kappsäge ein, zersägte die Verkleidung in kleine Rechtecke und lud sie in eine Schubkarre, die sie durch die Dunkelheit den steilen Weg hinaufschob.
Vor ihr auf der Lichtung leuchtete das Haus durch sämtliche Fenster und Löcher. Es war ein Haus, wie es ein Kind zeichnen würde, mit Dutzenden windschiefer und zu klein geratener Fenster. Schon völlig außer Atem, kämpfte sie sich mit der Schubkarre weiter den Hügel hoch. Die Taschenlampe, immer noch eingeschaltet in ihrer Manteltasche, leuchtete senkrecht in den Nachthimmel, und dort verlor sich ihr Licht.
Über eine Stunde lang arbeitete sie, nagelte die Löcher mit der Fassadenverkleidung zu und schob die Isolierung wieder hinein, so dass nur noch die Papprückseiten zu sehen waren. Die Löcher in den Innenwänden schloss sie nicht, nur die, die ins Freie führten. Der Kater kam durch eins davon herein und schlüpfte durch ein anderes wieder hinaus, als wollte er zeigen, wie gut die Katzentüren funktionierten.
Als sie fertig war mit der Arbeit, räumte sie das Werkzeug weg, kehrte das Sägemehl zusammen, duschte und legte sich ins Bett.
Schließlich hörte sie Wade herunterkommen. Er ging langsam, als dämmerte ihm allmählich etwas. Er hielt inne und blieb lange auf der Treppe stehen. Sie konnte beinahe hören, wie er mit dem Finger eine der Katzentüren entlangfuhr, als könnte er kaum glauben, dass sie wirklich da waren.
Sie lag im Bett und starrte an die Wand. Als er zu ihr kam, spürte sie schon bei seiner ersten Berührung die Veränderung in seinem Körper. Er war wieder er selbst.
»Ich wusste nicht, was ich tue«, sagte er. Sie drehte sich nicht zu ihm um. Die Erleichterung, die sie jetzt durchströmte, ließ sich kaum zügeln, und Ann schloss die Augen, um sie in sich einzusperren. Sie zitterte am ganzen Körper. Wieder kamen ihr die Tränen. Er schlang die Arme um sie.
»Es tut mir so leid.«
Als sie hörte, dass auch er weinte, drehte sie sich zu ihm um. Immer wieder berührte sie sanft sein Gesicht, strich ihm mit dem Finger über Wangen und Stirn, als wäre er ein Kind. »Ist schon in Ordnung«, sagte sie und lächelte unter Tränen. Nach einer Weile schlossen sie die Augen und hielten einander lange in den Armen.
Als er eingeschlafen zu sein schien, drehte sie sich in seinen Armen um, nahm seine Hand und drückte sie auf ihre Brust. Von der Bewegung wachte er auf. »Darf ich dich etwas fragen?«, sagte er nach einer Weile. Am unschuldigen Ton seiner Stimme und an der Zuversicht, dass es Dinge gab, die er sie noch nie gefragt hatte, erkannte sie schon, dass ein Teil von ihm wieder abwesend war.
»Ja«, sagte sie.
»Hast du jemals einen anderen Mann geliebt?«
»Nein«, antwortete sie. »Natürlich nicht.«
»Hast du mit anderen geschlafen, bevor wir uns kannten?«
Sie schloss die Augen und schluckte. Früher hatte er natürlich gewusst, dass sie mit anderen zusammen gewesen war, aber jetzt sagte sie: »Nein.« Sie sagte: »Nur mit dir.«
Er seufzte, als wäre er erleichtert.
Sie lag im Dunkeln und dachte darüber nach, wie seltsam es war, dass es auch ihre eigene Geschichte plötzlich nicht mehr gab. Alles, was in ihrem Leben vor ihm passiert war und was sie zusammengebracht hatte, war verschwunden. Die Schule. Ihre Kindheit. England, alles dort.
Für einen Moment war die Schwerelosigkeit dieser Abwesenheit beinahe erleichternd, und seine Hand auf ihrem Herzen war Anfang und Ende zugleich, eine Geschichte, in der nur sie beide vorkamen, die mit der Berührung ihrer Hände begann und mit ebendieser endete. Wenn nötig, konnte sie eine Weile in diesem Augenblick leben.
Soweit sie wusste, war auch Jenny aus seiner Erinnerung verschwunden. Sein Leben mit ihr, mit May und June, die Stimmen seiner Töchter und der letzte Geruch ihrer Kleider, der durch die vielen Wunden des Hauses in die Nacht geblutet war und jetzt, in dieser Geschichte von ihm und ihr, nicht mehr vorkam.
Der Augenblick war verstrichen, aber sie beschloss, ihn trotzdem zu fragen. »Und du?« Sie flüsterte es nur.
»Nein«, sagte er sanft. »Nur mit dir.«
Sie drehte sich um und küsste ihn. Sie waren ihre jeweils erste Liebe geworden, einfach so.
Als Wade am nächsten Morgen klar wurde, wie schwer er das Haus und die Werkstatt beschädigt hatte, schämte er sich. Aber Ann ließ sich nicht anmerken, wie sehr die Sache sie mitgenommen hatte. Fröhlich kehrte sie Laub und Käfer aus dem Haus und hängte Fliegenfänger in die Küche. Die großen Falter fingen sie in Konservengläsern und ließen sie draußen frei. Für Spinnen und Mäuse stellte er Fallen auf. Der Kater ging wieder, als wäre er nur wegen der Aussicht auf hundert Katzentüren gekommen.
Ann und Wade hatten in diesem Jahr eigentlich ihren Vater in Schottland besuchen wollen, aber nach diesem Vorfall sagte sie ihm ab. Sie war traurig darüber, zumal sie den Eindruck hatte, dass er sich von ihr entfernte. Auf Briefe antwortete er nur mit mehr oder weniger witzigen Grußkarten, deren knappe Zeilen kaum etwas über sein Leben verrieten. Er telefonierte nicht gern, wollte immer nur Witze reißen und gab den Hörer manchmal auch an seinen Bruder weiter, ihren Onkel. Es schmerzte sie, dass er nicht ein einziges Mal etwas zu ihren Briefen sagte, aber ihr Vater war noch nie der Typ gewesen, der über Persönliches sprach, und sie schwor sich, in Zukunft einen leichteren Ton anzuschlagen, damit sie einander wieder näherkämen.
Es wurde ein wunderschöner Herbst auf Mount Iris, vielleicht der schönste ihres Lebens. Wade und Ann unternahmen lange Spaziergänge durch die bunten Wälder, fröstelnd in dicken Pullovern, und kickten Laub vor sich her. Sie banden ihren Ziegen einen Strick um und fütterten sie mit Äpfeln, die sie von kümmerlichen wilden Bäumen gepflückt hatten. Mühevoll zerkauten die Tiere sie, und von ihren ledrigen Lippen tropfte grüner Schaum.
Ann und Wade waren glücklich. Sein Gedächtnisverlust offenbarte sich meistens in kleinen Dingen. Einmal machte er das Bett verkehrt herum, zog das Laken über die Steppdecke. Aber die eigentliche Überraschung für Ann war, dass er überhaupt das Bett machte. Sonst war das immer ihre Aufgabe gewesen, sie freute sich über diese Neuerung.
Einmal fand sie ihre Haarbürste in der Gefriertruhe, und manchmal riefen besorgte Kunden an und sagten, die Bestellzettel seien doppelt ausgefüllt worden. Aber nichts davon war wichtig, so wie die meisten Dinge unwichtig sind, auch die, die korrekt ablaufen.
Sie lernte, mit seinen Aussetzern umzugehen. Manchmal spürte sie auch ohne ein Wort von ihm, dass es wieder so weit war. An einem sonnigen Herbsttag lag sie neben ihm auf der Wiese, und während er döste, spürte sie förmlich, wie sein altes Leben und seine Erinnerungen von seiner Haut abstrahlten und ihn alles verließ. Alles außer ihr. Auch sie streifte ihr altes Leben ab, um sein Gegenstück zu werden. So lagen sie dort gemeinsam, ein Punkt in der Zeit. Als sich eine Wolke vor die Sonne schob, geriet in seinem Inneren etwas in Bewegung, und sie spürte es und ließ zu, dass in ihr das Gleiche geschah. Sie wurden wieder sie selbst, noch immer gewärmt von der verlorenen Erinnerung an den Moment kurz zuvor.
Doch in das Glücksgefühl mischte sich die große Angst, dass ihnen eines Tages nichts mehr bleiben könnte als das. Dann würden alle Assoziationen verloren sein: der Geruch der Handschuhe, das Geräusch, mit dem die Tür des Pick-ups zugeworfen wird. All die Details, die sie noch nicht kannte. Nichts würde mehr über sich hinausweisen, alles wäre nur noch es selbst.
Eines Nachmittags verbrannten sie weit draußen im Wald, am Rand ihres Grundstücks, ein paar modrige alte Möbel. Sie waren sicher von irgendeinem unbekannten Nachbarn dort entsorgt worden. Auf ihren gemeinsamen Spaziergängen durch den Wald war es inzwischen eine Art Spiel geworden, solche Schmuddelecken zu suchen, die sie aufräumen mussten. »Los komm, wir haben ein Rendezvous«, sagte Ann dann, zog lachend ihre sauberen Sachen aus und schlüpfte in die schmutzige, zerrissene Jeans, die nach früheren Müllfeuern roch.
Manchmal entdeckten sie inmitten des Gerümpels sogar etwas Nützliches. Einmal zum Beispiel zog Wade die Blattfedern von den Achsen eines schrottreifen LKWs. Es war ein ganz bestimmtes Metall, das er nur an älteren LKWs fand und für seine Arbeit verwendete. Er erhitzte es, bis es rot glühte, und schmiedete es mit dem Hammer.
An dem Tag, als sie die alten Möbel fanden, bedeckten sie eine Matratze mit Zweigen und übergossen sie anschließend mit Diesel. Sie traten einen Schritt zurück und betrachteten ihr knackendes, loderndes Feuer. Er schlang ihr einen Arm um die Taille. In seiner Berührung lag etwas Schweres, in seinem Lächeln, selbst in seinem Lachen etwas Kummervolles sowie die Einsicht, dass sie beide von irgendwo hierhergekommen waren, dass die Geschichte nicht erst mit ihnen beiden begonnen hatte.
Dieses Bewusstsein wird ihr fehlen, wenn es erst einmal verschwunden ist. Sie schmiegte sich an ihn, roch den Rauch in seinen Kleidern. Sie betrachtete sein schönes, dem Feuer zugewandtes Gesicht, dann sah auch sie in die Flammen. Die Luft über den Rauchschwaden flirrte vor Hitze, zitterte wie ein Spiegelbild auf Wasser, und es sah aus, als würden die Berge in der Ferne gequält beben.
»Da sind wir«, sagte sie, ohne zu wissen, was sie meinte.
»Da sind wir«, stimmte er ihr zu und zog sie dichter an sich heran.
■
Als Ann gerade auf den Berg gezogen war, gab es dort noch keine Ziegen, sondern Pferde, Appaloosas, die in dem ersten Jahr, in dem weder Jenny noch June sie geritten hatten, so biestig geworden waren, dass Ann sich nicht einmal in ihre Nähe traute, um ihnen die Kletten aus den verfilzten Mähnen zu bürsten. In der kleineren Scheune nahe dem Haus hatte Jenny das Heu gelagert; sie war voll gewesen bis zum Dach. Nicht lange nachdem Ann hierher gezogen war, hatten Wade und sie die Pferde mitsamt dem Heu verkauft, nur ein paar Ballen hatten sie behalten.
Ohne Heu wirkte die Scheune ganz anders, weit und voller Möglichkeiten. Sie hatte ein Fenster, das zum Wald hinaus ging. Ann träumte damals davon, sich hier ein Arbeitszimmer einzurichten, wollte ein Keyboard und einen Schreibtisch hineinstellen.
Sie stand inmitten von aufgewirbeltem Staub und fegte. Mit einem Besen entfernte sie Spinnweben und leere Hornissennester aus den Ecken. Es war anstrengend und tat gut, und als die ganze Scheune sauber war, legte sie sich auf einen der wenigen verbliebenen Heuballen in der Ecke, und ihre Hand fiel in den Spalt zwischen dem Heu und der Wand.
Dort steckte ein Buch, es stand mit dem Rücken nach oben auf zerknickten, gebogenen Seiten. Sie streifte es mit den Fingerspitzen; es war modrig und mit körnigem Staub bedeckt, ein großes Buch mit weichem Einband.
Es hieß Gesichter zeichnen und war ein Anleitungsbuch, in dem verschiedene Techniken gezeigt wurden, um Schritt für Schritt Gesichtsausdrücke festzuhalten, angefangen mit Ovalen in Gitternetzlinien und geometrischen Formen. Seite für Seite entwickelte sich die Skizze weiter, bis daraus ein Allerweltsgesicht mit sämtlichen Details und einer Frisur geworden und die Gitternetzlinien verschwunden waren. Es war ein Buch für Erwachsene; für Kinder waren die Skizzen zu präzise und zu schwierig. Auf der ersten Seite des Übungspapiers hinten im Buch fand Ann die halbfertige Bleistiftskizze eines Frauengesichts. Rechts unten eine Signatur.
Jenny.
Man erkannte noch die ausradierten Hilfslinien. Ann sah, wie sorgfältig die Anweisungen befolgt worden waren. Das Gesicht war ein wenig zur Seite gewandt. Die Nase war mit einem gewissen Selbstbewusstsein gezeichnet worden – Rechteck und Kreis waren schon ausradiert –, aber ein Auge war noch unschraffiert und leer, in den Linien des vorherigen Schrittes gefangen wie ein Auge, das man durch das Visier einer Waffe sah, die Pupille im Fadenkreuz. Das Haar dagegen, das links und rechts des Gesichts herabfiel, bestand aus kräftigen, differenzierten Bleistiftstrichen.
Ann schlug das Buch zu.
Die Scheune war nicht mehr dieselbe wie zuvor. Ann versuchte es zu ignorieren. Stellte ihre Sachen hinein. Einen Schreibtisch, ein Keyboard und sogar einen alten Computer mit einem Programm zum Komponieren und Aufnehmen von Musik. Ein hübsches kleines Studio.
Aber die Frau in der Ecke sah das genauso. Ann spürte, dass sie da war und es genoss, einen Moment ohne ihre Töchter und ihren Mann zu haben, sich mit dem Zeichenbuch auf der Brust ganz allein auf den Heuballen auszustrecken, die nackten Zehen über dem stramm gespannten roten Netz, den Arm gegen die blendende Sonne träge auf die Stirn gelegt, den Bleistift gespitzt. Ann stellte sich vor, wie die alten gefleckten Pferde in der Nähe geräuschvoll ihr Heu kauten. In den Ecken summten Hornissen, und irgendwo draußen unter einer Wäscheleine, an der rosafarbene Hemden im Sonnenlicht gestärkt wurden, füllten zwei Mädchen winzige blaue Teetassen mit Sand.
Weil Wade alles weggeworfen hatte – Zeichnungen, Kleider und Spielzeug –, lud sich jedes zufällige Überbleibsel in Anns Gedanken mit immenser, unsagbarer Bedeutung auf. Vier stockfleckige Puppen, unter Sägemehl in einem modrigen Baumstumpf begraben. Ein hochhackiger Barbieschuh, der aus dem Regenrohr gespült wurde. Eine neongrüne Zahnbürste in einer Hundehütte. Dann schließlich die halbfertige Zeichnung in einem Buch. Artefakte, schwer angereichert mit Bedeutung, die sie nicht verdienten, ihrer beängstigenden Seltenheit wegen aber unweigerlich bekamen; sie bauten sich vor ihr auf und erzählten ihre eigenen Geschichten, verankerten Erinnerungen in ihrem Kopf, die in dem von Wade hätten bleiben sollen.
Selbst die Himbeersträucher, die Ann nicht gepflanzt hatte. Lange kamen sie Jahr für Jahr wieder und verfolgten sie, allein aus dem hartnäckigen Willen heraus, sich ihre Ärmel zu schnappen, ihr die Beine zu zerkratzen und sie in sich hineinzuziehen. Jenny hatte sie gepflanzt. Ann goss sie nicht mehr, aber sie überlebten allein vom Regen und trugen mickrige, saure Beeren, die wie Kreide in der Hand zerbröselten. Jahr für Jahr kündigten sie sich durch störrische neue Triebe an, rötlich braun neben den alten grünen Stämmen. Eine Zeitlang tat Ann alles, um ihnen passiv den Garaus zu machen, aber als sie die Sträucher eines Winters kahl und kraftlos dort stehen sah, nahm sie eine Machete und hackte sie weg. Um sie herum flog feiner Schnee auf.
Es war verwirrend, nicht zu wissen, ob sie mehr von seiner Familie brauchte oder weniger. Sie hatte geweint vor Rührung, als sie die vier halb verschimmelten Puppen fand, war überwältigt und ungläubig gewesen angesichts der Teetässchen unter der Wäscheleine, jedes gerade einmal so groß wie ein Fingerhut, und hatte sich schuldig gefühlt, als sie den Berghüttensänger auf einem Geschirrtuch entdeckte, den Jenny sicher selbst gestickt hatte, und wenn sie die leeren Zimmer sah, spürte sie in sich nichts als Leere. Als sie bei der Post einmal Schlange stand, sah sie, wie ein kleines Mädchen auf dem Parkplatz mit einem Stock auf ihr umgefallenes Fahrrad einschlug. Ann lachte. Aber dann stiegen ihr plötzlich Tränen in die Augen.
Sie behielt das Zeichenbuch ein ganzes Jahr lang, räumte es mal hierhin und mal dorthin und versuchte, seine Bedeutung zu schmälern, indem sie es im Bücherregal hin und her räumte und dabei immer eine Spur zu grob behandelte. Eines Tages schließlich schob sie das Buch, in dem immer noch die Zeichnung enthalten war, wütend in einen großen braunen Umschlag und adressierte ihn an das Frauengefängnis Sage Hill. In die obere linke Ecke schrieb sie keinen Absender. Außen auf den Umschlag schrieb sie: »Z. Hd. Gefängnisbücherei. Eine Spende für Ihren Bestand.« Die Frau am Postschalter sagte nichts dazu, auch wenn sie die Adresse sicher zur Kenntnis nahm. Sie strich das Portolabel glatt und warf den Brief mit einem wissenden und schützenden Blick zu den anderen in die Kiste.
Als Ann an diesem Märztag aus dem Holzschuppen kommt, hält sie an der Scheune an. In ihrem Haar hängen noch die Abgase vom Pick-up. Ihr blauer Schlitten ist voll Birkenholz, das sie zwar nicht braucht, aber mit dem sie trotzdem ein Feuer macht, denn das Holz war der Vorwand, um zum Pick-up zu gehen, und das Feuer der Vorwand zum Holzholen. Je öfter sie Feuer macht, desto öfter kann sie zum Pick-up gehen und versuchen zu verstehen.
Die Ziegen in der Scheune spüren, dass Ann in der Nähe ist, und rufen sie. Sie legt das Schlittenseil auf das Birkenholz und drückt die Scheunentür auf.
Drinnen ist die Luft kühl und abgestanden. Die Ziegen kommen angerannt. Sie reibt ihre Ohren, tätschelt ihnen das Fell, und sie zittern freudig unter ihrer Berührung. Sie redet ihnen freundlich zu, obwohl sie Jennys Gegenwart in diesem Raum so stark wie nie zuvor empfindet. Durch das Scheunenfenster sieht sie das Wäldchen aus Ponderosa-Kiefern, aus dem sie gerade gekommen ist, und plötzlich spürt sie nicht nur Jennys Gegenwart, sondern auch die eines Lebens, das sie selbst beinahe geführt hätte. Eines ohne Wade.
Während sie mit einem Stock die Eisschicht auf dem Wassertrog der Ziegen zerschlägt, versucht sie diese simple Tatsache zu verstehen: Ich bin hier, weil du nicht hier bist.
Die Ziegen meckern lautstark; sie gibt ihnen Heu.
»Du bist nicht hier«, sagt sie leise zu allem, was in der Scheune anwesend ist. »Du bist nicht hier.«
Doch schon allein diese Rückversicherung ist ein schmerzliches Eingeständnis. Schnell geht sie aus der Scheune, schließt die Tür hinter sich und zieht den Schlitten weiter den Hügel hinunter.
Fast am Haus angekommen, sieht sie im Garten Wade. Er kniet im Schneematsch und entwirrt den Kletterdraht für die Bohnen. Auf der Schwelle aus bleichem Gras zwischen Haus und Garten bleibt sie stehen und beobachtet ihn.
»Ich liebe dich«, sagt sie.
Erschrocken sieht er von seiner Arbeit auf, das Gesicht müde und unschuldig, und aus seinen dunkelblauen Augen spricht Freude.
■ ■ ■
Ann ist in Poole an der Südküste Englands aufgewachsen. Aber geboren wurde sie hier, in Idaho, allerdings nicht in Ponderosa, sondern im Bergbaustädtchen Kellogg im Silver Valley des Panhandle.
An ihre ersten drei Lebensjahre in Idaho hat sie keinerlei Erinnerungen mehr. Als sie neun Jahre alt war, erwähnte ihre Mutter einmal, sie seien aus Amerika gekommen, und Ann begriff nicht, was sie damit meinte. Sie hatte keine Erinnerung mehr an die Reise über den Atlantik. Das Einzige, was ihre Eltern ihr über Idaho erzählten, war, dass ihr Vater in der Sunshine Mine gearbeitet hatte und dem berüchtigten Brand entkommen war, weil er drei Jahre zuvor dort aufgehört hatte.
Danach verwandelte sich Idaho, wenn Ann die Augen schloss, von einem Ort in ein Gefühl, völlig losgelöst von Amerika, ohne Grenzen oder eine Geschichte außer der, die ihr gehörte: das Silberbergwerk. Einhundert Tunnelmeilen, eine Meile unter Tage. Sie konnte kaum glauben, dass sie von einem solchen Ort stammte. Wenn sie daran dachte, kam es ihr vor, als hätten sich jene vergessenen drei Jahre in Idaho tief in ihr Inneres gegraben und all die schönen Jahre unterhöhlt, die folgten. Idaho war die Mine, England die instabile Oberfläche ihres Lebens.
Also zog sie zurück. Sie war achtundzwanzig. Ihre Mutter war ein paar Jahre zuvor gestorben, ihr Vater war vor Kurzem zu ihrem Bruder nach Schottland gezogen. Also kehrte auch Ann England den Rücken. In Hayden Lake im Norden Idahos, weniger als eine Autostunde von ihrem Geburtsort entfernt, fand sie eine Stelle als Chorleiterin einer kleinen Schule.
Die Schule lag in einem urwüchsigen Waldstück am Ende einer frisch gepflasterten Straße, direkt an einem See. Es war eine kleine Charter School für leistungsstarke Schüler mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften. Die insgesamt etwa zweihundert Schüler im Alter von sechs bis achtzehn wirkten alle sehr liebenswürdig und interessiert, nicht nur am Lernstoff, sondern auch aneinander. Obwohl die Schule fast ausschließlich von Weißen besucht wurde, war der Lehrplan stark auf Multikulturalität und Internationales ausgerichtet. Ann konnte sich nie entscheiden, ob es höchst seltsam oder nur natürlich war, einen so unnachgiebig toleranten Geist an einer ländlichen Schule vorzufinden, die so dicht am Hauptsitz der Aryan Nations lag, jener rechtsextremen Gruppe, die damals noch jährlich einen Weltkongress abhielt und bei der Parade zum Unabhängigkeitstag aufmarschierte. Auf dem Weg zur Arbeit kam Ann täglich an der Abbiegung vorbei, von der ein langer Waldweg zu jenem Gelände führte, und es verstörte sie und widerte sie an, dass dies real war.
Anns Klassenzimmer war ein Container etwas abseits des eigentlichen Schulgebäudes. Wenn sie das Fenster öffnete, hörte sie das Plätschern des Sees direkt unterhalb des Hügels oder das Kreischen ferner Kettensägen, das über das Wasser getragen wurde. Obwohl der See außerhalb des Schulgeländes lag, gingen die Schüler am Nachmittag gern hinunter ans Wasser, um dort auf ihre Eltern zu warten. Im allerersten Jahr der Schule, in dem Halbjahr bevor Ann dort anfing, war eines Abends ein Junge auf der Suche nach seinem Ranzen in einen halb versunkenen Steg eingebrochen, der fast vollständig von Rohrkolben verdeckt war. Sein rechtes Bein rutschte komplett in das Loch hinein; dicke Holzsplitter bohrten sich in sein Fleisch, und die Pfähle darunter, die den Steg gehalten hatten, spießten ihn förmlich auf. Niemand hörte seine Hilferufe, und seine Eltern, die ihn bei einem Freund glaubten, suchten auch nicht nach ihm. Die Nacht war stürmisch, und als ihn der Hausmeister am Morgen fand, lag er bewusstlos auf dem Steg, das Bein noch immer eingeklemmt. Die Ärzte mussten es vom Oberschenkel abwärts amputieren, um ihm das Leben zu retten.
Sein Name war Eliot. Er war sechzehn, als er zu Ann in den Chor kam. Sie erinnert sich noch genau, wie sie sich fühlte, wenn sie am Klavier saß und er hinter ihr sang. Dass so eine Stimme von einem High-School-Jungen kommen konnte, einem unbekümmerten, albernen Kind, war ihr unwirklich erschienen. Immer wenn sie ihn überschwänglich lobte, hatte sie zugleich den absurden Verdacht, er würde schummeln. Sie fühlte sich unwohl, wenn sie sah, wie wohl er sich offenbar fühlte. All die Aufmerksamkeit, die sie ihm schenkte, die Nachhilfestunden nach dem Unterricht und jedes große Solo bei Konzerten – all das nahm er an, weder verlegen noch dankbar, so als würde er es gar nicht bemerken. Er hatte große braune Augen und ungekämmtes Haar, und hinter dem Ohr trug er stets einen frisch gespitzten Bleistift, mit dem er nie schrieb. Wenn er sich so auf seine Krücke stützte, während er mit ihr sprach, ein Bein seiner Khakihose locker am Oberschenkel festgeheftet, wirkte er so lässig und cool, dass auch sie sich unwillkürlich irgendwo abzustützen versuchte und die Hand nach der Wand oder einem nicht vorhandenen Pult ausstreckte, als wäre sie die Unbeholfene, weil sie ein zweites Bein hatte. Wenn er sich nach der Schule bei den Chorproben dann mit Ann unterhielt, wenn er ihr ganz am Ende nach dem Singen irgendetwas aus seinem Leben erzählte, freute sie sich so, in seiner Nähe zu sein, dass es sie orientierungslos machte und sie sich fühlte, als würde ihr jeden Moment eine Körperhälfte wegsacken, nur dass sie keine Krücke hatte, die sie auffing.
Sie merkte damals gar nicht, dass sie für ihn etwas anderes empfand als für alle anderen Schüler. Es gab ein Grüppchen von Mädchen und Jungen, die nach den Proben gern noch blieben, mit ihr schwatzten, auf dem Klavier herumklimperten und in ihren Noten stöberten. Sie hatte sie alle ins Herz geschlossen und ging fast wie eine große Schwester mit ihnen um, aber irgendwann schickte sie sie immer nach Hause, um mit Eliot zu üben. Wenn sie dann zu zweit waren, wenn sie am Klavier saß und er sich beim Singen über sie beugte, um die Noten umzublättern, spürte sie seinen warmen, süßen Atem im Nacken, und in diesem Moment war ihre Angst vor dem bevorstehenden Moment des Abschieds immer am größten.
Ann fühlte sich in ihrer damaligen Mietwohnung nicht wohl, und da die Freundlichkeit ihrer Mitbewohnerinnen schon an Aufdringlichkeit grenzte, verbrachte sie den Großteil ihrer Freizeit in ihrem Containerklassenzimmer, in dem ein altes Klavier, eine kleine Bühne, ein Schreibtisch und unter dem Fenster eine grüne Couch standen. An den Wänden hingen Musical-Plakate ihrer Vorgängerin. Sie verbrachte so viele Stunden in ihrem Klassenzimmer, dass es ihr irgendwann wie ihr wahres Zuhause vorkam und die Wohnung wie ein Ort, den sie bloß besuchte. Oft schlief sie nachts auf dem grünen Sofa unter dem offenen Fenster, in den Schlaf gewiegt von den nächtlichen Geräuschen der Schule und des Sees, die außer ihr nicht einmal der Hausmeister kannte. Sie stand früh auf, benutzte die Dusche in der Lehrertoilette, putzte sich die Zähne und kämmte sich das Haar an ihrem Pult, in dessen Schubladen sie auch etwas Wechselwäsche aufbewahrte. Wenn die Schüler dann eintrafen, kamen sie ihr vor wie Besucher und die Sachen, die sie berührten, wie ihre Sachen. Sie sah genau, an welcher Stelle sich Eliot mit der Schulter gegen die Tür gelehnt hatte, um sie dem Nächsten aufzuhalten. Nachdem er einmal das Fenster geöffnet hatte, um einem anderen Jungen auf dem Parkplatz etwas zuzurufen, wischte sie seine verschmierten Fingerabdrücke nicht von der Scheibe. Sie bremste ihn nicht, als er den Finger in ein Loch in den grünen Polstern steckte, auf denen seine junge Lehrerin die Nacht zuvor geschlafen hatte, worauf er im Leben nicht gekommen wäre.
Die halbmondförmigen schwarzen Abdrücke seiner Krücke auf dem Podest berührten sie, Spuren seines Lebens in ihrem. Wenn er am Nachmittag nach Hause ging und sie mit diesen Spuren allein war, entdeckte sie in seiner Abwesenheit etwas, das der Trostlosigkeit ähnelte, die sie in der neuen Landschaft erwartet, aber nie gefunden hatte. Eine Weite, die sie verwirrte und sogar ein wenig demütigte. Der Junge war unterdessen gleichgültig wie ein Kontinent. Es lag etwas Kühles in seiner unerschütterlichen Seelenruhe, seiner konstanten und unpersönlichen Fröhlichkeit.
Sie klammerte sich ein wenig an diese Einsamkeit. An den Wochenenden bekam sie Heimweh nach ihrem Klassenzimmer. Selbst wenn sie sich darin aufhielt, war sie vage angewidert von all dem Schönen draußen vor dem Fenster – dem fedrigen Raureif auf den Pflanzen im Winter oder, viel später, den blühenden Lilien unten am Teich, deren Konturen seine Fingerabdrücke auf der Scheibe verschwimmen ließen.
Eines Nachmittags wartete Eliot nach der Probe vergeblich auf seinen Vater, der ihn sonst immer abholte. Eliot wohnte fünfzehn Autominuten von der Schule entfernt, und Ann bot ihm an, ihn zu fahren.
»Lehrer fahren doch nicht Auto«, sagte er und verdrehte angesichts ihrer Unwissenheit über die eigene Spezies die Augen. Es war derselbe Witz, den er ihr gegenüber immer machte, und sie wusste nicht anders darauf zu reagieren, als zu lachen. Immer und immer wieder – »Lehrer frieren doch nicht«, »Lehrer haben doch keinen Durst«, »Lehrer essen doch nicht«. Ann lachte, ein ums andere Mal.
An diesem Tag verbrachten sie die Fahrt zu ihm nach Hause fast schweigend. Skeptisch sah er sie vom Beifahrersitz aus an, das Fenster heruntergekurbelt, das Haar im Wind. Sie rechnete mit irgendeinem leicht spöttischen Kommentar, aber er sagte nichts. Dass er schwieg, war selten. Noch seltener war die Art, wie er sie ansah, kurz nachdem er ausgestiegen war. Er stand einfach nur in der Einfahrt und beugte sich ein wenig vor, um in den Wagen zu sehen. »Danke«, sagte er schließlich, dann lächelte er und schüttelte den Kopf, als hätte er etwas erfahren, das er nicht glauben konnte.
Am Tag darauf kam Eliots kleiner Bruder früh zur Schule, leerte Eliots Spind und warf den Inhalt in eine Plastiktüte, einschließlich der Beinprothese, die Eliot nie trug.
Der Direktor teilte Ann mit, dass Eliot von der Schule genommen worden war. Eliots Eltern hatten sich getrennt, er war mit seiner Mutter nach Oregon gezogen. Eliots Bruder bleibe beim Vater, sagte er.
»Aber es ist mitten im Halbjahr«, erwiderte Ann in dem Glauben, der Junge sei zu dem Umzug gezwungen worden. »Wie soll er das alles nachholen?«
Er wäre in den meisten Fächern sowieso durchgefallen, gab der Direktor zurück, und müsse daher sowieso jede Menge nachholen. Es war seine Wahl gewesen. Die Eltern hatten ihn selbst entscheiden lassen.
Sie wusste nicht, wie sie nach einem solchen Verlust weiter unterrichten sollte. Den anderen Schülern gegenüber war sie leicht reizbar, und in der Pause stützte sie die Ellbogen auf die kühlen Klaviertasten, legte die Hände vors Gesicht und versuchte zu weinen. Vergeblich. Am meisten schockierte sie die Grausamkeit, die er ihr gegenüber an den Tag gelegt hatte, indem er an seinem letzten Nachmittag in Idaho für ein Konzert geprobt hatte, bei dem er gar nicht mitsingen wollte. Ann konnte das nicht akzeptieren, konnte es einfach nicht glauben.
Am Abend streifte sie durch das leere Schulgebäude und spielte mit dem Gedanken, einen Blick in Eliots leeren Spind zu werfen. Vielleicht lag dort noch irgendetwas, vielleicht hingen innen an der Tür noch Fotos. Sie wusste, wo er war, weil sie ihn oft dort gesehen hatte; vor der weit geöffneten Spindtür hatte er sich mit Freunden unterhalten, ganz sicher, um mit dem Chaos zu prahlen, das er darin kultivierte. Im Spind hatte sie die Beinprothese gesehen, gegen den windschiefen Stapel aus Büchern und unsortierten Zetteln gelehnt.
Aber als sie den Flur betrat, stand dort ganz allein vor Eliots Spind ein Mädchen. In den Händen hielt sie ein Päckchen, das in Seidenpapier eingewickelt war.
Das Mädchen sah Ann nicht. Es war noch sehr jung, vielleicht acht oder neun. Die Grundschüler waren die meiste Zeit von den großen Schülern getrennt, so dass das Mädchen vielleicht noch gar nicht hatte merken können, dass Eliot nicht mehr da war. Sie hatte kurzes dunkles Haar und einen Pony. Ihre Schuluniform hatte sie schon ausgezogen und trug jetzt eine kurze Jeans und darunter eine weiße Strumpfhose mit Grasflecken an den Knien, dazu einen ausgeleierten rosa Pulli und rosa Schuhe, so ausgebleicht, dass sie fast schon weiß waren. Sie schloss die Spindtür ein Stück, überprüfte die Nummer. Ann sah, wie sie überlegte, was dieser leere Spind wohl zu bedeuten hatte. Das Mädchen blickte auf das sorgfältig verpackte Geschenk in ihren Händen und dann wieder auf den Spind. Ziemlich unvermittelt, so als fürchtete sie, dabei erwischt zu werden, legte sie das Geschenk hinein, schloss die grüne Metalltür und lief schnell davon.
Ann wartete, bis sie weg war, dann ging sie zum Spind und nahm das Päckchen heraus, ein längliches Schächtelchen in rosa Seidenpapier. Sie vermutete darin ein paar schöne Stifte oder eine Uhr. Auf einer Karte stand: Alles Gute zum Geburtstag Eliot, Deine Dich aus tiefstem Herzen liebende June Mitchell.
Die Karte berührte Ann. Sie empfand Verbundenheit und gleichzeitig Mitleid mit dem Mädchen. Sie nahm das Päckchen mit in ihren Container und wickelte es vorsichtig aus.
In der Schachtel lag ein Messer mit einer glänzenden, etwa fünfzehn Zentimeter langen Klinge. Ann sog hörbar die Luft ein vor Überraschung angesichts einer solchen Waffe in dem zarten Papier, aber auch, weil es so schön war. Der Griff war aus Knochen gefertigt und mit der Schnitzerei eines kleinen Hauses verziert. Links und rechts davon rankte je eine Rose, in deren Blüte ein Herz prangte. Das Messer lag auf einer ledernen Scheide, die mit Katzenaugen verziert war. Sie nahm es in die Hand und fuhr probehalber über die Klinge. Sie war so scharf, dass sie sich dabei in den Finger schnitt. Es war ein winziger, feiner Schnitt, der nicht wehtat und nur ein ganz klein wenig blutete.
Sie wusste nicht recht, was sie mit dem Messer machen sollte. In den Spind konnte sie das Päckchen jedenfalls nicht zurücklegen, jetzt, wo sie wusste, was es enthielt. Aber das Mädchen sollte auch keine Schwierigkeiten mit der Schule bekommen, und so legte sie das Messer erst einmal in ihr Pult.





























