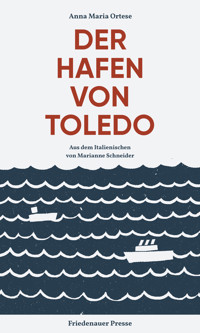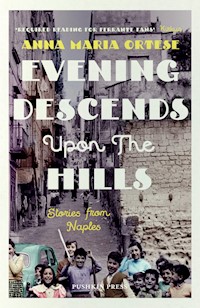Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Den jungen Mailänder Grafen Aleardo verschlägt es bei seiner Suche nach zum Verkauf stehenden Ländereien auf eine einsame Insel vor der Küste Portugals, die nicht einmal auf den Landkarten zu finden ist. Eine Insel des Bösen, wie sein Matrose glaubt. Tatsächlich tragen sich auf Ocaña seltsame Dinge zu: Drei verarmte Brüder eines portugiesischen Aristokratengeschlechts halten in einem heruntergekommenen Herrenhaus ein mysteriöses Wesen als Dienstmädchen, das Mensch und Echse, geschundene Kreatur und verwunschene Prinzessin zugleich ist – Iguana. Der Graf gerät in den Bann des schönen Geschöpfs, das unter den Menschen ein elendes Dasein fristet. Bei seinem leidenschaftlichen Versuch, das Geheimnis der Insel zu ergründen und Iguana zu retten, versinkt Aleardo immer mehr in eine verhängnisvolle Welt von Traum und Wahn, in der alles aus den Fugen gerät. Iguana untersucht das gestörte Verhältnis zwischen Kultur und Natur, den Missbrauch von Macht, die Übel von Kolonisation und Kapitalismus. Mit viel Zartgefühl für die Mittellosen und Elenden erzählt Anna Maria Ortese ein mitreißendes modernes Märchen, in dem das Böse nicht in Gestalt eines gefräßigen Wolfes oder einer arglistigen Hexe erscheint, sondern im Menschen selbst liegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Maria Ortese
IGUANA
Ein romantisches Märchen
Aus dem Italienischenvon Sigrid Vagt
Mit einem Nachwortvon Maike Albath
FRIEDENAUER PRESSE
INHALT
DER INSELKÄUFER
I
Der Spaziergang in der Via ManzoniDaddo
II
OcañaAuf hoher See. Eine hornförmige Insel
III
Begegnung am BrunnenDer gute Marquis. Das Tier. Wirkungen eines Halstuchs
IV
Das armselige HausEine Diskussion über das Universum. »Hilf mir!«
V
Die unfreiwillige IndiskretionEin Verrückter. Hypothesen
VI
Die SteineBei Kerzenschein. Die Natur im Alarmzustand
VII
Der Hut mit den scharlachroten FedernEin sanftes Erröten. Auf zum Hühnerstall!
VIII
Daddo in Verwirrung»Ich habe gesehen, dass du Geld gehortet hast!« Das Tier träumt
IX
Die zwei Monde von OcañaEin anderes Schiff. Welch eine Überraschung!
X
Eine typische KleinfamilieDer Erzbischof
XI
Der Schrecken des »Bösen«Neue Hypothesen
XII
Daddo kommt aus der LukeNochmals Geld. Der Traum
DER STURM
XIII
Am StrandDie Stimmen hinter der Wand. Zum Narren gehalten! Der edle Ritter
XIV
Daddo horcht aufKurze Einladung in die Freiheit. Definition des Teuflischen
XV
Kleiner SternDie Glückseligkeit. Der Fall. Die erbärmlichen Verstellungen
XVI
Daddo am Scheideweg»Am Ende stirbt selbst das Meer.« Salvatos Ausgelassenheit
XVII
Salvato weiß BescheidWo der Himmel sich schließt. Der Auszug
XVIII
Eine sonderbare IguanaDas Gespräch. »Die Jungfrau will es nicht!« Im Esszimmer
XIX
Der schreckliche MendesEin Gewerkschaftsproblem. Absurd! Verwirrung
XX
Daddo am BrunnenDas schöne Kind. Bewaffnet! Den Schuldigen auf der Spur
XXI
Der Prozess beginntDie Verhandlung. Wieder am Brunnen. Fast November
XXII
Die Verhandlung wird fortgesetztHoher Himmel. Identifiziert! Daddo ist froh
XXIII
Die Reise wird fortgesetztWer die Iguana war. »Gehen wir … Kosmos … Gnade … allen …«
XXIV
Die Kapelle vor dem MeerBrief aus Ocaña. Winter. Eine unbeholfene Einladung
Die blassgoldene Mattigkeit des Himmels. Anna Maria Orteses IguanaNachwort von Maike Albath
DER INSELKÄUFER
I
DER SPAZIERGANG IN DER VIA MANZONI
Daddo
IE du weißt, Leser, reisen die Mailänder alljährlich, wenn es Frühling wird, in die Welt hinaus auf der Suche nach Ländereien, die sie kaufen könnten. Um dort Häuser und natürlich Hotels und später vielleicht sogar Sozialwohnungen zu bauen; vor allem aber suchen sie nach noch unverfälschten Formen von »Natur«, nach dem, was sie unter Natur verstehen: eine Mischung aus Freiheit und Leidenschaft mit nicht geringer Sinnlichkeit und einem Hauch von Wahnsinn, woran es ihnen bei der Rigorosität des modernen Lebens in Mailand offenbar fehlt. Begegnungen mit den Eingeborenen und dem verschlossenen Adel dieser oder jener Insel gehören zu den begehrtesten Gefühlserregungen, und wenn dir scheint, Gefühlserregung sei ein den weitreichenden Möglichkeiten des Geldes wenig angemessenes Ziel, so bedenke, wie eng wirtschaftliche Stärke und Erschlaffung der Sinne miteinander zusammenhängen, weshalb ein Höchstmaß an Kaufkraft mit einer merkwürdigen Abstumpfung und einem allgemeinen Mangel an Unterscheidungsvermögen und Genussfähigkeit einhergeht; und dem, der heutzutage alles Mögliche speisen könnte, schmeckt nur noch wenig oder gar nichts mehr. So jagt er einigen starken Genüssen nach (die am Ende keineswegs stark, sondern ganz gewöhnlich sind) und würde sein Leben dafür geben. Vielleicht gilt das nicht für die Mehrheit der Mailänder, die, durch das Geschäftsleben eingeengt, noch keine Reisen gemacht, noch nichts gesehen haben und außerdem auch nur begrenzt neugierig sind; gewiss aber trifft es für eine Minderheit zu, nämlich für jene, die die Zierde ihrer Stadt sind, und dennoch sollte man nicht meinen, dass es unter ihnen nicht auch arglose, reine, vernünftige Menschen gäbe, kurz, das Beste der alten Lombardei. Im Gegenteil.
Don Carlo Ludovico Aleardo di Grees aus dem Geschlecht der Herzöge von Estremadura-Aleardi und Graf von Mailand, einer Familie entstammend, die allem Anschein nach zu zwei Dritteln schweizerischiberischer Herkunft war, und gleichwohl der heiterste und gutherzigste Lombarde, den man sich nur vorstellen kann, war einer von diesen. Mittlerweile um die dreißig, aber noch ausgesprochen jugendlich, als einziger Sohn durch den Tod seines Vaters in den Besitz eines umfangreichen Vermögens gelangt, das die Gräfin, seine Mutter, umsichtig verwaltete, verband der gute Graf Aleardi Segelleidenschaft und einen vom Vater geerbten vagen Idealismus mit einer weniger vagen, wenngleich unfreiwilligen Berücksichtigung der präzisen und komplizierten Interessen der Mutter, die für den jungen Mann während der folgenden Jahre eine immer rascher fortschreitende Vermehrung jener Besitztümer (in Form von Häusern und Grundstücken) im Auge hatte; und deshalb machte er sich jedes Frühjahr auf die Suche nach Grundstücken, auf denen er, der Architekt war, später Villen und Jachtclubs für die gute Gesellschaft der Mailänder Sommerfrischler bauen wollte. Sie hatten bereits viel gekauft und hatten vor (das heißt, die Gräfinmutter hatte es vor), noch mehr zu kaufen. Dem Daddo – so wurde der Graf genannt – schien allerdings nicht besonders viel daran zu liegen. Von irgendwoher hatte er eine christliche Unbekümmertheit im Blut, die ihn im Grunde gleichgültig gegen alle Besitztümer machte, so als sei der Sinn der Dinge ein anderer. Welcher, das wusste er nicht und würde es bei seiner bescheidenen Intelligenz vielleicht auch niemals wissen; berühmt aber war selbst damals, als Mailand noch nicht so trostlos war, sein stets bereites frisches und doch verhaltenes Kinderlachen, als würden ein den anderen verborgenes Fest, eine Musik hinter einer Mauer oder eine geheimnisvolle Gewissheit innerer Ruhe und Glückseligkeit, unabhängig von Jugend, Besitz und Namen und allzeit verfügbar, ihm Sicherheit geben. Er hatte noch nicht geheiratet und wollte es auch, trotz des Drängens der Gräfinmutter, die schon einige angesehene Schweizer Familien besucht hatte, noch nicht tun, weil ihm schien, das würde ihn einschränken … worin eigentlich, weiß man nicht. Er führte das einfachste Leben, das man sich nur denken kann, ein wahres, geradezu eintöniges Einsiedlerleben; den ganzen Tag saß er in seinem Büro und zeichnete Häuser wie ein Kind, während abends seine einzige Zerstreuung darin bestand, sich mit Boro Adelchi zu treffen, einem jungen Verleger der Nouvelle Vague, überaus ehrgeizig und noch nicht aus den Anfangsschwierigkeiten heraus, dem der Daddo, nebenbei bemerkt, ständig hinter dem Rücken der Mutter eine Menge Geld zukommen ließ.
Und ebendieser Adelchi war es, der an einem jener Aprilabende, wenn Mailand über und über grün und ganz zart ist und die Via Manzoni gar kein Ende zu nehmen scheint, den Anstoß zu jenem Abenteuer gab, das wir erzählen wollen.
Boro Adelchi also sagte ein wenig nachdenklich: »Ja, die Dinge stehen nicht schlecht … aber wir müssten etwas noch nie Dagewesenes, etwas Außergewöhnliches finden. Die Konkurrenz ist stark … Wenn du auf Reisen gehst, Daddo, warum solltest du mir nicht etwas ganz Urtümliches, vielleicht sogar Abartiges beschaffen? Es ist schon alles entdeckt, aber man weiß ja nie … alles ist möglich …«
»Am besten die Konfessionen irgendeines Verrückten, der womöglich in ein Leguanweibchen verliebt ist«, antwortete der Daddo scherzend; wer weiß, wie er darauf kam. Aber er schwieg sofort, beschämt, dass er mit Krankheit und Tiernatur sein Spiel trieb, zwei Dingen, denen er, wie viele Lombarden, obwohl er keinerlei Erfahrung damit hatte, tiefstes Mitgefühl entgegenbrachte.
»Ich weiß nicht«, entgegnete Adelchi, der den Scherz gar nicht bemerkt hatte, »ich würde eher sagen, irgendein Gedicht, einen canto, in dem die Auflehnung des Unterdrückten zum Ausdruck kommt …« Und er schwieg ebenfalls, aber nur weil seine diesbezüglichen Vorstellungen nicht ganz klar waren und er sich schämte, den Grafen dies merken zu lassen, der andererseits genauso wenig auf dem Laufenden war wie er.
Und an dieser Stelle ist es angebracht, auf eine eigenartige Verwirrung hinzuweisen, die zu der Zeit die lombardische Kultur beherrschte und deshalb auch das Verlagswesen beeinflusste, nämlich hinsichtlich dessen, was unter Unterdrückung und daraus folgender Auflehnung zu verstehen sei. Beides erschien den Lombarden, vermutlich im Widerstreit mit der bedrohlichen marxistischen Ideologie, lediglich als eine Sache der Gefühle und der Freiheit, diese zu äußern, wobei sie vergaßen, dass es (aufgrund der althergebrachten Traditionen in dieser Welt) dort, wo kein Geld ist oder wo man mit Geld alles kaufen kann, wo Not und große Unwissenheit herrschen, auch keine Gefühle gibt oder keine Lust, sie zu äußern; kurz, die Lombarden waren überzeugt, dass eine unterdrückte Welt etwas zu sagen habe, während doch, wenn die Unterdrückung alt und echt ist, das Unterdrückte nicht einmal existiert oder kein Bewusstsein seiner Unterdrückung mehr hat, sondern existent, wenn auch ohne wahres Bewusstsein, ist einzig und allein der Unterdrücker, der manchmal aus Gewohnheit die Formen nachahmt, die von Rechts wegen dem Opfer zustünden, wenn es noch existieren würde. Aber solche Spitzfindigkeiten und Spinnereien konnte man natürlich unmöglich den Verlegern anbieten, die gierig nach etwas verlangten, was den flauen Appetit des Publikums anzuregen vermochte. Derartige Überlegungen hätten den Ablauf der Produktion gefährdet, während die Wendung des erwähnten Konflikts in eindeutig traditionelle und deshalb beruhigende Formen, wie sie damals sehr in Mode waren, Zustimmung, Begeisterung, Wohlwollen und somit Verkauf und somit – da capo! – das liebe Geld garantierte.
Um auf unsere beiden jungen Leute zurückzukommen, wie sie heiter durch die Via Manzoni spazierten, und vor allem auf den Daddo, der, wie wir bald sehen werden, durch seine Unwissenheit nicht ernstlich eingeschränkt und so großmütig und reinen Herzens war, dass er deinen Respekt verdient, Leser; Daddo also sagte: »Wir werden sehen … ich will es versuchen. Ich habe die Vorstellung, dass es jenseits von Gibraltar etwas Unrechtmäßiges und deshalb auch Leidendes geben muss … Ich werde in den Bibliotheken nachforschen und mir Karten besorgen … Du aber, Boro, versprich mir, das Ganze ohne viel Aufhebens zu veröffentlichen … einzig und allein zu dem Zweck, die geistige Entwicklung der Mailänder zu fördern … Sonst nicht«, schloss er mit einem Lächeln, das weniger scherzhaft gemeint war, als es den Anschein hatte, und neigte dabei leicht den edlen Kopf vor, den ein wahrer Silberhelm umschloss – so früh und ohne jeden Grund ergrauten die Aleardi –, was dem feinen Gesicht bisweilen eine mittelalterliche Würde verlieh.
»Das verspreche ich dir … keine Sorge«, log aufgeregt Adelchi, der bereits mit größtem Vergnügen an die Sitzung des nächsten Tages dachte und daran, wie er das Werk in einigen Monaten oben auf dem Turm vorstellen würde. Er wollte ihm einen aufsehenerregenden Titel geben, wie zum Beispiel »Die Nächte eines Verrückten« oder »Die Hexe« oder besser noch »Verbrennt sie alle!«. Übersetzungen und Preise würden die Verkaufsziffern in den Himmel treiben. In Wirklichkeit würde er das Buch dann nicht einmal lesen, da er ein Mann ohne jede ungesunde Neugier war, ein einfacher Mensch, der nur nach einem fieberte, nämlich danach, Geld zu machen.
Unterdessen waren sie an jener Stelle der Via Manzoni angelangt, wo, wer von der Scala kommt, zu seiner Linken die Giardini, zu seiner Rechten die gleichnamige Galerie und vor sich den schönsten Platz Mailands liegen sieht mit einem aufgelockerten Park im Hintergrund, den der Nebel auch im April in einen sanften Schleier hüllt. Und wie immer überkam den Daddo bei diesem Anblick eine zarte Wehmut, fast schon eine Bewusstseinstrübung; er vergaß die verrückten Reden darüber, wie der Langeweile der Menschen abzuhelfen sei, und ließ den ruhigen Blick ringsumher schweifen wie jemand, der im Traum ein Bitten und Flehen vernimmt, welches als wirklich zu betrachten das Tageslicht verbietet, ein heimliches Klagen von Verlorenen hinter aller Stille.
»Wie du dir vorstellen kannst …«, fuhr Adelchi fort.
Doch der Graf hörte ihm schon nicht mehr zu.
II
OCAÑA
Auf hoher See. Eine hornförmige Insel
Vierzehn Tage später übergab Daddo das Büro in der Via Bigli zwei Sekretärinnen (von denen eine, die Bisi, geradezu verrückt nach ihm war, weil Daddo unter anderem ein Prachtexemplar jener ellenlangen, heiteren Erscheinungen darstellte, wie sie in der lombardischen Ebene gelegentlich noch anzutreffen sind), er verabschiedete sich von der Gräfinmutter, die ihm einen großen Smaragd mitgab, damit er ihn in Sevilla bei einem Juwelier ihres Vertrauens einfassen ließe, ging in Genua an Bord der Luisa, eines Schiffes, das mindestens achtzig Millionen Lire wert war, und nahm Kurs auf das untere Mittelmeer.
Wie Adelchi beim Thema »Unterdrückung« und die Gräfinmutter in Bezug auf Lebensinhalte, so hatte Daddo leider in Sachen Grundstückskauf – vielleicht, weil er diesem nicht wirklich Bedeutung beimaß – keine sehr klaren Vorstellungen und insofern auch keine entsprechenden Vorlieben. Er kannte das Mittelmeer wie seine eigene Hosentasche, und obwohl praktisch alles zum Verkauf stand, zögerte er ständig. Bald aus irgendeiner Rücksicht auf Sardinien, als litte es noch immer und bedürfte eher einer Heilung als einer Teilung; bald aus irgendeiner Nachsicht gegenüber den umliegenden Inselchen und Klippen, als wären sie noch zu klein, um sich von ihrer Mutter zu entfernen (was einfach lächerlich war, und wenn wir um das brüderliche Empfinden des Grafen noch nicht wüssten, könnten wir ihm frömmelnde Schwärmerei vorwerfen); bald, wie zum Beispiel vor bestimmten wunderschönen Landstrichen Spaniens, als ob Gott dort all seine Tränen vergösse und man nicht die lärmenden Touristen dorthin bringen dürfte. Und auch die Achtung schließlich, jenes feine und ein wenig schmerzliche Gefühl für die Würde des anderen, das einst die Ritter im Hinblick auf die Frau zu so vielen bewundernswerten Unternehmungen inspirierte und das der edle Lombarde, ohne es zu wissen, der Erde insgesamt entgegenbrachte, erschwerte ihm jedes Mal jene doch so einfache Handlung, die sich käuflicher Erwerb nennt. Diesmal jedoch, wer weiß warum, in sehr viel schärferer Weise. Aber bei seinem fröhlichen und ausgeglichenen Wesen nahm er sich das nicht weiter zu Herzen, und im Vertrauen auf die Geschicklichkeit des Salvato – das war der Matrose auf der Luisa – hatte er schon daran gedacht, sobald sie Gibraltar hinter sich gelassen und das Kap St. Vincent umschifft hätten, ganz langsam die portugiesische Küste hinaufzusegeln, womöglich gar bis zum Golf von Biskaya. Dort würde man vielleicht eine Insel sichten, die niemandem gehörte, und sie zu kaufen würde keine Kränkung bedeuten. Über die Proteste der Gräfinmutter machte er sich in seiner Einfalt nicht weiter Gedanken.
Das Wetter war gut, das Meer ruhig, der Frühling hauchte seinen warmen Atem bis aufs Meer hinaus, und es gab einen Augenblick, als Daddo an der Mündung des Rio Tinto die Luisa verließ und sich nach Sevilla begab, um jenen Juwelier aufzusuchen, da hätte man den Himmel in Scheiben schneiden können, so blau war er. Und es herrschte eine Ruhe, eine Stille die reinste Lebenslust! Herr Santos, der Juwelier, war zu einem kleinen Familienfest nach Granada gefahren und also nicht zu Hause, und Daddo tröstete sich damit, in den weißen Gassen umherzuschlendern und nutzlosen Krimskrams zu kaufen, den jedoch seine Mutter und die beiden Sekretärinnen, insbesondere Bisi, nicht als solchen ansehen würden; darunter einen wunderschönen, ganz und gar golddurchwirkten weißen Seidenschal und eine Halskette aus blaugrünen Steinen für Salvatos Frau, damit auch sie bei der Rückkehr ihres Mannes eine Freude hätte. Dann kaufte er noch zwei Kisten Malaga, über die der liebe Adelchi sich bestimmt freuen würde, und für sich selbst Ansichtskarten und Pfeifentabak. Bei Sonnenuntergang war er wieder in Palos, und die Seefahrt ging weiter.
Sie dauerte etliche Tage, weil Salvato offenbar absichtlich jedes Mal, wenn ein leichter Wind wehte, das Segel einholte und der Graf ihn, teils aus Höflichkeit, teils weil ihm Verzögerungen nichts ausmachten, gewähren ließ. So vergingen die Tage: Salvato streckte sich, sobald es möglich war, einen Arm über die Stirn gelegt, zum Schlafen aus, und Daddo ging, wenn er ihn nicht vertreten musste, auf der Brücke auf und ab, stopfte seine Pfeife, betrachtete die Wellen, die flüssigen Türkisen glichen, und dachte lächelnd, wie schön doch im Grunde, trotz des ewigen Konflikts zwischen Russland und Amerika, die Welt und wie bezaubernd der Kosmos sei.
Als sie Lissabon erreichten, war es der 5. Mai, und man feierte gerade irgendein religiöses Fest. Die Glocken der Kathedralen läuteten, das Volk schwärmte fröhlich durch die Straßen und blieb vor dem einen oder anderen der erleuchteten Stände stehen, um Erdnüsse, Rosinen, gebratenes Spanferkel, kleine Heiligenfiguren aus Gips, Spielzeugtrompeten und grüngelbe Holzwägelchen mit rotgezäumten weißen Pferdchen zu kaufen, das Ganze für wenige centavos, wie es bei jedem Volksfest so üblich ist, und die Portugiesen bildeten da keine Ausnahme. Sie erschienen dem Daddo bei dieser Gelegenheit als treffliche Menschen, die kaum etwas für ungut nahmen, und er bedauerte es, sie verlassen zu müssen. Ein weiterer Halt war, wenn sie nicht vorher noch irgendwo Land sichteten, mindestens bis Coruña nicht mehr vorgesehen, und dort würden sie sich wieder auf spanischem Territorium befinden.
Tags darauf, am 6. Mai, segelten sie erneut fernab der Westküste der Iberischen Halbinsel, dem letzten Zipfel Europas sozusagen, dahin, als sich etwas veränderte. Das Wetter war immer noch gut, aber es fehlte jenes strahlende Azurblau, jene Sonne; das Licht wirkte jetzt leicht verschleiert, als seien Wölkchen am Himmel, was aber nicht der Fall war. Und das Meer leuchtete nicht mehr türkisfarben; es hatte die Färbung von poliertem Silber angenommen, einem Fischrücken gleich, nur anstelle der Schuppen mit lauter kleinen Wellen … die eine der anderen nacheilten. Es herrschte eine große Ruhe, nicht größer vielleicht als im Mittelmeer, denn das Meer ist überall gleich, aber es schien so wegen der blassen Farben, in denen die Sonne eingeschlummert war, und wegen der Karwochentrübsal, die in der Luft lag, obwohl Ostern in dem Jahr sehr früh gewesen war und inzwischen bereits der Sommer vor der Tür stand … Eine bernsteingelbe Helligkeit war alles, was sich am Horizont zeigte, während man zur Rechten noch die flache, nackte Küste Portugals ahnte, bis sie wie ein Schatten endgültig verschwand. Dann mischte sich in das rosarote Licht ein fahles Grün, und die Wellen wurden, auch ohne sich zu überschlagen, größer. Es war ein Uhr am 7. Mai, und während der Nacht und des Vormittags waren weitere Meilen vorübergezogen, ohne dass sich deshalb die Szenerie geändert hätte, da zeigte sich dem Kinderblick Daddos, der ein wenig gedankenverloren auf der Brücke stand, ganz in der Ferne in jener Helligkeit ein grünbrauner Strich in der Form eines Horns oder eines zerbrochenen Kringels, der auf der Karte nicht auszumachen war. Er fragte den Matrosen, um was es sich handeln könne (im ersten Moment hatte er an eine Herde Wale gedacht, da jener Strich, so klein er auch war, Höcker aufwies), und Salvato antwortete, er könne sich irren, aber das sehe ganz nach der Insel Ocaña aus; und bei diesen Worten machte er nicht den Eindruck (wie übrigens auch sonst nie, und das hing mit seiner Trägheit zusammen), als brenne er vor Neugier und halte es für reizvoll, sie stillen zu können. Im Gegenteil!
»Ocaña! Was für ein schöner Name!«, der Graf nahm die Pfeife aus dem Mund; er sagte dies, gerade weil jener Name etwas leicht Unangenehmes, Bitteres hatte, was sein Mitleid erweckte. Und in leicht fragendem Ton fuhr er fort: »Wie ich sehe, ist sie auf der Karte nicht eingezeichnet.«
»Nein, ist sie nicht«, erwiderte Salvato trocken, »weil«, und dabei versuchte er, irgendwohin zu sehen, wo der Blick nicht der armen Insel Ocaña begegnete, »weil die, die Karten zeichnen, das sind Gott sei Dank Christenmenschen, und die beachten das nicht, was des Teufels ist.«
»Ach komm, mein Lieber«, der Graf lächelte begütigend, »so sollte man von Unglücklichen nicht reden. Wenn es den Teufel gibt, ist der Herr eher ihm wohlgesinnt als dir und mir, da kannst du sicher sein. Und außerdem, warum sollte sie dem Teufel gehören?«
Ihm war der Gedanke gekommen, dass, wenn jene Klippe von irgendeiner schlimmen Legende umwittert war, der Preis vermutlich niedrig läge, und alles in allem missfiel ihm das nicht. Das lombardische Gemüt hat stets einen praktischen Unterbau, der in gewisser Weise ebenfalls aus Gutherzigkeit besteht.
Auf diese Frage hin brummte der Matrose irgendetwas; und es wurde deutlich, dass die Legende mehr eine Erfindung seiner Trägheit als historisch fundiert war. Aber dadurch verstärkte sich ein Eindruck, der, wie der Graf später erkennen musste, der Wirklichkeit sehr nahe kam, nämlich dass es sich nicht um eine gewöhnliche Insel handelte, sonst wäre sie, Teufel hin, Teufel her, auf den Karten verzeichnet gewesen, sondern eher um ein aus dem Meer ragendes, halb verbranntes ödes Felshorn. Vermutlich gab es dort nur Wurzeln und Schlangen.
»Wir werden sehen«, schloss er.
Es war keine gute Idee, aber das passierte dem Daddo gelegentlich; etwas in seinem Wesen ließ sich mir nichts, dir nichts verzaubern und trieb ihn, sich Schwierigkeiten zu suchen. Um es noch deutlicher zu sagen: Gewisse Einsamkeiten und Schrecken übten, gerade weil er das Gegenteil liebte, eine Anziehung auf ihn aus, als erhöben sich von dorther klägliche Hilferufe. Ohne Rücksicht auf die Nützlichkeit der Sache sagte er deshalb dem Salvato, er solle in jene Richtung steuern, ein Befehl, dem der junge Mann nur sehr widerwillig gehorchte.
Es verging noch eine halbe Stunde. Wie durch eine gelbliche oder durch leichten Rauch gelb gefärbte Linse sah man jetzt einige Eichen, einen kleinen Acker und ein Haus. Sie fuhren noch näher heran, und im Schatten einer der Eichen saßen einige Herren und eine Alte (so schien es), die mit Stricken beschäftigt war.
Sie hatten das luxuriöse Schiff des Grafen bemerkt, wandten sich aber kaum um. Einer von ihnen, der jüngste, mit weißgoldenem Kopf, las im Schutz des großen Baumes etwas vor. Die anderen hörten schweigend zu.
Daddo machte einige allgemeine Begrüßungsgesten, auf die in keiner Weise reagiert wurde. Daraufhin bat er Salvato, in dem flachen Grund Anker zu werfen, ließ sich in ein anderes kleines Boot, die Luisina, hinab und legte rudernd die hundert Meter zurück, die ihn vom Strand trennten.
Es kam ihm vor, weiß der Himmel warum, als wären die Menschen versteinert.
III
BEGEGNUNG AM BRUNNEN
Der gute Marquis. Das Tier. Wirkungen eines Halstuchs
»Grüß Gott!«, rief er. »Brauchen Sie nicht irgendwas?«
Ihm wurde bewusst – und sofort war er wegen seiner Tollpatschigkeit verlegen –, dass das Schweigen dieser Leute nicht auf Verblüffung oder Missbehagen zurückzuführen war, sondern höchstwahrscheinlich darauf, dass er sich in reinem Lombardisch geäußert hatte, einer Sprache, die dort unbekannt sein musste; aber dies zusammen mit dem, gelinde gesagt, seltsamen und traurigen Anblick dieser Menschen und ihrer sonderbaren Beschäftigung, während der Ozean ruhig dalag und von allen Seiten her leuchtete – offenbar lasen oder hörten sie ein Gedicht oder einen Roman –, löste einen Augenblick lang eine vage Furcht in ihm aus. Es sei noch hinzugefügt, dass die Insel sich, wie unmerklich auch immer, zu bewegen schien, und das war zweifellos die Folge der langen Seefahrt wie auch – das ist nicht ausgeschlossen – der Tatsache, dass der Graf rudernd einen Punkt erreicht hatte, von dem aus die Luisa nicht mehr zu sehen war, sodass das Meer sich hinter ihm wie eine ewige Mauer schloss.
Unterdessen aber – so sehr aus dem Nichts gegriffen sind manche Empfindungen, und so unbegründet erscheinen am Ende Erschrecken und Schlussfolgerungen – hatte der jüngste der Männer, eben derjenige, um den die anderen im Kreis saßen, die Verlegenheit des Besuchers begriffen, verließ leichtfüßig sein natürliches Podium, während die Alte wieder ins Haus ging, und eilte ihm lächelnd entgegen.
Er mochte höchstens achtzehn Jahre alt sein, und alles an ihm zeugte von echter, aber bereits ramponierter Schönheit. Groß und feingliedrig wie ein Kranich, hatte er das lange schmale Gesicht der Iberer, jedoch helle Augen und farbloses Haar wie ein Brite und trug wie die anderen armselige bunte Kleider in der Machart einer weit zurückliegenden Zeit; doch während die der anderen zu Dunkelgrün und Blau tendierten mit einer Gesamtwirkung von Violett, waren die seinen sehr hell: eine gelbe Samtweste, hellblaue, ebenfalls samtene Hosen, rote Strümpfe und schließlich ein reich besticktes, aber abgetragenes grünes Leinenhemd. Und an den Füßen schäbige Latschen. Gesicht und Hände, die aus den mottenzerfressenen, mit den Jahren und durch offenbar ständiges Tragen vielfältig zerknitterten und schadhaft gewordenen prächtigen Stoffen hervorschauten, waren ebenso fein und abgenutzt wie diese, zugleich arglos, schüchtern, verstört und bei aller welken Blässe doch auch fröhlich. Während er näherkam, hellte sich sein Gesicht immer mehr auf wie ein armseliges, von Nebelschwaden bedecktes Ufer in der Sonne, und der Graf sah, dass die durchsichtige Haut seines Gesichts von lauter feinen Fältchen durchzogen war, ähnlich der Äderung mancher Blütenblätter, was einen für sein Alter ziemlich merkwürdigen Effekt von Hinfälligkeit und Resignation erzeugte. Wenige Schritte vor Daddo blieb er stehen, neigte leicht den Kopf und in einem sehr sanft, nahezu feminin gesprochenen altertümlichen Portugiesisch stellte er sich vor als Don Ilario Jimenez aus dem Geschlecht der Marquis von Segovia, Graf von Guzman und, zusammen mit seinen Brüdern, einziger Bewohner der Insel.
Die Überstürzung, mit der er der üblichen Pflicht des Fremden, sich als Erster vorzustellen, zuvorgekommen war – sei es aus jugendlicher Natürlichkeit, sei es, weil Aleardo in seiner Überraschung kein Wort herausbrachte –, rührte den Grafen, der sich nun mit einer Verbeugung seinerseits vorstellte und auf Portugiesisch – eine Sprache, die er sehr gut kannte, da er mehrfach in Brasilien gewesen war – für so viel Liebenswürdigkeit dankte; und er erzählte, dass er seit etlichen Tagen unterwegs sei mit dem Ziel, auf einen unbekannten Ort zu treffen, worauf er jedoch in Anbetracht der heutigen Entwicklung der Nautik schon nicht mehr gehofft habe. Nun aber sei ihm das Glück zu Hilfe gekommen.
»Es ist sehr liebenswürdig, o senhor, dass Ihr Euch uns betreffend so ausdrückt«, antwortete, nachdem er ihn angehört hatte, mit seinem reinen Lächeln Don Ilario; und etwas melancholisch setzte er hinzu: »Unser teures Stückchen Erde ist nicht einmal auf einer Karte verzeichnet, so klein ist es, und es kann auch keinerlei Fahne schwenken. Doch fühlen wir uns immer noch als Portugiesen. Portugiesisch jedenfalls war unsere Familie, als sie im siebzehnten Jahrhundert hierher übersiedelte. Aber wollt Ihr mir nicht folgen?«
Mit diesen Worten führte er ihn zum Haus hin, einem grauen, düsteren, eingeschossigen Bau, den auf einer Seite ein Türmchen zierte; und fast – da seit kurzem das Sonnenlicht offenbar noch schwächer geworden war, wie im Frühling, wenn es regnen will – erschien es dem Grafen mehr als Andeutung eines Hauses, wie man sie aus dem modernen Theater kennt, denn als wirkliche Behausung, und das verunsicherte ihn. Als sich dann die Brüder zu seiner Begrüßung erhoben, fiel dem Grafen auf, wie groß und lang sie waren und wie sehr sie sich von dem jüngsten unterschieden, als wären sie von einer anderen Mutter geboren, und ihre starren, melancholischen Gesichter schienen ihm anzudeuten, warum das Leben sich für den guten Marquis nicht in allzu leuchtenden Farben darstellte.
Nachdem sich die beiden Männer – die ihrer ganzen Erscheinung nach eher den Eindruck von Hirten oder Knechten als von Adligen machten – als Hipolito und Felipe Avaredo-Guzman, Söhne einer ersten asturischen Frau des verstorbenen Marquis, vorgestellt hatten, verfielen sie wieder in die gleiche apathische Haltung, mit der sie beim Vorlesen des Buches zugehört hatten; und das ließ sich für Aleardo rasch erklären nicht nur als Folge ihrer derben, schweigsamen Wesensart und einer entsprechend langsamen, trägen Vorstellungskraft, sondern auch als Verzweiflung über die ökonomische Lage, in der sie sich offenbar befanden und die bei ihnen nicht wie bei dem naiven Ilario in der Ausübung irgendwelcher literarischen Fähigkeiten Linderung fand.
Sie schienen sich der Verlorenheit und des Niedergangs, denen sie ausgesetzt waren, dermaßen bewusst und der Aussichtslosigkeit ihrer Lage so sehr gewärtig zu sein, dass die Aufmerksamkeit, die sie dem Bruder bei seinem Vorlesen widmeten, sicherlich so zu deuten war wie die Unfähigkeit eines Sterbenden, eine Fliege zu verscheuchen, und nicht wirklich als Aufmerksamkeit. Und sobald er das verstanden hatte, dachte Daddo angestrengt darüber nach, wie er seine Reichtümer über die Insel ergießen könnte, damit jene wie Pflanzen wieder erblühten, und wie es möglich wäre, dem sensiblen Ilario zu einem würdigeren Publikum und, wenn er es verdiente, zu Ruhm und Ehren zu verhelfen. Und er dankte dem Himmel, dass er ihn zum Grafen von Mailand gemacht, und seiner Mutter, dass sie ihn mit ihrem unerschöpflichen Ehrgeiz zu diesem armseligen Stück Land hingetrieben hatte.
Unterdessen schien sich Don Ilario, sei es wegen der Jugend, die er mit dem edlen Lombarden gemein hatte, sei es wegen der Gutherzigkeit und Sanftheit, die in ihnen beiden steckte, immer mehr über den Besuch des Fremden zu freuen und beinah schon nach einer Möglichkeit zu suchen, wie er sich verlängern ließe. Dazu fand er Gelegenheit, als er den Fremden bei der Besichtigung der Insel begleitete.
Gleich hinter dem Haus zog sich ein kleiner Hügel hin, der als Weide gedacht oder, besser, im Naturzustand belassen und von jenen Eichen umstanden war, die vom Meer aus wie Wale ausgesehen hatten und die einsamen Bewohner gegen den Ansturm des Seewinds schützten. Dort waren ein paar Schafe zu sehen, einige ins Gras gekauert, andere weidend mit gesenktem Kopf und, wie alle Schafe, vielleicht an gar nichts denkend. Weiter nach rechts, in einer Senke, in der Wind und Sonne den Silberglanz und die Musikalität einiger Olivenbäume hervorlockten, die sich flimmernd gegen den blendenden Streifen des hier wieder sichtbaren Meeres abhoben, gab es einen Brunnen, und neben diesem mühte sich die »Alte« ab, die kurz zuvor, als sie gesehen hatte, dass Besuch kam, ins Haus zurückgegangen war und dann auf der anderen Seite wieder herausgekommen sein musste.
Groß war in diesem Augenblick Daddos Überraschung, als er gewahr wurde, dass diejenige, die er für eine Alte gehalten hatte, nichts anderes war als ein ganz und gar grünes Tier, so groß wie ein Kind, dem Äußeren nach offenbar eine riesige Eidechse, aber als Frau gekleidet mit einem dunklen Röckchen, einem sichtlich alten, zerschlissenen weißen Mieder und einem Schürzchen in verschiedenen Farben, das anscheinend aus allen möglichen Lumpen der Familie zusammengesetzt war. Um den Kopf gebunden, sodass es das harmlose weißgrüne Maul verbarg, trug die Magd ein ebenfalls dunkles Stückchen Stoff. Sie war barfuß. Und obwohl diese Kleidung, die sich einer puritanischen Gesinnung ihrer Herrschaft verdankte, sie nicht wenig behinderte, war sie offenbar imstande, alle Arbeiten mit einer gewissen Behändigkeit zu erledigen.
In diesem Augenblick aber schien sie es tatsächlich nicht zu schaffen. An dem einen ihrer grünen Händchen hatte sie einen Verband, und mit dem anderen mühte sie sich unter heftigem Stöhnen vergeblich, einen großen Eimer aus dem Brunnen hochzuziehen.
In seinem Sinn für Ritterlichkeit, der den Daddo so liebenswert machte, und ohne sich lange zu fragen, wie die Religion, zu der er sich bekannte, es erfordert hätte, ob jene Kreatur christlich oder (wie es eher den Anschein hatte) heidnisch sei, stürzte er sofort zu dem Tier hin, das zwei flehende, schwärmerische Äuglein zu ihm aufhob und, als der Graf ihm den Eimer abnahm, murmelte: »Danke, o senhor! Danke!«
»Keine Ursache, Mütterchen!«
»Ja, der Haken ist abgebrochen«, bemerkte Don Ilario, den es gar nicht zu kümmern schien, welchen Eindruck eine solche Magd wohl auf den Fremden machen könnte. Und dieser Tonfall, absolut frei von Verlegenheit oder Besorgnis, genügte, um Daddo davon zu überzeugen, dass an der kleinen »Alten« nichts Verwunderliches sei; oder falls zufällig doch, dann gehörte es eben zur Normalität der Welt, die ja selbst (da es sie erst nicht gab, dann aber gab, und man nicht erkennt, wer oder was sie hervorgebracht hat) rätselhaft genug war. Sehr zustatten kam ihm dabei sein überschwängliches Gemüt, das in der gesamten Natur überall eine ebenbürtige Seele entdeckte und einen Appell an die eigene Brüderlichkeit vernahm. Zudem hatte die Kreatur tatsächlich etwas Demütiges, Sorgenvolles an sich.
Während er es vermied, sie neugierig zu betrachten, damit sie nicht in Verlegenheit geriete, zog Daddo geschwind den anderen Eimer hoch, und während der Marquis sich in Dankesbekundungen erging, sagte er, der abgebrochene Haken sei eine Kleinigkeit und er könne das wieder in Ordnung bringen: Er müsse nur an Bord zurück, um das Nötige zu holen.
Wenige Minuten später war er wieder auf der Luisa. Und sich wohlweislich hütend, dem Salvato mit seiner blühenden Fantasie zu erzählen, was er gesehen hatte, lud er zusammen mit dem Werkzeug so viel wie nur möglich ins Boot: eine Kiste Malaga, italienische Romane, die er Don Ilario schenken wollte, und das golddurchwirkte Seidentuch, ein wahrlich verrücktes Geschenk für die arme Alte. In seiner Unschuld sagte er sich, dass jene Kreatur schließlich ein weibliches Wesen sei und ihr ein wenig Eitelkeit in ihrem armseligen Leben doch wohl geblieben sein müsse. Er täuschte sich nicht.
Als die Echse, denn es war wirklich eine Echse, eine Iguana*, jenes reine Symbol der europäischen Kultur auf dem riesigen Küchenherd ausgebreitet sah, stieß sie einen schrillen Schrei aus, der in einem Klagelaut endete; ihre Händchen, deren eines, wie sich der Leser erinnern wird, mit einem Verband umwickelt war, legten sich zu einer Geste herzzerreißender, stummer Bewunderung zusammen; dann lief aus den kaum sichtbaren, sanften Äuglein, die ständig hinter faltigen Lidern verborgen waren, eine Träne herab, beziehungsweise sie stieg herauf insofern, als die Lider der Echsen sich ausschließlich von oben öffnen. Sie murmelte etwas Unverständliches, aus dem jedoch herauszuhören war: »Não para mim … Não para mim …«*
»Doch, es ist wirklich für Euch, Mütterchen«, erwiderte Daddo, während Don Ilario seinem neuen Freund entzückt zulächelte. »Schaut nur, seht Ihr nicht aus wie ein Mädchen? Steht es Euch nicht ausgesprochen gut?«