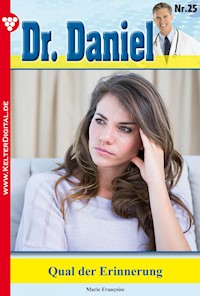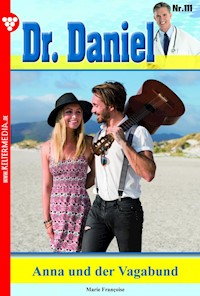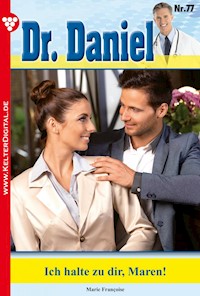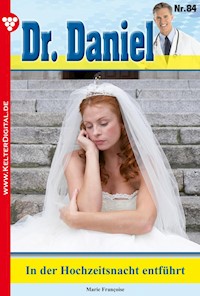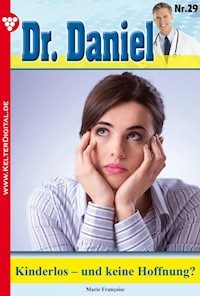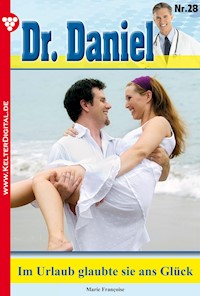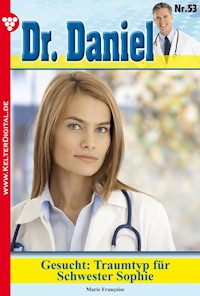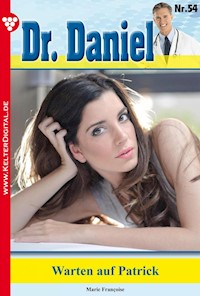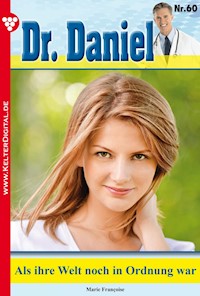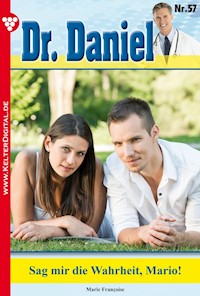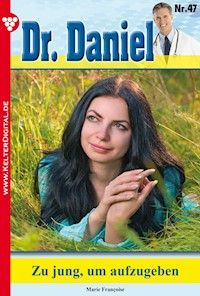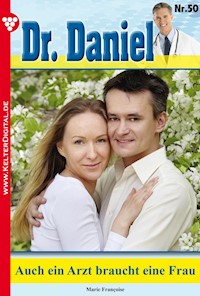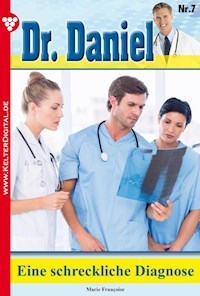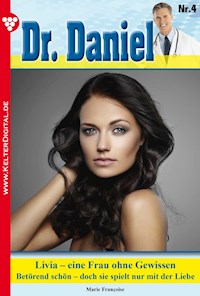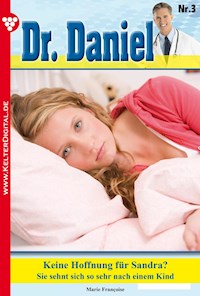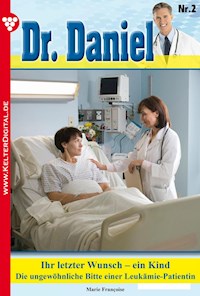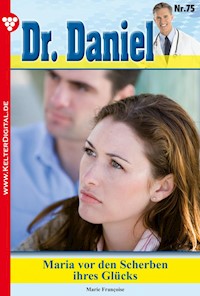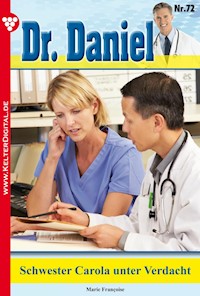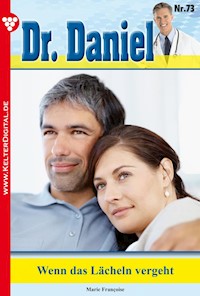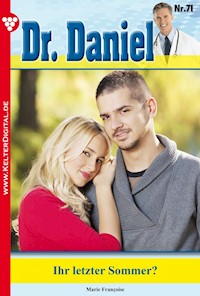
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Daniel
- Sprache: Deutsch
Dr. Daniel ist eine echte Erfolgsserie. Sie vereint medizinisch hochaktuelle Fälle und menschliche Schicksale, die uns zutiefst bewegen – und einen Arzt, den man sich in seiner Güte und Herzlichkeit zum Freund wünscht. Die Untersuchung war so schmerzhaft, daß Dominique Trussaut leise aufstöhnte. »Es ist ja gleich vorbei«, meinte der Arzt ungeduldig. »Entspannen Sie sich lieber.« »Es tut aber so weh«, flüsterte Dominique unter Tränen. »Bitte…« Dr. Konstantin Krämer seufzte entnervt, dann zog er die Hand zurück und wandte sich der Schwester zu, die neben ihm stand und Dominique mehrmals mitleidige Blicke zugeworfen hatte. »Geben Sie der empfindlichen jungen Dame ein Beruhigungsmittel, damit ich meine Untersuchung beenden kann.« Dominique blickte ihm nach, als er mit energischen Schritten den Raum verließ. »Ich bin nicht empfindlich«, erwiderte sie leise. »Es hat wirklich weh getan.« Schwester Bettina nickte. »Ich weiß schon, Fräulein Trussaut. Dr. Krämer ist leider etwas grob und wenig sensibel.« Sie errötete, weil sie sich einer Patientin gegenüber eigentlich nicht zu solchen Äußerungen hinreißen lassen durfte. Wenigstens hatte sie sich die Bemerkung verkniffen, daß sie Dr. Krämer darüber hinaus auch noch für einen denkbar schlechten Arzt hielt. »Ich werde Ihnen jetzt eine Spritze geben«, lenkte sie ab. »Dann bekommen Sie von der weiteren Untersuchung nicht mehr allzuviel mit.« Die junge Patientin tat ihr schrecklich leid – nicht nur, weil man sie ausgerechnet Dr. Krämer zugeteilt hatte. In den beiden Wochen, die seit Dominiques Einlieferung in die Klinik vergangen waren, hatte Schwester Bettina so einiges mitbekommen. Dominique war gerade mal achtzehn Jahre alt und stand völlig allein auf der Welt. Ihre Eltern waren vor fast zehn Jahren bei einem Zugunglück in Frankreich ums Leben gekommen, danach hatte die einzige Schwester von Dominiques deutschstämmiger Mutter das Sorgerecht für sie bekommen, doch die Jahre in
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Daniel – 71 –Ihr letzter Sommer?
Marie Francoise
Die Untersuchung war so schmerzhaft, daß Dominique Trussaut leise aufstöhnte.
»Es ist ja gleich vorbei«, meinte der Arzt ungeduldig. »Entspannen Sie sich lieber.«
»Es tut aber so weh«, flüsterte Dominique unter Tränen. »Bitte…«
Dr. Konstantin Krämer seufzte entnervt, dann zog er die Hand zurück und wandte sich der Schwester zu, die neben ihm stand und Dominique mehrmals mitleidige Blicke zugeworfen hatte. »Geben Sie der empfindlichen jungen Dame ein Beruhigungsmittel, damit ich meine Untersuchung beenden kann.«
Dominique blickte ihm nach, als er mit energischen Schritten den Raum verließ.
»Ich bin nicht empfindlich«, erwiderte sie leise. »Es hat wirklich weh getan.«
Schwester Bettina nickte. »Ich weiß schon, Fräulein Trussaut. Dr. Krämer ist leider etwas grob und wenig sensibel.« Sie errötete, weil sie sich einer Patientin gegenüber eigentlich nicht zu solchen Äußerungen hinreißen lassen durfte. Wenigstens hatte sie sich die Bemerkung verkniffen, daß sie Dr. Krämer darüber hinaus auch noch für einen denkbar schlechten Arzt hielt.
»Ich werde Ihnen jetzt eine Spritze geben«, lenkte sie ab. »Dann bekommen Sie von der weiteren Untersuchung nicht mehr allzuviel mit.«
Die junge Patientin tat ihr schrecklich leid – nicht nur, weil man sie ausgerechnet Dr. Krämer zugeteilt hatte. In den beiden Wochen, die seit Dominiques Einlieferung in die Klinik vergangen waren, hatte Schwester Bettina so einiges mitbekommen. Dominique war gerade mal achtzehn Jahre alt und stand völlig allein auf der Welt. Ihre Eltern waren vor fast zehn Jahren bei einem Zugunglück in Frankreich ums Leben gekommen, danach hatte die einzige Schwester von Dominiques deutschstämmiger Mutter das Sorgerecht für sie bekommen, doch die Jahre in München mußten nicht besonders schön gewesen sein. Dominique hatte Bettina gegenüber nur einmal eine Bemerkung gemacht, daß sie im Haus ihrer Tante im Grunde eine Küchenmagd gewesen sei. Kurz nach Dominiques achtzehntem Geburtstag war ihre Tante dann an Krebs gestorben, und allem Anschein nach zeichnete sich jetzt bei dem jungen Mädchen eine ähnlich schwere Krankheit ab – sofern Dr. Krämers vorläufige Diagnose tatsächlich stimmte, was Schwester Bettina stark bezweifelte.
Vorsichtig injizierte sie das Medikament in Dominiques Vene, wartete, bis die Wirkung eintrat, und informierte dann Dr. Krämer, daß er seine Untersuchung fortsetzen könne.
Noch einmal tastete er die Geschwulst ab, die sich an Dominiques Eileiter gebildet hatte.
»Ist ein ziemliches Monstrum, das da herangewachsen ist«, urteilte er, dann schüttelte er den Kopf. »Ich muß mir das noch mal auf Ultraschall anschauen.«
Schwester Bettina schob das Ultraschallgerät heran und sah zu, wie Dr. Krämer den Schallkopf über Dominiques Bauch gleiten ließ. Sie war der Meinung, daß hier eine transvaginale Sonographie nötig gewesen wäre, wußte ab, daß Dr. Kämer davon nicht viel hielt.
»Unregelmäßige Ränder«, murmelte er, dann schüttelte er wieder den Kopf und seufzte. »Sieht nicht gut aus für die Kleine.«
»Um das festzustellen, müßte man doch eine Gewebeprobe entnehmen«, entfuhr es Bettina.
Dr. Krämer warf ihr einen scharfen Blick zu. »Wollen Sie mir vielleicht erklären, was ich zu tun habe?«
Bettina errötete ein wenig. »Nein, Herr Doktor, natürlich nicht.«
»Gut«, meinte Dr. Krämer, dann fügte er bissig hinzu: »Bevor Sie mir hier weiter Ihre wertvollen Ratschläge erteilen, gehen Sie lieber, und holen Sie den Oberarzt her.«
Bettina murmelte eine Zustimmung und verließ den Raum. Wenigstens schien Dr. Krämer vernünftig genug zu sein, den Oberarzt zu Rate zu ziehen. Dieser mochte zwar etwas arrogant sein, aber er war zweifellos ein erstklassiger Arzt.
Oberarzt Dr. Bertram war nicht gerade erfreut, als Bettina ihn aus einer wichtigen Besprechung mit Stationsarzt und Oberschwester holte.
»Hätte diese Sache bei Krämer denn keine Zeit gehabt?« knurrte er unwillig.
Bettina schwieg, weil sie den Oberarzt lange genug kannte, um zu wissen, daß er auf derartige Fragen keine Antwort erwartete. Wenn Dr. Bertram wütend war, hatte man als Krankenschwester in ehrfurchtsvolles Schweigen zu versinken, und im Augenblick war er ziemlich wütend. Das zeigte sich, als er wie ein Orkan ins Untersuchungszimmer stürmte.
»Halten Sie mich bloß nicht lange auf, Krämer!« polterte er. »Also, was gibt’s?«
Das war das letzte, was Bettina hörte, bevor Dr. Bertram ihr die Tür vor der Nase zuknallte.
Warum bleibe ich eigentlich hier in dieser Klinik? fragte sie sich wieder einmal, dabei kannte sie die Antwort doch zur Genüge: Sie war ja froh, daß sie in München überhaupt eine Stellung gefunden hatte, und die würde sie keinesfalls so leicht aufs Spiel setzen.
In der Zwischenzeit hatte sich Dr. Krämer im Untersuchungszimmer erhoben und den Bildschirm ausgeschaltet. Nun wandte er sich dem Oberarzt zu.
»Meine Untersuchungen sind abgeschlossen«, erklärte er. »Die junge Dame leidet an einem Ovarialkarzinom und …«
»Wozu brauchen Sie da mich?« schnauzte Dr. Bertram ihn an. »Setzen Sie die Patientin auf die OP-Liste.«
»Ich glaube nicht, daß das nötig ist«, entgegnete Dr. Krämer. »Der Tumor ist inoperabel.«
Dr. Bertram starrte ihn an wie ein Wesen von einem anderen Stern. »Ein inoperables Ovarialkarzinom? Sie sind verrückt, Krämer.« Er warf Dominique einen kurzen Blick zu. »Im übrigen ist sie noch reichlich jung für einen Eierstockkrebs.«
»Wollen Sie meine Diagnose anzweifeln?« fragte Dr. Krämer äußerst pikiert.
»Ja«, antwortete der Oberarzt knapp. »Es wäre nicht Ihr erster Irrtum.«
Dr. Krämer schluckte schwer.
Das war ein Fehler, Dr. Bertram, dachte er insgeheim wütend.
»Na schön, dann untersuchen Sie die Dame doch selbst«, erwiderte er patzig.
Dr. Bertram zog die Stirn in bedrohliche Falten. »Passen Sie bloß auf, was Sie sagen, Krämer, und vor allem, wie Sie es sagen.« Mit zwei Schritten war er an der Zwischentür zum Schwesternzimmer und überflog den Dienstplan, der dort aufgehängt war, dann sah er Dr. Krämer wieder an. »Setzen Sie die Patientin am Freitag auf meine Untersuchungsliste, dann werden wir ja sehen, was an Ihrer Diagnose dran ist.«
Dr. Krämer kochte vor Wut, wußte aber, daß der Oberarzt eindeutig am längeren Hebel saß. Er hatte auch keine Gelegenheit mehr, irgend etwas zu erwidern, denn Dr. Bertram stürmte hinaus, wie er gekommen war – orkanartig.
»Herr Doktor… was …, was ist mit mir?«
Dominiques leise Stimme erinnerte Dr. Krämer daran, daß er nicht allein im Zimmer war. Die Wirkung des Beruhigungsmittels ließ offenbar nach – gerade zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Dr. Krämer war über die Zurechtweisung des Oberarztes so wütend, daß er nur an Rache denken konnte, und dabei war es ihm im Moment völlig egal, gegen wen sich diese Rache richtete.
Ohne viele Worte half er Dominique vom Untersuchungsstuhl herunter.
»Ziehen Sie sich an«, befahl er unwirsch.
Das junge Mädchen hatte sichtlich Mühe, unter den Nachwirkungen des Beruhigungsmittels in ihre Pyjamahose zu schlüpfen.
»Setzen Sie sich.« Dr. Krämer wies auf den Stuhl, der dem Schreibtisch gegenüberstand. »Sie können heute noch nach Hause gehen.«
Überrascht sah Dominique ihn an. »Ich kann… heißt das, ich bin gesund?«
»Nein«, antwortete Dr. Krämer völlig ungerührt. »Aber wir können nichts für Sie tun.«
Dominique hatte Mühe, diese Worte richtig zu verstehen. Sie war noch immer benommen von dem Beruhigungsmittel
»Ich … ich verstehe nicht …«
»Was ist daran denn so schwer zu verstehen?« entgegnete Dr. Krämer rüde. »An Ihrem Eierstock hat sich ein Tumor gebildet, der so groß ist wie eine Orange. Unglücklicherweise liegt er so, daß wir nicht operieren können.« Er schwieg kurz. »Dieser Meinung ist übrigens auch der Oberarzt.«
Dominique schluckte schwer. Noch immer war sie nicht sicher, das Dr. Krämers Worte wirklich zu bedeuten hatten.
»Aber… wenn ich jetzt nach Hause gehe… ich meine… ein Tumor, da… da kann ich doch sterben.«
Dr. Krämer nickte. Sein Blick war kalt und ohne jegliches Mitgefühl. In ihm war nichts anderes als Haß auf den Oberarzt – und Dominique mußte das an seiner Stelle ausbaden.
»Sie werden auch sterben«, bestätigte er grob, dann zuckte er die Schultern. »Genießen Sie die Zeit, die Ihnen noch bleibt.« Er schob ihr die Entlassungspapiere entgegen. »Hier, unterschreiben Sie, dann können Sie nach Hause gehen.«
Der Text verschwamm vor Dominiques Augen.
»Sie können mich doch nicht einfach so sterben lassen!« rief sie verzweifelt »Ich meine… wenn Sie nicht operieren können… es muß doch Medikamente gegen, die…«
»Ein Ovarialkarzinom in diesem Stadium ist nicht mehr heilbar«, fiel Dr. Krämer ihr in eisigem Ton ins Wort. »Mit Medikamenten würden wir Ihr Leiden nur unnötig verlängern. Gehen Sie nach Hause, und genießen Sie Ihren letzten Sommer.«
Mit zitternden Fingern nahm Dominique den Stift entgegen, den Dr. Krämer ihr fordernd entgegenhielt, dann setzte sie blind vor Tränen ihre Unterschrift auf alles, was der Arzt ihr vorlegte. Sie hatte keine Ahnung, daß sie soeben Papiere unterschrieben hatte, die bezeugten, daß sie auf eigenen Wunsch die Klinik verließ…
*
Noch immer völlig benommen von dem Beruhigungsmittel, das Schwester Bettina ihr gespritzt hatte, und haltlos schluchzend taumelte Dominique den Gehsteig entlang. Sie hatte keine Ahnung, wohin sie eigentlich lief – sie wollte nur weg… weg von den harten, grausamen Worten des Arztes… weg von dieser entsetzlichen Wahrheit…
»Was ist los, junge Frau? Brauchen Sie Hilfe?«
Dominique blieb stehen und sah in die Richtung, aus der die Stimme getönt war. Durch den Tränenschleier vor ihren Augen erkannte sie nur die Umrisse eines Menschen und merkte lediglich an der Stimme, daß es sich um einen Mann handelte.
»Ich will heim«, schluchzte sie. Der kleine Koffer in ihrer Hand war mit jedem Schritt schwerer geworden. Jetzt setzte sie ihn auf dem Boden ab, dann sackte sie in die Knie. Sie spürte die kräftige, stützende Hand an ihrem Arm.
»Kommen Sie.« Die Stimme des Mannes war sehr sanft. »Ich bringe Sie nach Hause. Wo wohnen Sie denn?«
Dominique schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Ahnung, wo sie überhaupt wohnte. Die Adresse wollte ihr einfach nicht mehr einfallen.
Der Mann bettete sie fürsorglich auf die Rückbank seines Wagens, dann nahm er ihre Handtasche, suchte kurz und fand schließlich ihren Ausweis. Er setzte sich ans Steuer, schaltete den Taxameter aus und fuhr los. Für dieses arme, verzweifelte Mädchen würde er eine Gratisfahrt machen.
»So, junge Frau, hier sind wir«, meldete er bald darauf, stieg aus und half Dominique aus dem Taxi, dann griff er sich ihren Koffer und begleitete sie ins Haus. Über zwei Treppen gelangten sie zu der winzigen Wohnung, die Dominique nach dem Tod ihrer Tante übernommen hatte. Ursprünglich hatte sie gar nicht hierbleiben wollen, weil die zehn Jahre, die sie hier verbracht hatte, zu den schrecklichsten ihres Lebens gehört hatten, doch wohin hätte sie sich sonst wenden sollen? Als Aushilfsverkäuferin verdiente sie nicht gerade fürstlich, aber ihre Tante hatte ja nicht zugelassen, daß sie einen richtigen Beruf erlernte. Diese Wohnung hier – sofern man das muffige Zwei-Zimmer-Appartement überhaupt als solche bezeichnen wollte – war wenigstens billig.
»Danke«, murmelte Dominique, als der Taxifahrer ihr die Wohnungstür aufgesperrt hatte.
»Brauchen Sie noch irgend etwas?« erkundigte sich der Mann fürsorglich. »Ich meine…, soll ich vielleicht einen Arzt rufen oder…«
Dominique schüttelte den Kopf. »Nicht nötig. Ich… ich komme ja gerade aus dem Krankenhaus…« Sie schluchzte wieder. »Danke, daß Sie mich heimgebracht haben.« Mit bebenden Händen suchte sie in ihrer Tasche nach der Geldbörse, doch der Mann hielt ihre Handgelenke fest.
»Nicht, Fräulein«, bat er. »Ich will von Ihnen kein Geld. Legen Sie sich hin, und ruhen Sie sich aus.« Er griff in seine Jackentasche und holte eine Karte hervor, die er in Dominiques Hand schob. »Wenn Sie etwas brauchen… egal was, dann rufen Sie mich an, ja?«
Dominique nickte schwach.
»Danke«, flüsterte sie noch einmal, schloß die Tür, schwankte in das kleine Wohnzimmer und ließ sich auf das Sofa fallen, dann vergrub sie das Gesicht in den Händen und schluchzte verzweifelt.
Ihren letzten Sommer… genießen… wie sollte das gehen? Wie sollte sie diesen letzten Sommer genießen, wenn sie zugleich den Tod vor Augen hatte?
*
Den restlichen Tag über und die darauffolgende Nacht war Dominique nicht fähig, sich auch nur zu bewegen. Erst am folgenden Morgen raffte sie sich auf, schenkte sich ein Glas Wasser ein und aß ein trockenes Stück Knäckebrot dazu. Mehr brachte sie allerdings nicht herunter.
Nach diesem spärlichen Frühstück packte sie den kleinen Koffer aus, den der Taxifahrer am vergangene Nachmittag neben der Wohnungstür abgestellt hatte. Dominique arbeitete ganz mechanisch, ohne zu denken, denn ihre Gedanken konnten immer nur um eines kreisen: ihre schreckliche Krankheit, die noch in diesem Jahr unweigerlich zu ihrem Tod führen würde.
Unwillkürlich mußte sie an das Leid ihrer Tante denken. Sie hatte ebenfalls Krebs gehabt und war von unerträglichen Schmerzen geplagt dahingesiecht, bis der Tod sie schließlich von diesem elenden Dasein erlöst hatte. Ein halbes Jahr war das nun her, und Dominique schämte sich noch immer, daß sie um die Tante nicht hatte trauern können. Nicht nur das – ihr Tod war für Dominique sogar eine Erleichterung gewesen. Tante Walburga war tot, nie wieder würde sie ihre Nichte schlagen und demütigen können, nie wieder…
»Es ist die Strafe dafür«, flüsterte Dominique. »Die Strafe für mich, weil ich über Tante Walburgas Tod froh gewesen bin. Nun muß ich auch sterben…«
Wieder begann sie zu schluchzen, während sie Handtücher und Unterwäsche aus ihrem Koffer holte und in die Wäschetruhe warf. Auch die Zeitschrift, die Schwester Bettina ihr am letzten Tag, kurz vor dieser schrecklichen Untersuchung, gegeben hatte, landete in der Wäschetruhe, bis Dominique ihren Fehler bemerkte.
Sie holte die Zeitschrift wieder hervor. Ein blonder Mann mit strahlend blauen Augen lächelte ihr entgegen, doch Dominique nahm ihn gar nicht richtig wahr. Desintessiert blätterte sie die Zeitschrift durch, während die Worte des Arztes noch immer in ihrem Kopf hämmerten. »Ein Ovarialkarzinom in diesem Stadium ist nicht mehr heilbar… genießen Sie Ihren letzten Sommer…«
Mitten im Blättern hielt Dominique inne und starrte das Bild an, das sie vor sich hatte. Tiefblaues Meer, das sich in schäumenden Wellen an dem menschenleeren Strand brach. Eine weiße Villa inmitten exotischer Blumen und Bäume auf einem sanften Hügel. Einzig der schnittige Sportwagen paßte nicht in diese landschaftliche Idylle hinein. Dafür umso mehr der junge Mann, der in buntem Hawaii-Hemd und weißen Shorts im Sand saß und Dominique lässig anlächelte – so, wie er in die Kamera hineingelächelt hatte.