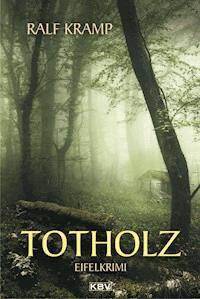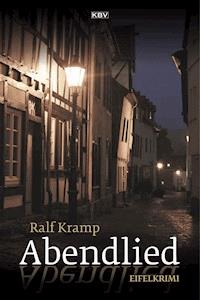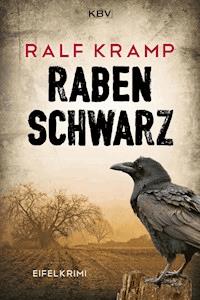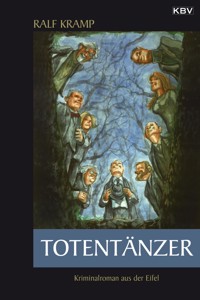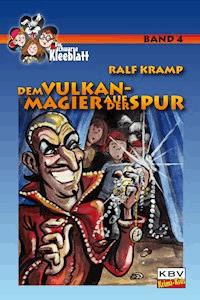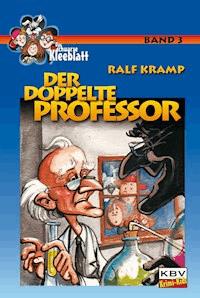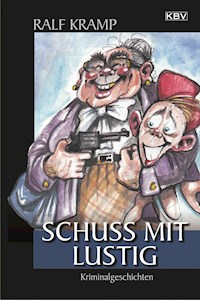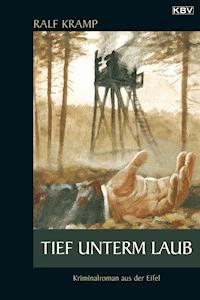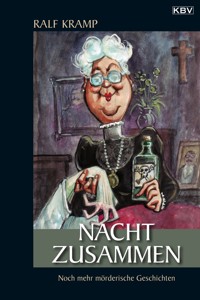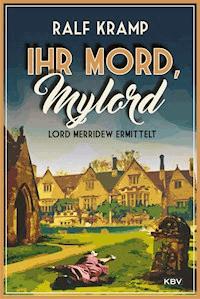
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: KBVHörbuch-Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Was haben wir denn da Feines?« »Eine Tote auf dem Friedhof, Sir.« »Ach, gehört die nicht genau da hin?« »Das schon, aber sechs Fuß tiefer, Sir.« »Ein Unfall?«, fragte Merridew unschuldig. »Wohl kaum, Sir. Es sei denn, die Dame ist versehentlich in die Flugbahn einer Großwildpatrone gestolpert.« Dieser übergewichtige Snob kann bisweilen eine richtige Nervensäge sein. Trotzdem ist Reginald Lord Merridew unbestritten einer der klügsten Köpfe Englands. Er löst seine Fälle ganz ohne die Hilfe von Computer oder Handy, denn wir befinden uns mitten in den Nifty Fifties, den Swinging Sixties und den Super Seventies. Egal, ob jemand nach Shakespeare-Manier meuchelt, ob die Lösung zum Rätsel im Pie-Rezept verborgen ist, oder ob eine gestohlene Oscar-Statuette als Mordwaffe dient – Lord Merridew ist seinem Freund und Begleiter Nigel Bates stets um mehrere Nasenlängen voraus. Diese amüsanten Kriminalerzählungen stecken voller raffinierter Anspielungen auf Literatur, Film und Fernsehen und sind durch-drun-gen von der tiefen Liebe des Autors zum British way of life.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Ralf Kramp Ihr Mord, Mylord
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Tief unterm Laub
Spinner
Rabenschwarz
Der neunte Tod
Still und starr
... denn sterben muss David!
Kurz vor Schluss (Kriminalgeschichten)
Malerische Morde
Hart an der Grenze
Ein Viertelpfund Mord (Kriminalgeschichten)
Ein kaltes Haus
Totentänzer
Nacht zusammen (Kriminalgeschichten)
Stimmen im Wald
Voll ins Schwarze (Kriminalgeschichten)
Starker Abgang (Kriminalgeschichten)
Mord und Totlach (Kriminalgeschichten)
Totholz
Schuss mit lustig (Kriminalgeschichten)
Ralf Kramp, geboren 1963 in Euskirchen, lebt und arbeitet als Krimiautor, Karikaturist und Veranstalter von Krimi-Erlebniswochenenden in der Eifel. Für sein Debüt »Tief unterm Laub« erhielt er 1996 den Eifel-Literatur-Förderpreis. Seither erschienen zahlreiche weitere Bücher bei KBV, unter anderem sechs schwarzhumorige Kurzkrimisammlungen und die bisher sechsteilige Romanreihe um den kauzigen Helden Herbie Feldmann. Im Jahr 2002 erhielt er den Kulturpreis des Kreises Euskirchen. Seit 2007 führt er mit seiner Frau Monika in Hillesheim das »Kriminalhaus« mit dem »Deutschen Krimi-Archiv« mit 30.000 Bänden, dem Krimi-Café »Café Sherlock« und der »Buchhandlung Lesezeichen«.www.ralfkramp.de, www.kriminalhaus.de
RALF KRAMP
LORD MERRIDEW ERMITTELT
Originalausgabe
© 2016 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
Print-ISBN 978-3-95441-319-5
E-Book-ISBN 978-3-95441-336-2
This book is dedicatedto Anthony Shaffer,who is somehow to blame for all of this.
Für Christian, Robert und Willi,die das alles schon so lange mitmachen.
Und für Kai-Magnus, der mich versteht.
REGINALD HANNIBAL BEARDSLEYLORD MERRIDEW
11. EARL OF GROTHBURY (* 24. AUGUST 1901 IN ALNWICK, NORTHUMBERLAND) IST EIN BRITISCHER PRIVATDOZENT UND SAMMLER ANTIKER GEHSTöCKE UND APHORISMEN.
Er ist der Sohn von St. John Lord Merridew, 10. Earl of Grothbury und Laetitia Boyle De Tolsley. Er folgte seinem Vater am 5. Oktober 1941 als Earl of Grothbury. Von 1921 bis 1923 diente er bei den Coldstream Guards. Danach studierte er am Pembroke College in Oxford, u.a. bei J.R.R. Tolkien. Während des Zweiten Weltkriegs diente er im Range eines Majors bei einer Spionage-Einheit. Später betätigte er sich als Privatermittler und Shakespeare-Rezitator.
Sportliche Erfolge errang er in seiner Jugend als Polospieler und Bogenschütze. Bei den Olympischen Spielen in Paris im Jahr 1924 errang er mit seiner Polomannschaft Bronze für Großbritannien. Er gewann 1927 und 1928 den »Sir Aston Lever-Cup« in der Disziplin Langbogen.
Ab 1969 war er Ehrenmitglied der Royal Toxophilite Society.
In den Siebziger Jahren betätigte er sich als TV-Werbefigur für die schottische Whisky-Destillerie Granbruich.
(Almanach de Gotha, 1981)
INHALT
Das Geheimnis des fünfköpfigen Hundes
Das Rätsel des verschwundenen Pies
Das Geheimnis der zwölften Nacht
Das Rätsel der Donaufürstin
Das Geheimnis der fliegenden Juwelen
Das Geheimnis des verschwundenen Oscars
Das Rätsel des grünen Kreises
Das Geheimnis der keuchenden Walküre
DAS GEHEIMNIS DESFÜNFKÖPFIGEN HUNDES
Eine Reise an die Küste hatte mir bislang immer eine Menge Vergnügen und ein gewisses Maß an Entspannung in einem unserer Seebäder versprochen. Ich war nie ein Sonnenanbeter, und am Mittelmeer oder am Karibikstrand hätte mir die Angst vor einem Sonnenbrand von vorneherein jeden Spaß madig gemacht. Ich bin Engländer. Mir reichen 100 Sonnentage im Jahr. Ein wenig schlendern auf dem Pier, ein bisschen auf der Kiesbank in der Sonne dösen, salzige Seeluft und fangfrischer Fisch, das lockte mich üblicherweise an die Südküste, aber meine Reise nach Shoreham-by-the-Sea im beginnenden Herbst des Jahres 1951 war von anderen Vorzeichen getrübt. Das Wetter war scheußlich, die Seeluft roch modrig, mir war eher nach einem gemütlichen Kaminfeuer als nach ein paar kräftigen Schwimmzügen im grauen Wasser des Ärmelkanals.
Was mich nach Sussex führte, war ein unerquicklicher kleiner Urheberrechtsstreit. Ein Bühnenkomödiant hatte sich gegen einen lächerlich geringen Betrag die Rechte an einem Theaterstück angeeignet, und der Verfasser dieser Klamotte versuchte jetzt, den Vertrag wieder rückgängig zu machen. Ich war noch sehr jung und neu im Geschäft und versuchte stets, allen Mandaten, mit denen mich unsere Anwaltskanzlei bedachte, etwas Positives abzugewinnen. In diesem Fall wollte mir das noch nicht so recht gelingen. Eine wenig erbauliche kleine Geschichte, die noch trübsinniger wurde, je mehr ich mich dem derzeitigen Wohnort des Stückeschreibers näherte.
Lauri Wylie lebte offenbar an der Mündung des Flusses Adur. Es war Ebbe, und die meisten der Kähne, die im und um den Hafen von Shoreham aufgereiht waren, lagen trocken. Die Hafengebäude und Fabriken, die ringsherum angesiedelt waren, verstärkten das Gefühl von Trostlosigkeit. Immer wieder dröhnten die Flugzeuge, die auf dem nur einen Steinwurf entfernten Flughafen verkehrten, so niedrig über mich hinweg, dass ich das Gefühl hatte, ihre Tragflächen könnten mir einen Scheitel ziehen.
An der angegebenen Adresse befand sich zu meiner Überraschung kein Wohngebiet, sondern eine schier endlos erscheinende Reihe von Wohnwagen und kleinen Hütten in verschiedenen Stadien des Niedergangs. Ich blätterte verunsichert in meinen Akten. Es war kalt, und der Wind spielte mit den Papieren. Doch, ich war hier offenbar richtig.
Ratlos schritt ich die Reihen der Wohnwagen ab. Vor einem giftgrünen Vorkriegsmodell war jemand damit beschäftigt, Müll in einer rostigen Tonne zu verbrennen. Er war dick und unrasiert und trug trotz der Kälte nur ein fleckiges Unterhemd. Ich sprach ihn an. Er stand inmitten seines fürchterlich stinkenden Qualms und kratzte sich im Nacken, während ein junger Bursche, offenbar sein Sohn, weiteren Müll ins Feuer kippte. Ich glaubte, inmitten des Unrats sogar etwas zappeln zu sehen.
»Wylie?« Der Mann deutete mit seinem glimmenden Holzspieß nach rechts. »Sechs Buden weiter. Der blaue Bedford isses. Un nich nur die Karre is blau«, mummelte er.
Ich folgte seinem Hinweis und schritt, begleitet von ein paar ausgelassen kreischenden Möwen, die Reihe der Campingwagen ab. Schließlich fand ich das verrostete, alte Wohnmobil, um das ein altersschwacher Lattenzaun gezogen war. Das kleine Tor stand weit offen, und ich ging zwischen den vertrockneten Hortensienbüschen und Dahlien hindurch auf die schmale Eingangstür zu. Ich schrak zusammen, als ich erkannte, dass das, was dort zusammengeknüllt auf einem Klappstuhl ruhte, nicht nur ein Berg von zerschlissenen Decken war. Der kleine, kahle Kopf eines alten Mannes ragte aus dem Wust heraus. Er bewegte in einem fort die Lippen, als schnappe er nach Luft.
Als ich näher kam, hörte ich ein kehliges Stöhnen.
»Mister Wylie?«, fragte ich vorsichtig.
Ich bekam keine Antwort. Stattdessen kam jetzt ein weiterer, stöhnender Laut, der von einem alarmierenden Gurgeln abgelöst wurde. Zwei dünne, weißliche Hände gruben sich unter den Decken hervor und zuckten durch die Luft. Die eine hielt einige kleine Zettel umklammert, die im Wind flatterten, und die andere wies unmissverständlich zur Wagentür. Die schmalen Lippen des Alten leuchteten so blau wie Heidelbeerkompott. Ich vermutete sogleich einen Herzinfarkt. Da galt es keine Zeit zu verlieren!
Hastig riss ich die Tür auf und sprang ins Innere des Wagens. Wenn es Herzprobleme waren, fand sich hier sicher irgendwo eine Medizin. Drinnen empfing mich ein jämmerliches Szenario der Verwahrlosung. Ich sah halbvolle Schnapsflaschen, überquellende Aschenbecher und schmutziges Geschirr. Leere Büchsen und zerknüllte Zeitungen lagen in den Ecken aufgetürmt. Die hölzernen Wände und Schrankoberflächen waren mit vergilbten, zerknitterten Theaterplakaten dekoriert. Ich versuchte, irgendwo Medizin zu entdecken, aber alles was mir in die Hände fiel, waren zwei restlos leere Fläschchen, die einmal mit Herztropfen gefüllt gewesen waren.
Schließlich stolperte ich unverrichteter Dinge wieder hinaus. Der Alte röchelte wieder, also lebte er immerhin noch.
»Hören Sie, Mister Wylie, ich werde einen Krankenwagen rufen!«, rief ich, und wollte ihn beruhigend an der Schulter fassen, die ich da irgendwo unter dem Schottenmuster vermutete, da schnellte seine Linke plötzlich auf mich zu und packte unerwartet kraftvoll mein Handgelenk. Die zweite Hand überließ die kleinen Zettel, die ich in diesem Moment als Fotografien identifizierte, dem Wind, der sie sogleich davontrug, und griff nach meiner Krawatte. Der Alte zog mich zu sich hinunter und krächzte: »Tenterden! Sie müssen rasch nach Tenterden!«
»Hören Sie, ich bin der Anwalt aus London. Ich werde jetzt …«
In diesem Moment ertönte hinter mir eine donnernde Stimme: »Loslassen, Bürschchen!«
Ich befreite mich aus dem Griff des Alten und fuhr herum.
Der Mann, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war und breitbeinig auf dem kleinen Trampelpfad zwischen dem Gestrüpp stand, war groß, dick, und steckte in einem Dreiteiler aus Harris-Tweed. Er mochte etwa um die fünfzig Jahre alt sein und ballte seine Rechte um den Knauf eines Gehstocks. Sein pausbäckiges Gesicht war zornesrot, und sein bärtiges Kinn hatte er angriffslustig fast noch weiter nach vorne gereckt als seine deutlich zu krumm gewachsene Adlernase. So wie der Wind seine grauen Haare und die goldene Uhrkette, die sich über seinen prallen Bauch wand, hin und her tanzen ließ, sah er ein bisschen aus wie ein aufgeblähter Zeus, der im Begriff war, gleich ein paar glühende Blitze zu mir herüber zu schleudern. »Was zum Teufel machen Sie da?« Er kam näher. »Finger weg von dem Mann!«
»Ich bin Anwalt«, sagte ich verzweifelt. »Nigel Bates von der Kanzlei Harringfield, Harringfield und Partner, London.« Ich reckte ihm meine Akten entgegen. »Ein Rechtsstreit. Ich habe Mr. Wylie nichts getan. Er hat offenbar einen Herzinfarkt oder so was.«
Ruppig schob mich der Mann zur Seite, griff nach einem von Wylies Handgelenken, zog seine Taschenuhr hervor und blickte mit auf die Brust gelegtem Kinn auf das Zifferblatt.
»Hm«, machte er. »Brauchen wohl einen Krankenwagen. Kümmern Sie sich mal. Rasch, es ist keine Zeit zu verlieren. Treiben Sie irgendwo am Hafen ein Telefon auf. Ich bleibe hier.« Ohne, dass ich es wagte, Protest einzulegen, nahm er mir die Akten ab und trieb mich mit einer unwirschen Geste an loszulaufen.
»Und wer sind Sie?«, rief ich ihm im Fortgehen über die Schulter zu.
»Mein Name ist Reginald Lord Merridew. Und jetzt legen Sie endlich einen Zahn zu, wenn Sie hier mit diesem Wrack noch ein Geschäft machen wollen!«
»Tenterden? Wo soll das sein?«, fragte mich Lord Merridew, nachdem der Krankenwagen mit dem nur noch stoßweise atmenden Lauri Wiley davongefahren war.
»In Kent, glaube ich.« Ich klemmte mir meine Aktenordner unter den Arm und nickte ihm zu. »Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Sir.«
Seine Augenbrauen zuckten in die Höhe. »He, Moment, was soll das heißen?«
»Nun, ich muss wieder zurück nach London. In der Kanzlei wartet man auf meinen Bericht.«
»Aber wir haben Freitagmittag!«
Ich blickte auf meine Armbanduhr. »Gut, Sie haben recht. Das werde ich am Montag klären müssen.«
»Na fein!«, trompetete er gut gelaunt. »Dann ist es also abgemacht. Wir unternehmen gemeinsam eine kleine Spritztour nach Kent! Mit dem Automobil werden wir in etwa zwei Stündchen da sein. Sie haben doch ein Auto, oder?«
»Ja schon, aber ich …«
»Jetzt sagen Sie mir bloß nicht, dass es Sie gar nicht interessiert, warum der Alte Sie unbedingt nach Tenterden schicken wollte. Außerdem liegt es doch für Sie fast auf dem Weg.«
»Also, wenn ich ehrlich bin …«
»Hören Sie, ich bearbeite einen Kriminalfall, in dem dieser Mr. Wiley eine gewisse Rolle zu spielen scheint.«
»Kriminalfall?«
»Nun ja …« Er warf sich mit wichtiger Miene in die Brust. »Ich bin Detektiv. Genauso wie mein Vater, Gott hab ihn selig. St. John Lord Merridew, Sie werden sicher von ihm gehört haben.«
Von einem Detektiv dieses Namens hatte ich keine Kenntnis. Ich kannte im Grunde genommen nicht einen einzigen dieser kettenrauchenden Schnüffler, die tagelang in ihren Autos hockten und fremde Wohnungen belauerten. Aber ich kam gar nicht dazu, das zu verneinen. Er drängte mich ungeniert weiter den Weg an den Wohnwagen entlang.
»Tja, meinen Vater kannte ja nun wirklich jeder. Er war es immerhin, der Oleg Graysinski an den Galgen gebracht hat. Der Mord auf dem Tennisplatz? Hm?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Oder die Affäre um den Druse-Diamanten? Na sehen Sie! Hat seinerzeit alles mein Vater aufgeklärt. Ein Genie! Aber jetzt lassen Sie mich doch lieber mal zu unserem armen, todkranken Mr. Wiley kommen. Ich erhielt gestern einen telefonischen Hinweis, dass ich diesen Bühnenautor mal unter die Lupe nehmen soll. Ein ganz harmloser Bursche, wie es scheint. Aber eine gute Tarnung ist ja bekanntlich alles.«
»Ach, Unsinn. Ich habe Wylie auch unter die Lupe genommen, wie Sie das nennen. Sein Konto ist so leer wie seine Medizinfläschchen, und hat er lediglich versucht, einen Urheberrechtsvertrag rückgängig zu machen, weil er sich über den Tisch gezogen fühlt. Da gibt es kein großes Geheimnis.«
Eine übelriechende Wolke wehte über den Weg. Der Mann von vorhin blickte von seiner Feuertonne auf, kam ein paar Schritte auf uns zugeschlurft und fragte: »Krankenwagen bei Wylie, was? Hat’s den alten Zausel jetzt endgültig aus den Latschen gehauen?«
Der Junge an seiner Seite bohrte ungeniert in der Nase, und im Hintergrund begann eine verlottert aussehende Frau damit, gleich neben der qualmenden Tonne Wäsche aufzuhängen.
»Das Herz wahrscheinlich«, gab ich bereitwillig Auskunft.
Er lachte schnarrend. »Herz, jaja. Vorhin, als die Frau da war, hat er jedenfalls noch munter Schnaps gepichelt.«
»Welche Frau?«, fragte Merridew rasch.
»So ne Frau eben. War zu Besuch bei ihm. Gute Laune. Haben nen Schnaps getrunken. Un als sie wieder weg is, hat er ihr hinterhergewunken. Da hinten, beim Gartentörchen.«
»Wie sah diese Frau aus?«
Der Mann rieb sich das filzige Kinn und guckte seinen Jungen an. »Könn’ wir uns gar nicht dran erinnern, was, Junior?«
Missmutig schnaufend zog Lord Merridew die Brieftasche aus dem Jackett und reichte dem Mann daraus eine Pfundnote hinüber. Der griff mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit danach, aber der Geldschein wurde einen Moment lang in der Luft hin und her gezerrt.
»Junges Ding, braune Haare, griffiges Figürchen«, ergänzte der Mann. Seine Frau im Hintergrund räusperte sich vernehmlich.
»Weiter«, sagte Merridew und hielt das Geld unerbittlich fest.
»Hatte nen Mantel an. So ne Farbe wie …«
»Wie so Himbeerlollis«, sagte sein Sohn schnell und versuchte jetzt ebenfalls nach dem Schein zu grabschen.
»Nee, eher wie so’n schön gebrutzeltes Steak innen drin rosa is!« Der Mann schlug seinem Sohn auf die Finger.
»Alles Quatsch! Malvenfarben, so wie das Kleid von der Begum, als die letztens in London war«, blaffte die Frau, schnappte sich den Schein und stopfte ihn in den Ausschnitt ihrer fadenscheinigen Bluse.
»Die hatte nen Fotoapparat dabei«, sagte der Junge. »War vonner Zeitung oder so, garantiert.« Er streckte erwartungsvoll die flache Hand aus, aber seine Mutter versetzte ihm eine Ohrfeige und jagte ihn in den Wohnwagen.
»Mehr is nich«, sagte der Mann jetzt und begann wieder in der Tonne herumzustochern.
Lord Merridew nickte zufrieden und zog mich sanft am Arm weiter in Richtung Parkplatz.
»Fotoapparat«, brummte er und hielt mir ein paar aufgefächerte Fotografien vor die Nase. »Schauen Sie mal hier.«
»Sind das etwa die Bilder, die …«
»… Lauri Wiley in der Hand hatte. Als ich vorhin zu Ihnen stieß, war gerade der Wind dabei, sie im Vorgarten zu verstreuen. Ich bin auf allen Vieren durch diese Steppe von einem Garten gekrochen, um sie wieder aufzusammeln. Erkennen Sie, was darauf zu sehen ist?«
Während des Gehens fiel es mir nicht leicht, Einzelheiten auszumachen. »Grabsteine?«
»Ganz recht!« Er blieb abrupt stehen und tippte auf die Bilder. »Drei Fotografien, drei Grabsteine … und nur ein einziges Datum!«
Ich betrachtete die Fotos genauer. Die eingemeißelten Namen und Geburtsdaten waren völlig unterschiedlich, aber das jeweilige Sterbedatum war stets der 17.7.1936.
»Warum fotografiert jemand Grabsteine?«
Er schnaufte verächtlich. »Mit solch plumpen Fragen kommen wir hier nicht weiter, mein lieber Nigel, wenn ich Sie so nennen darf. Warum sammelt jemand Lokomotivnummern? Warum bannt jemand gräulich klingende Vogelstimmen auf Tonband? Warum kleben Menschen Apfelsinenpapier in dicke Sammelalben? Unsere Welt ist doch voll von Beklopptheiten. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es sich hier nicht um einen simplen Spleen handelt. Dass diese drei Personen exakt am selben Tag zu ihren Ahnen abgedampft sind, scheint mir ein wichtiger Aspekt des Rätsels zu sein! Ich werde Ihnen im Auto alles Wissenswerte erzählen. Wo steht der Wagen?«
Ich deutete in die Richtung des Parkplatzes. »Der dunkelrote da.«
»Was?« Er öffnete verblüfft den Mund und deutete mit der Spitze seines Stocks auf meinen Wagen. »Dieses Ding da?«
»Es ist ein fabrikneuer Nash-Healey«, sagte ich beleidigt. Ich war unglaublich stolz auf mein schnittiges, kleines Cabriolet und würde es mir nicht von diesem aufgeblasenen, feisten Aristokraten madig machen lassen.
»Wo haben Sie denn den Büchsenöffner, um da reinzukommen?«
Ich protestierte. »Hören Sie, Sir, ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen nach Tenter… Dings zu fahren. Da müssen Sie sich einen anderen Chauffeur suchen. Ich freue mich auf ein entspanntes Wochenende, auf Besuch von Freunden, aufs Kino, auf …«
Er klopfte mir auf die Schulter und lachte dröhnend. »Na, jetzt werden Sie mal nicht gleich kratzbürstig. War ja nur ein Scherz. Tolles Auto, wahrscheinlich klasse Kurvenlage. Vielleicht brauchen wir damit sogar nur anderthalb Stunden bis Tenterden!«
Warum ich letzten Endes dann doch nachgab, weiß ich heute gar nicht mehr zu sagen. Dieser Lord Merridew hatte die Gabe, jede Gegenwehr platt zu walzen wie ein Panzer.
Wenig später saßen wir also nebeneinander in meinem Auto und fuhren in Richtung Nordosten. Merridew füllte den Beifahrerraum passgenau aus. Er hatte keinerlei Möglichkeiten, sich zu bewegen, hatte sich aber offenbar entschlossen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
«Nun mal aufgemerkt«, begann er fröhlich, »Wie gut kennen Sie sich in der Geschichte unseres Landes aus?« Und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er gleich fort: »Das Attentat von 1936? Hm?«
Ich wackelte unsicher mit dem Kopf hin und her, und er füllte sogleich ungefragt meine Wissenslücke: »Im Juli jenes Jahres hat ein kleiner irischer Faschist namens Jerome Brannigan den täppischen Versuch unternommen, Edward VIII. zu töten. Er lauerte dem König nach der Parade im Hyde Park auf und hatte offenbar die Absicht, ihn zu erschießen. Ein anderer Passant aber durchschaute sein Vorhaben und verpasste ihm kurzerhand eine ordentliche Backpfeife. Danach war Brannigan wohl dermaßen durch den Wind, dass es ihm nur noch gelang, seinen Revolver nach dem König zu werfen. Albern, sowas. Er bekam ein Jahr Zwangsarbeit aufgebrummt und war danach wieder auf freiem Fuß. Seitdem ist der Störenfried nur noch dann und wann durch unbedeutende Umtriebe und fragwürdige Kontakte zu den deutschen Nazis aufgefallen. Man hat ihn wohl jahrelang an der langen Leine laufen lassen, weil man gemerkt hat, dass er für ernst zu nehmende Störfälle zu unterbelichtet ist. Meiner persönlichen Meinung nach hat diese Episode unseren König damals derart nachhaltig verwirrt, dass er ein paar Monate später dieser Wallis Simpson zum Opfer fiel. So ist er dann auf viel perfidere Weise aus dem Verkehr gezogen worden. Aber das nur am Rande. Apropos Verkehr: Sie fahren zu dicht auf, Nigel!«
Ich schickte einen giftigen Blick zum Beifahrersitz hinüber. »Wollen Sie fahren?«
Er grunzte vergnügt. »Das wäre das erste Mal. Aber wenn Sie es mir gestatten? Vielleicht macht es ja sogar Spaß.«
»Erzählen Sie lieber weiter«, sagte ich und versuchte, mich wieder auf die Straße zu konzentrieren.
»Gerne. Sagt Ihnen ›Der fünfköpfige Hund‹ etwas?« Darauf erwartete er nicht wirklich eine Antwort.
»Dieser Brannigan schwor damals vor Gericht Stein und Bein, dass eine fremde Macht ihm 150 Pfund für den Mord an Edward VIII. bezahlt habe.«
Ich lachte. »Für 150 Pfund würde ich ja nicht mal meinem Milchmann eine Flasche vom Wagen klauen. Sie etwa?«
»Ich bitte Sie! Ich kenne Ihren Milchmann ja nicht mal. Wie dem auch sei, Brannigan gab an, alle Instruktionen und auch den Revolver von diesem ominösen ›fünfköpfigen Hund‹ erhalten zu haben. Vorsicht, der will überholen!«
Diesmal verkniff ich mir sogar den Seitenblick. Ich würde diesen seltsamen Vogel jetzt gleich einfach in Tenterden rauswerfen und weiter nach London brausen. Eine halbe Stunde Wegs hatten wir immerhin schon hinter uns.
»Seltsamerweise ist es dem Geheimdienst angeblich nicht gelungen, diesen ›fünfköpfigen Hund‹ aufzuspüren. Niemand weiß etwas darüber. Bis jetzt!« Es klang ungemein bedeutungsschwanger.
»Und jetzt kommen Sie ins Spiel, was?«
»Ganz recht, mein Bester. Wie ich vorhin erwähnte, habe ich einen Anruf bekommen.« Er hob seine krumme Nase einen Deut höher. »Ein Spezialauftrag, über den ich Ihnen vielleicht Näheres sagen kann, wenn wir uns erst ein bisschen besser kennen. Ich ziehe also am Morgen unverzüglich in die Schlacht, und dann komme ich an der – na, nennen wir es mal Behausung von Wylie an und finde Sie vor, wie Sie sich da in scheinbar schurkischer Absicht über den gurgelnden Greis beugen.«
»Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich …«
»Ruhig Blut, zügeln Sie Ihr Temperament und geben Sie dafür lieber mal Ihrem Blechgaul die Sporen. Ich glaube Ihnen ja. Was ist das für eine Sache mit diesem Theaterstück?«
Ich berichtete ihm die Dinge, die ich weitergeben durfte, ohne mit meinem Kodex als Rechtsanwalt in Konflikt zu geraten.
»Und wie heißt dieses Machwerk?«, fragte er anschließend.
»Es trägt den klangvollen Titel ›Dinner for One‹. Eine ziemliche Klamotte, wenn Sie mich fragen. Der Schauspieler Freddie Frinton, dem die Rechte an diesem Stück jetzt eigentlich ganz regulär gehören, spielt es überall rauf und runter. Ich habe mir extra eine Vorstellung in Reading angeguckt, um zu wissen, worum es geht.«
»Und?«
»Jede Menge Alkohol, eine alte Lady mit Dutt und ein weißhaariger, alter Butler mit steifem Kragen und schwarzem Frack, der immer über ein Tigerfell stolpert. Sie haben sicher auch einen von der Sorte, habe ich recht? Einen Butler, meine ich.«
Er spitzte die Lippen und sog tief die Luft ein. »Sie dürfen getrost die Vergangenheitsform benutzen, mein Lieber. Unsere Familie hatte einen Butler, ganz recht. Aber das war, bevor diese Bande sich unseren Stammsitz unter den Nagel gerissen hat.«
Überrascht wandte ich ihm den Kopf zu. Da war plötzlich keinerlei Heiterkeit mehr in seinem Gesicht. Er hatte die großen Hände auf dem runden Bauch gefaltet und das bärtige Doppelkinn auf die Brust gelegt und sah aus wie ein übellauniges Huhn beim Brüten. Ich beschloss, dass es wohl keine gute Idee war, wegen dieser Geschichte weiter in ihn zu dringen.
Der weitere Verlauf der Reise verlief nahezu gesprächslos. Ich fragte mich, warum er mich so vorbehaltlos ins Vertrauen zog. War es nur, weil er eine Transportmöglichkeit benötigte? Oder schien ich ihm tatsächlich vertrauenswürdig genug, um sein Wissen mit mir zu teilen?
Wir erreichten die Grafschaft Kent, und es war nun nicht mehr weit bis zum Etappenziel.
»Ob diese geheimnisvolle Frau wohl versucht hat, einen Mordanschlag auf Wylie zu verüben?«, fragte ich, um die Stimmung meines Beifahrers wieder ein wenig aufzuhellen.
»Kann man nicht sagen. Es sah zunächst mal nach einem hundsgewöhnlichen Herzanfall aus. Sagte auch der Arzt. Außerdem hätte sie ihm in diesem Fall wohl kaum die Fotografien dagelassen«, knurrte Merridew. »Ich frage mich vielmehr, was dieses Theaterstück mit dem Attentat auf Edward VIII. zu tun haben soll.«
»Mit Sicherheit überhaupt nichts!« Dies war meine ehrliche Meinung. Diese Dinge passten nicht zusammen.
Lord Merridew kicherte leise. »Es ist rührend, wie ahnungslos Sie doch sind, mein guter Nigel.«
»Sagen Sie mir lieber, wo ich Sie in Tenterden absetzen soll.«
Er runzelte die Stirn. »Sie wollen mich nicht begleiten?«
»Das sagte ich bereits.«
Er schwieg wieder.
Zehn Minuten später rollten wir auf der High Street in das Städtchen Tenterden hinein. Ein ruhiger, kleiner Ort mit Pubs und Geschäften beiderseits der breiten Durchfahrtsstraße.
Und mit einer verblüffenden Menge von hektischem Blaulichtgeflacker.
Mehrere Polizeifahrzeuge standen an der Straße unweit der Kirche.
Merridew reckte den Kopf nach vorne. »Ah, da wird es sein! Ja, ja, ich denke, Sie können mich genau dort absetzen.«
Eigentlich hatte ich keine andere Wahl. Ich versuchte mir einzureden, dass all das irgendwie mit meinem Fall zusammenhing, und dass ich im Interesse meines Mandanten gewissermaßen dazu verpflichtet war, mir einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Aber Merridews munter zwinkernde Äuglein, mit denen er mir beim Gehen einen Blick über seine breite Schulter zuwarf, erfassten es natürlich in all seiner schnöden Schlichtheit: Mich trieb nichts weiter an als die Neugier.
Merridew schlug mit seinem gewaltigen Körper eine Schneise durch eine kleine Gruppe von Passanten, die sich um den Ort des Geschehens scharten.
»Achtung«, trompetete er und hob den Gehstock wie ein Fremdenführer. »Bitte mal zur Seite treten!« Und niemand wagte es, sich ihm zu widersetzen.
»Hier gibt es nichts zu sehen«, versuchte ein Polizist zaghaft, uns abzuweisen, als wir das Polizeiabsperrband erreicht hatten.
»Ach, und warum bummeln Sie dann hier rum und pflegen nicht Ihren Gummibaum im Büro?«
Ich schrak zusammen, aber Merridew ließ gleich im nächsten Moment ein dröhnendes Lachen hören und klopfte dem Polizisten kumpelhaft auf die Schulter. »Kleiner Spaß, Officer. Sie können sich sicher auch was Schöneres vorstellen, als hier Überstunden zu machen, was? Und nach Überstunden sieht es doch aus, oder? Was haben wir denn da Feines?«
»Eine Tote auf dem Friedhof, Sir.«
»Ach, gehört die nicht genau da hin?«
»Das schon, aber sechs Fuß tiefer, Sir.«
»Ein Unfall?«, fragte Merridew unschuldig.
»Wohl kaum, Sir. Es sei denn, die Dame ist versehentlich in die Flugbahn einer Großwildpatrone gestolpert.«
»Donnerwetter!« Merridew sog scharf die Luft zwischen den Zähnen ein. »Eine Frau von hier?«
Der Polizist schüttelte unsicher den Kopf. »Keine Papiere. Aber, wenn’s recht ist, Sir, würde ich Sie bitten, jetzt keine weiteren Fragen mehr zu stellen.« Er wandte sich in einem Anfall von Verzweiflung von uns ab.
Auf dem Grün zwischen den windschief stehenden Grabsteinen lag eine Frau. Wir konnten sie deutlich erkennen, da ihr Körper nur etwa fünfzehn Fuß von dem Absperrband entfernt lag. Sie trug einen weiten, malvenfarbenen Popelinemantel.
»Grundgütiger, Lord Merridew«, murmelte ich. »Das muss die Frau aus Shoreham-by-the-Sea sein!«
»Sie sind ja blitzgescheit«, murmelte er und spähte zu der Toten hinüber wie ein Greifvogel zu einem Mauseloch. »Ich sehe aber nirgendwo einen Fotoapparat.« Er prägte sich offenbar jedes Detail ein. Ihre dunklen, schulterlangen Haare, die cremefarbenen Schuhe mit den halbhohen Absätzen, die weiße Bluse und der bläulich gemusterte Rock mit dem Muster aus großen, stilisierten Blüten, der zwischen den Mantelschößen erkennbar war.
»Kommen Sie«, sagte er. »Wir werden uns mal umsehen.«
»Und wo, wenn ich mal fragen darf?«
Er wedelte mit den Fotos. »Die Frau liegt in der falschen Ecke. Die Grabsteine da sind hundert Jahre alt. Lassen Sie uns nach den Gräbern suchen, die Mitte der Dreißiger angelegt wurden. Kommen Sie, hier lang.« Er umrundete den Südflügel der Kirche und schritt eine Reihe von Grabsteinen ab.
»1932 … 1937 … 37 … 37 … Meine Güte, muss ein ungesundes Jahr gewesen sein. 1935 … 1934 … Aha! Hier hätten wir es: 17. Juli 1936!«
»Dasselbe Datum!«
Wir lasen die Inschrift: Von mir wird man nur Gutes sagen, wenn sie mich einst zu Grabe tragen. Nur eines gibt es, das mich stört. Ich hätt’ es noch so gern gehört. Alfred Aurelius Winterbottom, geboren am 28. März 1863, gestorben am 17. Juli 1936.
»Winterbottom!«, rief ich überrascht und griff nach den Fotografien, die Merridew jetzt wieder hervorgeholt hatte. Ich las die anderen Namen: »Jetzt fällt es mir ein! George Martin Pommeroy, Admiral Benedict von Schneider und Sir Toby Gilmore-Smythe … Das sind vier Namen aus dem Stück!«
Merridew grinste mich breit an. »Wollen Sie immer noch behaupten, es könne kein Zusammenhang zwischen der Bühnenklamotte und dem Attentat bestehen?« Er nahm mir behutsam die Fotos weg und drehte sie um. »Dann wollen wir mal schauen, ob wir herausfinden können, wo die dahingeschiedene junge Frau im malvenfarbenen Mantel gewohnt hat.«
»Und wie soll das gehen?«
Er tippte auf die untere Ecke der Rückseite eines der Fotos: »Schauen Sie mal hier. Der kleine Stempel des Fotogeschäfts. Robert C. Marley, Burgh Heath. Ein winziges Nest, dieses Burgh Heath. Liegt in Surrey. Ich würde es nicht kennen, wenn mich nicht vor ein paar Jahren der Fall des Flaggenmörders in den Nachbarort Tadworth geführt hätte. Schlimme Geschichte übrigens. Ein Killer, der seine Opfer rund um London herum an die öffentlichen Fahnenstangen hängte. Nun, wie dem auch sei, es steht kaum zu vermuten, dass Miss Malve extra in dieses putzige, kleine Burgh Heath fährt, um dort ihre Bilder entwickeln zu lassen, wenn sie nicht in der Nähe lebt.«
»Anderthalb Stunden Fahrt mindestens«, murmelte ich.
»Aber in Richtung London!«
Ich wackelte nachdenklich mit dem Kopf.
»Na, kommen Sie schon, Nigel, seien Sie kein Frosch! Geben Sie es zu: Sie haben Blut geleckt!«
Als ich ihn, wie ich glaubte, mit einem undurchdringlichen Pokerface ansah, wusste er längst, dass ich ihn begleiten würde.
Wir schafften es in einer Stunde und vierzig Minuten. Der Laden des Fotografen war geschlossen. Nicht, dass es schon zu spät gewesen wäre, aber ein handgeschriebener Zettel verkündete, Mr. Marleys zweiwöchiger Jahresurlaub habe genau heute begonnen. Wenn Merridew bei unserem Eintreffen in Burgh Heath noch fröhlich pfeifend auf den Laden zustolziert war, so stapfte er jetzt fast missmutig über den Bürgersteig und stieß den Stock mit jedem Schritt so heftig auf, als wolle er die Gehwegplatten zertrümmern.
»Ich habe einen kleinen Appetit«, brummte er schließlich an der nächsten Hausecke und steuerte ein Lokal in einer Seitenstraße an. »Bei der Gelegenheit können wir gleich mal weiterfragen.«
Mr. Marley saß bereits im Flieger nach Spanien. Dies erklärte uns die dralle, junge Kellnerin vom Old Willow Tea Room, die allerdings auf die Frage, ob sie von einer jungen Journalistin oder einer Fotografin wisse, die im Ort oder in der Nähe wohne, keine Antwort geben konnte. »Der alte Marley macht Abzüge für alle möglichen Leute«, erklärte sie im Plauderton. »Und manchmal macht er auch sehr schöne Fotos von mir.« Während sie Tassen und Tee auf unserem Tisch verteilte, lächelte sie auf eine geheimniskrämerische Weise in sich hinein. Merridew und ich blickten uns an und dachten uns unseren Teil, ohne das pummelige Ding mit weiteren Fragen zu belästigen.
Telefonisch hatte Merridew sich inzwischen im Krankenhaus nach Lauri Wylies Zustand erkundigt und die nüchterne wiewohl erschütternde Botschaft vernommen, Mr. Wylie habe den Herzinfarkt nicht überlebt.
Mein Mandant war gewissermaßen vor meiner Nase verstorben, und somit war auch seine Klage ein Fall für den Papierkorb.
Wir rührten trübsinnig in unseren Teetassen herum. Was Merridew dachte, konnte ich nur erahnen. Ich konnte an nichts anderes denken, als an die Botschaft, die ich am Montag meinem Chef würde überbringen müssen. Freddie Frinton würde fortan fröhlich und ungestört das Stück »Dinner for One« aufführen können. Obwohl ich nicht der Auffassung war, dass es ein Kassenschlager war, für den sich in ein, zwei Jahren noch irgendjemand interessieren würde, wurmte mich der Gedanke sehr.
Nachdem wir ein paar Scones mit Erdbeerkonfitüre und Clotted Cream verspeist hatten – ich anderthalb und Merridew vier – verschwand mein neuer Bekannter erneut im Hinterzimmer des Tearooms, um zu telefonieren.
Er machte ein großes Geheimnis darum, mit wem er das zu tun gedachte. Ich reimte mir zusammen, dass es seine Auftraggeber sein mussten und sprach ihn nach seiner Rückkehr darauf an.
»Ach, was soll ich Ihnen sagen, Nigel … Das sind Verbindungen, die schon viele Jahre zurückreichen. In eine weniger lustige Zeit, wissen Sie. Im Krieg war ich übrigens Mitglied einer Spionage-Einheit. Das schien mir das Vernünftigste zu sein.«
»Waren Sie auf dem Kontinent?«
»Victoria Street, London. Dechiffrierabteilung. England hätte einen bösen Verlust erleiden können, wenn man mir ein Loch in meinen genialen Kopf geballert hätte, das sehen Sie doch ein, oder?«
Ich grinste ihn an. »Sie haben also lieber zu Hause herumgekniffelt, statt sich schmutzig zu machen.«
»Wenn Sie es so volkstümlich ausdrücken möchten. Ach, und da gab es noch das Double-Cross-System. Famose Sache! Unsere Spezialität war es, die Krauts mit falschen Informationen zu füttern. Einen Heidenspaß hat das gemacht. Nun ja …« Er zog einen Zettel aus der Westentasche. »Man hat mir am Telefon erfreulicherweise etwas über die Personen verraten können, deren Namen in die Grabsteine gemeißelt wurden.
Sir Toby Gilmore-Smythe, bis zu seinem Tod Mitglied der Legion of Loyalists, einer unappetitlich weit rechts stehenden Partei, residierte in seinem Familienstammsitz in Goudhurst.
Mr. George Martin Pommeroy, ein Gemüsegroßhändler, lebte in Crowborough.
Admiral Benedict von Schneider wohnte mit seinem Angeblichen-Ziehsohn-in-Wirklichkeit-aber-Liebhaber in einem Cottage im beschaulichen Battle.
Und Alfred Aurelius Winterbottom, ein Bauunternehmer aus Kensington, verbrachte seinen Lebensabend in Tenterden.
Allesamt einflussreiche, betagte Gentlemen, deren Tod scheinbar auf natürlichem Wege eintrat. So sagen es jedenfalls die Sterbeurkunden.«
Ich dachte darüber nach, welche Organisation wohl imstande war, in so kurzer Zeit derart spezielle Informationen beizubringen. Merridew registrierte meinen fragenden Gesichtsausdruck, gedachte aber nicht, mich aufzuklären und vervollständigte stattdessen seinen Bericht: »Sir Toby legte sich ins Bett und erlag einer gemeinen Grippe. Mr. Pommeroy erlitt in der Nähe von Tunbridge Wells einen Übelkeitsanfall und fuhr mit dem Auto in den Gegenverkehr. Admiral von Schneider verstarb im Krankenhaus von Hastings nach einem akuten Anfall von Nierenversagen. Und Mr. Winterbottom stürzte aus ungeklärter Ursache mit seinem Privatflugzeug in der Nähe des Aerodroms von Headcorn ab. Bei keinem der Herren wurde wegen des fortgeschrittenen Alters eine nähere Untersuchung angeordnet.« Er verleibte sich ungefragt meinen übrig gebliebenen halben Scone ein, schmatzte zufrieden und hatte den Blick durch das Fenster in die Ferne gerichtet.
»Vier scheinbar unverdächtige Todesfälle«, murmelte ich und trank meinen letzten Schluck Tee.
»Und vier Wohnsitze, die jeweils etwa zehn bis zwanzig Meilen voneinander entfernt waren.« Er klopfte sich die Krümel aus den Falten seiner Weste und sagte beiläufig: »Weiß man natürlich nur, wenn man das Kartenmaterial unseres Heimatlandes gewissermaßen hier drin gespeichert hat.« Er tippte sich an die Schläfe. »So, dann wollen wir uns mal die Behausung unserer malvenfarbenen Fotografistin anschauen!«
»Aber woher …?«
Er stand wortlos auf und verließ, nachdem er bezahlt hatte, forschen Schrittes den Tearoom. Draußen begann es zu dämmern. Ich blickte auf die Uhr: Es war bereits halb sechs.
»Kommen Sie, Nigel, trödeln Sie nicht!«
Als ich den Kopf hob, hatte Merridew die Straße bereits überquert und marschierte auf einen begrünten Platz zu. Er blieb vor einem von mehreren modernen, kleinen, zweigeschossigen Häusern stehen, die aussahen, als habe ein Kind quadratische Löcher in ein paar Schuhkartons hineingeschnitten.
»Voilà«, sagte er zufrieden. »Da hätten wir es ja.«
Ich blickte zwischen dem Haus und Merridew hin und her. »Wie bitte? Ich verstehe nicht.«
»Das ist es. Dort wohnt die Dame, deren Namen wir wohl jetzt endlich erfahren werden.«
»Aber wie kommen Sie darauf, Merridew? Das Haus sieht aus wie mindestens vier andere hier an diesem Platz!«
»Schauen Sie genau hin, Nigel!« Er wies mit dem Finger auf eines der Fenster im Erdgeschoss. »Ich konnte es vom Tearoom aus sehen. Die Vorhänge.«
»Vorhänge ja, und?« Ich erkannte große, runde Blüten in verschiedenen Blautönen.
»Das Muster!«
Ich verstand immer noch nicht, und er rollte ungeduldig mit den Augen. »Es ist derselbe Stoff, aus dem auch der Rock der Toten geschneidert wurde.«
Natürlich hatte er Recht. Wie hatte ich nur daran zweifeln können.
Die Häuser beherbergten jeweils vier Mietparteien. Auf dem Klingelschild, das zu der linken Erdgeschosswohnung gehörte, stand E. Peverell.
»Finanzamt oder Stadtverwaltung?«, krähte eine Stimme hinter uns. Eine alte Frau mit einem gehörigen violetten Stich im weißen Haar wackelte auf uns zu und zog mit quietschenden Rädern ein prall gefülltes Einkaufswägelchen hinter sich her.
»Wir wollen zu Miss Peverell«, sagte Merridew.
»Sag ich ja. Und ihr Jungs seid entweder von der Steuerfahndung oder vom Rathaus.« Sie hatte einen prallen Schlüsselbund aus ihrer Handtasche gekramt.
Merridew und ich warfen uns ein paar schnelle Blicke zu. »Nun ja, wenn Sie das sowieso schon wissen«, sagte ich gedehnt.
»Steuerbehörde«, log Merridew.
Die Augen der Alten blitzten uns durch die Brille triumphierend an. »War ja klar. Ihr seid ja nicht die Ersten. Dauernd will hier einer bei Edna Peverell abkassieren kommen, weil das gnädige Fräulein überall Schulden hat.« Sie zupfte an meinem Ärmel und senkte in gespielter Vertraulichkeit die Stimme. »Erst gestern war wieder so ein alter Knacker hier, der mich nach ihr ausfragen wollte.« Ihre krummen Finger fummelten die einzelnen Schlüssel auseinander. Es schienen mindestens drei Dutzend zu sein, und das Geklimper war überaus nervtötend.
»Ein älterer Herr? Gestern?«, sagte Merridew geistesgegenwärtig. »Sollte das etwa schon jemand anderes aus unserem Amt gewesen sein? Wie sah der Mann denn aus?«