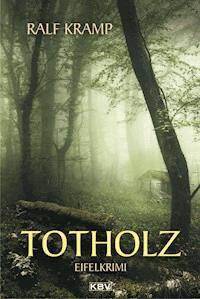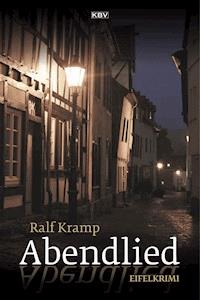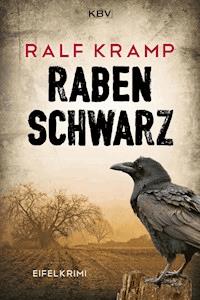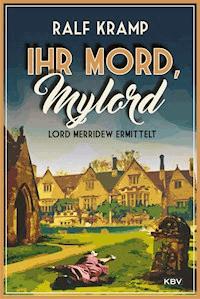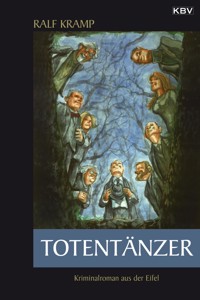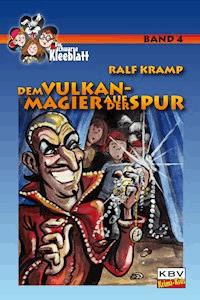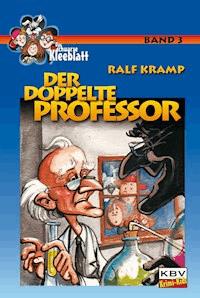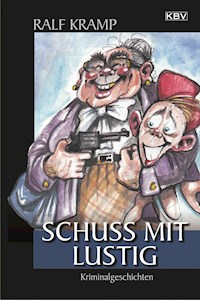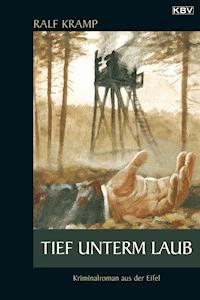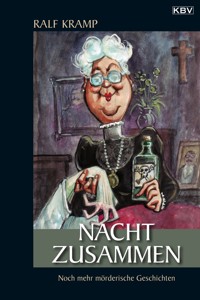Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: KBVHörbuch-Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Herbie Feldmann
- Sprache: Deutsch
Die Maare sind die "Augen der Eifel" – geheimnisvolle runde Kraterseen, um die sich Sagen und Legenden ranken. Zwei Leichen stören eines Tages die Idylle. Ein alter Maler und sein junges Modell werden am Ufer gefunden, und ausgerechnet Herbies Freund Köbes wird des Mordes verdächtigt. Gemeinsam mit seinem unvermeidlichen Schatten Julius macht sich Herbie auf die Suche nach dem wahren Täter. Dabei decken sie die Machenschaften einiger Kunstmaler, Fälscher und Sammler auf, die vielleicht besser im Verborgenen geblieben wären.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Ralf Kramp
Malerische Morde
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Tief unterm Laub
Spinner
Rabenschwarz
Der neunte Tod
Abendgrauen (Hg.)
Still und starr
… denn sterben muss David!
Kurz vor Schluss
Abendgrauen II (Hg.)
Malerische Morde
Hart an der Grenze
Ein Viertelpfund Mord
Ein kaltes Haus
Abendgrauen III (Hg.)
Totentänzer
Nacht zusammen
Stimmen im Wald
Voll ins Schwarze
Ralf Kramp, geboren am 29. November 1963 in Euskirchen, lebt heute in Flesten in der Vulkaneifel. Für sein Debüt »Tief unterm Laub« erhielt er den Förderpreis des Eifel-Literaturfestivals. Seither erschienen mehrere Kriminalromane, unter anderem auch die Reihe um den kauzigen Helden Herbie Feldmann und seinen unsichtbaren Begleiter Julius, die mittlerweile deutschlandweit eine große Fangemeinde hat. Seit 1998 veranstaltet er mit großem Erfolg unter dem Titel »Blutspur« Krimiwochenenden in der Eifel, bei denen hartgesottene Krimifans ihr angelesenes »Fachwissen« endlich bei einer Live-Mördersuche in die Tat umsetzen können.
Im Jahr 2002 erhielt er den Kulturpreis des Kreises Euskirchen.
Seit 2007 führt er mit seiner Frau Monika in Hillesheim das »Kriminalhaus« mit dem »Deutschen Krimi-Archiv« mit 26.000 Bänden, dem »Café Sherlock« und der Buchhandlung »Lesezeichen«. www.ralfkramp.de · www.kriminalhaus.de
Ralf Kramp
Malerische Morde
1. Auflage 2002
2. Auflage 2005
3. Auflage 2012
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlagillustration: Ralf Kramp unter Verwendung von © WS-Design und © Demian – www.fotolia.de
Redaktion: Dorothee Steuer, Sankt Augustin
Satz: Volker Maria Neumann, Köln
Print-ISBN 978-3-934638-59-4
E-Book-ISBN 978-3-95441-062-0
vermummt und würdig vor der Türe polizeipoch poch die ganze türe auf herr schmidtdie morgenstund ist faul schlaf geht entzweiziehn sie sich an mein herr sie müssen mit
ach gott herr kommissar im warmen überrockach panik was denn warum darum wiehos hemd und handschuh hut und havelockgamaschen augenblick den parapluie
[…]
ihr schwarzes blut herr schmidt ihr ganzes schwarzes blutwird nun vergossen ohne viel gefühlder henker hackt präzise haupt und hutvom körper und geht hin zum kartenspiel
(aus: Ror Wolf »Hans Waldmanns Abenteuer«Haffmanns, Zürich 1985)
Für Gabi, Lisa, Laura, Leo und Martin.
Und für Susanne und Klaus Gieseler.
Manche Stationen sind fast so schön wie das Ziel.
Ich danke euch.
Inhalt
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Epilog
Danksagung
Prolog
Wenn sie durch das Wasser glitt, fühlte sie sich gerade so, als würde sie schweben. Die Kälte zog an ihr vorbei und unter ihr her, spülte mit schlürfenden Geräuschen zwischen ihren gespreizten Fingern hindurch, wenn sie weit mit ihren Armen ausholte und durch das morgendunkle Wasser nach vorne schoss.
Ohne Brille sah sie so gut wie nichts. Aber sie musste ja auch nichts sehen, sie fühlte mit dem ganzen Körper. Sie schmeckte das kühle Wasser, atmete seinen reinen Duft mit jedem Luftholen tief ein. Sie genoss das Perlen der Luftblasen auf ihrer nackten Haut.
Irgendwann ertasteten ihre Hände den schlammigen Grund des Ufers und sie hörte auf zu paddeln. Ihre Füße fanden den Boden, und sie ging in die Hocke. Sie rieb sich prustend mit den flachen Händen über das Gesicht und presste mit langsamen, kräftigen Bewegungen das Wasser aus ihrem Haar. Dann richtete sie sich auf und spürte, wie der kühle Wind die Härchen auf ihrem nassen, nackten Körper aufrichtete. Die Knospen ihrer Brüste wurden fest.
Jede ihrer Bewegungen schickte platschende Geräusche durch die morgendliche Stille über dem Wasser.
Vogelstimmen aus dem Wald, ihr Plätschern … sonst nichts.
»Hermann?«, flüsterte sie fast, um die Idylle nicht zu zerstören. Beinahe hatte sie Angst vor dem rauen Klang ihrer eigenen Stimme. »Es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Auch wenn du es nicht glaubst. Irgendwann wirst du es auch ausprobieren, und dann wirst du sehen, wie unglaublich toll das ist.«
Sie sah seine Gestalt am Ufer. Schemenhaft. Er stand bei der Staffelei. Sie ertastete das Handtuch, das sie sich auf einem Ast bereitgelegt hatte.
»Ich brauche meine Brille.« Während sie begann, sich abzutrocknen, trat sie von einem Fuß auf den anderen. Das Handtuch glitt zwischen ihre Beine, sie rieb ihre Schamhaare trocken. Vor ihm brauchte sie sich nicht zu genieren.
»Hast du gehört, Hermann, ich brauche meine Brille. Warum sagst du nichts? So fasziniert?« Und als er nicht antwortete: »Hm?«
Sie stellte sich provozierend hin, spreizte die Beine ein wenig, zeigte sich ihm in all ihrer Nacktheit.
Er kam auf sie zu, ganz plötzlich. Sagte kein Wort. Sie lächelte ihn herausfordernd an. Dann drehte sie sich langsam um die eigene Achse und erlaubte ihm, sie von allen Seiten zu betrachten.
Er machte ein paar Schritte ins Wasser. Oh, Mann, der Alte war wirklich verrückt. Sie machte ihn verrückt, und dieses Gefühl erregte sie.
Spielerisch entfernte sie sich von ihm und lockte mit dem Zeigefinger. Doch er war viel schneller, als sie es ihm zugetraut hätte. Er sagte keinen Ton, sie hörte nur sein Schnaufen, das sich unter das Geräusch des kühlen Wassers mischte, das bei jedem Schritt um seine Beine sprudelte.
Als er plötzlich mit dem Arm ausholte, hielt sie mit ihren Bewegungen inne.
Der erste Schlag traf sie wie ein Donner. Ein berstendes Geräusch brandete durch ihr Hirn. Sie taumelte zurück. Er hatte etwas in der Hand gehabt! Etwas Hartes, mit bizarren Formen! Die Finger ihrer Rechten krampften sich um das Handtuch.
Ihre Füße pflügten unbeholfen rücklings durch das seichte Wasser. Sie ruderte mit den Armen und versuchte instinktiv, das Gleichgewicht zu halten.
»Nicht, Hermann … nicht …« Sie stammelte mit schwerer Zunge. Der Schlag hatte sie fast betäubt. Sie begann zu winseln.
»Was soll das …?«
Da traf sie der nächste Hieb. Ihr Kopf explodierte. Es riss sie von den Füßen. Ihr Körper schlug rückwärts ins Wasser. Ein Sturm von Blut und Luftblasen umtobte sie, als sie untertauchte. Wasser schoss in ihre Lungen und hinderte sie am Schreien, die Hände griffen ins nasse Nichts. Sie hielt immer noch krampfhaft das Handtuch fest.
Dann traf sie der letzte Schlag.
Erstes Kapitel
Das Café T in Bad Münstereifel schickte sein warmes Licht auf das Pflaster der Wertherstraße hinaus. Der Abend neigte sich seinem Ende entgegen.
»Nun ja, wie soll man den beschreiben? Das war eigentlich ein stinknormaler Typ. Nicht besonders groß, nicht besonders klein …« Theo versuchte, mit der flachen Hand eine Größenangabe zu veranschaulichen. Der italienische Kellner hatte den Kopf schiefgelegt und die Arme verschränkt. Er stand am Tisch der beiden Gäste und dachte angestrengt nach, aber er konnte sich nicht erinnern.
»Wie gesagt, ich glaube, er ist nach München gegangen, bevor du hier angefangen hast«, warf Harald ein und trank an seinem Hefeweizen.
Aber Theo gab nicht auf. »Blond war er. Die Haare nicht besonders kurz, aber auch nicht besonders lang.«
»Und deine Erklärung ist nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut«, grunzte Harald. »Er ist jetzt schon zwei Jahre weg von hier, und da kann Domingo ihn gar nicht kennen.«
»Dann hast du was verpasst, Domingo.« Theo zuckte mit den Schultern. »Er war wirklich ein verrückter Typ.«
Sie saßen an einem kleinen, runden Tisch in der Nähe der Theke und erinnerten sich an alte Zeiten.
Und irgendwann waren sie bei Herbie Feldmann gelandet. Bei einem weder lang- noch kurzhaarigen, weder sehr großen noch extrem kleinen Zeitgenossen, der vor Jahren Stammgast in diesem Bistro gewesen war.
»Wasse war sso besonders an ihm?«, fragte der Italiener.
Die beiden guckten sich an, und ein Grinsen huschte über ihre Gesichter. Theo tippte sich zuerst an die Stirn.
»Er hatte nicht alle Meisen in der Trommel.«
Harald relativierte das: »Wenn man Herbie Feldmann auf der Straße begegnete, hätte man vermutlich keine Notiz von ihm genommen. So im Vorbeigehen sah er völlig normal aus.«
»Also weder besonders …«, wollte Theo ergänzen, aber Harald winkte ab.
»Er hat eine Tante hier wohnen. Hier in Bad Münstereifel. Sie ist irrsinnig reich. Villa oben an der Windhecke und so. Ein unangenehmes, altes Reptil, diese Frau. Der Haken an der ganzen Sache ist folgender: Eigentlich gehört ein ordentlicher Teil dieser Kohle unserem Herbie. Sie ist sein Vormund, denn, wie Theo schon ganz richtig erwähnte …«
Theo tippte sich wieder an die Stirn und kicherte.
»Wasse warr denn sso verruckt an ihm?« Domingo holte einen Stuhl vom Nachbartisch und klemmte ihn sich zwischen die Beine. Das Bistro hatte sich weitestgehend geleert, der sägende Gesang von Patricia Kaas hing zwischen dem Kitsch und den Kostbarkeiten, die von der Decke baumelten, die Wände pflasterten oder den Weg versperrten.
»Nun ja«, Harald beugte sich vor, setzte eine konspirative Miene auf, bemerkte dann, dass sein Bierglas leer war, und nachdem Domingo diesen Missstand behoben und sich wieder zu ihnen gesetzt hatte, erklärte er: »Herbie Feldmann hatte einen neben sich gehen.«
»Wie?« Die Redewendung erschloss sich dem Italiener nicht auf Anhieb.
»Er war nie wirklich allein, verstehst du?« Theo redete wieder mit den Händen und malte eine imaginäre Gestalt in die Luft neben seinem Stuhl.
Harald präzisierte es: »Herbie Feldmann war von dem Wahn besessen, es sei ständig jemand in seiner Nähe. Und das seit seiner Jugend. Zur Erklärung muss man vielleicht dazu sagen, dass er nach dem Tod seiner Eltern einen Nervenzusammenbruch hatte und in psychiatrischer Behandlung war.«
»Es soll ein großer, fetter, bärtiger Kerl gewesen sein«, sagte Theo. »Er hieß Julius.«
»Ja, und wenn man Herbie auf der Straße oder im Café begegnete oder beim Einkaufen, dann konnte es durchaus sein, dass er gerade in ein ernstes Gespräch mit seinem unsichtbaren Begleiter vertieft war. Mit Julius eben.« Harald reckte sich auf seinem Bistrostuhl und unterdrückte ein Gähnen.
»Manchmal stritten sie«, fiel es Theo ein. »Ich habe Herbie mal am Geldautomaten in der Bank getroffen, und da hat er versucht, sich an seine Geheimnummer zu erinnern, während Julius fortwährend irgendwelche Zahlenketten runterplapperte.«
Harald verschluckte sich. »Du hast Julius gehört?«, fragte er entgeistert.
»Quatsch. Herbie hat es mir hinterher erzählt. Er musste sich eine neue Geheimnummer geben lassen, weil er ganz durcheinandergeraten war.«
»Im Lebensmittelgeschäft Melder haben sie sich mal gezankt, ob die Melonen reif sind oder nicht.« Dann seufzte Harald. »Aber das ist ja alles längst vorbei.«
Domingo erhob sich langsam wieder. Die Geschichte schien zu Ende zu sein. »Wießo vorbei, eh?«
Theo stopfte seine Pfeife nach und berichtete: »Herbie hat die Frau fürs Leben gefunden. Nina, seine Cousine. Mit der ist er nach München abgehauen, weil seine Tante, der alte Drachen … aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls habe ich gehört, dass Julius seither nicht mehr aufgetaucht sein soll. Unser Herbie ist jetzt ein ganz normaler junger Mann. Vielleicht normaler als Harald …«
Harald kicherte. »Ich weiß. Weder besonders klug, noch besonders …«, plötzlich hielt er inne und starrte wie vom Donner gerührt auf die Eingangstür.
Der Kellner und Theo folgten verwundert seinem Blick.
Im Eingang stand ein junger Mann. Er war nicht besonders groß, noch war er außerordentlich klein. Er war blond und trug die Haare weder kurz noch lang. Er trug einen hellgrauen Sommermantel und in der Rechten hielt er einen großen Koffer.
»Na, so eine Überraschung. Das sind doch Theo und Harald«, sagte Herbie mit einem scheuen Lächeln. »Hätte ich mir doch denken können, dass mindestens einer von euch hier rumhängt.« Er setzte seinen Koffer vor der Theke ab und kam näher. »Habt ihr was dagegen, wenn ich mich ’nen Moment zu euch setze?«
Harald Bongart, der Museumsleiter der Stadt Bad Münstereifel und sein Freund, der Fotograf Theo Broere, starrten ihn mit offenstehenden Mündern an.
»Du bisst der Herbie«, sagte Domingo lächelnd und rückte den Stuhl zurecht.
»Aha. Wie ich sehe, eilt mir mein Ruf schon voraus«, sagte Herbie ein wenig beschämt. »Woher wusstet ihr, dass ich heute zurückkomme, Jungs?«
* * *
Wenig später schlürfte Herbie geräuschvoll an seinem Tee und blickte hin und wieder zu dem Koffer hinüber, der immer noch vor der Theke stand. Die beiden anderen klebten an seinen Lippen und hatten immer noch irgendwie das Gefühl, als hätten sie ihn nach den Jahren seiner Abwesenheit geradewegs herbeigeredet.
Domingo hatte sich wieder hinter die Theke verkrümelt und begann, die Abrechnung zu machen.
»München ist nicht meine Stadt«, sagte Herbie zerknirscht und fuhr mit dem Finger über den Rand seines Teeglases. »Eigentlich gehöre ich überhaupt gar nicht in irgendeine Stadt. Ich hatte verschiedene Jobs da, wisst ihr. McDonald’s am Stachus, Second-Hand-Möbelladen in Leim … so was. Kaum zu glauben, dass ich hier eine Tante habe, die geradezu im Geld schwimmt. Ihr wisst ja, wem dieses Geld eigentlich …«
Harald und Theo nickten synchron. Der Kellner hinter der Theke nickte ebenfalls.
»Aber mit Tante Hettie hatte ich es mir ja leider verscherzt. Nach der Geschichte mit ihren Möbeln und ihrem Parkett. Sie hätte mit mir das gemacht, was bei Karl May die Indianer mit den Weißen zu machen pflegten, wenn sie mich zu packen gekriegt hätte. Haut in Streifen und so … Ich habe morgen einen schweren Gang vor mir, Jungs.«
Theo räusperte sich. »Ähhhm, was ist denn mit …« Er versuchte, es möglichst beiläufig klingen zu lassen, »… mit Nina?«
Herbie seufzte und verfiel in düsteres Schweigen. Nach einer Zeit sah es so aus, als sei er für den Rest des Abends in die Betrachtung eines Bierdeckels versunken, und Theo bereute schon, überhaupt gefragt zu haben. Herbie seufzte schließlich erneut und sagte, ohne den Bierdeckel aus den Augen zu lassen: »Nina geht’s hoffentlich gut. Sie hatte ja damals diesen Freund, diesen Chris.« Er sah die beiden anderen an und setzte ein schiefes Grinsen auf. »Nun, jetzt hat sie ihn wieder. Mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Die beiden gehören wohl zusammen. Da bin ich überflüssig.«
»Sie ist in München geblieben?«, fragte Harald.
Herbie nickte. »Bei Chris. Ich musste weg. München ist was für Münchner und solche, die sich dafür halten. Nicht für mich. Neulich bin ich über den Hut eines siebenköpfigen Orchesters gestolpert, das im strömenden Regen in einem Arkadengang in der City Rossini fiedelte. Sie dachten, ich wollte ihr Kleingeld mopsen und haben mich verhauen.«
Er winkte zur Theke und bestellte einen Eifelgeist. Dann besann er sich und rief: »Für die zwei auch!«
Theo und Harald winkten ab. »Wir sind auf dem Absprung.«
Nachdem er seinen Kräuterschnaps geschluckt hatte, fuhr er fort: »Im Englischen Garten bin ich der ersten Exhibitionistin meines Lebens begegnet. Das war im Sommer.« Als Harald wollüstig grinste, schickte er hinterher: »Sie war dreiundsiebzig, stand später in der Zeitung. So was passiert dir nur in München.«
Harald winkte ab. »Komm mal sonntags zum Heino-Rathauscafé. Wenn Heino mit den Fingern schnippen würde, würden sich alle Omis sofort und ohne zu zögern die Chiffonblusen aufreißen, dass die Perlmuttknöppchen nur so durch die Gegend prasseln.«
»Ich bin in eine Kurdendemo geraten und verhaftet worden, in der S-Bahn hat mir ein Besoffener in die Tasche gekotzt, und im Biergarten bin ich mit der Bank umgekippt. Direkt in eine Kellnerin mit sechs Maß Bier in den Pranken. Glaubt mir, Jungs. So was passiert einem wirklich nur in München.«
Er kippte den restlichen Schnaps und sah auf die Uhr.
»Hat sich eigentlich Köbes noch nicht gemeldet?«
Die anderen verneinten. Auch der Kellner wusste nichts.
»Sollte er?«, fragte Theo.
Herbie zuckte mit den Schultern. »Er hatte mir versprochen, mich hier in Empfang zu nehmen, wenn ich ankomme. Ich hätte bei ihm zu Hause in Zingsheim wohnen können, bis ich was anderes gefunden habe. Das würde mich davor bewahren, schon am ersten Abend vor Tante Hettie zu Kreuze kriechen zu müssen. Ich hätte erst mal Kräfte sammeln können, versteht ihr?«
Die beiden nickten verständig. Auch Domingo setzte ein ahnungsvolles Gesicht auf, während er Gläser polierte.
Herbie ließ sich das schnurlose Telefon geben, kramte einen Zettel hervor und begann eine Nummer einzutippen.
»Immer noch kein Handy?«, fragte Harald.
Herbie schüttelte den Kopf, während er die Ziffern leise vor sich hinmurmelte.
»Kein Auto?«, fragte Theo. Wieder verneinte Herbie wortlos.
Als er den Hörer ans Ohr presste und auf die Verbindung wartete, sagte er tonlos: »Kein Handy, kein Auto, keine Wohnung, keine Freundin … ist doch konsequent, oder?«
Die Verbindung wurde hergestellt.
»Wer? … Oh, Verzeihung, ich dachte, das sei die Telefonnummer eines Freundes … Wie bitte? … Ach so. Ja … hm … hmmm … hmmm ja … Im Moment habe ich keinen festen Wohnsitz. Ja, ich weiß, das klingt mysteriös, aber ich sitze hier in Münstereifel im Café T, und eigentlich wollte Köbes, … also Jakob Nießen mir eine Wohnung besorgen. Ich ziehe gerade aus München zurück in die Eifel, verstehen Sie?«
Die beiden anderen verfolgten interessiert das Gespräch. Am anderen Ende schien jemand sehr energisch auf seinen Gesprächspartner einzureden. Aus Herbies Miene konnte man allerhand lesen: Erstaunen, Verwirrung, Nervosität.
»Kann ich ihn vielleicht kurz … ja … ja, das versuche ich dann noch mal … Wie bitte? … Am besten hier im Café. Ich werde sehen, wo ich unterkomme … Ja, danke … bitte. Auf Wiederhören.«
»Was passiert?«, fragte Harald. »Klang geheimnisvoll.«
»Das glaubt ihr mir nie«, murmelte Herbie. »Das waren die Bullen. Kripo Wittlich. Die haben Köbes‘ Handy. Weil sie Köbes verhaftet haben. Glaubt man so was?«
»Köbes?«, fragte Theo. Er kannte den zotteligen Gebrauchtwagenverkäufer als zuverlässigen Saufkumpanen aus wilden Jugendtagen. »Kripo? Verhaftet?«
Herbie nickte. »In dieser Reihenfolge. Es hat zwei Tote gegeben. In der Vulkaneifel. An einem der Maare. Und Köbes soll was damit zu tun haben. Kaum zu glauben, so was.«
Er bestellte noch einen Schnaps und kippte ihn in einem Zug hinunter. »So was«, murmelte er. »So was passiert einem nur in der Eifel.«
Zweites Kapitel
Eine Stunde später stieg er durch die laue Frühsommernacht den Berg zur Windhecke hinauf. Der Quadratmeter Baugrund war dort oben kostbar und teuer wie nirgendwo sonst im Kreis Euskirchen. Hier wohnten keine armen Menschen, wie er einer war. Hier wohnte Tante Hettie. Er wechselte alle fünfzehn Schritte den Koffer, der von Meter zu Meter an Gewicht zu gewinnen schien, von einer Hand in die andere.
Harald und Theo hatten es gut. Sie waren auf dem Weg in ihr Zuhause, in weichgelegene Matratzen, sie würden bis zum Morgen von einem vertrauten Geruch umgeben sein, von einer heimeligen Umgebung und von Möbeln, Büchern, Teppichen – ja, sogar von Spinnweben und Staubschichten, die zu ihrem Zuhause dazugehörten. Sie hatten ein Heim. Ihm war nichts geblieben. Er war allein.
Beide hatten ihm, als sie sich aus dem nächtlich-leeren Bistro verabschiedet hatten, angeboten, ein oder zwei Nächte bei ihnen zu verbringen. Sogar der Kellner – das hatte er gemerkt – hatte mit sich gerungen, ob er Herbie nicht vielleicht Asyl anbieten solle.
Aber all das wäre nur ein allzu bequemer Aufschub gewesen. Irgendwann musste es passieren.
Er musste tun, was zu tun war.
Sie war seine Tante, sie war sein Vormund – sie hortete sein Geld.
Es war an der Zeit, Tante Hettie einen Besuch abzustatten.
Er stapfte unverdrossen weiter durch die Nacht, stieg den gepflasterten Weg entlang der alten Stadtmauer hinauf. Er wunderte sich, dass die wenigen Habseligkeiten, die allesamt in seinen Koffer hineinpassten, so schwer werden konnten.
Wie sollte er nur Tante Hettie erklären, was passiert war? Wie würde sie ihn empfangen?
Hältst du das für eine gute Idee? Herbie vernahm eine Stimme schräg hinter sich. Sie schien geradewegs aus der Weißdornhecke zu kommen, die die alte Stadtmauer säumte. Die Luft war warm, die Sträucher atmeten die Sonne aus. Es roch süßlich und schwer.
Die Stimme war ihm wohlbekannt. Es war eine dunkle, leicht näselnde Stimme mit einem Anflug von Arroganz.
Als Herbie für einen Moment innehielt, um den Koffer von der Linken in die Rechte zu geben, erkannte er im trüben Schein der Straßenlaterne seinen Begleiter, der ihn vor zwei Jahren in die ferne Großstadt entlassen hatte.
Julius hatte sich nicht verändert. Wie sollte er auch, unterlag er doch nicht den biologischen Prozessen der Alterung und der Vergänglichkeit.
Aber, bitte. Julius machte eine treibende Handbewegung. Nur zu. Vermutlich wird deine alte Tante ganz außer sich vor Freude sein, weil der heiß geliebte, verlorene Neffe nach so langer Zeit nach Hause zurückgekehrt ist. Sie wird einen Kuchen gebacken haben – an jedem einzelnen Tag deiner Abwesenheit, um stets gerüstet zu sein für deine Wiederkehr.
»Du hast dich nicht verändert.«
Wie sollte ich auch?
»Du redest immer noch denselben Unsinn wie damals.«
Stimmt, mein Bester. Verzeihung, du hast natürlich Recht. Sie hat einen einzigen Kuchen gebacken. Und der wartet schon seit zwei Jahren auf dem Küchentisch auf deine Heimkehr. Hoffentlich ist es ein Rodonkuchen und keine Buttercremetorte.
»Es sind fast zwölf Uhr. Du kannst dir wahrscheinlich ebenso gut vorstellen wie ich, wie uns Tante Hettie empfangen wird.« Herbie setzte den Koffer ab und rieb seine schmerzende Hand. Dann musterte er Julius mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Skepsis. »Hast du auf mich gewartet?«
Sehe ich da einen Hauch von Freude in den kleinen verschmitzten Äugelchen? Hat mich da jemand vermisst?
Herbie griff nach dem Koffer und beschleunigte seinen Schritt.
Auf der Rückreise hatte er oft genug an seinen unsichtbaren Begleiter aus früheren Zeiten gedacht. Als die Wehrtürme des alten Eifelstädtchens vor ihm aufgetaucht waren, da war es beinahe schon so gewesen, als sei er dicht bei ihm, als habe der massige Körper schon längst wieder seinen Schatten auf seinen Weg geworfen.
Und als Julius dann endlich das Wort ergriff, da war plötzlich alles wieder so wie früher, so wie in der Zeit vor Nina, vor München.
Er war nun nicht mehr allein – und das musste reichen.
Man konnte sich seinen Begleiter nicht immer aussuchen.
»Zwei Tote, Julius. Kannst du dir vorstellen, dass unser Köbes für zwei Leichen verantwortlich sein soll?«
Köbes war schon immer ein ruchloser Mensch. Einem Frankenstein, der sein Geld damit verdient, verbeulte Autoteile zu gemeingefährlichen Monstren zusammenzuschweißen, traue ich alles zu.
»Er versteht nichts von Autos, okay, aber Mord …«
Ein Teufelskreis der Gewalt.
Julius’ Argumentation hatte sich nicht zum Besseren gewandelt.
Sie hatten die Windhecke erreicht, die sich den steilen Berg hinaufwand. Herbie schnaufte, und der Schweiß schoss ihm aus allen Poren.
Das musste man München lassen. Es war ebenerdig angelegt.
Wir sind da, mein Alter. Schau, schon alles dunkel. Ich schätze, die alte Dame steht mit wirrem Haar in der beklemmenden Dunkelheit ihres einsamen Heims am Fenster, so, wie sie es jede Nacht tut, um Ausschau nach dem verschollenen Lieblingsneffen zu halten. Die Hände fest um den Rosenkranz geklammert, der zahnlose Mund Fürbitten und Stoßgebete brabbelnd.
»Sie wird mich erschlagen. Mit dem silbernen Knauf ihrer Krücke wird sie mir eins überziehen, und wenn ich Glück habe, werde ich mir noch rasch aussuchen dürfen, was auf meinem Grabstein stehen wird.«
Gib dich keinen Illusionen hin, du wirst in einem Armengrab vor der Stadtmauer verscharrt werden.
Herbie öffnete das kleine schmiedeeiserne Tor, das auf den Fußweg aus Bruchsteinplatten führte. Henriette Hellbrechts Anwesen hatte in den beiden letzten Jahren nicht gelitten. Eine schmiedeeiserne Reiherfamilie war um den kleinen Teich gesetzt worden, und auch die Marmorputten schienen sich ungebührlich vermehrt zu haben, aber ansonsten war alles unverändert.
Wie eine neuzeitliche Trutzburg lag Tante Hetties Villa im kalten Mondlicht vor ihnen. Weiß getüncht, akkurat herausgeputzt wie eh und je, schien sie geradezu von innen heraus vor Kraft zu strahlen.
»Julius.«
Hm?
»Mal angenommen, mein Name wäre Don Quichotte de la Mancha.«
Mal angenommen.
»Und du wärst mein treuer Gefährte Sancho Pansa.«
Grmmmpfff.
»Nina wäre die unerreichbare, schöne Dulcinea …«
Worauf willst du hinaus, Junge?
»Schau, dort, vor uns. Siehst du die Riesen?«
Ihr meint die Windmühlen, Herr?
»Die Riesen, Sancho! Die Riesen. Sieh, wie sie mit den Armen rudern, wie sie uns drohen.«
Er wechselte den Koffer ein letztes Mal von einer Hand in die andere, atmete tief ein und flüsterte: »Attacke!«
* * *
Bert Wallraff tippte mit dem Zeigefinger an die Seitenscheibe des Pförtnerzimmers. Der alte Bergengruen schien ihn nicht zu hören. Er hatte sich auf seinem Bürosessel zurückgelehnt und hielt die Fernbedienung am lang ausgestreckten Arm auf den kleinen Fernseher gerichtet. Die Batterie taugte nichts mehr. Immer wieder zappte er durch die Programme, und immer dann, wenn nicht gerade jemand durch das Foyer des Altenheims am Neuwieder Rheinufer ging, schaltete er rasch auf Neun Live um, wo sich zur Nachtstunde drittklassige Models in stummen Endlos-Sequenzen ihrer Spitzenunterwäsche entledigten und in Zeitlupe an sich herumkitzelten.
Gerade jetzt glaubte sich Bergengruen unbeobachtet, und um seine runzligen Mundwinkel zuckte es verräterisch.
Bert Wallraff klopfte lauter.
Bergengruen wirbelte mit seinem Bürostuhl herum, riss die Augen hinter der dicken Hornbrille weit auf und vergaß glatt das Umschalten.
Verärgert hievte er seinen alten Körper aus dem federnden Sessel und schlurfte auf Wallraff und die Glasfront zu.
»Spinnst du? Mich so zu erschrecken!«, raunzte er wenige Augenblicke später durch das geöffnete Fenster. »Noch ’n Herzkasper und ich ziehe um. Vom Pförtnerzimmer auf Stock zwei.«
Wallraff sah sich hektisch um. Auf dem Fluss zogen zwei beleuchtete Frachter rheinaufwärts durch die Nacht. Es hätte romantisch sein können. Aber Wallraff war schon längst der Sinn für diese Art von Romantik abhandengekommen.
Er fischte eine Flasche Steinhäger aus einer Plastiktüte und reichte sie Bergengruen durch das Fenster. Als der alte Pförtner immer noch sehnsüchtig auf die Tüte starrte, holte er die zweite Flasche auch noch heraus.
Bert Wallraff war klein und kugelrund. Um seinen kahlen, feisten Kopf tanzten die Mücken wie um einen Lampion. Er hatte Mühe, die Flaschen durch das Fenster ins Innere des Altenheims zu reichen. Immer wieder verfing sich sein speckiges Jackett in den dornigen Büschen, die entlang der Uferseite des Hauses gepflanzt waren.
»Was ist mit der Alten?«
Bergengruen studierte das Flaschenetikett, als sei er ernsthaft an den Ingredienzen des Gesöffs interessiert. »Hier sind nur Alte. Welche meinst du?«
»Komm, mach keinen Blödsinn, Mann. Ich habe gehört, die Verwandten sind schon bei ihr. Wird das noch was heute Nacht?«
Bergengruen zuckte mit den Schultern. »Weiß man ja nicht. Der Doktor war da, und ich habe gehört, dass der Chef schon überlegt hat, wer das Zimmer kriegt. Im Moment ist die Tochter mit ihrem Mann da. Sie guckt andauernd auf die Uhr. Ich glaube, denen wäre auch lieber, es ginge schneller.«
»Denk an mich, Bergengruen.«
Bergengruen ließ sich einen Augenblick lang von einer flachbrüstigen Blonden mit Impfnarben ablenken, die sich in einer Badewanne verrenkte. Dann wandte er sich wieder zu Wallraff um und blaffte ihn an. »Was soll ich tun? Soll ich da jetzt reinmarschieren, der Tochter auf die Schulter tippen und sagen: ›Ach, und wenn die Mama endlich ihr Besteck abgegeben hat, wartet da schon einer auf den ganzen ollen Ramsch hier aus dem Zimmer. Das Sofa wandert zur Caritas, die Klamotten machen wir zu Putzlappen, wichtig sind nur die beiden Ölschinken an der Wand.‹ So in etwa?«
Wallraff fuchtelte mit den Armen. »Sei ruhig, Mann. Du wartest natürlich ab, bis sie endlich abgeschmiert ist, und dann gibst du denen meine Karte.«
Bergengruen winkte ab. »Jaja, ist ja schon gut. Hab ich dich jemals hängen lassen?« Er hielt die beiden Schnapsflaschen in den Armen wie zwei Neugeborene.
»Tut mir leid. Ich will dir ja nicht auf den Keks gehen, aber ich hab Druck. Die Bilder kämen jetzt gerade recht.«
In diesem Augenblick ertönte ein Summen. Bergengruen verschwand vom Fenster und eilte zu seiner Schaltanlage. Einen Augenblick später kam er ohne die Flaschen zurück. Er hatte den Telefonhörer ans Ohr gepresst und zischte Wallraff zu: »Da oben geht’s los. Ich soll noch mal den Doktor rufen. Und jetzt verzieh dich.«
Wallraff atmete befreit auf und grinste nervös. Er winkte Bergengruen ein letztes Mal zu, bevor er die Uferböschung zum Radweg hinunterkraxelte. Als er sich noch einmal umwandte, sah er noch, wie Bergengruen in den Telefonhörer sprach, gleichzeitig wieder in den Sessel sank und sich zum Fernseher drehte.
Dann ging er in Richtung Parkplatz, wo er sein Auto abgestellt hatte. Er machte ein paar ungelenke Hüpfbewegungen, als er versuchte, seine Hose über den prallen Bauch hochzuziehen.
All das machte ihn nervös. Der Druck. Dieser unglaubliche Druck!
Was da in der Eifel passiert war, hatte die Dinge ganz hübsch in Unordnung gebracht. Wer konnte schon wissen, wie es jetzt weitergehen sollte?