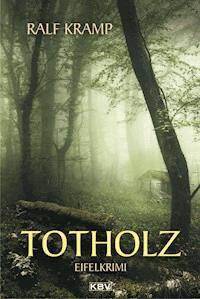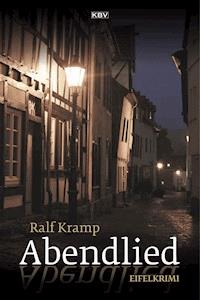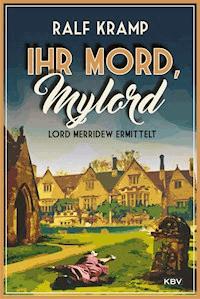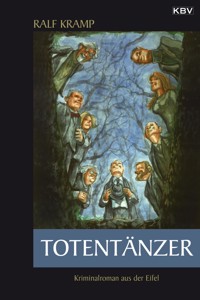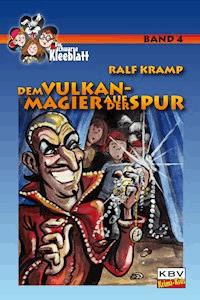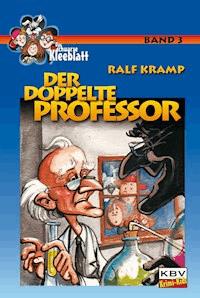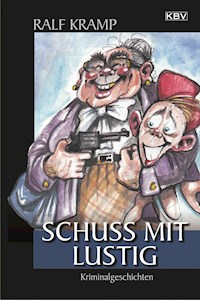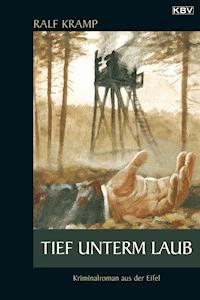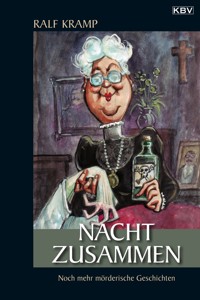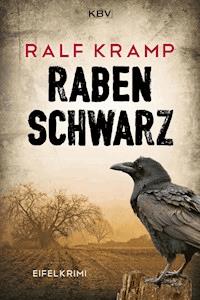
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: KBVHörbuch-Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Herbie Feldmann
- Sprache: Deutsch
Zunächst ist da nur Tante Hetties Auftrag, das rätselhafte Kidnapping ihres geliebten Schoßhündchens aufzuklären und den skrupellosen Erpresser zu stellen. Aber dann wird die Leiche von Herbies früherer Schulfreundin Rosi im Steinbruch gefunden und niemand glaubt dabei an Mord. Nur Herbie. Unverdrossen machen er und sein unvermeidlicher Schatten Julius sich auf die Suche nach der Wahrheit. Plötzlich verquicken sich die beiden Fälle auf erstaunliche Weise miteinander und führen ihn in das Dörfchen Buchscheid und in ein Nobelhotel inmitten der stillen Abgeschiedenheit der Eifel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf KrampRabenschwarz
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Tief unterm Laub
Spinner
Rabenschwarz
Der neunte Tod
Still und starr
... denn sterben muss David!
Kurz vor Schluss
Malerische Morde
Hart an der Grenze
Ein Viertelpfund Mord
Ein kaltes Haus
Totentänzer
Nacht zusammen
Stimmen im Wald
Voll ins Schwarze
Starker Abgang
Ralf Kramp, geboren am 29. November 1963 in Euskirchen, lebt heute in Flesten in der Vulkaneifel. Für sein Debüt »Tief unterm Laub« erhielt er den Förderpreis des Eifel-Literaturfestivals. Seither erschienen mehrere Kriminalromane, unter anderem auch die Reihe um den kauzigen Helden Herbie Feldmann und seinen unsichtbaren Begleiter Julius, die mittlerweile deutschlandweit eine große Fangemeinde hat. Seit 1998 veranstaltet er mit großem Erfolg unter dem Titel »Blutspur« Krimiwochenenden in der Eifel, bei denen hartgesottene Krimifans ihr angelesenes »Fachwissen« endlich bei einer Live-Mördersuche in die Tat umsetzen können.
Im Jahr 2002 erhielt er den Kulturpreis des Kreises Euskirchen.
Seit 2007 führt er mit seiner Frau Monika in Hillesheim das »Kriminalhaus« mit dem »Deutschen Krimi-Archiv« mit 30.000 Bänden, dem »Café Sherlock« und der Buchhandlung »Lesezeichen«.
www.ralfkramp.de · www.kriminalhaus.de
Ralf Kramp
Rabenschwarz
1. Auflage 19982. Auflage 20013. Auflage 20034. Auflage 20065. Auflage 2013
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Fax: 0 65 93 - 998 96-20Umschlagillustration: Ralf Kramp unter Verwendung von © waald und © kwasny221 – www.fotolia.deRedaktion: Volker Maria Neumann, KölnPrint-ISBN 978-3-934638-35-8E-Book-ISBN 978-3-95441-058-3
Für Moritz: Herzlich willkommen auf dieser,der verrücktesten aller Welten!Kinder unter einem Meter haben freien Eintritt!
Und für Maximilian de Winter, das beste alteKatervieh, das je an meiner Seite geschnurrt hat.Viele Mäuse in den ewigen Jagdgründen!
Inhalt
1951
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Nachtprophet, erzeugt von Zweifeln,
seist du Vogel oder Teufel –
Bei dem göttlichen Erbarmen,
lösch nicht diesen letzten Schimmer!
Sag’ mir, find ich nach dem trüben Erdenwallen
einst dort drüben
Sie, die von dem Engelschore
wird geheißen Leonore?
Werd’ ich sie dort einst umarmen,
meine Leonore?«
»Nimmer«,
krächzte da der Rabe, »nimmer!«
(Edgar Allan Poe, Der Rabe)
1951
(In Schwarz und Weiß und beunruhigenden Graunuancen.Farblos-freudlos. Schattenfinster)
Es war ein unaufhörliches Hecheln, Schnaufen und Rascheln, wenn sich die beiden düsteren Gestalten ihren Weg durch das hohe Gestrüpp entlang des Ackerrains bahnten. Sie schienen immer und überall gleichzeitig zu sein. Nie war man sicher, ob die beiden riesenhaften Schatten nicht im nächsten Augenblick aus dem Dickicht herauswachsen und erbarmungslos zuschlagen würden. Man fürchtete sie schon als Kind, und selbst als Erwachsener musste man auf der Hut sein, verhieß doch ihr Erscheinen stets skrupellose Behandlung und harte Bestrafung. Krechels Griff war hart und unbarmherzig. Gerade so, wie es die tiefen Furchen waren, die sich links und rechts seines verkniffenen, schmallippigen Mundes tief in sein Gesicht gegraben hatten. Furchen, vom rauen Wind über den Eifelhöhen so grob und kantig geschnitzt wie die Rinde der alten Bäume, die sich unten im Rothensief um den sumpfig nassen Wiesengrund der Sonne entgegenreckten.
Wenn Krechelfränz erschien, hatte es fast den Anschein, als wählte er seinen Standort gerade so aus, dass sich jedes Licht, ganz gleich, ob es sich um fettes, gleißendes Sommerleuchten oder nur um das magere Zwielicht nahender Winterabende handelte, stets hinter seinem Rücken und dem struppigen Nacken seines stetigen Begleiters, eines riesenhaften, verkommenen Wolfshundes, ausbreitete. Das machte die beiden Spukgestalten noch düsterer, noch bedrohlicher. Das malte ihm Schatten ins Gesicht und ließ die Angst der erwischten Missetäter wachsen – und ihre Verzweiflung.
Seine Augen lagen tief begraben in einem undurchdringlichen Gewirr harter, schnörkelloser Falten, überschattet von einem Paar buschiger Augenbrauen, grau und störrisch wie das Haar, das dicht und ungepflegt unter seinem breitkrempigen Hut hervorwuchs. Krechelfränz, der Feldschütz, den jeder mied und alle fürchteten, erschien, in der Einheit mit dem bösartigen Vieh an seiner Seite, jedem im Dorf wie eine nicht ganz reale Erscheinung, wie ein düsterer Schatten aus grauer Vorzeit, wie eine Sagenfigur, die normalerweise nur am heimischen Herdfeuer in abendlichen Erzählungen zu Furcht einflößendem Leben erwacht. Den Kindern, die man zur Vernunft bringen wollte, drohte man damit, dass der Feldschütz sie hole. Weder die Menschen aus dem Dorf, die stets in der Furcht lebten, von ihm bei einer noch so kleinen Untat in Feld und Wald erwischt zu werden, noch die Herrschaften in der Gemeinde, bei denen er in Brot und Lohn stand, suchten den Umgang mit dem Mann mit dem schmutzig grünen Lodenmantel und dem schwieligen Eichenknüppel.
Sein Hund wurde von ihm mit knapp bemessenem Futter verpflegt, doch ebenso wie das Vieh bei passender Gelegenheit nicht gezögert hätte, ihm die Kehle zu zerreißen, so würde auch er nicht mit der Wimper zucken, wenn es eines Tages daran ginge, dem widerlichen Untier mit einem kräftigen Schlag des schweren Knüppels den Schädel zu spalten.
Man hatte alles verloren. Das Land war verwüstet, das Saatgut knapp, die Maschinen zerstört. Die Eifel war arm, immer schon ein bisschen ärmer als andere Landstriche gewesen. Doch jetzt, nach dem Krieg, der bis zuletzt in greifbarer Nähe am Westwall getobt hatte, war es um diese Landschaft noch ärger bestellt. Der Hunger nagte unbarmherzig an den Mägen der Einwohner Buchscheids, und allzu deutlich musste man jeden Tag aufs Neue erfahren, dass Gotteslob und Frömmigkeit allein nicht satt machten.
So trieb es die Menschen in die Sünde. Besonders Mutige überquerten die neue Grenze nach Belgien. Zu Fuß. Bei Nacht. In kleinen Trupps und auf eigene Faust. Tagelang blieben sie fort. Oft genug kam es vor, dass sie nicht zurückkehrten. Statt Lebensmitteln und dem erträumten Stück Schokolade erhielt man nur Nachricht von der Verhaftung.
Andere schlugen sich in die Wälder, bauten Fallen, jagten Kaninchen, schlichen sich angsterfüllt auf die Felder, gruben Kartoffeln aus, stahlen Kohlköpfe.
Krechel fing sie. Er packte sie beim Nacken und zerrte sie an ihrem Kragen zu sich hinauf, sodass sie in Todesangst, nach Luft schnappend, um ihr Leben winselten. Niemand hatte den Mut zur Gegenwehr. Das tiefe, rollende Knurren des gemeinen Köters, der Schatten des hocherhobenen Knüppels, Krechels eiserne Umklammerung, all das machte sie wehrlos. Und Krechel sorgte gnadenlos dafür, dass jeden von ihnen die gerechte Strafe ereilte. Er war wie eine Maschine, die schnaufend und bösartig ihre Bahnen zieht, die nichts aufhalten kann, die sich nicht etwa an ihrer Aufgabe erfreut, sondern unbeirrt fortfährt, ihr grausames Handwerk zu verrichten. Solange, bis irgendjemand kommt und sie zu Fall bringt.
»Er kommt!« Der Junge mochte sechzehn oder siebzehn Jahre alt sein. Sein Freund, der noch rasch etwas Laub verteilte, vielleicht drei oder vier Jahre älter.
»Er sieht et«, dachte der Jüngere. »Er wird et sehen. Sofort, auf den ersten Blick!« Das Laub an der Unterseite war feucht gewesen. Die trockene, deckende obere Schicht war zerstört, wo sie die Schnur verlegt hatten und wo das Eisen lag. Jemand, der Tag und Nacht im Gelände herumstreifte, der musste es sehen, der konnte Fährten lesen. Der sah, was hier getan worden war. Aber der Schein des flackernden Feuers würde den Blick ablenken.
Es war ein kleines Feuerchen. Gerade groß genug, um Krechel anzulocken. Sie hatten ihn zuletzt unten auf der Bank am Eichbaum entdeckt, wo er eine Rast eingelegt hatte. Der Wind stand günstig. Wahrscheinlich hatte er das Feuer gerochen, noch bevor er es gesehen hatte.
Krechel war schnell. Sie konnten von Glück sagen, dass sie mit den Vorbereitungen fertig geworden waren, bevor seine schweren Schritte den Pfad zum Leeßenpesch hinauf ertönten.
Sie hörten das Hecheln des Köters. Dann schnaufte Krechel heran. Er gab sich keine Mühe, leise zu sein. Der Feldschütz war wütend. Ein Feuer war eine offene Herausforderung. Kein Mensch durfte sich ungestraft derlei Frechheiten erlauben! Wie konnte dieses lichtscheue Gesindel es wagen, mitten in der Nacht ein lustiges Lagerfeuerchen anzuzünden, um sich gestohlene Kartoffeln zu braten?
Krechels Gesichtszüge waren verkniffen wie eh und je. Auf seiner fliehenden Stirn standen Schweißperlen, seine harten Wangenknochen traten gerötet hervor. Unter dem Dickicht seiner eisgrauen Augenbrauen sandte er den schneidend scharfen Blick eines Besessenen in die Nacht, als er um die Ecke bog.
Die beiden Jungen glaubten, er müsse sie durch den schützenden Vorhang des reifen, dürren Maisfeldes hindurch sehen, als er an ihnen vorüberstapfte. Aber weder er noch sein Hund nahmen Notiz von ihnen, sie hasteten auf das mickrige Feuerchen zu, die nackte Wut im Blick, keuchend den Atem in die kühle Nacht hinausstoßend. Unaufhaltsam liefen sie bergan, auf das Feuer zu. Krechel begann, den Blick nun nach rechts und links auszusenden. Er hielt hastig nach den Übeltätern Ausschau, seine Augen sondierten das Gelände rund um die Feuerstelle. Er erreichte schließlich das kleine Plateau, auf dem mit sachtem Knistern und leisem Knacken die Flammen ab und an einen munteren Funkenwirbel in die Nacht aufsteigen ließen.
In diesem Moment zerriss das schmerzverzerrte Aufheulen des Köters die klare Nachtluft. Der schrille Ton ließ den Jungen in ihrem Versteck das Blut in den Adern gefrieren, und der Ältere erinnerte sich nur mit Mühe daran, dass es nun Zeit war, die Schnur anzuzünden. Während Krechel hastig auf seinen winselnden Hund zustolperte, brachte der Junge es mit zitternden Fingern fertig, das Streichholz zu zünden. Er hielt es an das Ende der Lunte, die sofort mit leisem Zischen in Brand geriet. Das prasselnde Flämmchen begann mit atemberaubender Geschwindigkeit seine Reise, bahnte sich seinen Weg durch struppiges Gras und klebriges Laub und marschierte unaufhörlich den Weg hinauf, den soeben noch der Feldhüter und sein Hund genommen hatten.
Der gellende Schrei des Mannes verhieß den beiden Jungen, dass auch der zweite Teil ihres Plans reibungslos funktionierte. Sie rannten los.
Krechel war neben seinem Hund zusammengebrochen. Ein scharfer Schmerz durchfuhr seinen linken Knöchel. Die Zähne des Fangeisens hatten sich tief in das sehnige Fleisch seines Fußes geschlagen, genauso wie das andere Eisen wenige Augenblicke zuvor dem Hund mit einem Schlag beinahe den rechten Vorderlauf zerfetzt hatte. Der Hund winselte und heulte, Krechel versuchte hastig und mit zitternden Händen, seinen Fuß aus der eisernen Umklammerung zu lösen. Seine Hand rutschte an dem blutigen Metall ab, er verlor das Gleichgewicht und stürzte nach hinten. Ein drittes Eisen sprang mit einem metallischen Schnappen ein paar Zentimeter in die Höhe, als es sich um seine rechte Hand schloss. Krechel heulte auf. Es war ein unmenschlicher Schrei, tief und röhrend, wie ein sterbendes Tier ihn in die Tiefe der Nacht hinausschreit.
»Wir hätten et net tun dürfen!« Der Kleinere heulte, während sie auf den Bunker zurannten. »Halt dein Maul, un renn!«, rief der andere. Die heftigen Laufbewegungen ließen ihre Stimmen erbeben. Dürres Maisgestrüpp raschelte um ihre nackten Waden. Der Bunker tauchte vor ihnen auf. Lange Zeit hatte er Soldaten Schutz vor den feindlichen Truppen geboten.
Durch den hämmernden Schmerz hindurch bemerkte Krechel wie im Fieber etwas Fremdes, etwas, das nicht hergehörte. Das Zischen kam näher. Er sah das kleine Rauchwölkchen, das unter dem Laub hervorquoll. Er sah die kleine Wölbung im Maisfeld, die erst kürzlich jemand aufgeschüttet haben musste. Als er begriff, was geschehen würde, war es schon zu spät. Trotz des unbändigen Schmerzes versuchte er, auf die Zündschnur zuzurobben. Mit der ausgestreckten Linken versuchte er, danach zu greifen, die kleine Flamme mit der bloßen Hand zu löschen. Seine Hand griff ins Leere, wirbelte Laub auf, krallte sich verzweifelt in die feuchte Erde, kratzte, griff, zitterte ...
Die Jungen warfen sich in dem Moment hinter die meterdicken Trümmer des zerbombten Bunkers, in dem der Sprengsatz explodierte; keuchend blieben sie für einige Sekunden am Boden liegen. Die Detonation war ohrenbetäubend laut gewesen, hatte sich hundertfach in der lautlosen Schwärze der Nacht fortgepflanzt. Ein Schwarm Krähen war aus seinen Schlafbäumen hochgeschreckt und flatterte hektisch kreischend ins Dunkel davon. Das war keine kleine Explosion gewesen, die dazu diente, jemandem wie Krechel einen gehörigen Schrecken einzujagen. Dies war ein todbringendes Inferno gewesen, wie sie es nicht beabsichtigt hatten. Schweigend sahen sie sich durch die beinahe undurchdringliche Finsternis an.
Als alles still wurde, spähte der Ältere über den Rand der Bunkerruine hinweg zu der Stelle, wo eben noch Krechel mit dem Tode gerungen hatte. Das Feuer war in alle vier Winde zerstoben. Kleine Flammen flackerten hier und da rund um den entstandenen Krater auf. Im schwachen Mondlicht konnte man die Leiche des Feldhüters und den Tierkadaver nur ungenau ausmachen. Zerfetzt und zersprengt lagen sie mehrere Meter weit von der Stelle der Explosion entfernt.
»Wat hammer da jetan? Wir hätten et net tun dürfen! Dat durften mer net!« Der Kleinere kauerte unterhalb des fetten Betonblocks und heulte Rotz und Wasser.
»Dat konnte ja keiner wissen, dat dat Zeuch so stark is ...«, bekräftigte sein Freund tonlos. »Un trotzdem ... Verdient hat dat Schwein et. Denk an unsere Väter! Wenn die im Knast sterben, is dat nur de Krechel schuld!« Beruhigend legte er dem Jüngeren die Hand auf die Schulter. »Komm, mir müssen weg, bevor einer kommt! Die Fangeisen müssen noch weg. Ich mach dat schon.« Seine Kiefer mahlten verbissen, seine Hände zitterten, und als er sich aus dem Schutz des Bunkers hinausbegab, flüsterte er unaufhörlich: »Der tut keinem mehr wat zuleide! Dat Schwein is tot!«
Erstes Kapitel
(Zwar wieder im Dunkel, doch diesmal in tröstlicheFarbschattierungen getaucht.)
So ein Bahnhof bei Nacht hat etwas Trostloses. Hie und da lungerten noch ein paar abgerissene Gestalten in der Dunkelheit zwischen den grellen Lichtflecken herum, die die Beleuchtung auf den Vorplatz malte. Eine Flasche zersplitterte klirrend, ein Auto raste mit laut dröhnenden Bässen vorbei. Aus der Halle des Euskirchener Bahnhofs erscholl Männergeschrei. Kley seufzte tief. So hatte er sich seine Heimkehr nicht vorgestellt. Als er auf dem Köln-Bonner Flughafen gelandet war, da hatte ihn der Anblick des erleuchteten Rheinlands noch freudig erregt. Sauber und glitzernd hatte Köln ihm zu Füßen gelegen, als er aus dem Fenster der Boeing geschaut hatte. Millionen von kleinen Lichtern funkelten entlang der verworrenen Straßenzüge und erinnerten an den Albtraum eines jeden Familienvaters vor dem Weihnachtsfest: verknotete Lichterketten, die es galt zu entwirren, um sie um den Tannenbaum zu drapieren.
Die Zugfahrt nach Euskirchen allerdings hatte das Bild rasch zerstört. Schmutzig gelblicher Lichtschein umwusch die kleinen Bahnhöfe, die, abwechselnd mit Schrottplätzen, wild wucherndem Gestrüpp und verödetem Industriegelände, am Fenster vorbeiflogen. Er war viel unterwegs, und trotzdem schockierte ihn immer wieder, dass sich jedes Land entlang der Bahnstrecke von seiner unwirtlichsten Seite zeigte.
Jetzt stand er an einer der Bushaltebuchten und versuchte angestrengt, im Halbdunkel den Fahrplan der Strecke Euskirchen-Bad Münstereifel zu studieren. Aber so oft er auch die einzelnen Spalten durchforstete: Der letzte Bus in die Kurstadt war längst abgefahren. Kley seufzte und ergriff resignierend seine beiden Koffer. Er musste ein Taxi nehmen. Das hätte er von Münstereifel aus ohnehin tun müssen, um nach Buchscheid zu kommen. Er tröstete sich damit, dass das am Ende sowieso die bequemere Lösung war.
Er wollte sich gerade auf den Weg zu dem Taxistand am anderen Ende des Bahnhofsgebäudes machen, als ihn aus dem Zwielicht heraus jemand ansprach.
»Ist das nicht Kley? Richard Kley?«
Er fuhr herum und entdeckte eine kleine Gestalt am anderen Ende der Bushalteinsel. Der Mann kam ihm bekannt vor. Ein junger Kerl, Mitte dreißig, blond, unscheinbar ... Kley erinnerte sich zögernd. »Herbie?«, fragte er zaghaft. Es war die Abiturklasse. Es war das Gymnasium in Bad Münstereifel gewesen. »Du bist Herbert Feldmann!«
Der junge Mann eilte auf ihn zu, und Richard Kley bemerkte den raschen Blick, den Herbie Feldmann nach hinten warf. Nur für den Bruchteil einer Sekunde huschte der Blick zur Seite, aber Kley erinnerte sich sofort an alles: an Herbies Nervenzusammenbruch nach der Schulzeit, an die Nachricht, dass er in psychiatrischer Behandlung war, an Julius, einen großen, fetten, bärtigen Mann, den Herbie von da an stets neben sich wähnte. Dieser kurze Seitenblick sagte ihm alles: Es war Herbie Feldmann, der harmlose, kleine Kerl, den sie immer alle gemocht hatten und den später dieses furchtbare Schicksal ereilt hatte. Er war Vollwaise, hatte beide Eltern bei einem Autounfall verloren und war in den Genuss eines immensen Vermögens gelangt, von dem er allerdings nie viel zu sehen bekam, weil seine Tante wie ein Zerberus treuhänderisch darüber wachte, seit Herbie vorübergehend in der Psychiatrie gelandet war. Als Kley die Eifel verlassen hatte, lebte Feldmann in Euskirchen, teilte eine kleine Wohnung mit dem bärtigen Hünen namens Julius, den niemand jemals sah oder hörte, außer Herbie selbst. Ein Hirngespinst, gegen dessen Existenz die Bemühungen sämtlicher herbeizitierter Psychiater machtlos waren.
Sie schüttelten einander herzlich die Hand.
»Du bist zurückgekommen?« Herbie lächelte ihn an. Ehrlich erfreut, wie es schien. Sie hatten nach der Schule keine wirkliche Freundschaft aufrechterhalten, aber trotzdem vermittelte Herbie immer, wenn sie sich getroffen hatten, das Gefühl echter Wiedersehensfreude. »Du warst lange weg!«
»Zwei Jahre. Fast. Nächsten Monat wären es genau zwei Jahre. Und ehrlich gesagt ... nach der Zugfahrt ... nach dem, was man da so aus dem Fenster betrachten kann, da hätte ich mir fast gewünscht, ich wäre in Australien geblieben.« Herbie lachte pflichtschuldig. Er hatte nie verstehen können, warum es überhaupt irgendjemanden für einen solch langen Zeitraum in die Ferne ziehen konnte. Richard Kley hatte seine eigenen Gründe gehabt. Geheime Gründe, die aber doch jedermann kannte. Beim letzten Klassentreffen, vor einem knappen Jahr, war diese Geschichte ausführlich debattiert worden. Es war eine Flucht gewesen. Jetzt war er zurückgekehrt.
Erneut bahnte sich ein Golf GTI mit großem Getöse und dröhnender Musik, die nur aus Bässen zu bestehen schien, den Weg durch den späten Abend.
»Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von hier nach Hause kommen soll. Der letzte Bus nach Münstereifel ist weg, und ich fürchte fast, ich werde mir ein Taxi nehmen müssen.« Richard fuhr ratlos mit dem Finger auf dem Fahrplan hin und her.
»Da wird dir nichts anderes übrig bleiben. Wir können uns eins teilen, wenn du willst. Ich muss auch unbedingt nach Münstereifel. Tante Hetti ... Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal von meiner Tante erzählt habe. Sie macht es immer sehr dringend. Ich habe genau noch eine halbe Stunde, um bei ihr auf der Matte zu stehen, bevor sie mir die Polizei oder die Feldjäger auf den Hals hetzt.«
»Ist er auch immer noch dabei?« Richard Kley deutete mit dem Finger in die Dunkelheit hinter Herbie. Dieser wurde ein wenig unsicher.
»Julius? Na ja, klar! Julius ist immer noch da. Weicht mir nicht von der Seite. Scheint einen richtigen Narren an mir gefressen zu haben.« Herbie kicherte verlegen.
Nicht ganz der richtige Ausdruck, mein Teuerster. Was mich an dich bindet, habe ich in all den Jahren nie so recht herausgefunden. Nenne es Mitleid, nenne es Schadenfreude, aber nenne es nie Sympathie, wenn jemand zuhört! Mit geziertem Schritt balancierte Julius seinen riesigen Körper hinter den beiden jungen Leuten her, während sie zum Taxistand schlenderten. Herbie hatte einen von Richards Koffern genommen, und beinahe augenblicklich mündete ihr Gespräch in einen nicht enden wollenden Fluss von Erinnerungen an vergangene Schultage in der kleinen Kurstadt. Richard Kley war wieder da. Der Einzige aus ihrer Klasse, der ein Glas Bier im Kopfstand austrinken konnte.
Das Taxi war einer dieser mit grässlicher Baumarktreklame zugekleisterten Neuimporte aus England, eine dieser Altweißversionen der berühmten Londoner Beförderungsmittel, in deren Innerem man britisch steif und aufrecht sitzen konnte, ohne den berühmten Bowlerhat vom Kopf zu nehmen. Weder Richard noch Herbie trugen irgendeine Form von Kopfbedeckung, aber mit raschem Seitenblick stellte Herbie fest, dass sein Begleiter Julius den selbst für seine üppigen Körpermaße komfortablen Innenraum des Fahrzeugs mit anerkennendem Kopfnicken bewertete.
»Der alte Scharrenbroich ist im letzten Herbst gestorben«, knüpfte Herbie an dem kurzfristig unterbrochenen Gespräch über ehemalige Mitschüler und Lehrpersonen an.
»Scharrenbroich ... Scharrenbroich?« Richard Kley grübelte.
»Der, der den Mädels immer so in den Ausschnitt geguckt hat. Besonders der Rischmann, du erinnerst dich doch. Die mit den dicken ...« Herbie imitierte einen stieren Blick über den Rand einer imaginären Lesebrille und formte mit den Händen zwei melonengroße Halbkugeln in der Luft. »Weißt du, der, von dem wir immer angenommen hatten, die Elke Beck hätte damals, nach diesem Kurstreffen, bei ihm ... na, du weißt schon.«
Richard schien sich zu erinnern. »Mathe, stimmt’s? Den hatte ich ja selber nie. War’n anderer Kurs. Ich hatte Mathe-Leistung bei Kögel.«
Und dann entglitt Herbie ein Name, den er eigentlich nicht hatte erwähnen wollen. Ein Name, mit dem Richards Schicksal der letzten Jahre eng verknüpft war und der stets mit Richards eigenem Namen in einem Atemzug genannt wurde. Beinahe so, wie man mit dem von Herbie immer auch gleich grinsenderweise den von Julius nannte.
»Mathe-Leistung? Zusammen mit Rosi?« Und als es heraus war, da hätte Herbie sich ohrfeigen können, und er stellte doch insgeheim fest, dass er den Namen mit voller Absicht ins Spiel gebracht hatte. Um die Reaktion zu testen. Um etwas aus Richards Seelenleben zu erfahren. Oder einfach nur, weil er eben auch einer von denen war, die Richard und Rosi immer wieder gemeinsam erwähnten, so, als sei alles immer noch so wie früher.
Gratuliere. Du bist wieder ein Ausbund an Takt und Feingefühl. Julius schenkte ihm ein herablassendes Lächeln als Ausdruck seiner Geringschätzung.
Rosis Name verfehlte seine Wirkung nicht. Roswitha Brabender, die spätere Frau Kley. Und nicht nur vor Herbies Augen entstand plötzlich die kleine, zierliche Gestalt eines stupsnasigen Mädchens mit dunkelbraunen, schulterlangen Locken und einem Lachen, das allein schon Grund genug gewesen war, dass sie damals zur Schulsprecherin gewählt worden war. Dieses Lachen war wohl auch für Richard Grund genug gewesen, sich als einer der begehrtesten Jungs der Schule das begehrteste Mädchen der Schule zu angeln.
Es hätte alles so schön werden können. Eine richtige Bilderbuch-Lovestory war es gewesen. Zu schön, um wahr zu sein. So intensiv, dass sie über das Abitur hinaus dauerte. So fest, dass sie auch die Trennung während des Studiums schadlos überstand. So ernst, dass sie schließlich sogar in einer Traumhochzeit mündete.
Aber der Alltag stellt oftmals eine Prüfung dar, die härter und unbarmherziger ist als jeder Astronautentest.
Das Taxi hatte Rheder erreicht.
»Die Rosi ...«, murmelte Richard, und sein Blick wurde starr. »Ach ja, die Rosi. Hast du sie mal gesehen?«
Herbie nickte stumm. Er war Rosi erst vor ein paar Wochen im Café T in Bad Münstereifel begegnet. Sie sah gut aus. Sie hatte immer gut ausgesehen. Erstaunlich gut, selbst damals, als Richard seine Koffer gepackt hatte. Seit anderthalb Jahren arbeitete sie in einem Kindergarten in Bad Münstereifel. Eine Arbeit, die sie ganz auszufüllen schien.
Richards Beruf hatte ihnen wohl einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht, so vermutete man damals. Auch beim letzten Klassentreffen hatte Herbie wieder diese Version gehört. Richard war immer ein echter Technikfreak gewesen. Auf den Computerboom war er als einer der Ersten voll abgefahren, was seinen Berufsweg von vornherein fest vorgezeichnet hatte. Er hatte sein Hobby schon bald zum Beruf gemacht und ging in seiner Arbeit voll auf. Der Computerjob in Köln vereinnahmte ihn ganz und gar. All die Schulungen, die Seminare. Die Reisen kreuz und quer durch die Republik, in die Staaten ...
Richard Kley war nie ein Streber gewesen. Seine schulischen Erfolge kassierte er mit der zufriedenen Gelassenheit eines serienmäßigen Gewinners ab. Wenn er seine Mitschüler jemals mit etwas genervt hatte, dann war es eher seine schamlose Tiefstapelei, die die anderen beschämte. Ein echter winner, dieser Richard Kley. Herbie selber hatte immer neidvoll zu ihm emporgeblickt und hatte verständnislos mitverfolgt, wie Richard seine Freundinnen wechselte wie Herbie das kleine metallene Monatskalenderchen an seiner Armbanduhr.
Herbie selbst flüchtete sich damals in die absolute Unscheinbarkeit, und es schien ihm nichts erstrebenswerter, als farblich und strukturell mit der Tapete zu verschmelzen, vor der er sich gerade eben befand.
Du warst ein echter Draufgänger, was? Jammerschade, dass ich dich damals nicht kannte. Du hättest gewiss ein paar meiner aufbauenden Ratschläge gebrauchen können, sagte Julius näselnd und schickte ein schnarchendes Kichern hinterher, um die ironische Note seiner Bemerkung zu unterstreichen.
Der Taxifahrer betätigte kurz das Fernlicht und schimpfte halblaut einem entgegenkommenden Fahrzeug hinterher, das nicht rechtzeitig abgeblendet hatte. Sie überquerten hoppelnd die Eisenbahnschienen bei Kirspenich. Über Bad Münstereifel leuchtete der Himmel gelblich vom warmen Licht der Burg- und Stadtbeleuchtung.
Als Herbie so an seine Schulzeit zurückdachte und sich die ein oder andere der allzu häufigen Gelegenheiten ins Gedächtnis zurückrief, bei denen er am liebsten vor Scham im Fliesenboden oder oftmals auch im Kunststoffbodenbelag der Turnhalle versunken wäre, da wusste er plötzlich, warum Richard geflohen war. Er wusste, dass es in einem kleinen Dorf tödlich sein konnte, ins Gerede zu kommen. Er wusste, was das für ein Gefühl war, wenn man verlacht wurde, und er ahnte, wie viel schlimmer es sein musste, wenn es zum ersten Mal geschah. Wenn man es nicht gewohnt war, traf es einen vermutlich viel härter. Da konnte man vielleicht gar nicht anders als die Flucht ergreifen.
»Ich habe mit Rosi telefoniert.« Richard blickte aus dem Fenster. Sein Gesicht war ausdruckslos und verschlossen.
Herbie war verblüfft. Was hatte Richard vor? Sollte nach zwei Jahren das Kriegsbeil begraben werden? War diese Liebe stark genug gewesen, um sich jetzt zu regenerieren?
»Sie hat mich in Sydney in der Firma erreicht. Es geht um den Tod meines Onkels. Onkel Paul aus Buchscheid. Du kennst ihn nicht, glaube ich.« Er steckte sich eine Zigarette an. »Fand ich nett.«
»Ihr habt die ganze Zeit nicht miteinander gesprochen?«
Richard schüttelte den Kopf und blickte wieder aus dem Fenster. Die kantigen Strukturen des Iversheimer Lärmschutzwalls rauschten an ihnen vorbei. »Ich hab’s nicht fertiggebracht. Ich bin noch nie gut im Verzeihen gewesen. Ich wollte einfach nicht zurückblicken. Schließlich hat sie ...«
Er ließ den Satz unvollendet in der Luft hängen. Er wusste, dass Herbie im Bilde war. Es hatte sich im Nu herumgesprochen. Sie hatte ihn zum Gespött des Dorfes gemacht. Wäre Richard alleine nach Hause gekommen, hätte vielleicht niemals jemand etwas erfahren. Aber soweit Herbie sich an das ihm Erzählte erinnerte, war irgendjemand bei ihm gewesen. Irgendjemand aus dem Dorf, der den Mitgliedsbeitrag für den Karnevalsverein kassieren wollte. Das machte man noch so in Buchscheid. Von Tür zu Tür. Und dann hatten sie es gesehen. Das, was der Kassierer und auch Richard bestenfalls aus irgendwelchen Filmen kannten, was auf der Leinwand und auf dem Bildschirm ganz natürlich daherkam, was Männerherzen vor Freude hüpfen ließ.
Richards Herz hatte nicht gehüpft, als er Rosi entdeckte. Vollkommen nackt. In trauter Zweisamkeit mit ihrer besten Freundin Bea. Auf dem Sofa und mit einer Flasche Wein. »Softporno live«, so hatte es der Kassenwart der Karnevalsgesellschaft Löstige Höhner Bösched 1956 e.V. später grölend bei irgendeiner Gelegenheit in der Dorfkneipe formuliert. Vermutlich war es dem Überraschungseffekt zu verdanken, dass Rosi und ihre Freundin es schafften, sich rechtzeitig wieder in ihre Textilien zu hüllen, bevor sich der Rest der karnevalistischen Vereinigung zusammenfand.
»Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich ihr gegenübertreten soll«, murmelte Richard und zog gierig an seiner Zigarette.
»Rauchverbot!«, rief der Taxichauffeur von vorne und deutete auf ein entsprechendes Schildchen am Türpolster.
Nervös warf Richard den Rest der Zigarette aus dem Fenster, das er für eine Sekunde einen Spalt öffnete. Der Fahrtwind rauschte herein und zerriss die Stille.
»Na, ich glaube, ich werde einfach hineinspazieren und so tun, als sei nichts gewesen. Wir werden reden ... später. Aber zuerst müssen wir einen Waffenstillstand schließen. Oder?«
Er lächelte Herbie dünn an.
Julius räusperte sich und schlug das Revers hoch. Seine Reaktion auf das für Bruchteile von Sekunden geöffnete Fenster. Der junge Mann hat ausgesprochen weiche Knie. Ihr sitzt gewissermaßen im selben Boot. Nur fürchte ich beinahe, dass seine Mission die schwierigere ist.
Herbie hätte fast entgegnet, dass sich das erst herausstellen müsse, bremste sich aber sofort und bedachte Richard mit einem ausgesprochen schwachen Trost: »Mach dir mal keine Sorgen! Das wird schon wieder.«
Das wird schon wieder ... das wird schon wieder ... Du solltest zur Telefonseelsorge gehen, bei deinem ausgeprägten Seelentröstertalent.
Unterdessen lenkte der Taxifahrer sein cremeweißes Vehikel die steil ansteigende Windhecke hinauf, die, spärlich von Straßenlaternen illuminiert, verlassen und fast ein wenig geheimnisvoll dalag.
Tante Hettis protziges Anwesen war schon von Weitem zu entdecken. Irgendetwas hatte die alte Dame dazu veranlasst, die gesamte Außenbeleuchtung einzuschalten, was zur Folge hatte, dass die Einfahrt schon durch das herbstlich lichte Strauchwerk zu erahnen war, noch bevor sie um die Ecke bogen.
Ein gutes Dutzend schmiedeeiserner Laternen schickten ihr Licht in die Nacht, zwei extrem starke Scheinwerfer, die sonst mithilfe eines Bewegungsmelders jeden Einbrecher in die Flucht schlugen, waren auf Dauerbetrieb umgestellt, und in dem Teil des Gartens, den man von der Straße aus einsehen konnte, wurden Sträucher und Beete von einer Niedervoltlichtanlage in milchiges Gelb getaucht. Selbst der Springbrunnen plätscherte vollständig illuminiert vor sich hin, und auch an der Straßenfront des Hauses war kein Fenster zu entdecken, hinter dem nicht mindestens eine Lampe brannte.
»Fete?«, fragte der Taxifahrer vorlaut.
»Glaub ich kaum«, murmelte Herbie, der staunend versuchte, die Situation zu erfassen. Zu Richard gewandt erklärte er: »Diesmal scheint es etwas wirklich Dringendes zu sein. Ich meine, sie macht ja immer viel Wind und so, aber so was hat mich noch nie erwartet.«
Vielleicht pflegt sie Kontakt zu Außerirdischen, und wir müssen nur ein paar Momente warten, bis sie mithilfe ihrer Hauptsicherung ein paar kryptische Morsesignale ins All schickt.
Richard zeigte Herbie den hochgestreckten Daumen, als dieser ausstieg. Er wünschte viel Glück und bestand darauf, die Kosten des Taxis zu übernehmen. »Ich hätte ohnehin über Münstereifel fahren müssen.«
Herbie reichte ihm durch die heruntergekurbelte Scheibe die Hand. »Auch für dich viel Glück. Sehen wir uns?«
Richard grinste gequält. »Kommt ganz drauf an, wie lange ich in Deutschland bleibe. Kommt wirklich ganz drauf an.«
»Bestell Rosi viele Grüße!«
»Mach ich.«
Herbie und Julius blickten für einen Moment den kurios geformten Umrissen des englischen Taxis nach, bis es hinter dem dichten Gesträuch an der nächsten Straßenecke verschwunden war. Dann wandten sie sich wieder dem Haus zu und betraten tapfer die hellerleuchtete Einfahrt.
»Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es hier wärmer ist. Kann das sein?«
Julius zuckte mit den tweedverhüllten Schultern. Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Wenn man grob die Wattzahlen addiert... Es wäre zweifellos interessant herauszufinden, inwieweit sich die Beleuchtung auf die Motten- und Mückenpopulation in der Umgegend auswirkt.
Sie schritten nebeneinander die rötlichen Steinplatten entlang auf die Haustüre zu. Herbie zaghaft und unsicher, Julius mit hinter dem Rücken verschränkten Armen und munter summend.
Noch bevor sie das kleine Podest am Eingang erreicht hatten, wurde die schwere Holztüre aufgerissen, und Tante Hettis zierliche Figur trat in das Flutlicht hinaus.
Irgendetwas war heute Abend anders an ihr. Nervös fummelte ihre Rechte am Knauf ihrer orientalischen Krücke herum, und ihr obligatorisches »Da bist du ja endlich!« hatte diesmal einen ungewohnt gebrochenen Klang. Sie wirkte fahrig und hilflos. Ein Zustand, in dem sie sie in all den Jahren der Bitt-, Bettel- und Demutsbesuche noch niemals vorgefunden hatten. Doch da war noch etwas oder vielmehr, etwas war nicht da. Irgendetwas fehlte in dem gewohnten Bild.
Zweites Kapitel
Richard Kley bezahlte den Taxifahrer und stieg aus. Als er die Autotüre hinter sich zugeschlagen hatte, wandte er sich nicht mehr um. Er konnte den Blick nicht von seinem früheren Eigenheim abwenden. Nur noch mit halbem Ohr hörte er, wie sich das Fahrzeug langsam entfernte, die Anhöhe hinunterfuhr und wieder in Richtung Euskirchen verschwand. Dann umfing ihn die spärlich flüsternde Geräuschkulisse des nächtlichen Dörfchens. Ein schwacher Wind strich durch das kaum mehr belaubte Geäst der beiden alten Buchen, die das Grundstück zur Straße hin säumten. Von links erklang für einen Moment das hysterische Geschrei zweier Katzen, die einander anscheinend ins Gehege gekommen waren.
Das Haus lag unterhalb des Straßenniveaus am Ende einer flach abfallenden Steintreppe. Es gab keinerlei Zaun. Sträucher und Büsche wucherten wild. Gärtnern war noch nie Rosis Stärke gewesen. In seiner Abwesenheit schien sich die Natur endgültig den Vormarsch erkämpft zu haben. Richard lächelte wehmütig und blieb minutenlang schweigend stehen. Das Haus selber war alt. Nicht alt genug, um wirklich schön zu sein. Es hatte Verwandten von Rosi gehört, die es irgendwann in den Fünfzigern hier oben am Ortsrand errichtet hatten. Den schmucklosen Rauputz hatte man damals vermutlich für sehr attraktiv gehalten.
Für sie beide war es ein Traum gewesen. Die eigenen vier Wände mitten in der Natur. Dank Rosis Erbschaft verfügten sie schon in jungen Jahren über ein eigenes Heim. Vielleicht war alles zu früh gewesen. Vielleicht hätten sie erst einmal miteinander gegen die Widrigkeiten des täglichen Lebens ankämpfen müssen, um für immer und ewig miteinander verschweißt zu werden. Vielleicht war aber auch alles vorherbestimmt gewesen, so, wie Rosi es vermutlich mit irgendeiner ihrer fernöstlichen Weisheiten, die sie so faszinierten, erklärt haben würde.
Es brannte kein einziges Licht im Haus. Er sah auf die Leuchtziffern seiner Uhr. Gleich elf. Im nächsten Haus, das ungefähr zweihundert Meter weiter die Straße hinunter stand, schimmerte hinter einem orangefarbenen Vorhang noch Licht in die Nacht hinaus. Der alte Kirsch konnte bestimmt noch nicht schlafen.
Richard gab sich einen Ruck.
Er drückte den Klingelknopf neben der schmucklosen braunen Haustüre. Ein schrilles Klingelgeräusch zerriss die Nacht. Es war noch lauter, als Richard erwartet hatte. Er hatte es immer gehasst, und sie hatten sich schon damals fest vorgenommen, sich irgendeine harmonisch klingende Hausglocke zuzulegen. Hätte er damals doch nur geklingelt, bevor er mit diesem Hans-Willi ... wie hieß der doch gleich ...?
Im Haus rührte sich nichts.
Er klingelte erneut. Es schrillte und schepperte, und er war sich sicher, dass man es noch im Haus des alten Kirsch hören konnte.
Nach weiteren nervenaufreibenden Minuten in der Dunkelheit, in denen der Strom der Erinnerungen sich ungehemmt seinen Weg bahnte und es beinahe schaffte, dass Richard die Tränen in die Augen traten, fischte er aus dem Schlüsselbund, mit dem er seit geraumer Zeit nervös in der Jackentasche herumgespielt hatte, einen kleinen BKS-Schlüssel heraus. Er wog ihn einen Augenblick in der Rechten, bevor er ihn schließlich ins Schloss steckte und drehte. Mit einem leisen Schnappgeräusch öffnete sich die Türe und schwang ein paar Zentimeter auf. Dahinter herrschte Finsternis. Zögernd trat er ein. Die Luft roch abgestanden, beinahe ein wenig säuerlich. Seine Hand ertastete den Lichtschalter, als habe seine Abwesenheit höchstens zwei Wochen und nicht zwei Jahre betragen.
Die Diele schien ihm nicht nennenswert verändert. Richard versuchte, sich an die Farbe der Vorhänge zu erinnern. Es schien ihm, als ... aber möglicherweise spielte ihm das künstliche Licht einen Streich. Im angrenzenden Wohnzimmer ging es ihm ähnlich. Ein paar Bilder erschienen ihm ungewohnt, ein neuer Teppich schien auf dem Boden zu liegen. War das noch der alte Fernseher? Er registrierte alles mit wenig Sorgfalt. Etwas anderes machte ihn unruhig. Rosi war nicht da. Er kehrte zurück in ein verlassenes Zuhause, das nicht mehr das seine war. Dann sah er die Fotografie.
Der zierliche Metallrahmen stand auf der Durchreiche zur Küche, ein wenig abgewinkelt, sodass er von der Sitzgruppe aus am besten zu sehen war. Er enthielt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Rosi. Richard ging näher heran und nahm das Foto in beide Hände. Sie hatte ihr dunkelbraunes langes Haar hochgesteckt. Das Licht fiel von rechts auf ihr Profil und tauchte die andere Hälfte des Gesichts in einen düsteren Schlagschatten. Es handelte sich um eine meisterliche Fotografie. Rosi blickte ihn mit melancholischem Gesichtsausdruck an. Aus seinem linken Augenwinkel löste sich eine Träne.
Ein Geräusch hinter ihm ließ ihn jäh herumfahren. Es hätte nicht viel gefehlt, und er hätte die gerahmte Fotografie fallen lassen.
Aus der Diele ertönte erneut ein Geräusch. Er hatte die Türe nicht hinter sich geschlossen, als er hereingekommen war. Ein leises Rufen ertönte.
»Hallo!«
Verunsichert trat Richard auf den Durchlass zur Diele zu.
Ein Schopf wirr gelockter grauer Haare wurde zur offenstehenden Haustüre hereingesteckt. Darunter zwinkerte ein Augenpaar nervös hinter dicken Brillengläsern. Richard erkannte Frau Stoffels sofort wieder. Ein Dutzend Falten mochte sich in der Zwischenzeit zusätzlich in ihr Gesicht gegraben haben, aber ansonsten schien sie unverändert. Selbst ihr Auftritt war typisch. Ihr gestreckter Hals, der sich um die Kante der Türe herumwand, war symptomatisch für ihre unbeschreibliche Neugier, für die die alte Haushälterin des Pastors weit über Buchscheids Grenzen hinaus verschrien war. Im Halbdunkel hinter ihr konnte Richard schemenhaft die Umrisse ihres Bruders, des alten Kirsch, erkennen. Was für ein Empfangskommando.
»Richard«, hauchte sie, während er den beiden die Türe vollends öffnete, ohne dass er erkennen konnte, welcher Art die Emotionen waren, die in ihrer Äußerung mitschwangen.
»Ja, ich bin’s. Gerade angekommen.«
»Haben wir uns schon gedacht. Da war ja deine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Du hast gesagt, du kämst heute Abend ... hat man uns erzählt.«
»Sie wissen nicht zufällig, wo meine ... wo die Rosi ist?« Wenn überhaupt jemand wusste, wo sich wer wann in Buchscheid aufhielt, dann war es Agnes Stoffels.
Und sie wusste es.
»Die Rosi? Ja, wie soll ich das sagen, Junge?« Hilfesuchend schickte sie einen Blick zu ihrem Bruder. »Weißt du, da war dieser Unfall. Heute Morgen. Und die Rosi ... ja, die Rosi, die ist ja jetzt tot.«
Tante Hettis Hand zitterte, als sie den Briefumschlag öffnete und hineingriff. Sie förderte schweratmend etwas zutage, das vom anderen Ende des goldverbrämten Couchtischs etwa so wie ein Büschel türkisfarbener Haare aussah. Als Herbie sich hinüberbeugte und es aus ihrer knochigen Hand entgegennahm, stellte sich heraus, dass es ein türkisfarbenes Büschel Haare war.
»Das soll ein Beweis sein!«, zeterte seine Tante. »Wofür, bitte schön, ist das ein Beweis, frage ich dich!« Sie trank nervös einen weiteren Schluck Pfefferminzlikör.
Es könnte sich um den schlagenden Beweis im Rechtsstreit gegen eine Haarwaschmittelfirma handeln, näselte Julius mit wichtigtuerischem Tonfall und näherte seine Nasenspitze dem flauschigen Objekt. Herbie sah kurz und unsicher zu ihm hinauf, was seine Tante stutzen ließ. Sollte ihr meschugger Neffe am Ende wieder diesen Wahnvorstellungen in Gestalt eines fetten, bärtigen Lebensgefährten verfallen sein?
»Was um alles in der Welt ist das, Tantchen? Sieht aus wie ein Büschel türkisfarbener Haare.«
Das ist ein Büschel türkisfarbener Haare!, grunzte Julius.
»Das ist ein Büschel türkisfarbener Haare!«, echote Henriette Hellbrecht, ohne dass sie es ahnte. »Ein Beweis dafür, dass sie noch lebt. Dass ich nicht lache!« Wieder füllte sie das zierliche Glas mit der giftgrünen, öligen Flüssigkeit und trank erneut. Herbie hatte sie lange nicht mehr so aufgeregt gesehen, ohne dass es sich dabei um ihn gehandelt hatte.
»Du musst mir schon ein bisschen mehr erzählen, Tantchen. Es scheint dich furchtbar aufzuregen, aber versuch doch einfach mal in Ruhe zu erzählen, worum es sich hierbei handelt. Ich bin schließlich kein Hellseher oder so was.«
»Natürlich.« Sie legte die Hand flach auf das faltige Dekolleté und zwang sich, ruhiger zu atmen. »Diese Haare lagen dem Erpresserbrief bei, den man mir heute Morgen in den Kasten geworfen hat. So ein schäbiger, gemeiner Brief! So eine abgeschmackte ...«
Herbie hob beschwichtigend die Hand und bremste damit für einen Augenblick den hasserfüllten Redeschwall. »Was will man von dir erpressen und vor allem: Mit welchen Mitteln will man dir etwas abknöpfen? Hat man etwa eine Geisel?«
In demselben Augenblick, in dem er die Worte ausgesprochen hatte, dämmerte ihm plötzlich, was seine Tante hier ganz dicht an den Rand eines Nervenzusammenbruchs trieb. Unsicher blickte er sich im Wohnzimmer um. Er hatte schon vor der Haustüre gespürt, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte oder vielmehr, wie es sonst immer gewesen war. Kein hektisches Hecheln, kein feindseliges Knurren bei seiner Ankunft. Keine hinterlistigen Bissattacken oder heimtückischen Überraschungsangriffe. Oder konnte es sein, dass Bärbelchen, das ondulierte Pudelmistvieh, nur irgendwo im Hinterhalt lauerte, um im richtigen Moment seinem Erzfeind Herbie Feldmann die kleinen, spitzen Hauer in die Wade zu schlagen? Das wäre nicht einmal ungewöhnlich.
Er sah zu seiner Tante hinüber, die sich die Augenwinkel trocken tupfte und fortwährend »Mein Liebling, mein armes, armes kleines Mädelchen« vor sich hinmurmelte. Kein Zweifel: Der Hund war weg!
Er zwang sich krampfhaft, Ansätze eines Strahlens oder den Hauch eines seligen Lächelns im Zaum zu halten.