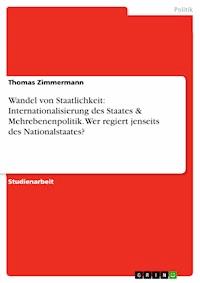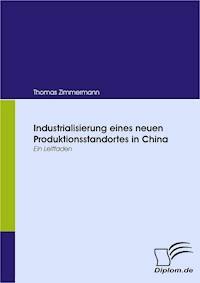Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Selfpublishing eröffnet Autoren den Weg in eine faszinierende neue Welt. Allerdings verlangt dieser Weg eine Beschäftigung nicht nur mit dem Inhalt, sondern auch mit der Form - der Typographie. Microsoft WORD als Synonym für Textverarbeitung bietet jedoch nur eine geringe bis keine Unterstützung bei Fragen des Textsatzes. Dieses Dilemma kann TEX oder das heutige LaTEX lösen. Das Buch beschreibt nach einem kurzen Überblick über Typographie und LaTEX eine Dokumentvorlage zum Erstellen von Büchern mit LaTeX. Es schließt ab mit den wesentlichen Befehle für die Textgestaltung. Damit kann sich der Autor wieder auf seine ureigenste Aufgabe - dem Inhalt widmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abbildung 0.1: Buchdruck im 16. Jahrhundert
Die Informationen in diesem Buch sind mit Sorgfalt recherchiert und praxiserprobt. Gleichwohl sind Fehler nicht auszuschließen. Ich übernehme keine Verantwortung für eventuell verbliebene Fehler und entstehende Probleme. Sollten Verbesserungen erforderlich sein, danke ich bereits jetzt für die Unterstützung und stelle ich mich gerne der Diskussion.
Errata sowie die Dokumentvorlage und Beispiele stehen zum Download auf meiner Homepage https://edv-beratung.familiezimmermann.de
Vorwort
Jeder Computerbenutzer kann willkürlich ein Buch gestalten. Daher sind die meisten neuen Bücher häßlich. Grundsätzlich haben unsere Bücher folgende Mängel: Der Satzspiegel ist zu groß, die Verlage nutzen das Papier soweit wie nur möglich aus und verzichten auf eine Umrandung der Kolumnen. Die Ränderverhältnisse sind zufällig, oft stehen die Kolumnen zu tief. Die Seitenzahlen sind laienhaft angeordnet. . . . Die Buchkunst liegt derzeit sehr im Argen. Bevor ein ganzer Berufsstand und mit ihm das Wissen und die Fertigkeiten, derer die Herstellung guter Bücher bedarf, aus Kostengründen verlorengehen, wäre zu wünschen, daß die Verlage ihre Gleichgültigkeit gegen das Buch ablegen und die Herstellung nicht mehr Computerspezialisten und Werbeagenturen überantworten, sondern Typographen, die ihr Handwerk beherrschen.
(Martin Z. Schröder)
Stimmt! Im Rückblick auf meine zahlreichen schriftlichen Arbeiten war entweder die Schreibmaschine oder Microsoft Word mein treuer Begleiter. Natürlich war ein Blick auf Layout und Satzspiegelgestaltung hilfreich, aber im Grunde war Word doch gut. Bis zum Studium. In einer UNIX-geprägten Umgebung standen andere Werkzeuge zur Verfügung. Sehr schnell musste ich feststellen, dass mit LATEX ein System existiert, dass bei gleicher Einarbeitungszeit deutlich bessere Ergebnisse und diese als PDF-Datei sogar wirklich weitergabefähig hervorbringt.
Ein zweiter Trigger waren Jahre später meine Erfahrungen im Carola Hartmann Miles Verlag. Obwohl seitens Books on Demand zahlreiche Word-Vorlagen zur Verfügung gestellt wurden, konnte ich regelmäßig feststellen, dass ein erheblicher Aufwand für die Korrektur des Layouts erforderlich war.
Der Autor kümmerte sich eben nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Form.
Zeilenabstand und Zeilendurchschuss, Satzspiegel, Silbentrennung, Grauwert usw. Es gibt vieles zu beachten und einzustellen – oder zu verstellen. Dieses Dilemma kann LATEX beheben – wenn man sich darauf einlässt! Ein jeder Texteditor benötigt dafür seine Zeit. Doch keiner unterstützt derart profund mit Wissen um die Typographie und entlastet den Autor wie LATEX.
In a nutshell: Trennung von Inhalt und Layout, typographisch korrekter Zeichensatz bei Kerning und Ligaturen, optimierte Silbentrennung, keine Seiteneffekte bei komplexen Dokumenten, usw. Die Vorteile von LATEX liegen auf der Hand.
Aussagekräftige Beispiele findet man bei Dario Taraborelli mit seinem Artikel The beauty of LATEX; Andrew Roberts mit Getting to Grips with LaTeX – Benefits of LaTeX typesetting; Allin Cottrell: Word Processors: Stupid and Inefficient oder Clemens Niederberger: Warum LATEX? Ein Vergleich mit Libreoffice.
In diesem Sinne soll dieses Buch die Schwelle zu LATEX vermindern und eine Handreichung für die Realisierung eines Buchprojektes mit einem professionellen und dennoch frei verfügbaren Textsatzsystem darstellen.
Es ist der Einstieg in eine neue Welt. Wer die ganze Schönheit und Mächtigkeit von LATEX erfahren möchte, für den ist dieser »Reiseführer« zu wenig. Für den weiteren Weg ist daher der Blick in die Literatur – an Herbert Voß und Markus Kohm führt kein Weg vorbei – sowie der Blick ins Internet unerlässlich. Auch wenn diese Drei bereits die Grundlage für das vorliegende Handbuch bilden.
Ich habe mir insofern erlaubt, auf die jeweiligen Zitate zu verzichten und stattdessen die genutzten Quellen im Literatur- und Quellenverzeichnis aufzuführen.
Widmung
In der Hoffnung, dass dieses Buch tatsächlich hilft, die Trennung von Inhalt und Form zu vollziehen, dass ein jeder sich wieder arbeitsteilig auf seinen Bereich konzentriert, danke ich meiner Frau für die abendliche Geduld, mit der sie meine – geistige – Abwesenheit erduldet hat.
Ebenso danke ich meinen Kollegen Rene Fröhlich, Martin Heusler, Dirk Lambertz und Sebastian Zecher sowie meinem Sohn Jann-Niklas Zimmermann für ihre Bereitschaft zum Korrekturlesen sowie ihre Hinweise.
Thomas Zimmermann
Berlin, im April 2019
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Widmung
Typographie – von Kunst und Handwerk
1.1 Grundbegriffe
1.2 Satzspiegel
LATEX – auch nur ein Werkzeug?
2.1 Etwas Geschichte
2.2 LATEX und Windows
2.2.1 LATEX-Basissystem
2.2.2 LATEX-Editor – eine grafische Entwicklungsumgebung
2.3 Grundlagen von LATEX
2.3.1 LATEX Dokumentstruktur
2.3.2 Dokumenterstellung
2.3.3 LATEX-Befehle
Die Dokumentvorlage für Buchprojekte
3.1 Gestaltungsvorgaben
3.2 Buchprojektvorlage
3.2.1 000-autor-buchprojekt.tex
3.2.2 000-verlag-praeambel.tex
3.2.3 010-verlag-schmutztitel.tex
3.2.4 020-autor-frontispiz.tex
3.2.5 030-verlag-titelseite.tex
3.2.6 040-verlag-impressum.tex
3.2.7 050-autor-vorwort.tex
3.2.8 060-autor-widmung.tex
3.2.9 100-verlag-inhaltsverzeichnis.tex
3.2.10 110-autor-kapitel.tex
3.2.11 900-autor-anhang.tex
3.2.12 901-verlag-abbildungsverzeichnis.tex
3.2.13 902-verlag-tabellenverzeichnis.tex
3.2.14 903-verlag-listingverzeichnis.tex
3.2.15 904-autor-literaturverzeichnis.tex
3.2.16 905-autor-glossar.tex
3.2.17 906-autor-abkuerzungsverzeichnis.tex
3.2.18 908-verlag-stichwortverzeichnis.tex
3.2.19 909-verlag-personenverzeichnis.tex
3.2.20 990-verlag-autoren.tex
3.2.21 999-verlag-verlagsverzeichnis.tex
LATEX in der Praxis
4.1 Gliederung
4.2 Zeilen-, Absatz- und Seitenumbrüche
4.3 Absatzauszeichnung
4.4 Horizontale Abstände
4.5 Vertikale Abstände
4.6 Absatzformate
4.7 Umgang mit Schrift
4.7.1 Schriftfamilien
4.7.2 Schriftstärke und Laufweite
4.7.3 Schriftform
4.7.4 Schriftgrad - Punktgröße
4.7.5 Schriftauszeichnungen
4.7.6 Ligaturen
4.8 Aufzählungen und Listen
4.9 Zitate und zitieren
4.10 Anführungszeichen
4.11 Abbildungen
4.11.1 Eine um 90° gedrehte Abbildung
4.11.2 Umfließen von Abbildungen mit Text
4.11.3 Mehrere Abbildungen über- oder nebeneinander
4.11.4 Bildqualität
4.12 Fußnoten
4.13 Tabellen
4.13.1 Spaltenformate
4.13.2 Linien
4.13.3 Mehrspaltige Zellen
4.13.4 Umfließen von Tabellen
4.13.5 Tabellen und Unterschrift um 90° gedreht
4.14 Mehrspaltige Seiten
4.15 Minipages
4.16 Reservierte Zeichen
4.17 Verzeichnisse
4.17.1 Inhaltsverzeichnis
4.17.2 Abbildungsverzeichnis
4.17.3 Tabellenverzeichnis
4.17.4 Listingsverzeichnis
4.17.5 Literaturverzeichnis
4.17.6 Glossar
4.17.7 Abkürzungsverzeichnis
4.17.8 Stichwortverzeichnis
4.17.9 Personenverzeichnis
4.18 Verweise
4.19 Hypertext
4.20 Kopf- und Fußzeilen
4.20.1 Inhalte positionieren
4.20.2 Linien
... zum Schluss
Anhang
6.1 Typographie
6.2 Wesentliche LATEX-Befehlsreferenz
6.3 Beschreibungen wichtiger LATEX-Pakete
6.4 Längen
6.5 Maßangaben und -einheiten
6.6 Die wichtigsten Warnungen und Fehlermeldungen
6.7 Dateien und Dateiendungen
6.8 LATEX-Durchläufe
6.9 Programme
6.10 Checkliste Qualität von Code und Daten in LATEX-Projekten
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Verzeichnis der Listings
Literatur- und Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Bilderquellen
TEX-Gruppen
TEX-Foren und Kurse
Sonstige hilfreiche Quellen
Glossar
Stichwortverzeichnis
Personenverzeichnis
Über den Autor
1 Typographie – von Kunst und Handwerk
The only time success comes before work is in the dictionary.
(Harvey Spector)
Typographie, von griechisch typos – »Schlag«, »Abdruck«, »Figur« – und graphein – »Zeichnen« – bezieht sich im klassischen Sinne auf die Gestaltung von Druckwerken mit beweglichen Lettern. Dennoch liegen die Wurzeln tiefer. Bereits die Handschriften des Mittelalters mit ihrer grafischen Gestaltung weisen Gesetzmäßigkeiten auf, die auch heute noch ihre Gültigkeit besitzen. Mit der Entwicklung und Verbreitung des Buchdrucks wurde dieses Wissen um grafische Gestaltung Teil des Fachwissens der Drucker und Schriftsetzer. In der Renaissance umfasste der Begriff Typographie sämtliche Bereiche der »Buchdruckerkunst«, in der Frührenaissance auch »Deutsche Kunst« oder »Schwarze Kunst« genannt.
Typographie umfasst damit die Makrotypographie mit den Gestaltungsrichtlinien für ein harmonisches Layout sowie der Mikrotypographie zur Anwendung von Schrift.
Heute ist Typographie ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung der Grafiker, Mediengestalter und ähnlicher Berufsgruppen. Aber auch für die Schriftstellerei gilt: Grundwissen schadet nicht. Insbesondere da mit der Digitalisierung der Schreibmaschine hin zu Textverarbeitungsprogrammen auch von Autoren Grundkenntnisse der Typographie erwartet werden.
1.1 Grundbegriffe
Einen hervorragenden Überblick bietet Wolfgang Beinert mit seinem Typographielexikon auf https://www.typolexikon.de/.
Buchsatzspiegel ist die Bezeichnung für das gesamte schematische Ordnungssystem einer Doppelseite (Verso und Recto). Der Buchsatzspiegel beschreibt die unbedruckten und bedruckten Flächen und umfasst Außenstege, Bundstege, Fußstege, Kopfstege, Kolumnentitel (lebend/tot), Kopfstege und Satzspiegel (Textbereich).
Abbildung 1.1: Buchsatzspiegel
Verso ist die Bezeichnung für die linke Seite eines Buches.
Recto ist die Bezeichnung für die rechte Seite eines Buches.
Kolumne ist ein Bereich oberhalb oder unterhalb eines Satzspiegels. Der darin enthaltene Text wird als Kolumnentitel bezeichnet. Die klassische Buchtypografie unterscheidet zwischen »toten« und »lebenden« Kolumnentitel. Die Kolumne oberhalb des Satzspiegels – im Kopfsteg – wird umgangssprachlich als Kopfzeile bezeichnet. Die Kolumne unterhalb des Satzspiegels – im Fußsteg – wird umgangssprachlich als Fußzeile bezeichnet.
Toter Kolumnentitel ist die Bezeichnung für eine einzeln stehende Seitenzahl.
Lebender Kolumnentitel ist eine Seitenzahl mit beigefügtem Text, der auf den nachfolgenden Seiten seinen Inhalt ändern kann. Er kann beispielsweise aus Hauptüberschriften, Kapitelüberschriften, Untertiteln oder Rubrikentiteln bestehen. In der traditionellen Buchgestaltung trägt die linke Buchseite (Verso) meist den übergeordneten Titel und die rechte Seite (Recto) den untergeordneten Titel, wobei in der Regel der rechtsseitige Textinhalt häufiger gewechselt wird.
Kopfsteg ist der typographische Fachausdruck für den oberen Rand einer Buchseite.
Außensteg ist der typographische Fachausdruck für den äußeren, also den linken Außenrand der Versoseite bzw. den rechten Außenrand der Rectoseite eines Buches. Der Außensteg sollte immer etwas breiter sein als der Bundsteg, da beim geöffneten Buch der Bundsteg optisch gespiegelt und somit verdoppelt wird.
Fußsteg ist der typographische Fachausdruck für den unteren Rand einer Buchseite. Der Fußsteg sollte bei Handbüchern, z.B. einem Roman, deutlich breiter sein als die Kopf-, Bund- und ggf. die Außenstege, da beim Halten und Umblättern eines Buches die Finger keinesfalls in den Satzspiegel geraten dürfen. Dies würde die Lesegeschwindigkeit und somit schlussendlich die Lesbarkeit eines Buches mindern.
Bundsteg ist der typographische Fachausdruck für den inneren, also den rechten Innenrand der Versoseite bzw. den linken Innenrand der Rectoseite eines Buches. In Abhängigkeit des Buchbindeverfahrens ist der Bundsteg um die Bindekorrektur zu vergrößern. Die Bindekorrektur ist der Bereich, der durch die Bindung verdeckt wird.
1.2 Satzspiegel
Grundlage einer harmonischen Buchgestaltung ist die Gestaltung des Satzspiegels – die Bestimmung des Textbereiches unter Berücksichtigung der Stege und der Bindekorrektur. Die Harmonie wird bestimmt durch das Verhältnis von Bundsteg : Außensteg sowie Kopfsteg : Fußsteg. Mit den Diagonalen in der nachfolgenden Abbildung lässt sich dieses Verhältnis überprüfen.
Abbildung 1.2: Harmonischer Satzspiegel
Der einfachste Weg, diese Verhältnisse zu erreichen, ist die Satzspiegelkonstruktion durch Teilung. Zunächst wird an der Innenseite der Wert für die Bindekorrektur abgezogen. Anschließend wird die Seite horizontal und vertikale in die gleiche Anzahl von Streifen geteilt. Die klassische Teilung ist die sogenannte Neunerteilung – also jeweils neun Streifen.
Abbildung 1.3: Neunerteilung
Einen hervorragenden Überblick hat Markus Kohm hierzu in der TEXnischen Komödie 4/2002 veröffentlicht.
Eine weitere Bedingung für eine harmonische Seitengestaltung ist ein einheitlicher Grauwert. Der Grauwert bezeichnet in der Typografie die scheinbare Helligkeit eines Textes. Er basiert jedoch nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern er ist ausschließlich ein subjektiver Eindruck. Allerdings herrscht Konsens, dass der Grauwert ausschlaggebend für die Gesamteindruck und die Lesbarkeit eines Buches ist. Deshalb gilt die Regel: je dunkler und dichter der Grauwert einer Schriftfläche ist, desto unangenehmer und schwerer ist der Text lesbar.
Das Wissen der Typographen, das für eine harmonische Seitengestaltung erforderlich ist, wurde dank Donald E. Knuth mit LATEX einem größeren Kreis zugänglich gemacht.
2 LATEX – auch nur ein Werkzeug?
English words like »technology« stem from a Greek root beginning with the letters and this same Greek word means »art« as well as »technology«.
(Donald E. Knuth)
2.1 Etwas Geschichte
Als Donald E. Knuth mitte der 70er Jahre vor der Herausforderung stand, seine wissenschaftlichen Arbeiten zu publizieren, stellte er fest, dass mit der Digitalisierung im Druckwesen die Veränderungen den Beruf des Schriftsetzers haben überflüssig werden lassen.
»Mathematics books and journals do not look as beautiful as they used to. It is not that their . . . content is unsatisfactory, rather that the old and well-developed traditions of typesetting have become too expensive. Fortunately, it now appears that mathematics itself can be used to solve this problem.1 «
Dies war die Geburtsstunde von TEX, einem System, welches das Wissen des Schriftsetzers einem breiten Kreis zugänglich macht. Bereits mit den Standardwerten von TEX lassen sich qualitativ hochwertige PDF-Dokumente erstellen, die von jeder digitalen Druckvorstufe akzeptiert werden. Mit dieser Trennung von Form und Inhalt kann sich der Autor wieder auf seine eigentliche Arbeit – dem Inhalt und der Struktur – konzentrieren.
TEX ist damit keine Textverarbeitung wie beispielsweise Microsoft Word, die augenblicklich darstellt, wie der Druck später hoffentlich aussieht – What you see is (probably) what you get. TEX ist vielmehr ein Textsatzsystem, dass anhand von Steuerbefehlen den zu druckenden Text formatiert und ausgibt. Die Anwendung von TEX – das Setzen von Text – ähnelt somit eher dem Programmieren.
Die nachfolgende Abbildung zeigt den schematischen Ablauf. Ein vollständiges Bild ist im Abschnitt 6.8 auf Seite → aufgeführt.
Abbildung 2.1: Vom Text zum Dokument
Doch keine Angst: wenn das Grundgerüst für ein LATEX-Dokument einmal erstellt wurde, können Sie sich als Autor voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren. Für die Gestaltung reichen ein paar Befehle für das weitere Arbeiten aus.
In den folgenden Jahren wurde das Grundsystem systematisch erweitert und in seiner Handhabung verbessert. Leslie Lamport entwickelte in den 80er Jahren das auch heute noch am meisten genutzte TEX-Paket: LATEX.
Eine weitere wichtige Erweiterung ist KOMA-Script, das in den 90er Jahren von Frank Neukam begonnen und von Markus Kohm vollendet wurde. Mit diesem Paket wurde LATEX weiter verfeinert und seine Nutzung optimiert.
2.2 LATEX und Windows
Ein lauffähiges LATEX-System umfasst in Gänze rd. 75.000 Dateien bei einem Speicherplatzbedarf von ca. 4 Gigabyte. Aber auch hier gilt: keine Angst! Jede LATEX-Distribution enthält eine Paketverwaltung, die bei Bedarf die notwendigen Ergänzungen automatisch vornehmen wird.
2.2.1 LATEX-Basissystem
Für Windows gibt es drei Optionen für das Basissystem:
TEXLive
die umfangreichste TEX-Distribution. TEXLive wird auf einer DVD-ROM vertrieben oder kann aus dem Internet frei heruntergeladen werden. Sie wird gemeinsam von den internationalen Benutzergruppen der TEX User Group gepflegt. TEXLive enthält grundsätzlich alle Pakete, die auch auf dem Comprehensive TeX Archive Network vorhanden sind. Beschränkungen ergeben sich im Einzelfall für Pakete, die unter keiner freien Lizenz stehen.
Die Webseite ist https://www.tug.org/texlive/.
MiKTEX
eine deutschsprachige LATEX-Distribution von Christian Schenk. Mit einem Installationsprogramm werden die benötigten TEX-Pakete aus dem Internet oder von der MiKTEX-CD geladen und danach auf dem Rechner installiert. Bei einer kompletten Installation der Version 2.9 müssen ungefähr 1,3 Gigabyte aus dem Internet geladen und 2,4 Gigabyte auf der Festplatte installiert werden. Ein Aktualisieren der Pakete ist möglich, außerdem werden benötigte, noch nicht vorhandene Pakete bei Bedarf nachgeladen und installiert.
Die Webseite ist https://miktex.org/
ProTEXt
eine integrierte Freeware-Entwicklungsumgebung für LATEX, die von Thomas Feuerstack auf der Basis von MikTEX entwickelt wurde. Diese Distribution hat bereits den Editor TEXstudio integriert.
Die Webseite ist https://www.tug.org/protext/.
Ich selbst nutze MikTEX von Christian Schenk. Da mit der Basisversion bereits bei einfachen Dokumenten zahlreiche Pakete nachgeladen werden müssen, empfehle ich die Komplettversion zu installieren – 2 Gigabyte an Daten sollten heute beim Download keine Herausforderung darstellen.
Installation und Konfiguration von MikTEX
Zur Installation reicht es aus, von der Webseite den Installer herunterzuladen und zu starten. Nach der Installation erfolgt beim ersten Start die Konfiguration. Die wichtigste Option ist die Frage nach dem automatischen Nachladen benötigter Pakte. Diese sollte mit »Ja« beantwortet werden.
Weitere Arbeiten an MikTEX beschränken sich auf regelmäßige Updates. Hierfür steht die MikTEX-Console zur Verfügung.
Abbildung 2.2: MikTEX-Console
Damit steht dem ersten Dokument nichts mehr im Weg. Für die Erstellung reicht ein einfacher Texteditor sowie die Kommandozeile. Wer es jedoch etwas einfacher haben will, muss eine der vorhandenen grafischen Entwicklungsumgebungen installieren.
2.2.2 LATEX-Editor – eine grafische Entwicklungsumgebung
Spätestens hier wird deutlich, warum das Setzen von Dokumenten mit LATEX dem Programmieren ähnelt. Auch hier gilt: Bange machen gilt nicht! Suchen Sie sich unter den zahlreiche Windows-Varianten eine Umgebung aus:
TEXnicCenter
ist ein freier Texteditor für LaTeX-Dokumente für Windows. Die Software wird unter der GNU General Public License veröffentlicht. Integrierte Funktionen erleichtern unter anderem die Strukturierung, Formatierung und Texthervorhebung der Dokumente – Einstellungen, die bei LATEX als Markup-Befehle direkt in den Text geschrieben werden.
Die Webseite ist http://www.texniccenter.org/
TEXmaker
ist ein plattformübergreifender Unicode-Texteditor für die Erstellung von LATEX-Dokumenten. Die Software wird unter der GNU General Public License veröffentlicht. Der Editor richtet sich insbesondere an LATEX-Anfänger, denen mit Hilfe von Assistenten die Erstellung von Dokumenten erleichtert werden soll.
Die Webseite ist http://www.xm1math.net/texmaker/
TEXstudio
ist ein plattformunabhängiger Editor für die Erstellung von LATEX-Dokumenten. Er basiert auf TEXmaker. Die Software wird unter der GNU General Public License veröffentlicht.
Die Webseite ist https://www.texstudio.org/
TEXworks
ein einfacher Editor. Die Open Source Freeware benötigt als Voraussetzung ein installiertes TEXLive.
Die Webseite ist https://www.tug.org/texworks/
Nach mehreren Tests bin ich mittlerweile bei TEXstudio angelangt. Hier überzeugt mich der interne Betrachter sowie die Anzeige der Dokumentstruktur und die Anzeige der aktuellen tex-Datei. Diese drei Ansichten laufen synchron. Darüber hinaus verfügt TEXstudio über eine integrierte Rechtschreibprüfung sowie Syntaxhilfe und Vervollständigung für Befehle.
Umfangreiche Assistenten für Dokumente, Umgebungen sowie Kurzbefehle runden das Bild ab. Eine Anleitung finden Sie unter http://www.mi.uni-koeln.de/wp-MIEDV/wp-content/uploads/2016/05/dokumentNeuYP.pdf bzw. http://www.linux-community.de/ausgaben/LinuxUser/2014/08/Mit-Texstudio-komfortabel-LaTeX-Dokumente-erstellen/.
Aber sehen Sie selbst und probieren Sie es einfach aus.
Abbildung 2.3: TEXstudio
Installation von TEXstudio
Zur Installation reicht es aus, von der Webseite den Installer herunterzuladen und zu starten. Das umfangreiche und ausführliche Handbuch ist Online verfügbar unter http://texstudio.sourceforge.net/manual/current/usermanual_en.html. Darüber bieren auch die TEX-Foren ergänzende Hilfestellungen.
Weitere Software
Hilfreich ist ein zusätzlicher externer PDF-Betrachter. Ein schlankes Programm, das neben der Anzeige der PDF-Datei in Buchansicht automatisch eine geänderte PDF-Dateien nachlädt, ist »SumatraPDF«. Das Programm ist verfügbar unter https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html
Für die Grafikbearbeitung empfehle ich zum einen den Bildbetrachter »Irfan View«. IrfanView ist ein Freeware-Programm zur Betrachtung und in kleinem Umfang auch zur Bearbeitung von Bildern unterschiedlicher Formate für die Betriebssystemplattform Microsoft Windows. Es überzeugt vor allem durch seine Möglichkeiten zur Skalierung von Bildern und der Option, den DPI-Wert anzupassen. Die Webseite ist https://www.irfanview.com/.
Abbildung 2.4: Bildbetrachter Irfan View
Zum anderen empfehle ich »Gimp«. GIMP (GNU Image Manipulation Program) ist ein pixelbasiertes Grafikprogramm, das Funktionen zur Bildbearbeitung und zum digitalen Malen von Rastergrafiken beinhaltet. Das Programm ist eine freie Software und kann kostenlos genutzt werden. Das Programm ist verfügbar unter https://www.gimp.org/.
2.3 Grundlagen von LATEX
»Boxen, Boxen – ich seh’ nur Boxen«
Das Grundprinzip von LATEX baut auf den mittelalterlichen Bleilettern auf. Jedes Zeichen steht auf einer Grundlinie und ist von einer Box eingerahmt mit einer Höhe über der Grundlinie, einer Tiefe unter der Grundlinie sowie einer Breite. Die Einzelboxen werden zu Wortboxen, diese zu Zeilenboxen und diese
Abbildung 2.5: Das Box-Prinzip
zu Absatz- und dann zu Seitenboxen zusammengefasst. LATEX berechnet aus den vorgegebenen Werten zu Papiergröße, Ränder und Schriftgrößen die optimalen Abstände zwischen den einzelnen Boxen für ein harmonisches Gesamtbild. Damit sind Herausforderungen wie Durchschuss, Laufweite, Unterschneidung etc., die bei einem Textverarbeitungssystem manuell zu definieren sind, für den Nutzer von LATEX nicht zu bewältigen.
Für den Autor bleibt damit seine Kernaufgabe, das Schreiben des Textes sowie die Festlegung von Gestaltungsmerkmalen wie Kopf- und Fußzeilen, Gliederungsebenen, Textauszeichnungen, Schriftarten, Tabellen, Grafiken, Listen oder Verzeichnissen. Doch davon mehr in den nächsten Kapiteln.
2.3.1 LATEX Dokumentstruktur
Die Trennung von Inhalt und Form wird auch bei der Dokumentstruktur deutlich. Ein LATEX-Dokument besteht aus
der Präambel mit der Definition der Dokumentklasse mit
\
documentclass
[Optionen]{Dokumentklasse}
, globalen Definitionen für das Layout sowie der Einbindung von zusätzlichen Paketen, die benötigt werden.
dem eigentlichen Dokument.
Dokumentklasse
Die erste Zeile der Präambel legt die Dokumentklasse und damit die Dokumentart fest. LATEX kennt drei grundlegende Dokumentklassen: report für Berichte, article für Zeitschriftenartikel und book für Bücher. Sollen die Vorteile von KOMA-Script zur Anwendung kommen, sind die entsprechenden KOMA-Script-Klassen scrrpt, scrartcl oder scrbook zu verwenden. Der Befehl dazu lautet \documentclass{scrbook}. Details zum Dokument sind in den Optionen zu definieren. Bei Nutzung von KOMA-Script erfolgt dies mit der Anweisung KOMAoptions{...}.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Klassen beispielsweise für Briefe, Rechnungen, Präsentationen etc.
Damit ist die grundlegende Definition abgeschlossen, alles Weitere erfolgt in den Folgezeilen der Präambel.
Präambel
Die Präambel hat zwei Funktionen: zum einen werden hier alle Pakete benannt, die für das Erstellen des LATEX-Dokument erforderlich sind. Pakete beinhalten zusätzliche Funktionen, die das Grundsystem für spezielle Aufgaben erweitern. Diese Pakete werden jeweils mit dem Befehl \usepackage{...} eingebunden. Zum anderen werden globale Vorgaben wie beispielsweise Abstände oder Verzeichnisse definiert. Die Präambel legt somit das grundlegende Aussehen des Dokumentes fest.
Dokument
Das Dokument steht in der Umgebung \begin{document} ... \end{document}. Diese Umgebung ist einmalig vorhanden und beinhaltet sowohl den Text mit seinen Gestaltungselementen als auch die Befehle zur Formatierung. Bei längeren Texten empfehle ich, den Buchblock in einzelne Kapitel aufzuteilen und diese Kapitel in einzelnen TEX-Dateien mit dem Befehl \include{Dateiname} einzubinden. Das Hauptdokument, welches diese Filialdokumente einbindet, ist bei TEXstudio über Optionen – Root-Dokument als Wurzel-Dokument zu markieren.
Im nachfolgenden Kapitel 3 »Die Dokumentvorlage für Buchprojekte« gehe ich auf die Vorlage für ein Buchprojekt detailliert ein.
Die wichtigsten Befehle zur Formatierung sowie Befehle für Gestaltungselemente wie Listen, Tabellen und Bilder folgen anschließend in Kapitel 4 »LATEX in der Praxis«.
2.3.2 Dokumenterstellung
Aus dem LATEX-Dokument erzeugt der Übersetzer das eigentliche PDF-Dokument anhand der Vorgaben in der Präambel. Während des Übersetzungsvorgangs wird jegliche Aktion gemeldet. Durch die ausführliche Bildschirmausgabe des Übersetzers sollten Sie sich nicht irritieren lassen. Das Box-Konzept bringt unter anderem mit sich, dass jede Box, die unter- oder überfüllt ist, angezeigt wird.
Wichtig sind einzig und allein die Fehlermeldungen. Doch auch hier gilt: keine Panik! Alle Meldungen werden zusammen mit einer Zeilennummer bzw. dem betreffenden Absatz in einer Protokolldatei dokumentiert. Die wichtigsten Warnungen und Fehlermeldung sowie Tipps zur Abhilfe sind im Anhang aufgeführt.
Ebenso zu beachten ist, für die vollständige Erstellung benötigt LATEX mindestens zwei Durchläufe: im ersten Durchlauf werden das Inhaltsverzeichnis sowie alle weiteren zu erstellenden Verzeichnisse erzeugt. Im zweiten bzw. den folgenden Durchläufen werden diese dann sortiert und in das Dokument eingebunden.
2.3.3 LATEX-Befehle
Die Steuerung von LATEX erfolgt über Befehle, die jeweils mit einem Backslash \ eingeleitet werden. Diese Befehle wirken
ohne Parameter
für den nachfolgenden Text bis sie durch einen weiteren Befehl aufgehoben oder geändert werden. Beispiele hierfür sind Änderungen der Schriftfamilie und der Schriftgrößen.
Sofern nach dem Befehl ein Leerzeichen ausgegeben werden soll, ist dieses mit einem Backslash \ einzuleiten.
mit Parameter
für den nachfolgenden Text. Der Text wird in geschweiften Klammern { } angegeben. Weitere Parameter bzw. Optionen werden in eckigen Klammern [ ] übergeben. Beispiele hierfür sind Auszeichnungen von Texten wie Fett oder Kursiv oder Einfügen von Grafiken.
als Umgebung
für ein Objekt oder einen Textbereich. Umgebungen definieren Eigenschaften für längere Textbereiche. Beispiele hierfür sind Listen, Tabellen, Grafiken oder zentrierter Text. Die Umgebungen selbst werden jeweils mit
\
begin
{Umgebung} ... \
end
{Umgebung}
definiert. Das Schlüsselwort
Umgebung
definiert den Typ der Umgebung.
1Donald E. Knuth: Mathematical Typography, 1978.