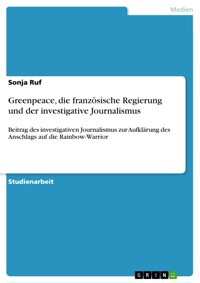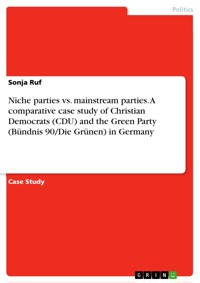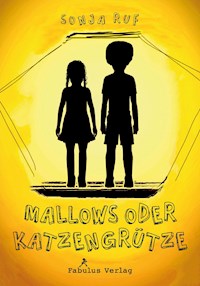9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Roman über drei Frauen und andere Menschen, die sich in der online gesteuerten und kontrollierten (Arbeits-)welt nicht mehr zurechtfinden. Miriam Schmitt betreibt in der Klinik Bad Hochwald das Café Schmittchen. Manchmal schreibt sie selbst, Texte über Literatur, gibt auch Bücher heraus. Miriam erzählt den ersten Teil des Romans, erzählt Geschichten von Patienten, die, wie auch sie einst, in der Arbeitswelt scheiterten, nach Burnouts nicht mehr weiterwussten. Doch die schicke, hochmoderne Klinik entpuppt sich als Vorzeigeunternehmen der heutigen Arbeitswelt ... Miriam erzählt auch ihre eigene Geschichte und von ihrer heimlichen Liebe zu Morton, einem angestellten Therapeuten, der oft in ihr Café kommt. Doch die Controler haben Morton im Visier ... Auch Miriams Schwester Manuela war Patientin in der Klinik. Sie erzählt den zweiten Teil des Romans, von der Zeit nach der Klinik, einer neuen Liebesgeschichte, sie hat geschafft, ihr Leben zu ändern. Sie erzählt auch, wie es dazu kam, dass sie in Bad Hochwald landete, von „Kontrollwahn“ und Mobbing. Der dritte Teil des Romans ist das von Miriam herausgegebene Buch der Freundin der Schwestern, Mara Prochazka. „Das Muster, das die meisten hierhertreibt, das auch mich einmal nach Bad Hochwald getrieben hat, ist einfach: mit fünfzig, mit plus minus fünfzig passen wir nicht mehr zu unserer Arbeit. Wir versuchen wieder und wieder, uns passend zu machen und schaffen es nicht.“ Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran, auch und gerade am Arbeitsplatz. Effizienz ist das, was zählt und oftmals auch das, wonach Menschen bewertet werden. Wer online nicht mithalten kann, der verliert den Anschluss – und damit ein Stück weit auch die Kontrolle über sein Tun. In ihrem neuen Roman „Im Glanz der Kontrolle“ greift Sonja Ruf dieses absolut aktuelle gesellschaftspolitische Thema auf. „Im Glanz der Kontrolle“ erzählt von der Diktatur der Fremd- und der Selbstkontrolle. Und stellt dagegen Würde, Freundlichkeit, Partnerschaft. Liebesgeschichten. Die Lust an der Sabotage. Die Kraft der Menschen, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und ihr Leben auch unter den verwirrenden Umständen der Gegenwart selbst zu regieren,
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sonja Ruf
Im Glanz der Kontrolle
Roman
konkursbuch
Verlag Claudia Gehrke
Zum Buch
Roman über drei Frauen und andere Menschen, die sich in der online gesteuerten und kontrollierten (Arbeits-)welt nicht mehr zurechtfinden. Miriam Schmitt betreibt in der Klinik Bad Hochwald das Café Schmittchen. Manchmal schreibt sie selbst, Texte über Literatur, gibt auch Bücher heraus. Miriam erzählt den ersten Teil des Romans, erzählt Geschichten von Patienten, die, wie auch sie einst, in der Arbeitswelt scheiterten, nach Burnouts nicht mehr weiterwussten. Doch die schicke, hochmoderne Klinik entpuppt sich als Vorzeigeunternehmen der heutigen Arbeitswelt ... Miriam erzählt auch ihre eigene Geschichte und von ihrer heimlichen Liebe zu Morton, einem angestellten Therapeuten, der oft in ihr Café kommt. Doch die Controler haben Morton im Visier ...
Auch Miriams Schwester Manuela war Patientin in der Klinik. Sie erzählt den zweiten Teil des Romans, von der Zeit nach der Klinik, einer neuen Liebesgeschichte, sie hat geschafft, ihr Leben zu ändern. Sie erzählt auch, wie es dazu kam, dass sie in Bad Hochwald landete, von „Kontrollwahn“ und Mobbing.
Der dritte Teil des Romans ist das von Miriam herausgegebene Buch der Freundin der Schwestern, Mara Prochazka.
„Das Muster, das die meisten hierhertreibt, das auch mich einmal nach Bad Hochwald getrieben hat, ist einfach: mit fünfzig, mit plus minus fünfzig passen wir nicht mehr zu unserer Arbeit. Wir versuchen wieder und wieder, uns passend zu machen und schaffen es nicht.“
Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran, auch und gerade am Arbeitsplatz. Effizienz ist das, was zählt und oftmals auch das, wonach Menschen bewertet werden. Wer online nicht mithalten kann, der verliert den Anschluss – und damit ein Stück weit auch die Kontrolle über sein Tun. In ihrem neuen Roman „Im Glanz der Kontrolle“ greift Sonja Ruf dieses absolut aktuelle gesellschaftspolitische Thema auf.
„Im Glanz der Kontrolle“ erzählt von der Diktatur der Fremd- und der Selbstkontrolle. Und stellt dagegen Würde, Freundlichkeit, Partnerschaft. Liebesgeschichten. Die Lust an der Sabotage. Die Kraft der Menschen, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und ihr Leben auch unter den verwirrenden Umständen der Gegenwart selbst zu regieren.
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Buch
Teil 1: Hochwald
Morten hält eine kleine Klagerede.
Als Kind war ich geliebt
Es ist nach 22 Uhr
Kurzsichtig schwimme ich
Heute kaufe ich einfach
Teil 2: Kontrolle
»Personalwechsel. Die Fahrkarten bitte.«
Überall standen die Bildschirme
Am Freitag fuhren sie
Lisa-Marie hatte einmal
Noch am nächsten Morgen
Susanne schrieb
In Trier …
Teil 3: Das Menschenbuch der Mara Prochazka
Wo sind wir
Warum haben mir meine Eltern nie gesagt
Am Abend die Amsel
Mamméh geht fort.
Sie sagt, sie liebt mich.
Es ist warm
Beton ist nur eine Form von Sand.
Meine Lust
Oh, ich
Die erhabenen Acherons
Wir schnappen uns
Es stört mich nicht
Eine Zeitlang
Da steh ich morgens in Leipzig
Soll ich verschweigen
Seit einem Jahr
Wie heißt du?
Im Schwarzwald lebte ein Paar
Oleander
Ich repariere die Welt.
Anna Seghers
Stell dir vor
Nun ist es still
Es war auf der Frankfurter Buchmesse
Die Menses des ersten Tages
Für den Fall
Mit dem Mann
Wie sollen jene
Ich liege bei ihr
Im Café-Restaurant
Ich wusste nicht
Ich bin in Tibet geboren
Anhang
Vorwort für Mara Prochazka
Zur Autorin
Impressum
Teil 1: Hochwald
Wenn Gott dich ruft, klar, dann musst du gehen, aber bevor er dich ruft, hast du kein Recht dazu, deine Seele schwirren zu lassen. Wenn du es vor deiner Zeit versuchst, rufen wir dich unter die Kuppel im Hochwald.
Hier in Bad Hochwald auf dem Hügel wirst du wieder Persönlichkeit mit Vorgeschichte, gibst deinem Leben Sinn und schaust nach vorne – so steht’s auf der Webseite.
Und deine arme kleine Schwarmseele bleibt in ihrem Käfig, bis es Zeit ist.
Am Tag deiner Anreise hockst du auf einem hellgrünen Kunstledersofa, das auf dunkelgrünem Teppichboden steht. Du bist umgeben von rasch wachsendem Bambus, von großblättrigen Hydrokulturen, die der Aula die Anmutung eines Tropenhauses geben.
Es herrscht Kunstlicht. Von oben schweben in gleichmäßigem Abstand an langen Schnüren tropfenförmige Leuchten herab. Eine davon ist verkehrt herum gehängt, unter leuchtenden Tropfen ein einzelner Pfropfen wie in einem Parfüm-Flakon.
Auf einmal ertönt das Brummen der Motoren, mit dem sich über den schwarz eingefassten Fenster-Segmenten der riesigen Kuppel die Jalousien öffnen, so dass das Tageslicht in die Aula dringt. Die Leuchten werden zugleich herunter gedimmt. Lautlos bewegen sich Stäbe gleitend in ihren Rinnen und drücken die obersten drei Fensterreihen auf – wie Orangenschnitze fallen sie auseinander.
Der oberste Kreis bildet eine Krone, die zweite Reihe stellt sich auf wie lauschende Lama-Ohren, der dritte Reif öffnet sich unregelmäßig wie winkende Hände oder auch ein flatternder Rocksaum.
Eine kühle Frische macht sich bemerkbar.
Du kannst die Gänse schnattern, die Dohlen schnalzen, die Frösche schmatzen hören. Dein Blick soll sich nach oben richten, doch leider bist zu sehr mit dir selbst beschäftigt, um den Duft des Waldes wahrzunehmen – höchstens, dass mal ein Sensibelchen denkt: »Wow, das Raumschiff hebt ab!«, wenn die Motoren starten, die die Jalousien und Fensterheber bedienen.
Zwischen deinen Fingern rollst du das letzte Stückchen Papier hin und her, das du hier benötigst, du zerkrümelst den nummerierten Fetzen, den du eben von einer Rolle gezogen hast und wartest darauf, aufgerufen zu werden.
Du willst so schnell wie möglich ein Zimmer zugewiesen bekommen, willst an diesem ersten Tag möglichst wenig mit anderen Menschen zu tun haben, dich rasch verbergen, erholen. Was immer du gestern noch getan hast und hier nicht mehr darfst, du hast es übertrieben.
Nun bist du müde und matt.
Oder unruhig, deine Augen flackern. Du springst auf wie eine Feder aus einer alten Matratze – du bist dran, du wirst aufgerufen.
Trittst an die lange Rezeption, hinter der zwölf Menschen unermüdlich alle Anreisenden abarbeiten.
Eine lässt sich deinen Namen nennen, eine Weißkittlerin injiziert dir den winzigen Dau in das Fett deines Oberarmes oder Schenkels, du darfst gehen.
Der implantierte Dau, den du vergessen kannst, sobald die kleine Wunde nicht mehr juckt, befreit dich von allem, was dich davon ablenken könnte, deine wichtigste Aufgabe zu bewältigen, die ich eben schon angedeutet habe, nämlich, deinem Leben selbst erstmals oder wieder einen Sinn zu geben und nach vorne zu schauen. Das Leben muss immer nach vorne gelebt werden, auch wenn es nur rückwärts verstanden werden kann.
Jeder hat doch eine Vorstellung von der menschlichen Seele, ob er sie jetzt im Kopf oder im Herzen sucht, ob er deren Gewicht in Gramm zu messen versucht oder von ihr verlangt, leichter als nichts zu sein, ob er sie einfach Wärme und Leben nennt, sie aus dem Mund, der Nase, den Ohren entweichen sieht, in die Augen seiner großen Liebe hineinliest. Ein Mensch zu sein, heißt Materie Plus, ich nenne dieses Plus Seele. Und wenn eine Seele entweicht, trinkt sie das Licht. Dort, wo beim Säugling der Schädel noch nicht geschlossen ist, wo die Fontanelle ist, entweicht meiner Vorstellung nach die Seele.
Wenn ich jemanden mag, lege ich gern meine Hand auf den Scheitelpunkt dieses Menschen. Wenn ich ein Baby gehabt hätte, hätte ich sein Köpfchen vor der Sonne und vor der Kälte mit einem Mützchen geschützt, hätte ich diese Stelle immer geschützt.
Zwischen den betongrauen Hochhäusern strecken sich Wege längs künstlicher Bachläufe. Wege, Pflanzenkübel und Bänke sind mit durchsichtigen luftigen offenen Dächern in der Trapezbauweise des Münchner Olympiastadions überspannt. Auf diesen Wegen bist du zugleich drinnen und draußen, bist vor dem Wetter geschützt, kannst trockenenen Fußes, auch im Bademantel, auch in Hausschuhen von einem Block zum anderen gelangen. Die meisten Wege sind rollstuhlgerecht, einige gewundene Seitenpfade mit historischem Buckelpflaster gestaltet. Blümchen und Kraut wachsen zwischen den Ritzen, Erde wird toleriert.
Überall reagieren hochwaldblaue Plasmatafeln auf deinen Dau, sobald du davor stehen bleibst. Du findest dort deine nächsten Termine und deinen Standort gewiesen. Termine und Wegbeschreibung werden dir vorgelesen oder angezeigt, ganz wie du es lieber hast, und auch, in welcher Sprache du willst.
Der Dau hat Zahlungsfunktion, auf ihm sind alle Daten gespeichert, die uns dein Hausarzt und die Kassen übermittelt haben. Auf seinem Plasmabrett findet der Arzt oder der Therapeut alles, was für ihn nützlich ist, sobald du dich ihm näherst. Der Dau befreit dich von jeglicher Bürokratie. Niemand nimmt dich ins Verhör. Deine Konsumgewohnheiten sind hier bekannt, du brauchst dich nicht zu rechtfertigen.
Übrigens besitzen auch alle Angestellten von Hochwald einen Dau, der für sie vor allem Schlüssel-Funktion hat und den sie nicht unter der Haut tragen, sondern sich in Piercing, Ring, Stift oder Namensschild haben einfügen lassen. Nachts legen sie ihn ab.
In Bad Hochwald auf dem Hügel, so bedrückt du auch angekommen bist, bist du nun sorglos wie kaum je im Leben.
Wenn du zum Beispiel nicht mehr zu deiner Arbeit passt und alle Versuche, dich passend zu machen, gescheitert sind, wenn du ins Schlammloch gerutscht und um so rascher eingesunken bist, je mehr du den Schlamm mit den Füßen getreten hast, dann wirst du hier wieder aus dem Schlamm gezogen, deine Haut wird gereinigt, du kannst frei atmen und nutzt deinen Atem zum Reden, redest endlos, redest mehr als die ganzen Jahre zuvor und all die gestauten, warm ausgeatmeten Worte steigen hoch bis zur Spitze der Glaskuppel, kühlen sich ab und rinnen als Kondenswasser innen an den Scheiben wieder hinab.
Ich höre so viele Geschichten, wenn ich die Rehabilitanden in meinem Kiosk-Café bediene.
Ich öffne das »Schmittchen«, indem ich einfach die Glasschiebetüren vor dem Thekenbereich zur Seite schiebe und die Fläche auf dem grünen Teppich, wo ich ein paar Klapptische und Stühle aufstelle, zum Café erkläre.
Gegen zweiundzwanzig Uhr räume ich die Tische und Stühle wieder weg und ziehe die gläserne Falttür in einer im Boden versunkenen Rinne zu, schließe sie mittels eines Vorhängeschlosses ab.
Dann sind nur noch die kleine Küche und ein winziger Personalraum beleuchtet, in dem ich Reste des Tages verzehre, sobald ich vorne alles geputzt und aufgeräumt habe.
Der Anreisetag ist zugleich der Abreisetag.
Die Anreisenden kaufen bei mir, was sie zuhause vergessen haben, die Abreisenden trinken manchmal noch einen Tee, ehe der Bus kommt oder das Sammeltaxi zum Bahnhof sie abholt. Manch einer kauft sich ein Souvenir – ein Fläschchen Dianenwasser, eine Postkarte, Reiseproviant, die Broschüre: »Hochwald im Glanz. Die schönsten Fotos.«
Aber die meisten tragen als einziges Souvenir das hochwaldblaue Pflaster auf dem Arm mit nach Hause, wo der Dau mit einem kleinen Schnitt wieder entfernt worden ist.
Sie machen freudige Bemerkungen, auf die ich nicht eingehe. Sie umklammern den neuen Partner, den Griff ihres Rollkoffers – beides kann schon auf dem Heimweg verloren gehen, gestohlen, geneidet werden. Sie wünschen so sehr, dass es endlich mal funktioniert, dass es klappt mit dem neuen Leben, dass sie in Bad Hochwald auf dem Hügel tatsächlich ein neuer Mensch geworden sind, dass es anhält!
Oder sie freuen sich auf das alte Leben, auf etwas zuhause, das ihnen hier in Bad Hochwald verboten war, den Kontakt zu einem gesperrten Kollegen oder Angehörigen, freuen sich auf das Auto, das Telefon, den Computer, das Internet, das Fernsehen, die Spielhalle, die Trinkhalle, das Flaschenregal.
Suchtmittel, vom Tabak bis zum Smartphone, sind hier verboten. Das gilt für alle. Bad Hochwald auf dem Hügel ist als einer der wenigen sogenannten »Safe Places« in Deutschland zertifiziert, wo Menschen mit Suchterkrankungen sicher sein dürfen, nicht verlockt zu werden.
Im kleinen Hochwald im Tal kannst du Alkohol, Zigaretten oder Rubbellose kaufen, aber das ist sieben Kilometer entfernt, es gibt keine reguläre Busverbindung, die lange Wanderung hin und zurück kostet Zeit, die dir zwischen den Anwendungen fehlt.
Natürlich gibt es Taxen, es gibt Wege, sich alles zu beschaffen, es gibt Blaukittler, die eine Art Schwarzmarkt betreiben, aber der Missbrauch bleibt nicht verborgen – dann wirst du eben wieder nach Hause geschickt und musst für den Aufenthalt selbst bezahlen und nicht nur die ohnehin obligatorische Zuzahlung – dann zahlen die Kassen überhaupt nichts.
Ich wünsche dir, wenn du regulär nach drei Wochen oder einer Verlängerung abreist, mit ehrlichem Herzen Glück, sage ironiefrei »Auf Wiedersehen«, wünsche mir, dich nicht wiederzusehen, selbst wenn ich damit die Wette verliere, die ich mit Dipl.-V. Morten geschlossen habe.
Die Kiosk-Cafés nutzen die Lage nicht aus und verkaufen vergleichbare Waren kaum teurer als unten im alten Hochwald.
Das Muster, das die meisten hierher treibt, das auch mich selbst hierher getrieben hat, ist einfach: mit fünfzig, mit plus minus fünfzig, passen wir nicht mehr zu unserer Arbeit. Die Arbeit verändert sich unablässig, zu rasch, als dass wir uns darauf jeweils wieder einstellen könnten, wie unter einem Wasserfall. Die Veränderung findet kein Ende, und wir kommen da nicht mehr mit. Wir versuchen wieder und wieder, uns passend zu machen und scheitern daran. Wir sagen nicht »er kann mich im Arsche lecken« wie der Götz von Berlichingen – stattdessen machen wir das Scheitern zu einem persönlichen Problem, einer Frage der inneren Haltung, und treten den Schlamm, bis wir zu ersticken drohen, kommen als Gespenster nach Bad Hochwald auf dem Hügel, als Schatten, als soundsovielter Abklatsch unserer selbst.
Reden und endlos reden, Vorträge hören und zuhören, endlos zuhören, Gewohnheiten ändern, alles Mögliche ausprobieren, experimentieren mit Sinn, mit Hoffnung, Beziehung und so weiter … werden als »neuer Mensch« dann entlassen.
In Bad Hochwald auf dem Hügel wird unser Verhalten vorhergesagt, ein Konzept entwickelt, das die Kosten unseres Scheiterns, die Schäden unseres künftigen Verhaltens für die Kassen so gering wie möglich hält, das die Wirtschaft so wenig wie möglich belastet. Es geht darum, für uns andere, leichter zu bewältigende, niveaulose Arbeit zu finden oder uns in die Berufsunfähigkeit oder Frührente zu entlassen. Uns erwartet damit eine extrem viel niedrigere Rente als wir bekommen hätten, wenn wir im erlernten Beruf verblieben wären, aber egal: Zieh den Trennstrich jede Minute! Falls wir noch etwas besitzen und gebunden sind, so verkaufen, verlassen wir das jetzt alles, um anderswo und ganz allein neu anzufangen.
Es geht uns besser als den Mitarbeitern der französischen Telekom, deren Manager sie in den Tod gejagt haben.
Da sitzt eine Journalistin bei mir im Schmittchen, die noch per Hand ihre Sendungen geschnitten und Bänder geklebt hat.
Eine junge Dozentin hatte schon beim ersten Digitalisierungs-Workshop gesagt: »Sie schaffen das nicht mehr. Nichts gegen Sie persönlich, aber Menschen über fünfzig können das nicht mehr schaffen!«
Da ist die Journalistin wütend geworden. Sie war zweimal als Kriegsberichterstatterin unterwegs, zweimal im Krieg. Sie hat ihrem Mitarbeiter, der mit der schweren Kamera auf der Schulter plump und nach hinten oder seitlich blind war, mehrfach das Leben gerettet. Sie ist sein drittes Auge gewesen, seine Bewacherin, sein Schutzengel auch.
»Mädchen«, dachte sie wütend, »sag du mir nicht, was ich schaffen kann und was nicht! Ich schaff das!«
Und sie hat sich nachts im Sender einschließen lassen und geübt und geübt und geübt.
Aber schaffte es nicht. Hat versagt, hat versagen müssen, versagte weiter und auf anderen Gebieten, entwickelte irgendwann eine Überempfindlichkeit, Nervosität, einen Tick, eine Störung, eine Krankheit – ich weiß nicht mehr, was.
Kam zu uns.
Als sie mir ihre letztlich sinnlosen Nachtschichten im Sender schildert, lächelt sie grimmig.
Ich weiß nicht, wie die Sache für sie ausgeht, ob sie degradiert wird, ausgemustert, früh verrentet, ob sie zu einem Stadt-Magazin oder zum Freien Funk Wütender Bürger wechselt, wie auch immer, der Weg zurück auf den alten Arbeitsplatz ist versperrt.
Eines Tages sitzt meine Schwester Manuela auf einem der grünen Sofas und steht nicht mal auf, als ich auf sie zulaufe, um sie zu begrüßen und zu küssen.
Meine tapfere, gut organisierte, sportliche, schöne Schwester Manuela Schmitt, die als Krankenschwester in Leipzig eine Pflegestation geleitet hat, ist daran so restlos gescheitert, dass sie wie ein weißes Gespenst aussieht, das hinter der Tapete haust, nur noch Haut, dünn wie ein Tuch. Vom Entwurf ihres Lebens, den sie sich schon als Schülerin gemacht und über’s Bett geklebt hat, ist nur noch ein Streifen übrig geblieben, ein einsamer, durchsichtiger Streifen Tesafilm.
Sie kommt jeden Tag zwischen den vielen Terminen ihrer Reha wenigstens kurz mal zu mir, ich gebe ihr dann Tee und halte ihre zittrigen Hände.
So heruntergekommen, so zittrig, so dünn ist sie, weil sie seit langem nicht mehr schlafen kann. Sie muss immer zugleich wachen und schlafen. Sie hat schlafend gewacht und wachend geschlafen, bis nur noch ein Fädchen sie ans Leben klebte. Um ein Haar hätte ihre Seele das Licht getrunken, aber sie hat es gerade noch nach Bad Hochwald geschafft.
Als sie mir erzählt, was zuletzt bei ihr los war, denke ich, wie kann so ein Unsinn einen Menschen so ausdünnen, wie kann eine Kleinigkeit ihn so schwächen?
Gut, von vorne: Sie besitzt in einem der grünen Viertel in Leipzig ein Haus. Mann, Kind, zwei Liegeräder, eine Lebensversicherung. Beruflich hat sie über die Jahre etliche Menschen durch Krisen oder beim Sterben begleitet, sie ist nicht leicht zu erschrecken, aber scheitert an einem Programm, das sie nicht erlernen kann.
Sie soll die Dienstpläne ihrer Mitarbeiterinnen so erstellen, dass diese – und die Geschäftsleitung – sie jederzeit überall abrufen können.
Manuela erstellt aber weiter die Dienstpläne wie bisher auf großen kopierten Bögen, in die sie die Zeilen per Hand und mit Bleistift einträgt, da sie häufig kurzfristig ändern muss. Das wird nicht akzeptiert. Es gibt niemanden, der es für sie erledigen kann. Sie muss es selbst tun, zugleich aber auf Station mitarbeiten. Formell ist sie von der Pflege freigestellt, aber sie arbeitet mit, um die anderen zu entlasten, das Team hat zu wenig Hände und Köpfe. Als sie eine Fortbildung macht, kann sie sich nicht konzentrieren. Immerzu denkt sie an ihre Station und empfindet es als sinnlos, in Halle am Computer zu üben, während die Kolleginnen sie in Leipzig vermissen.
Als sie zurückkommt, versucht sie es mit dem neuen Programm, stellt aber fest, dass sie sich fast nichts hat merken können.
Ihre Fehler wirken sich auf die Gehaltsabrechnungen aus.
Ihre Kolleginnen beschweren sich bei Manuelas Vorgesetztem, bei T.
Manuela wird ermahnt, wird stärker beobachtet und öfter überprüft.
Das macht sie so nervös, dass sie weitere Fehler macht und abgemahnt wird, aber das Programm zu erlernen ist ihr nicht möglich, es ist nicht möglich.
Nach Hochwald ist sie aus dem Beruf ausgestiegen.
Was nicht überlebt hat, das ist ihre erste Ehe, ist das Haus in Leutzsch, die Lebensversicherung und ihre beiden Liegeräder. Alles, was verkauft werden konnte, musste zu Geld gemacht werden.
Sie ist auch ihrer Tochter Lisa-Marie unheimlich geworden in der Zeit, als sie Medikamente nahm, die ihr Wesen veränderten. Ich weiß nicht, ob meine Nichte inzwischen ihrer Mutter wieder vertraut. Ich weiß nur, dass sie in Mannheim eine Ausbildung zur Tischlerin macht und seit ihrem Auszug weder Mutter noch Vater besucht hat.
Das ist es, was Manuela mir erzählt, wahrscheinlich ist alles viel komplizierter.
Ich habe in ungefähr derselben Lage meine Brockhaus-Enzyklopädie verkauft, die letzte gedruckte Ausgabe, mit Goldschnitt und Ledereinband.
Mehr hatte ich nicht zu geben.
Und eines Morgens steigt Manuelas Ex-Mann aus dem Sammelbus vom Bahnhof Hochwald. Sitzt Sigmund zwischen den genügsamen und zugleich fleischigen Pflanzen in den Hydrokulturen.
Sigmund, mein Ex-Schwager, erzählt mir endlos viel von seiner Chefin, der Schandauer. Er spricht diesen Namen immerzu aus, spricht mehr von ihr als von Manuela oder Lisa-Marie. Immerzu heißt es: Die Schandauer, Schandauer, Schandauer, Schandauer.
Wenn er bei der Schandauer kündigt, wird er sich frei wie Sisiphos auf dem Berge fühlen, der seinen Blick über die Höhen schweifen lässt, während er den Felsen ins Tal rumpeln hört.
Was ihm passiert ist: Sigmund arbeitet im Verbund mehrerer Bildungsträger, die sich die Sekretariatsstunden aufteilen, jeder Lehrer muss alle Medien selbst bedienen können.
Sigmund kopiert eines Tages Prüfungsaufgaben für die Abschlussprüfung samt Lösungshorizont für die Kollegen. Er kopiert das alles nur einmal, schaltet den Kopierapparat ab und verschließt die Aufgaben und Lösungen gewissenhaft in seinem Schreibtisch. Als nun am nächsten Morgen die Schandauer den Kopierer anstellt, wirft dieser 111 mal das Blatt mit den Prüfungsausgaben aus.
Nun dürfen auch Schüler dort kopieren, es ist ein Zufall, dass nicht ein Schüler diese Kopien findet. Er hätte sie heimlich an sich nehmen und verteilen können – eine Katastrophe!
Wäre das irgendwann ausgeplaudert, müssten alle Zeugnisse kassiert werden; schon im Beruf stehenden Absolventen wäre ihre Berufsbefähigung aberkannt worden.
Sigmund wird in aller Strenge ermahnt. Von da an ist es mit seiner Arbeitsfreude vorüber.
Was ist geschehen?
Um die Ziffern und Worte auf dem Anzeigenfeld des Kopierers zu erkennen, bräuchte Sigmund mit seinen 55jährigen Augen eine Lupe, für die Eingaben ein Streichholz. Seine Finger sind zu dick und er drückt zu lange und zu fest auf dem Touch-Screen herum. Er rutscht von Ziffer 1 auf die 2 und bestellt unwissentlich 112 Kopien statt einer, von denen 111 am Folgetag ausgedruckt werden, ohne dass Sigmund sich überhaupt bewusst wird, dass er einen Druckauftrag in die Warteschleife geschickt hat. Sicher gibt es auf dem Display Hinweise, die er aber nicht lesen kann – zu klein.
Er nimmt die erste Kopie an sich, drückt auf den Ein- und Aus-Knopf, bemerkt, sieht und fühlt nicht, dass er einen Fehler gemacht hat.
Doch selbst hinterher, als er den Fehler begreift und analysiert, weiß er, dass er ähnliche Fehler wieder machen wird, er wird sich nie an die Berühr-Bildschirme gewöhnen, wie er auch mit vielen anderen der neuen Medien nie zurechtkommen wird. Sein Zeitgefühl, sein Raumgefühl, sein Sehvermögen, sein Tastsinn, sein Körperwissen, seine Reflexe … alles, sein ganzes Sein hindert ihn daran.
Darf er zugeben, dass es nicht geht? Ja, aber das ändert nichts. Es gibt nun einmal kein Budget für Sekretariatsaufgaben, es gibt keinen Kollegen, der ihm vor dem Unterricht etwas einrichten, es gibt niemanden, der für Sigmund kopieren könnte.
So hat die Schandauer Sigmunds Schule aufgestellt. So kann der Schulverbund größer und größer und größer werden, während Sigmund, während die übrigen Lehrerinnen und Lehrer schrumpfen.
Wie die Sache für Sigmund weitergeht, weiß ich nicht. Obwohl er anekdotenreich und fröhlich mit mir gesprochen hat, meldet er sich nach seiner Reha nicht mehr.
In zwanzig, dreißig Jahren werden Sigmunds Schüler hier auf den grünen Sofas landen, wenn ihr Beruf überflüssig, ihre Ausbildung wertlos geworden ist, wenn von all ihren Fähigkeiten nur noch die eine zählt, nämlich die, ihre Unfähigkeit zu überspielen.
Gegen zweiundzwanzig Uhr ist es still unter der Glaskuppel. Die Tische habe ich weggeräumt, die Glastüren zugezogen. Die Aula ist leer, die Jalousien geschlossen, die Tropfen und der einzelne Pfropfen leuchten nicht länger. Nur ein hochwaldblaues Lichtband zieht sich an den Wänden entlang zu den Treppenhäusern und Aufzügen.
Im winzigen Personalraum am Café Schmittchen brennt eine Tischlampe mit orangenem Schirm.
In diesem Licht sitzt mir Dipl.-V. Morten gegenüber. Wir essen die offenen Lebensmittel, die ich morgen nicht mehr anbieten kann, einen kleinen Obstteller mit Käse, dazu Vanillewaffeln, deren Haltbarkeitsdatum heute abläuft.
Wir sind ganz allein in der Stille, die Aula zwischen Block V und Block IV ist nachts meistens leer.
Morten hält eine kleine Klagerede.
Morten hält eine kleine Klagerede. Vorhin hat ihm einer aus Block I gesagt, es könne doch nicht sein, dass er mit seiner Arbeitszeit nicht zurechtkäme, er müsse sich besser abgrenzen und anders organisieren.
Block I misstraut grundsätzlich jedem. Wenn sich Morten nicht anders organisieren kann, dann, weil er von Berufs wegen idiotensüchtig ist, weil ihm das große L – wie Looser – auf der Stirn geschrieben steht.
Priester, Chorleiter und Jugendtrainer können gar nicht anders als pädophil sein. Soldaten und Metzger sind Sadisten. Controler entwickeln Kontrollwahn und Waschzwang. Bei der freiwilligen Feuerwehr sind nur Pyromanen. Jeder Musiker oder Sportler ein Masochist. Die Bürgermeisterin von Bad Hochwald leidet an Geltungssucht. Und ein Dipl.-V. Morten muss ein geborener Verlierer sein, sogar ein Diplomverlierer, sonst würde er doch was anderes machen als Bad Hochwald, sonst wäre er nicht Tag für Tag länger hier oben als alle anderen Weißkittler aus Block V, der psychosomatischen Klinik.
Morten will rauchen.
Ich öffne das kleine Klappfenster, das aus der Küche nach draußen geht. Nur dort kann ich es riskieren, ihn rauchen zu lassen, nachdem sie die Rauchvermeider eingebaut haben.
»Ich bin aber nicht idiotensüchtig«, sagt Morten, »ich will doch einfach nur das machen, wofür ich ausgebildet worden bin und was ich halbwegs gut kann, weil ich es länger mache als was anderes.«
Und ja, vielleicht sei er zu langsam in allem oder zu gründlich …
Ich gebe ihm den billigen Trost, dass die Rehabilitanden nur gut über ihn sprächen, wenn sie mir im Café Schmittchen etwas erzählten.
Ich weiß nicht, ob er mir glaubt oder sich nur entspannt, weil er meine Freundlichkeit bemerkt.
Er schließt die Klappe und kehrt lächelnd an den Tisch zurück.
Wir lassen das Geschirr stehen, weil die Spülmaschinen schon abgepumpt sind, und bevor wir uns trennen, wünschen wir uns eine Gute Nacht.
Er geht nach Minus-Null-Drei in die Tiefgarage und zu seinem Dienstwagen, ich zum Treppenhaus im Block IV, wo fast alle Angestellten von Bad Hochwald ihre Apartments haben.
Die Begegnung mit Morten wärmt mich, er gibt mir ein gutes Gefühl für die Nacht. Er kommt fast jeden Werktag, aber manchmal kommt er auch nicht. Ich kann mich nicht darauf verlassen. Dass er heute da war, lässt mich wieder hoffen. Leichtfüßig und beschwingt nehme ich zwei Stufen auf einmal bis hoch in den siebten Stock. Ich freue mich an meiner Beweglichkeit und denke: »Fünfzig ist die Jugend des Alters … wir sind selten nicht hübsch gewesen«, oder ähnliche Sätze, die ich auf der Ratgeberseite einer Illustrierten oder in einer Kolumne der Hochwald-Post gelesen habe.
In der folgenden Nacht ist er wieder bei mir. Nun sitzen Morten und ich über den Resten des Marmorkuchens, den ich heute nicht habe verkaufen können.
Morten freut sich über den matschigen Kuchen wie ein Kind, das die Teigschüssel ausschlecken darf, »das ist jetzt mein Lohn«, sagt er.
Heute musste er den Vortrag halten, den er seit Jahren etwa alle drei Wochen hält: »Vom Burnout und Burnin zum Burnon«.
Burnout bedeutet zu viel, Burnin zu wenig zu tun zu haben, einmal bläht sich das Leuchtmittel auf und explodiert, einmal vertrocknet es und zerfällt. Bad Hochwald soll helfen, in den Burnon zu kommen, also stetig zu glühen wie ein Leuchtmittel im Energiesparmodus, und um das zu erreichen, brauchst du eine banale gesunde Verbindung zwischen Arbeit und Privatem. Sagt Morten – und schämt sich dafür, Dinge anzupreisen, von denen jeder Mensch wissen müsste, dass sie gut für ihn sind, jeder vernünftige Mensch, jeder Mensch mit einem Quäntchen Lebenserfahrung oder Selbstwahrnehmung: Spazierengehen zum Beispiel, eine angemessene Sportart, Obst und Gemüse, abends nicht mehr in einen großen oder kleinen Bildschirm schauen – Bücher zu lesen, traut er sich kaum noch zu sagen – keine Stand-bys im Schlafzimmer, all so Sachen eben bla bla. Er rät den Schlaflosen, ein Zeitfenster zu bestimmen, in dem sie immer auf ihrem Bett in einem stillen, ruhigen, dunklen und nicht zu warmen Raum liegen sollen. Vielleicht würde sich der Schlaf einstellen, vielleicht käme er in einem dunklen, stillen Raum ohne Smartphone und Fernseher ganz von selbst.
Du musst sie wie kleine Kinder an all das heranführen, was ihnen gut tut, du musst es verpacken, sonst nehmen sie nichts davon an, nicht Spazierengehen anraten, sondern Waldbaden, nicht Seilspringen, sondern Rope-Skipping, nicht Lesen, sondern die Webseite nennen, wo du für jedes gelesene Buch einen Credit-Point bekommst, nachdem über Fragen zum Inhalt geprüft wurde, ob du das Buch wirklich bis zu Ende gelesen hast.
Im Schmittchen verkaufen sich die Heftchen gut, in denen die Menschen lernen sollen, von wenig zu leben und die einfachen natürlichen Dinge zu schätzen. Der Verkäuferin mit schweren Beinen wird empfohlen, barfuß durch feuchtes Gras zu gehen, oder eine bestimmte Feuchtigkeitscreme zu kaufen. Und für sie wird es in der Regel leichter sein, im Drogeriemarkt diese Creme zu kaufen als irgendwo eine Wiese zu finden, durch die sie ohne Schamgefühl barfuß spazieren gehen kann.
Morten ist es unangenehm, den Rehabilitanden etwas ans Herz zu legen, das langsam, schwach und zart, auf Dauer und erst in der soundsovielten Wiederholung wirkt, während sie es gewöhnt sind, etwas in sich hineinzukippen, zu schlucken, zu sehen, zu hören oder zu spritzen und sofort, auf der Stelle, einen Effekt zu haben.
Morten hält das Ganze für sinnlos: Entweder ist die Motivation zum Lesen da, dann kommt sie von innen heraus, oder sie ist nicht da und dann nützt auch die Registrierung auf der Webseite nichts und der Credit-Point nach erfolgter Lektüre, der bei Mc Donalds einen Rabatt gewährt … aber er muss den Vortrag halten. Jeder neue Schub Rehabilitanden hat ein Recht darauf.
Einmal habe ich ihn mir angehört. Mortens liebe Stimme, sein blasses Gesicht, die verschatteten Augen … noch nicht einmal mich überzeugt er, wenn er vorschlägt, sich jeden Tag etwas Gutes zu tun, und wäre es auch was ganz Kleines.
Es ist ihm anzusehen, dass er selbst fast nichts von dem macht, was er anderen anempfiehlt, dass er weder genug schläft, noch regelmäßig isst.
Ich saß in der ersten Reihe, lächelte ihm zu und er erwärmte sich ein wenig mehr für sein Thema, so dass das Publikum am Ende sogar applaudierte.
Heute jedoch ist es nicht gut gelaufen, denn es war ein Controler im Publikum.
Es macht Dipl.-V. Morten unsicher, wenn er im Publikum einen Mann oder eine Frau in Türkis erblickt. Alle paar Monate hört ihm einer der Controler aus Block Iunangemeldet zu, um seine Leistung und Akzeptanz zu bewerten.
Diesmal war es ein sehr junger Controler, der seine eigene Rolle noch nicht kennt, denn er meldete sich zu Wort und hielt einen spontanen begeisterten Vortrag über den eigenen Umgang mit dem Thema »Vom Burnout und Burnin zum Burnon«.
Morten unterbrach ihn nicht. Es war ihm ganz recht, dass die Zeit verging, ohne dass er sprechen musste.
Zuerst hat der junge Türkiskittler begeistert erzählt, dass kein Weiß-, oder Blaukittler im Hochwald-Klinikum jemals unter Burnin zu leiden habe. Sie hätten alle immer genug und abwechslungsreich zu tun. Burnin käme in Bad Hochwald nicht vor. Und zum Thema Burnout und zur Work-Life-Balance habe er selbst einen guten Tipp: »Stellen Sie sich vor«, sagte der junge Controler, »Sie haben drei Luftballons. Sie dürfen aber nur zwei halten, in jeder Hand einen. Und keiner darf so weit wegfliegen, dass Sie ihn nicht mehr erwischen können. Sie werden einen Ballon loslassen, dann den anderen, den ersten wieder einfangen, den dritten kurz loslassen, wieder fangen usw., eine ständige Bewegung, die auf die Dauer sehr anstrengend ist, obwohl die Übung zunächst leicht scheint. Und dabei nicht ermüden, konzentriert sein, nicht aufgeben. Auf dem ersten Ballon steht: Familie. Auf dem zweiten: Arbeit. Auf dem dritten: Gesundheit.
Sie werden erst zur Ruhe kommen, wenn Sie sich entscheiden, einen der Ballons wegfliegen zu lassen, dann dürfen Sie zur Ruhe kommen, in jeder Hand einen Ballon.«
Er hat sich entschieden, den Ballon Familie steigen zu lassen und seither geht es ihm viel besser.
Er hat sich von seiner Frau getrennt und die Kinder bei ihr gelassen.
Jetzt hat er alle Zeit für die Themen Arbeit und Gesundheit und erhält deutlich mehr Prämien als früher, wovon sowohl die Allgemeinheit als auch Frau und Kinder etwas haben, denn er zahlt höhere Steuern und mehr Alimente. Er geht jeden Tag zum Work-Out ins Fitness-Studio, nutzt den Urlaub zur weltweiten Anwerbung neuer Kollegen und die Wochenenden zur europaweiten Anwerbung. Ja, er besucht gern die Familien »unserer« Blaukittler in ihrer Heimat. Dort wird er mit einer Gastfreundschaft aufgenommen, die in Deutschland selten vorkommt. Und fast immer bringt er einen neuen Blaukittler, eine neue Blaukittlerin mit.
Bad Hochwald wachse ständig. Es sei mit einem international besetzten riesigen Schiff zu vergleichen, das erfolgreich durch die Weltmeere kreuzt.
Er wäre nicht als ein Mensch ohne Familie zu bedauern, sondern frei von einer Familie. Er wäre nicht kinderlos, sondern kinderfrei, nicht lieblos sondern liebfrei.
Und setzte sich wieder.
Niemand hat ihm widersprochen. Niemand hat dem etwas entgegengesetzt. Auch Morten nicht. Der junge Controler hat sie alle beschämt.
Während der drei Wochen in Bad Hochwald versuchen die meisten Rehabilitanden, so viele Punkte wie möglich auf ihren Dau zu speichern; jedes Plasmabrett zeigt ihren Punktestand an. Also hören sie auch auf Morten und gehen in den Wald.
Ab drei Kilometern speichert der Dau je einen Punkt für Waldbaden, Stille-Übung, Fuß-Massage, Immunstärkung, Walking, Sensual-Overloop, Balancing und Asthma-Prävention.
Eine Hamburger Erzieherin, die in einem Schulhort mit vierzig Kindern angefangen hat zu arbeiten, kann sich die Namen der nunmehr rund 500 Grundschüler nicht mehr merken, auf die der sozialpädagogische Bereich derselben Schule 35 Jahre später angewachsen ist. Sie kann sich auch die Gesichter und die Namen der unzähligen Erwachsenen nicht mehr merken, die diese Kinder abholen oder auch unter keinen Umständen abholen dürfen.
Dazu die Enge, der Lärm, die ständigen Unterbrechungen bei allem, was sie anzuleiten versucht – und zu keinem Kind eine Bindung.
Heute kann sie in den Teamgesprächen nicht mehr sagen, wer mit wem spielt oder welche sich wie entwickelt hat. Sie beobachtet so viel, dass sie letztlich nichts mehr beobachtet.
Sie verstummt im Team, bereitet keine Aktivitäten mehr vor, bietet nichts an, fühlt sich als Verkehrsschild auf dem Pausenhof, ihre Stimme ist ein Signalgeber, ihr Körper ein Punching-Ball, ihre Qualifikation die einer Türsteherin vor einem Club.
Sie müsste laut, groß und schnell sein, aber sie ist klein, dick und langsam, ihre Stimme ist leise, ihr Kehlkopf chronisch entzündet.
Sie mag nicht mehr.
Im Café Schmittchen verlangt sie lächelnd nach einem kühlen Bier. Als ich ihr sage, dass ich keinen Alkohol verkaufen darf, bestellt sie Hagebuttentee, aber »schön sauer und handwarm, das erinnert mich an die Freizeiten von früher«.
Ich serviere ihn ihr und er hat die Farbe von frischem Blut.
»Sie sind so freundlich«, lobt sie.
Ich erwidere, alle kämpften ja ihren Kampf, von dem ich keine Ahnung habe, so wie sie ihren Kampf auf dem Schulhof, da wäre ich eben auch lieber freundlich zu allen.
Sie lächelt mich fast verliebt an, fragt mich nach meiner Kindheit, was für mich das Schönste gewesen wäre, und ich antworte, dass ich manchmal zusammen mit meiner Schwester und einer Freundin heimlich in das leerstehende Hotel Rappen eingedrungen bin und dort spielten wir ein sich stetig erneuerndes Fantasiespiel. Wir waren die Gäste, die Hoteliers, wir waren Königinnen und Dienerinnen, wir kamen aus anderen Zeiten, aus dem Märchen, von fernen Planeten, waren Waisenkinder –
»Und niemand hat Sie gestört?«
»Nein.«
»Sie Glückliche!«
Sie bedankt sich noch einmal, lässt den Hagebuttentee unberührt stehen und fragt, ob sie im Hotel ein Bier bekommen könne.
Ich muss das leider verneinen, Bad Hochwald sei ein Safe-Place, nenne ihr dann aber die Zimmernummer des tschechischen Kollegen, der immer was zu verkaufen dahat, sie sollte nur darauf achten, den Morgen-Urin-Automaten (MU) in ihrem Badezimmer für den Folgetag abzuschalten, ich erkläre ihr, wie das geht.
Als Kind war ich geliebt
Als Kind war ich geliebt und beschützt. Wenn ich Ärger im Schulbus hatte, verteidigte mich meine Schwester Manuela – nur anderthalb Jahre älter, ewig die große Schwester. Sie schlug meinem kindlichen Feind ins Gesicht und es war Ruhe. Sie verteidigte mich immer, sogar, wenn ich den Streit angefangen hatte.
So lernte ich, dem Leben grundsätzlich zu vertrauen und vertraute ihm auch als Erwachsene, probierte verschiedene Städte, Studienfächer, Berufe, Beziehungen aus.
Einige Jahre arbeitete ich für einen Verlag zunächst als Hausbotin, als Setzerin und Ausschneiderin von Rezensionen – Berufe, die nicht mehr existieren – ich arbeitete in den verschiedensten Schreibbüros, bei Anwälten, für eine Versandbuchhandlung, in einem Ärztehaus. Wenn ich irgendwo nicht gut genug verdiente oder Lust auf eine andere Stadt hatte, dann wechselte ich die Arbeit und fand stets leicht eine neue.
Ich arbeitete gern mit den ersten Personalcomputern, genoss es, nun viel schneller, anstrengungsloser tippen und vor allem korrigieren zu können als mit der mechanischen, dann elektrischen Schreibmaschine.
Doch dann kamen zwei Schläge, die ich bis heute nicht überwand und die mir das Gefühl geben, es nur noch mit Idioten zu tun zu haben.
Der erste Schlag war die Rechtschreibreform, die mich selbst verunsicherte und die darüber hinaus dafür verantwortlich ist, dass es heute kein Schild, keine Reklame, keine öffentliche Anweisung mehr gibt, die fehlerlos wäre.
Der zweite Schlag war, als sich das Internet für alle öffnete, wodurch plötzlich jedem einzelnen überall möglich wurde, sich öffentlich zu äußern.
Je größer die Dummheit, desto weniger ist der Dumme in der Lage, seine eigene Dummheit zu erkennen, umso sorgloser stellt er sie aus. Ich fühlte mich bald von Dummheit umstellt, in Dummheit getunkt, ich kannte auf einmal jeden einzelnen Dorfdeppen in jedem Dorf der Welt und das frustrierte mich, veränderte mein Menschenbild. Ich suchte nach einem Versteck, einem Safe-Place, fand Hochwald.
Aber zunächst mühte ich mich weiter zu arbeiten wie bisher, doch vernetzt verlor der Computer seinen dienenden Charakter. Er wurde vampirisch und saugte meine Kraft weg.
Am Arbeitsplatz fühlte ich mich einer sich überschlagenden Welle von Veränderungen ausgesetzt. Immer prägte ich mir die Arbeitsschritte, die Symbole auf der Oberfläche, ein und notierte mir auf Klebezetteln, wie was zu machen wäre, welcher Klick auf welchen und welche Berührung auf welche folgen musste. Und dann griff eine unsichtbare Hand in mein System ein und veränderte es, ohne dass ich das verlangt hätte, ohne, dass es mir nützte oder ich es brauchte. Die Leisten rechts und links, oben und unten, die Symbole waren plötzlich vertauscht, die aufplatzenden Geräusche aggressiver Werbung erschreckten mich, sich bewegende Bilder überdeckten die Symbole, die ich brauchte, um diese Bilder verschwinden zu lassen, jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Etwas geschah in Schichten, die ich nicht erreichen konnte, etwas geschah außerhalb des Rahmens, den mein Bildschirm vorgab. Meine eigentliche Arbeit war verdeckt, das, was ich mir notiert hatte, war ungültig. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Meine Augen zuckten, wo sie früher ruhig den Zeilen gefolgt waren. Ich verlor einen Schritt auf meinen Zetteln, eine Perle im Rosenkranz, und damit verlor ich den Pfad, ich verirrte mich nicht einfach, sondern der Weg, auf dem ich noch am Vortag sicher hatte gehen können, explodierte vor meinen Füßen.