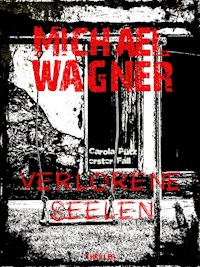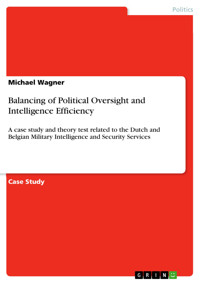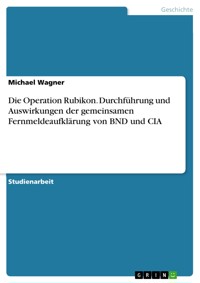9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kettling und Larisch ermitteln
- Sprache: Deutsch
In Lüdenscheid findet ein feuchtfröhliches Klassentreffen statt. Unter den Teilnehmern ist auch Theo Kettling. Als der Frührentner am nächsten Tag verkatert aufwacht, erreicht ihn eine Hiobsbotschaft: Drei Schulkameraden sind nach der Feier mit ihren Autos tödlich verunglückt, und zwar völlig unabhängig voneinander. Kann das Zufall sein? Nein!, meint Lieselotte Larisch, eine Bekannte von Theo. Die pensionierte Schulrektorin merkt nämlich sofort, wenn eine Sache zum Himmel stinkt. Also nehmen sie und Theo die Ermittlungen auf - und befinden sich bald auf einer abenteuerlichen Mörderjagd quer durchs Sauerland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Epilog
Danksagung und Schlusswort
Über das Buch
In Lüdenscheid findet ein feuchtfröhliches Klassentreffen statt. Unter den Teilnehmern ist auch Theo Kettling. Als der Frührentner am nächsten Tag verkatert aufwacht, erreicht ihn eine Hiobsbotschaft: Drei Schulkameraden sind nach der Feier mit ihren Autos tödlich verunglückt, und zwar völlig unabhängig voneinander. Kann das Zufall sein? Nein!, meint Lieselotte Larisch, eine Bekannte von Theo. Die pensionierte Schulrektorin merkt nämlich sofort, wenn eine Sache zum Himmel stinkt. Also nehmen sie und Theo die Ermittlungen auf – und befinden sich bald auf einer abenteuerlichen Mörderjagd quer durchs Sauerland.
Über den Autor
Michael Wagner, Jahrgang 1968, ist diplomierter Ingenieur der Produktionstechnik und gelernter Journalist. Heute arbeitet er als PR-Experte für ein großes Industrieunternehmen und lebt in der Nähe von Marburg. Sein Krimi-Debüt um die zwei Rentner Theo Kettling und Lieselotte Larisch ist eine Liebeserklärung an seine Heimat, das Märkische Sauerland.
MICHAEL WAGNER
Im Grab ist noch ein Eckchen frei
Sauerland-Krimi
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnUmschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.deunter Verwendung von Motiven von © shutterstock: PhotoHouse | Steve Collender | Iakov Kalinin | grafvisionE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6695-2
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für meinen Opa –der mir so viel mitgegeben hat.Johann Benisch, 1906–1987
Prolog
Was für ein herrlicher Frühlingstag, denkt sie. Die milde Vormittagssonne taucht das tief eingeschnittene Tal in ein goldenes Licht, und wenn sie den Kopf ein wenig aus dem Abteilfenster hält, kann sie trotz der laut schnaubenden Dampflokomotive, trotz der lebhaften Diskussionen der Frauen und des Geschreis der Kinder die Vögel zwitschern hören.
Im Zug ist es so voll, dass sie sich kaum rühren kann, doch das ist ihr egal. Die Fahrt, die sie schon am frühen Morgen angetreten hat, hat sich gelohnt. Das Gerücht stimmte: In einer der Bäckereien gab es Brot, und sie hat zwei Laibe für ihre Lebensmittelkarten bekommen.
Außerdem hat sie gleich noch das hübsche kleine Erinnerungsstück abgeholt, das er liegen gelassen hatte.
Dieser kleine Schussel – nun ist er schon fast dreizehn Jahre alt, und trotzdem vergisst er ständig irgendetwas. Immer muss sie auf ihn aufpassen, und wenn sie es mal nicht tut, passiert garantiert wieder ein kleines Unglück.
Böse aber kann sie ihm nicht sein. Er ist halt immer noch ihr Kleiner, und eigentlich will sie gar nicht, dass er in einigen Jahren erwachsen ist. Sie drückt die Brotlaibe an sich, schließt die Augen und genießt den Moment.
Sie vergisst die Not, die seit Monaten herrscht, und die Frage, wie sie ihre zwei Kinder jeden Tag satt bekommen soll. Sie vergisst sogar die Angst vor dem Besuch des Briefträgers, die Angst vor dem Feldpostbrief mit der Nachricht, dass sie ihren Mann niemals wiedersehen wird. Sie vergisst diesen ganzen verdammten Krieg, dessen Ende sich mehr und mehr anzukündigen scheint.
Durch das schrille Quietschen der Bremsen wird sie aus ihrer Ruhe gerissen. Der Zug steht, die Menschen im Abteil werfen sich ängstliche Blicke zu. Aus dem Stimmengewirr hört sie »feindliche Flugzeuge« und »Tiefflieger« heraus.
Gleich darauf fallen Schüsse – nicht in unmittelbarer Nähe, sondern in einiger Entfernung. Fest umklammert sie die Brote. Sie erwartet, dass die Reisenden die Flucht ergreifen, doch es bleibt alles ruhig, und schon bald setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Alles scheint noch einmal gut gegangen zu sein, und sie spürt, wie das Pochen ihres Herzens langsam leiser wird.
Dann hört sie lautes Motorengeräusch von Flugzeugen. Es hat sich nicht allmählich entwickelt, sondern ist plötzlich da gewesen.
Im nächsten Moment erschüttern die Explosionen zweier Bomben den Zug. Es scheint ihr, als rüttele der Teufel selbst das Abteil durcheinander, als drückte seine Hand sie gegen die Sitzlehne und gegen die Wand neben dem zersplitternden Fenster. Instinktiv schlägt sie ihre Arme vor das Gesicht und kauert sich so klein wie möglich zusammen.
Als sie den Kopf wieder hebt und die Augen aufmacht, eröffnen zwei Maschinen vom Typ Republic P-47 Thunderbolt das Feuer aus ihren MGs. Die Geschosse durchschlagen das Dach und die Wände des Waggons, und fast jedes trifft. Der Lärm der Schüsse, das Geräusch berstenden Stahls vermischt sich mit Schreien wie von Tieren.
Sie könnte durch das zerschossene Fenster aus dem Zug springen und versuchen, irgendwo eine Deckung zu finden. Doch die Panik lässt kein rationales Denken mehr zu. Sie sieht, wie die Menschen kreischend und in Todesangst versuchen, zu einer der beiden Abteiltüren zu kommen, und läuft ebenfalls los. Sie springt durch Blutlachen und robbt über zerfetzte Körper: Körper von Erwachsenen und Körper von Kindern.
Neben dem Bild des Grauens – eines Grauens, das tausendmal schlimmer ist als alles Böse, was sie bisher gesehen und erlebt hat – sieht sie noch ein zweites Bild. Die Gesichter ihrer Kinder. Sie will nicht, dass sie ohne Mutter aufwachsen müssen; sie will beide in ihre Arme schließen. Sie will leben.
Es gelingt ihr, die Abteiltür und die dahinterliegende Plattform zu erreichen und vom Zug zu springen. Sie rennt und stolpert wie von Sinnen die steile Böschung mit den Gärten hinauf, die neben den Schienen liegen, versucht, zur etwa fünfzig Meter oberhalb liegenden Kirche zu gelangen.
Doch sie schafft es nicht. Nur wenige Schritte vom rettenden Gebäude entfernt trifft sie ein 12,7-Millimeter-Geschoss aus einem der Browning-M2-MGs und löscht das Bild des Grauens, das Bild ihrer Kinder und alle anderen Bilder in ihr aus.
1
Theo Kettling hatte keine Lust, hier noch länger zu sitzen. Wie immer, wenn er einen Termin bei seinem Orthopäden hatte, schien das Warten kein Ende zu nehmen, und wie immer verzögerte sich seine Untersuchung um mehrere Stunden.
Ein einziges Mal hatte er sich in den letzten fünf Jahren getraut, das sinnentleerte Schauspiel abzubrechen, war von seinem Stuhl im Büro des Arztes einfach aufgestanden und gegangen und hatte den gleichermaßen unfähigen wie unfreundlichen Mediziner ebenfalls einfach sitzen lassen. Dies allerdings hatte sich bitter gerächt, denn seitdem dauerte es noch länger, bis die herrisch auftretenden Sprechstundenhilfen verkündeten, er wäre nun an der Reihe. Und auch die eigentliche Untersuchung durch den Arzt mit ihrem überaus schmerzhaften Höhepunkt, dem Nervenwurzel-Provokationstest, sowie der anschließenden, gar nicht enden wollenden Begutachtung der Medikation zog sich fortan noch quälender in die Länge.
Theo verfluchte den Tag vor bald fünf Jahren, an dem sich mit einem zwar heftigen, aber eigentlich doch so profanen und unbedeutend erscheinenden Schmerz im unteren Rücken die Spirale des Unheils in Gang gesetzt hatte. Er dachte an die Diagnose »akuter Bandscheibenprolaps«, die ihm hier in dieser Praxis eröffnet worden war. Und an den gleichermaßen unsinnigen wie verhängnisvollen Rat des Arztes, sich schnellstmöglich einer Operation zu unterziehen.
Danach nämlich war alles nur noch schlimmer geworden. Es hatte angefangen, auch im mittleren Rücken und im Nacken fürchterlich wehzutun, und phasenweise hatte er sogar Morphiumtabletten verschrieben bekommen, mit deren Einnahme die Schmerzen zwar auszuhalten gewesen waren, dafür aber war er von urplötzlich einsetzenden Träumen aller Art heimgesucht worden – am helllichten Tage, im Stehen und mit offenen Augen. Gar so unerträglich war sein Leiden zwar irgendwann nicht mehr gewesen, und auch das Morphium hatte er nach und nach absetzen können. Doch auch heute noch waren die Schmerzen im Rücken eigentlich immer da; auch dann, wenn er an etwas anderes dachte und sie deshalb nicht bewusst wahrnahm.
Das Schlimmste bei alldem aber waren nicht die Schmerzen, auch keine verrückten Tagträume oder anderen Nebenwirkungen von Medikamenten. Das Schlimmste war, dass diese verdammte Krankheit sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt hatte. Hatte er schon zuvor wenig Befriedigung bei dem Gedanken empfunden, seinen Lebensunterhalt als Konditor zu bestreiten, so war es ihm heute fast unerträglich, Frührentner zu sein und auf Kosten der Allgemeinheit zu leben.
Und zu allem Überfluss saß er – quasi als tragikomischer Höhepunkt des Ganzen – jedes Vierteljahr in der Praxis dieses tyrannischen Quacksalbers und musste dessen Launen über sich ergehen lassen.
Aber auch dieses Mal war es irgendwann geschafft. Irgendwann ließ der Arzt davon ab, Theos Bein weiter und weiter in die Höhe zu strecken, freilich erst, nachdem dieser ihm wie üblich vor Schmerz mit der Faust in die Seite geschlagen hatte. Schließlich und endlich war auch die Prüfung der Medikamentenliste abgeschlossen, allerdings nicht ohne den vorherigen obligatorischen Hinweis des Orthopäden, Theos Hausarzt werde ihn mit diesem Füllhorn an diversen Schmerzmitteln irgendwann noch ins Grab bringen.
Viel zu spät, um exakt 18.22 Uhr, verließ er die Praxis am Staberg. Zu spät, um sich noch eine halbe Stunde aufs Ohr zu hauen und den Schmerzen im Rücken etwas Einhalt zu gebieten. Zu spät, um sich im Bad halbwegs in Ruhe zurechtzumachen, und erst recht zu spät, um einfach noch etwas dazusitzen und sich zu freuen auf das, was da kommen würde und was zweifellos der Höhepunkt des gesamten Sommers 1974 war: das Klassentreffen!
Alle zwei Jahre trafen sie sich in der Ollen Piepe. Und immer noch war es so wie vor 30 Jahren. Obwohl sie charakterlich so unterschiedlich waren, oder eben gerade deshalb, waren sie ein eingeschworener Haufen gewesen. Einer war für den anderen da, und die autoritären Lehrer hatten alle Mühe gehabt, ihre Macht auszuspielen.
Theo freute sich darauf, gemeinsam mit den anderen die besten und lustigsten Anekdoten wieder aufleben zu lassen, Witze zu hören und Witze zu erzählen, zu rauchen und Bier und Schnaps zu trinken.
Gerade als er den Staberg hinuntergelaufen war und die Hochstraße erreicht hatte, fuhr ihm – trotz Winkens und hektischen Gestikulierens – der Einser vor der Nase weg. Der nächste würde zwar bereits in zehn Minuten kommen, doch so lange konnte und wollte er nicht warten. Mit Rückenschmerzen hetzte er die Hochstraße entlang und dann die Werdohler Straße. Kurz bevor er das Haus Nummer 195 a erreichte, überholte ihn der nächste Einser.
Fluchend erklomm er seine Wohnung im dritten Stock, zog sich hastig aus, setzte sich in die Badewanne und drehte die Dusche auf. Weil einerseits sein Vermieter, dieser miesepetrige Geizhals, nicht bereit war, eine moderne Dusche einbauen zu lassen und andererseits er, Theo, nicht über das notwendige handwerkliche Geschick verfügte, wenigstens eine Duschkopfhalterung über der Badewanne an der Wand anzubringen, war er seit siebzehn Jahren gezwungen, diese umständliche Form der Körperreinigung zu praktizieren.
Nachdem er unter den hässlich knackenden Geräuschen seiner Wirbelsäule der Wanne wieder entstiegen war, föhnte er sich das Haar zumindest so lange, dass es nur noch halbwegs feucht war, und trug eine unangemessen große Menge Eau de Cologne auf.
Einen Moment später stand er ratlos und hilflos vor dem Kleiderschrank. Er wollte gut aussehen, wollte attraktiv wirken. Was konnte daran so schwer sein? Denn heute war nicht nur Klassentreffen, was ja allein schon Grund genug war, ordentlich zu erscheinen, heute war das Klassentreffen, bei dem seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder sie dabeisein würde: Christiane Born, heute Stuckmann, aber längst wieder geschieden und allein lebend – sein großer Kindheits- und Jugendschwarm.
Nach anstrengender Grübelei entschied er sich für eine ausgewogene Mischung zwischen legerem Chic und Eleganz, zog seine neueste Jeans an und ein Hemd mit modischem Wellenmuster in verschiedenen Orange- und Pinktönen, dazu seine noch am wenigsten ausgelatschten Lederschnürschuhe.
Dank eines kurzen, aber wenig rückenschonenden Sprints zur nur hundert Meter entfernt liegenden Haltestelle erwischte er gerade noch den Einser um 19 Uhr 7.
Halbwegs bequem auf dem graublauen Kunststoffsitz hockend, konnte er endlich tief durchatmen. Und ging in Gedanken die Menschen durch, die er, bis auf zwei oder drei Ausnahmen, seit zwei Jahren nicht gesehen hatte und die ihm – ebenfalls bis auf zwei oder drei Ausnahmen – so viel bedeuteten. Er dachte an Elfriede Henke, heutige Nöllenkamp, das Organisationstalent, das sämtliche Klassentreffen seit sechsundzwanzig Jahren organisiert hatte. An Walter Stutenkötter, den Elektriker, dem es schon unzählige Male gelungen war, Theos uralten Schwarzweiß-Fernseher irgendwie wieder ans Laufen zu bringen. An Willi »Schlotti« Schlottmann, der spätestens nach seinem fünften Bier wieder mit gekonnten Parodien von Prominenten glänzen würde.
Und auch der Rest der üblichen Verdächtigen würde wieder mit dabei sein: Eva Brocke, verheiratete Pohl – ein lebenslustiger und humorvoller Wirbelwind, dazu noch ein sehr hübscher. Wo sie war, war immer was los. Das hatte sich in all den Jahren nicht geändert, und bei jedem Klassentreffen hatte allen voran sie für gute Laune gesorgt. Seit beinahe zwanzig Jahren lebte sie mit ihrem Mann und den drei Kindern in Frankfurt-Bornheim, doch sie war immer zum Klassentreffen erschienen.
Rolf Menkhoff – der Fabrikant, der es von allen am weitesten gebracht hatte. Nach seiner Lehre, dem Nachholen des Abiturs und dem Absolvieren der Ingenieursschule hatte er sich selbstständig gemacht und aus den berühmten kleinsten Anfängen heraus nach und nach ein Unternehmen aufgebaut, das mittlerweile fast 250 Mitarbeiter an mehreren Standorten beschäftigte und als ausgewiesener Spezialist für fortschrittliches Elektroinstallationsmaterial galt. Die Arbeit kam bei ihm stets an erster Stelle, weshalb er auch nicht an allen Klassentreffen teilgenommen hatte. Diesmal aber würde er dabei sein, und Theo freute sich darauf, ihn wiederzusehen, weil Rolf bei allem Erfolg auf dem Teppich geblieben war und seinen angenehmen Charakter nicht verloren hatte.
Heinz Plettenkämper – der Lebenskünstler, der immer wieder eine windige Geschäftsidee fand, damit jeweils eine Zeit lang sehr erfolgreich unterwegs war und viel Geld machte. Der dann irgendwann übermütig wurde und alles in den Sand setzte. Doch Heinz stürzte niemals ganz ab, wurde niemals zum Sozialfall. Er schüttelte sich zwei-, dreimal, hatte die nächste Geschäftsidee, und das Drama ging von vorne los. Allerdings wuchs die Liste derer, die nicht besonders gut auf ihn zu sprechen waren, mit jeder neuen beruflichen Episode an. Immer blieben irgendwo Leute zurück, die anstatt seiner den Schaden zu tragen hatten. Im Moment hatte er seinen Lebensmittelpunkt im norddeutschen Oldenburg und war – wieder einmal – in Versicherungen unterwegs. Es fiel nicht schwer zu glauben, dass er auch das Klassentreffen dazu nutzen würde, einem oder besser gleich mehreren seiner ehemaligen Schulkameraden irgendeine Police aufzuschwatzen.
Marianne Brüseke, verheiratete Dierbusch – als Jugendliche die graueste Maus, die man sich nur vorstellen konnte. Nicht hässlich, aber völlig unscheinbar. Sie hatte auf die Jungen weder attraktiv noch unattraktiv gewirkt; sie hatte ganz einfach gar nicht gewirkt und hatte auch unter den Klassenkameradinnen kaum Freundinnen gehabt, da sie sich vorwiegend mit sich selbst zu beschäftigen schien und nur selten den Eindruck erweckt hatte, Kontakt zu suchen. Nach der Schulzeit aber hatte sie ganz offenbar irgendeine erstaunliche Entwicklung durchlaufen. Nach einigen Jahren war Theo – und wohl auch den anderen – aufgefallen, dass sie von Klassentreffen zu Klassentreffen hübscher wurde und immer kommunikativer und eloquenter wirkte. Und heute nun, mit Anfang 40, war sie zweifellos die schönste und charmanteste Frau der ehemaligen Klasse b des Einschulungsjahrgangs 1938.
Harry Hölscher – der Eigenbrödler. Harry sagte selten etwas. Er saß da, hörte hin und wieder den Gesprächen und Witzen zu, ohne dass er dabei sonderlich großes Vergnügen zu haben schien. Je höher allerdings sein Alkoholpegel stieg, umso näher kam der Punkt, da er – stets urplötzlich – äußerst mitteilsam wurde. Wer dann gerade neben ihm saß, hatte den schwarzen Peter gezogen. Harry erzählte und erzählte; nicht über das Wetter, nicht über Politik und Gesellschaft, nicht über Musik oder Filme und auch nicht über Krankheiten. Nein, wenn Harry dozierte, dann über sein in höchstem Maße skurriles und einziges Hobby: Aufzüge. Alles, was an Literatur zu diesen, wie er selbst sagte, Wunderwerken der Technik vorhanden war, stand in seinem Bücherregal, und Harry war im Laufe der Jahre durch die ganze Republik, ja durch ganz Europa gereist, um seltene Exemplare zu inspizieren und eine Probefahrt zu unternehmen. Und auch heute würde ganz sicher wieder – vermutlich irgendwann zwischen elf und Mitternacht – das mit feuchten Augen und beeindruckendem Pathos vorgetragene Bekenntnis Harrys in die Runde schallen: »AUFZÜGE SIND MEIN LEBEN!«
Ingeborg Vollmann – die Emanze. Theo und den anderen männlichen Teilnehmern des Klassentreffens ein Graus und auch bei den Frauen umstritten, weil in ihren Ansichten und Forderungen unangemessen radikal und, so zumindest die weitgehend einhellige Meinung, weit über das Ziel hinausschießend. Theo hoffte inständig, dass Ingeborg Vollmann bereits in der Ollen Piepe war, damit er sich einen Platz möglichst weit von ihr entfernt würde suchen können und nicht das Gleiche würde erleiden müssen wie vor vier Jahren, als sie ihm in nicht enden wollenden Doktrinen klarzumachen versuchte, dass Männer generell niederträchtig seien, gipfelnd in der nicht näher begründeten These, er, Theo, gehöre auch dazu, zu der Sorte Männer, die man nur als Schwein inmitten eines reaktionär-sexistischen Schweinesystems bezeichnen könne.
Christiane Born, verheiratete Stuckmann, schon lange aber wieder geschieden, und, wie man hörte, derzeit alleine lebend. Was für ein Mädchen! Theo war seine ganze Kindheit lang und beinahe auch seine ganze Jugendzeit in sie verliebt gewesen. Und auch wenn er bis auf ein dreitägiges Intermezzo mit lediglich einigen Zungenküssen keine Chance bei Christiane gehabt hatte, so hatte doch die Begeisterung für sie nicht nachgelassen und war erst schwächer geworden, als die Schulzeit zu Ende gewesen war und man sich weitgehend aus den Augen verloren hatte. Sie war nur noch die ersten zwei Male beim Klassentreffen gewesen; dann war sie angeblich irgendwohin ins Ruhrgebiet gezogen, und von dieser Zeit an hatte Theo nie wieder etwas von ihr gehört. Nun aber war es Elfriede Nöllenkamp gelungen, sie ausfindig zu machen und einzuladen, und zu Theos beinahe euphorischer Freude hatte Christiane angekündigt, in der Ollen Piepe zu erscheinen.
Theo Kettling – der … er überlegte … Durchschnittliche. Nein, das klang zu negativ. Vielleicht »der Normale«? Ja, das ging; es war zumindest nicht völlig gelogen und hörte sich halbwegs erträglich an. Also weiter: der Normale, der eigentlich ganz sympathisch … konnte man das sagen, fanden die Leute ihn sympathisch? Der Normale, der eigentlich ganz nett war und der meistens … nein, der in aller Regel … der hin und wieder einen … hm … ruhigen und ausgeglichenen …
Ach, zum Teufel – es ging ganz einfach nicht. Er konnte sich nicht selbst charakterisieren, ohne sich die Vorfreude auf das Klassentreffen komplett zu versauen.
Als Theo an der Haltestelle »Wiedenhof/Bahnhof« ausgestiegen war und nach ein paar Schritten die Olle Piepe erreichte, standen bereits Elfriede Nöllenkamps VW K 70 und Marianne Dierbuschs Peugeot 304 Cabrio vor der Gaststätte. Neben dem Peugeot war ein weiteres französisches Fahrzeug auf dem kleinen Platz mit der Fahrzeugwaage abgestellt, ein giftgrüner Simca 1000 Rallye 2 mit Frankfurter Kennzeichen. Das schneidige kleine Auto musste Eva gehören. Offenbar war sie es leid gewesen, in der Großstadt immerfort mit einer unhandlichen Familienkutsche herumzufahren, und hatte sich den Simca als Stadtflitzer gekauft. Ein Fahrzeug, das ganz zweifellos zu ihr passte und genauso temperamentvoll war wie sie selbst.
Schon im Vorraum der Ollen Piepe mit dem Zigarettenautomaten konnte er es mehr oder weniger deutlich vernehmen: »Theeooo!« Er wunderte sich, dass die anderen ihn durch das kleine Fenster an der Straßenseite der stets mit Zigarettenqualm vollgeräucherten Kneipe hatten kommen sehen. Doch nachdem er die Tür zum Gastraum geöffnet hatte, begriff er, dass es gar nicht seine Klassenkameraden waren, die nach ihm riefen, sondern die griechisch-deutsche Schlagersängerin Vicky Leandros, die ihren Kassenschlager »Theo, wir fahr’n nach Lodz« mit Hilfe der alten Stereoanlage des Wirtes zum Besten gab. Seit einigen Wochen wurde der Gassenhauer im Radio rauf und runter gespielt; sehr zu Theos Leidwesen, weil er bei jeder Gelegenheit von allen möglichen Leuten damit aufgezogen wurde. Und kaum hatten die alten Schulkollegen ihn bemerkt, da brandete auch im Gastraum der Piepe Jubel auf, und sofort danach stimmten alle in Vicky Leandros’ Gesang ein – »Theeooo, Theeooo …«.
Der wirkliche Theo lächelte dünn, schlug ihm doch das Herz bis zum Hals in der Erwartung, nun Christiane Born, heutige Stuckmann, in die Augen zu blicken. Doch halb beruhigt, halb enttäuscht stellte er fest, dass sein großer Schwarm aus vergangenen Tagen noch nicht da war.
Er ging die Anwesenden mit zwei, drei schnellen Blicken durch und stellte fest, dass ansonsten nur Heinz Plettenkämper fehlte. Vermutlich würde er wie üblich ein bis zwei Stunden später kommen, mit irgendeiner neuen Angeberkarre, reichlich gehetzt wirken und von wichtigen Terminen faseln, die ein pünktliches Erscheinen unmöglich gemacht hätten.
Alle anderen waren da – auch Ingeborg Vollmann und Harry Hölscher. Nun konnte er sich einen freien Platz wählen, der so weit weg wie nur möglich von den beiden war, und damit zumindest für die ersten ein oder zwei Stunden des Abends sicherstellen, weder von Vorträgen über die beeindruckendsten Aufzüge in Südskandinavien noch über die Suffragettenbewegung in England ins Koma versetzt zu werden. Wie gewöhnlich musste Theo in den ersten Minuten seiner Anwesenheit unzählige Fragen nach seinem »schlimmen Rücken« beantworten, woraufhin – trotz der Beteuerung, es gehe schon – jeweils ein wahres Feuerwerk an Genesungswünschen sowie an gleichermaßen unnützen wie nervtötenden gesundheitlichen Ratschlägen folgte.
Endlich brachte die junge Aushilfsbedienung, die von Marianne Dierbusch Gabi genannt wurde und die Theo von irgendwoher kannte, sein erstes Herrengedeck – einen Korn und ein Bier. In der Piepe gab es Andreas-Pils; nicht gerade seine Lieblingsmarke, aber man bekam es runter. Wie zu Beginn jedes feuchtfröhlichen Abends nahm er sich vor, dieses Mal so hochkonzentriert mitzuzählen, dass er am Ende exakt wissen würde, wie viele Gläser er getrunken hatte.
Die Tür wurde aufgerissen, und teils von Applaus, teils von gequältem Aufstöhnen begleitet begrüßte Heinz Plettenkämper die Runde mit einem laut ausgerufenen »Hey, Leute – da bin ich!« Das rief er immer, und es klang immer wie: »Platz da – jetzt komm ich!«
Offenbar war nun der harte Kern komplett versammelt, und Marianne Dierbusch förderte ihre neueste Errungenschaft aus einer schicken Ledertasche zutage – eine Sofortbildkamera des Typs SX-70 von Polaroid. Außerdem stapelte sie noch eine ganze Batterie von Filmen vor sich auf den Tisch und legte den ersten davon mit fachmännisch wirkenden Griffen und unter erwartungsfreudigen Blicken in die schwarz-braune Kamera ein. Fortan klickte, blitzte und surrte es alle paar Minuten, und anschließend blickten die Fotografierten gebannt auf die sich wie durch Geisterhand langsam entwickelnden Aufnahmen.
Keine Frage: Marianne Dierbuschs Fotoapparat und die von ihm produzierten Bilder waren trotz fragwürdiger Farbqualität die Stars des Abends. Selbst die von Elfriede Nöllenkamp wie eh und je mitgebrachten und in die Runde gereichten Schulfotos schienen erstmals seit Jahrzehnten nur Nebensache zu sein. Die wenigen Aufnahmen, die während der Schulzeit gemacht worden waren – alle in Schwarzweiß, aber schärfer als Marianne Dierbuschs Sofortbilder –, wurden diesmal nur kurz und wohl eher aus Höflichkeit betrachtet, und sofort danach wandte man sich wieder auf Fotopapier festgehaltenen Momenten zu, die fast live waren, weil sie Situationen wiedergaben, die man nur Minuten zuvor erlebt hatte.
Offensichtlich etwas enttäuscht über das unerwartete Desinteresse, hatte Elfriede Nöllenkamp aber noch einen Pfeil im Köcher. Neben den vier altbekannten Fotografien – von der Einschulung 1938, vom Unterricht im Freien mit Klassenlehrer Gottfried Könning 1941, vom Unterricht im Klassenraum mit Gottfried Könning zwei Jahre später sowie von der Ausschulung 1946 – hatte sie noch eine weitere dabei.
»Wisst ihr das noch? Die hat mein Großonkel gemacht, als wir im vorletzten Schuljahr auf Klassenfahrt in Altena waren. Die ist dann auch bei mir ganz in Vergessenheit geraten, aber als mein Onkel Max vor einem halben Jahr gestorben ist und ich mitgeholfen habe, sein Haus auszuräumen, da fiel sie mir wieder in die Hände.«
An die Klassenfahrt zur Jugendherberge auf Burg Altena im Herbst 1944 erinnerten sich alle; an den Amateurfotografen Max Henke, der eigens aus Lüdenscheid gekommen war, um das Erinnerungsfoto zu machen, nur wenige.
Und anscheinend niemand außer Elfriede Nöllenkamp kannte das Mädchen, das an dritter Stelle von rechts in der hinteren Reihe stand.
»Das ist Ingrid Heimann. Sie war nur vier Monate bei uns. Ihr Vater war im Krieg, so wie fast alle unsere Väter. Und ihre Mutter hatte im Ruhrgebiet in irgendeinem Rüstungsbetrieb gearbeitet, bevor sie mit Ingrid nach Lüdenscheid kam. Doch nach nur vier Monaten ging sie dann wieder zurück ins Ruhrgebiet; ich weiß auch nicht mehr, wie und warum.«
Trotz der prächtigen Stimmung wurde Elfriede Nöllenkamp plötzlich nachdenklich.
»Als sie in unsere Klasse kam, wurden wir sofort Freundinnen. Wir waren unzertrennlich, gingen zusammen ins Kino, haben uns darüber unterhalten, welche Jungs nett waren und welche nicht, und haben heimlich unsere erste Zigarette geraucht. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann war das die schönste Zeit meines Lebens.«
Nun war es nicht mehr nur Nachdenklichkeit, die in Elfriede Nöllenkamps Stimme mitschwang, nun war es Traurigkeit und tiefes Bedauern.
»Als sie wegzog, wollte ich nicht mehr leben. Es war nicht so, dass ich meiner Mutter nur gesagt hätte, ich wolle nicht mehr leben. Nein, ich konnte … ich wollte wirklich keinen Sinn mehr erkennen ohne sie. Ich dachte jeden Tag an Ingrid, und ich kämpfte dagegen an, dass der Schmerz zurückginge, dass sich Licht in mein Dunkel mischte.«
Ihre Mitschüler, die gerade noch so ausgelassen feierten, schwiegen jetzt, wirkten zumeist ebenfalls berührt und hingen geradezu an Elfriede Nöllenkamps Lippen.
»Doch sosehr ich mich auch dagegen sträubte – irgendwann wurde der Schmerz weniger, und ich konnte mich wieder über Dinge freuen.«
Wären nicht die beiden volltrunkenen Idioten an der Theke gewesen, die irgendetwas von »In gut zwei Wochen sind wir Weltmeister, und morgen putzen wir erst mal die Ostzone« faselten, man hätte eine Stecknadel fallen hören können.
»Irgendwann fiel mir auf, dass ich mich nicht mehr an ihre Stimme erinnern konnte und später auch nicht mehr an ihr Gesicht.«
Hastig wischte sie sich mit dem Handrücken eine Träne von der Wange.
»Und wenn ich dieses Foto da ein paar Jahre später gefunden hätte … ich glaube, mir wäre nicht einmal mehr ihr Name eingefallen.«
»Hast du irgendeinen Anhaltspunkt, wo sie heute leben könnte?«, fragte Marianne.
»Nein, ich weiß noch nicht so recht, wo ich ansetzen soll. Aber ich habe mir fest vorgenommen, sie zu finden. Ich will sie unbedingt wiedersehen.«
Es folgten verschiedene Ratschläge zum Aufstöbern des Mädchens Ingrid Heimann, und schon bald lockerte die Stimmung wieder auf. Es wurde getrunken und geraucht, und Marianne Dierbusch fotografierte mit ihrer Polaroid SX-70 alles kurz und klein.
Als Theo sich eine seiner Krone-Zigaretten angezündet und den ersten Schluck aus seinem vierten Glas Bier sowie – natürlich in einem Zug – den Korn zu sich genommen hatte, blickte er mehr zufällig zur Tür und sah, wie eine überaus ungepflegt wirkende Frau den Gastraum betrat.
Sie schritt auf die zwei zusammengestellten Tische zu, blieb vor der Gruppe stehen und blickte ausschließlich in fragende Gesichter.
Theo erkannte sie prompt als Erster und erschrak beinahe zu Tode.
Das war Christiane Born. Heutige Stuckmann. Seine große Liebe aus Kinder- und Jugendtagen. Sie wog mindestens 110 Kilo, ihr früher so seidiges brünettes Haar hing in fettigen Strähnen von ihrem kugelrunden Kopf, und wenn sie einen Zahnarzt hatte, dann musste der letzte Behandlungstermin sehr lange zurückgelegen haben. Dazu trug sie abgelatschte Sandalen, deren helles Beige die schmutzigen Zehennägel zusätzlich betonte, einen Minirock, der selbiges in Bezug auf ihre dicken Beine übernahm und – als Krönung des Ganzen – ein viel zu enges knallbuntes T-Shirt, das jedes einzelne Speckröllchen perfekt zur Geltung brachte.
Während die anderen mehr oder weniger erfolgreich versuchten, ihr Entsetzen zu überspielen, und versicherten, man freue sich wahnsinnig, sie nach so langer Zeit wiederzusehen, und sie, Christiane, habe sich über all die Jahre gar nicht verändert, blickte Theo gedankenverloren in eine ganz andere Richtung. Inständig hoffte er, nicht erkannt zu werden. Doch wie üblich brachte die Schauspieleinlage nicht den gewünschten Erfolg.
»Aaah, wen haben wir denn da?«, rief Christiane Stuckmann spitz aus. »Na, wenn das mal nicht mein lieber Theo ist!«
Mit einem unerwartet schnellen Satz sprang sie auf den freien Stuhl neben Theo und rückte so nah an ihn heran, dass sie fast auf seinem Schoß saß.
Seitdem er vor einigen Tagen erfahren hatte, dass Christiane zum Klassentreffen erscheinen würde, hatte er sich wie ein zum ersten Mal verliebter Teenager die Begegnung mit ihr ausgemalt, hatte mit pochendem Herzen Stunden, später auch Minuten gezählt und dabei die Langsamkeit der vorüberfließenden Zeit verflucht. Wie sehr hatte er sich gewünscht, sie würde sich nicht einfach irgendwo hinsetzen, sondern ganz gezielt einen Platz neben ihm wählen. Und nun, da genau das flehentlich Ersehnte eingetreten war, wäre er am liebsten im Erdboden versunken.
Er stürzte sein Bier in einem Zug hinunter und rief der Bedienung namens Gabi zu, sie möge ihm schnell ein frisches Herrengedeck bringen. Es war doch immer so: Je mehr er trank, desto schöner wurden die Frauen um ihn herum. Dennoch war er skeptisch, dass die Maßnahme in diesem Fall funktionieren würde.
Christiane Stuckmann nahm Theo sofort in Beschlag, indem sie überaus lebhaft und ohne Punkt und Komma auf ihn einredete. Das einzig Tröstliche an der Situation war, dass er sich nicht sonderlich auf die »Unterhaltung« konzentrieren musste. Es reichte, wenn er Interesse durch regelmäßiges Kopfnicken heuchelte und hin und wieder ein »Ja« oder auch ein »Mhm« nuschelte.
Er hatte sich schon seelisch darauf eingestellt, für den Rest des Abends neben dieser auf so subtile Weise fremden Frau zu sitzen, die nicht nur ununterbrochen sprach, sondern auch alles andere als angenehm roch. Doch nach einer knappen halben Stunde und weiteren drei Herrengedecken war er erlöst. Christiane Stuckmann stand auf und suchte sich ihr nächstes Opfer.
Wie zur Feier dieses erhabenen Augenblicks legte der Wirt wieder die Single mit seinem Lieblingslied auf, das, zumindest an diesem Abend, offenbar das Lieblingslied aller war. Die Nadel setzte auf das Vinyl auf, und zwei Sekunden später rief Vicky Leandros – und weiß Gott nicht nur sie – »Theeooo …«.
Theo verband das Angenehme mit dem Nützlichen und verschwand unter den Protestbekundungen der vereinigten Theeooo-Brüller auf die Toilette. Nachdem er seine Blase entlastet hatte, ging er zum Waschbecken, förderte aus einem in seiner Hosentasche mitgeführten Röhrchen Spalt-Tabletten zwei Stück heraus und spülte beide mit einem großen Schluck Wasser hinunter. Wäre sein Orthopäde Zeuge der gleichsam eigenmächtigen wie unerlaubten Einnahme gewesen, hätte es mit Sicherheit ein fürchterliches Donnerwetter gegeben. Doch der war nicht da, und so sorgte Theo mit dem illegalen Medikamentenkonsum einerseits dafür, dass der Schmerz im Rücken etwas zurückgehen und andererseits der Brummschädel am nächsten Morgen nicht ganz so peinigend daherkommen würde.
Zurück am Platz und dort weit genug entfernt von Christiane, Harry und Ingeborg, gerieten die folgenden Minuten dennoch zu einer Belastungsprobe für seine Nerven. Er hatte zwei Jahre zuvor – wenn auch nicht allein und streng genommen eher begleitend – einen Mordfall aufgeklärt. Noch beim Klassentreffen 1973 war es ganz eindeutig und ausschließlich Bewunderung gewesen, die ihm seine ehemaligen Schulkameraden entgegengebracht hatten. Man hatte ihn mit allen denkbaren Fragen regelrecht gelöchert, und Theo war der unumstrittene Star des Abends gewesen.
Ein Jahr später aber gab es nichts mehr, das noch nicht beantwortet worden war. Stattdessen konzentrierten sich die Anwesenden darauf, den »Freizeit- und Hobbyermittler« auf den Arm zu nehmen. Wohlwollend bis liebevoll zwar, aber deshalb kaum weniger nervend. Theo Poirot, Hercule Kettling, Mr. Marple – die Kreativität am Tisch schien keine Grenzen zu kennen, und immer wieder wurden Forderungen laut, er möge doch den Tatort-Kommissaren Trimmel, Finke, Haferkamp und wie sie doch sonst gleich alle hießen, auf die Sprünge helfen; der Sonntagabend ziehe sich ansonsten ja unerträglich in die Länge.
Als die ausgelassene Runde sich endlich bequemte, zu anderen Themen überzugehen, fiel Theo auf, dass es nun doch wieder passiert war: Er hatte keinen Überblick mehr über die bislang konsumierten Herrengedecke.
Allenfalls war er in der Lage, ein grobes Spektrum zu umreißen, das bei elf bis vierzehn Stück lag.
Durch den mittlerweile recht beträchtlichen Alkoholpegel etwas verschwommen sah er Heinz, Rolf und Eva an jener schmalen Seite der Theke stehen, die fast an die Tür zum kleinen Vorraum grenzte.
Nun war es also so weit: Heinz begab sich auf die Suche nach Opfern für gute Geschäfte. Theo ärgerte sich über die Kaltschnäuzigkeit seines Klassenkameraden, dem ganz offensichtlich ein paar schnell verdiente Mark wichtiger waren als Freundschaften. Diese Erkenntnis war zwar nicht neu, aber dennoch schmerzhaft.
Da man in der Ollen Piepe für den Gang an die frische Luft ebenso an der Theke vorbeimusste wie für den Weg zum Zigarettenautomaten im Vorraum, blieben immer mal wieder einzelne Teilnehmer des Klassentreffens bei den dreien stehen, verabschiedeten sich aber jedes Mal nach einem kurzen Moment wieder. Anscheinend kam nur für Eva und Rolf der Abschluss einer neuen Versicherung in Frage.
Obwohl Theos Bierglas noch halb voll war, brachte Gabi schon wieder ein frisches Herrengedeck. Er ließ das alte Pils stehen, kippte das neue auf ex hinunter und ließ einen ungewollten, aber dennoch überaus lautstarken Rülpser folgen, für den er umgehend anerkennenden Applaus erhielt.
Schlagartig übermannte ihn eine massive Müdigkeit, was angesichts der ungezählten Herrengedecke aber auch kaum verwunderlich war. Gegen die bleierne Schwere ankämpfend, sah er zu Christiane Stuckmann hinüber, deren Anblick noch immer nicht attraktiv, ja nicht einmal erträglich war. Im Gegenteil: Mit ihrem großen Mund und dem oben am Kopf angeklatschten und ganz unten, an den Schultern, strähnigen Haar erinnerte sie Theo an den Kiemenmenschen aus Jack Arnolds Horrorschocker »Der Schrecken vom Amazonas«.
Heinz’ Akquise dauerte unterdessen erstaunlich lang. Selbst als Schlotti ein fiktives Streitgespräch zwischen Willi Brandt, Heinz Erhardt und Else Tetzlaff überaus gekonnt vortrug, blieben er, Rolf und Eva an der Theke stehen, schauten nur hin und wieder kurz herüber, lachten über Schlottis Gags und widmeten sich dann wieder ihrer Unterhaltung.