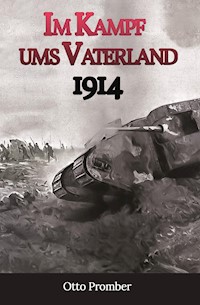
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Über 60 Erlebnisse aus den Kriegstagen des Jahres 1914 schildern die tiefen Eindrücke, die der Weltenumbruch bei den Beteiligten hinterlässt. Feldpostbriefe wurden hier ebenso zusammengetragen, wie auch die Darstellungen aus Presseberichten. Das vorliegende Werk von Otto Promber vermittelt einen hervorragenden Überblick über die Taten und Kämpfe deutscher und österreichisch-ungarischer Truppen. Erstmals stehen die Kriegsteilnehmer einer Vielzahl bis dahin unbekannter Waffengattungen gegenüber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im
Kampf ums Vaterland
Einzelbilder interessanter Erlebnisse sowie
Schilderungen hervorragender Taten
aus den Kämpfen der deutschen
u. österreichisch-ungarischen
Armee im Weltkriege
1914
Herausgegeben von
Otto Promber
_______
Originalausgabe erschien im:
Loewes Verlag Ferdinand Carl,
Stuttgart, 1916
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2018 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-145-5
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Titel
Die Beschießung des russischen Kriegshafens Libau
Ein deutsches Reiterstückchen.
Im Sturm auf Lüttich.
Wie Prinz Friedrich Wilhelm zu Lippe den Heldentod fand.
Erste Einfälle der Österreicher und Ungarn in Serbien.
Radlerstreiche.
Ein gefährlicher Ordonnanzritt.
Ungarn und Montenegriner an der Drina.
Der KriegspilotIn Feindes Mitte gelandet.
Mülhausen und Lagarde.
Die schneidigen Ungarn am Zbruz.
Heldenhafter Untergang der „Zenta“.
Tagebuchblätter eines Leutnants.
Der KriegspilotGegen die Serben.
Die bayrischen Löwen in der Lothringer Schlacht.
Der KriegspilotEine Heldentat deutscher Pioniere.
Minenwerfen in der Nordsee.
Wie ein Leutnant mit vier Mann ein Fort eroberte.
Beschießung des französischen Sperrforts Manonviller.
Die Schlachten an den masurischen Seen.
Standrechtlich erschossen.
Die Einnahme von Kielce.
Der KriegspilotNach der Schlacht.
Bei Verdun.
Ein Überfall.
Der Gefangenschaft entflohen.
Zweiter Teil
Im Kampfe um eine österreichische Fahne.
Furchtlos und treu.
Der Einmarsch der Deutschen in Brüssel.
Die Schlacht bei Krasnik.
Wann kommt der Befehl zum „Vorwärts!“?
Sieg des deutschen Kronprinzen bei Longwy.
Deutsche und österreichische Flieger.
Panzerzüge.
Geglückte Flucht.
Niederlage der Engländer bei St. Quentin.
Prinz Eitel Friedrich als Tambour bei St. Quentin.
Österreichische Motorbatterien.
Radler im Kriege.
Ein famoser Streich!
Sedan 1914.
Wie sich Tiroler schlagen.
„U 9“.
Drei Treffer.
Vom Kommandanten des „U 9“.
Aus dem Argonnenwald.
Heldentod eines österreichischen Oberst.
Der Sturm der Zuaven.
Das Auffahren der schweren Artillerie.
Antwerpen.
Ein Handstreich der Sachsen.
Das schlaue Bäuerlein.
Hoch die Fahne!
Ein lustiges missverständnis.
Im Feuer der deutschen 42 er Mörser.
Aus den Sturmtagen von Przemysl.
Ostende.
Die tapferen Tschechen.
Kriegskuriosum.
Österreicher und Ungarn im Kampf mit den Russen.
Die Emden.
Drei gegen sechzehn.
Ein Seegefecht an Englands Küste.
Was die Soldaten erzählen.
Die Beschießung des russischen Kriegshafens Libau
Fünf deutsche Dampfer „Wilhelm Hemsoth“ aus Emden, „Düsseldorf“ und „Albatros“ aus Bremen, „Prima“ aus Flensburg und „Saxonia“ aus Memel lagen am Abend des 1. August 1914 im Handelshafen von Libau vor Anker.
Während vier dieser Dampfer schon längere Zeit eingelaufen waren, kam der „Albatros“ erst am Samstag den 1. August nachmittags dort an, bekanntlich zu einer Zeit, wo die russische Mobilmachung schon befohlen war.
Man war denn auch nicht wenig erstaunt, trotzdem ein deutsches Schiff noch einfahren zu sehen.
Bei dem Unsicherwerden der Lage wollten die vier schon länger in Libau anwesenden deutschen Schiffe nach ihrer Heimat zurückkehren, was indessen nicht gestattet wurde.
Ein dänischer und ein englischer Dampfer erhielten jedoch die Erlaubnis zur Ausfahrt.
Der Kapitän der „Düsseldorf“ rief denn auch sofort den Kapitän des „Albatros“ an.
„Wie können Sie, nachdem die Kriegsgefahr zwischen russland und Deutschland zugenommen und uns infolgedessen die Behörde die Ausfahrt verbietet, hier noch einfahren?“
Die Antwort lautete: „Habe nichts Definitives gewusst, von See kommend, fragte ich den russischen Lotsen, wie es mit dem Krieg stehe. Der Lotse sagte, alles sei noch ruhig. Daraufhin hatte ich kein Bedenken und fuhr in den Hafen ein.“
Aber die Enttäuschung sollte gleich in Erscheinung treten.
Als der Kapitän des „Albatros“ verlangte wieder abfahren zu dürfen, verweigerte man ihm dies. Obwohl er absichtlich getäuscht worden war, erklärte man Schiff und Mannschaft für kriegsgefangen.
Gleichfalls wurden auch noch einige schwedische Schiffe festgehalten.
Am andern Tag Sonntag morgen schon um 4 Uhr holte man die Besatzung der deutschen Schiffe durch russische Marinesoldaten von Bord.
Sie wurden in das Emigrantenhaus eingesperrt.
Man gab jedem einen Topf und bedeutete ihnen, draußen im Hof sei eine Wasserleitung, da könne jeder nach Belieben sich satt trinken.
Dabei blieb es; den ganzen Tag bekamen die Gefangenen nichts zu essen.
Draußen im Hafen aber wurde von Sonntag früh bis abends gesprengt.
Die Besatzung hatte den Befehl bekommen, alles in Brand zu setzen und in die Luft zu sprengen, ebenso zu fliehen, wenn sich ein deutsches Kriegsschiff zeigen sollte.
Wohl aus Verwirrung oder missverständnis wurde aber die Sprengung gleich nach Eintreffen der Anweisung ausgeführt, obgleich kein deutsches Kriegsschiff gesichtet war.
Die deutschen Dampfer versenkte man in Gemeinschaft von zwei russischen Baggern in den drei Einfahrten zu dem Hafen.
In Brand gesetzt wurden gleichfalls schon am Sonntag vormittag die Kohlenlager nebst den Kriegs- und sonstigen Vorräten.
Es war ein kopfloses Tun und Treiben, das die Furcht vor deutschen Kriegsschiffen nicht gerade mildern konnte.
Sonntag abend zwischen 8 und 9 Uhr verkündeten Rauchsäulen draußen auf der Reede das Nahen des Feindes.
In der Tat da war er auch schon, und zwar der deutsche Kreuzer „Augsburg“.
Durch einen kleinen Wald eine Viertelstunde von der Stadt getrennt, liegt der Libauer Kriegshafen.
Auf ihn eröffnete der Kreuzer „Augsburg“ sofort das Feuer, während die Stadt selbst von der Beschießung verschont blieb.
Die Kriegswerft, die Forts und Leuchttürme an den Hafeneinfahrten wurden zusammengeschossen.
Eine Granate ging etwa 15 Meter vor einem schwedischen Dampfer nieder, aber das Schiff blieb unversehrt, weil sie nicht explodierte.
Die deutschen Seeleute hofften bei dem heftigen Angriff, dass die Besatzung der „Augsburg“ landen und sie befreien würde.
Aber ihr Hoffen war vergebens. Nachdem der deutsche Kreuzer seine Aufgabe gelöst, dampfte er wieder ab.
Dafür durften aber am Montag früh die deutschen Seeleute nach eingetroffener Erlaubnis in die Stadt gehen. Abends 9 Uhr hatten sie wieder im Emigrantenhause zu sein. Wer nicht pünktlich zur Stelle, würde bei Ergreifen ohne Gnade erschossen. Das war nicht misszuverstehen.
Während des ganzen Montags brannten die von dem Kreuzer „Augsburg“ zusammengeschossenen Werftanlagen, sowie die Kohlenlager lichterloh.
In der Stadt Libau befand sich wenig russisches Militär, das mochte wohl auch mit die Ursache sein, dass vier deutsche Matrosen, welche einen gesonderten Trupp bildeten, den Plan bei ihrem Spaziergang durch die Stadt fassten, einen Fluchtversuch zu wagen.
Sie beobachteten jetzt alles scharf. Als ihr Weg sie an die Hafenanlagen führte und zu der Stelle, wo die Dampfer von den Russen versenkt worden waren, verdoppelten sie ihr Spähen und hatten Glück.
In einer der Hafeneinfahrten, an deren Südmole der Dampfer „Saxonia“ zugrunde gehen sollte, hatte die Versenkung nicht das ganze Schiff betroffen.
Es ragte mit seinem Vorderteil noch aus dem Wasser und ein Rettungsboot, das gänzlich unversehrt geblieben war, befand sich darauf. Das war ein günstiger Zufall.
Er konnte die Rettung bringen.
Aber die Dunkelheit musste abgewartet werden. Bei deren Eintreten kurz nach 9 Uhr entkleideten sich die jungen Seeleute eiligst und schwammen behend zum Wrack der „Saxonia“ hinüber.
Sie erreichten es auch unbemerkt und konnten Nachsuchung in dem über Wasser stehenden Teile des Schiffes nach Lebensmitteln und anderen für die Flucht brauchbaren Gegenständen halten, die sich aber nicht vorfanden. Nur ein Kompass war vorhanden, der ihnen willkommen war. Geräuschlos traf das von der „Saxonia“ heruntergleitende Boot alsdann aufs Wasser.
Die Matrosen ruderten ans Land zurück und holten ihre Kleider wieder.
Die Nacht über hielten sie sich im Hafen versteckt; erst am andern Vormittag 11 Uhr bot sich dann günstige Gelegenheit zur unbehinderten Ausfahrt.
Zunächst mit Kurs nach See, hielten sie später der Sicherheit halber mehr der Küste entlang.
Nach Wunsch ging alles vonstatten. Niemand belästigte sie, schien es doch, als sei die ganze Küste ausgestorben.
So senkte sich der erste Abend hernieder, Hunger und Durst stellten sich bei der anstrengenden Fahrt in verschärfter Weise ein.
Zehn Uhr abends konnte man noch in der Ferne den Feuerschein des brennenden Libauer Hafens sehen.
Die Weiterfahrt während der Nacht brachte das Boot noch näher an die Küste heran. Und jetzt wurde es gesichtet.
Es war in der zweiten Stunde, als eine Kosakenabteilung die Flüchtlinge bemerkte und durch den Schein ihrer Laternen genau erkennen konnte.
Ihr Anrufen und Auffordern, an Land zu kommen wurde nicht befolgt, im Gegenteil, die vier Flüchtlinge verdoppelten ihre Anstrengungen, um möglichst rasch die offene See zu gewinnen, weil die Kosaken sogleich von ihren Karabinern Gebrauch machten und nachhaltig eine zwar wirkungslose, aber heftige Beschießung erfolgen ließen.
Nach abermaliger zweistündiger anstrengender Fahrt morgens 4 Uhr war die deutsche Grenze in Sicht.
Dort bot die Grenzstadt Nimmersatt ihnen den rettenden Schutz.
Über Memel und Königsberg, so berichtet der Lübecker Anzeiger, ging dann ihre weitere Beförderung in die Heimat vonstatten.
Die Deutsche Marine aber erhielt am 2. August ein Funkentelegramm des kleinen Kreuzers „Augsburg“ um 9 Uhr abends: „Bombardiere den Kriegshafen Libau, bin im Gefecht mit feindlichen Kreuzern, habe Minen gelegt. Der Kriegshafen Libau brennt.“
Als die „Augsburg“ wieder zur Flotte zurückgekehrt war, erschien Prinz Heinrich von Preußen an Bord und teilte der Mannschaft mit, dass den Kaiser der kecke Handstreich überaus gefreut habe.
Ein deutsches Reiterstückchen.
Es war in den ersten Augusttagen.
Auf dem Neuen Markt von Tschenstochau (Czestochowa), einer Stadt in Russisch-Polen, befanden sich ungefähr 200 Kosaken. Nachdem die Hälfte von ihnen in die angrenzende Warschauer Straße abgeritten und um die Ecke verschwunden war, kamen von der anderen Seite des Neuen Marktes im Galopp ein deutscher Kavallerieoffizier und zwei Mann. Sie taten, als seien die Kosaken für sie Luft und preschten vorbei — um ebenfalls in die Warschauer Straße einzubiegen, wohin der eine Teil Kosaken bereits abgezogen war.
Natürlich waren die auf dem Neuen Markt stehenden Kosaken ob des so unverfrorenen deutschen Besuchs höchst verwundert, schwangen sich aufs Pferd und ritten hinterher.
Die zahlreich anwesende Menge glaubte nun, um die Deutschen sei es geschehen, da sie jetzt zwischen die beiden Kosakentrupps gerieten.
Aber weit gefehlt!
Schon im nächsten Augenblick sausten die zwei Mann wieder um die Ecke; nur der Offizier fehlte. War er gefallen?
Die zwei deutschen Reiter parierten auf dem Markt ihre Pferde und wandten sich um.
Da aber kam auch schon im vollen Galopp der fehlende Offizier herbei, jedoch nicht allein, sondern einen Kosaken mit dessen Pferde zur Seite. Mit der Zügelfaust hielt er das Gelenk der rechten Hand des Kosaken, in der dieser den Säbel hielt, umspannt. So musste der Steppensohn seinem überlegenen Gegner folgen, der mit ihm weiterjagte, um die Meldung zu bringen, dass die Ortschaft Tschenstochau nunmehr vollständig vom Feinde geräumt sei.
Eine Viertelstunde später marschierten die deutschen Truppen ein.
O. Promber.
Im Sturm auf Lüttich.
Wie Prinz Friedrich Wilhelm zu Lippe den Heldentod fand.
Zum Tode des Prinzen Friedrich Wilhelm zu Lippe gibt das stellvertretende Generalkommando in Hannover folgende Einzelheiten bekannt:
Nach erbittertem Nahkampf gingen wir am Morgen des 6. August erfolgreich gegen Lüttich vor. Die Abteilung, zu der ich zählte, bei der sich auch eine der Regimentsfahnen und der Regimentskommandeur Prinz Friedrich Wilhelm zu Lippe befand, gelangte gegen Morgen auf nordwestliche Wälle von Lüttich. Hier wurden wir von allen Seiten von belgischen Truppen umstellt, die uns mehr und mehr einschlossen und mit einem Hagel von Geschossen überschütteten, sowie uns stark bedrohten. Auf Befehl des Prinzen bildete unsere Abteilung nunmehr einen Kreis und wir verteidigten uns längere Zeit aufs hartnäckigste. Endlich erschien zu unserer Unterstützung von links her eine starke Abteilung. Um dies genauer festzustellen, erhob sich der Prinz in Kniestellung, musterte mit dem Feldstecher die herannahende Abteilung und gab mir, der ich auf handbreite Entfernung unmittelbar neben ihm auf der Fahne lag, den Befehl: „Erheben Sie die Fahne, damit wir rechtzeitig erkannt werden!“ Ich erhob die Fahne und schwenkte sie im Kreise, was sofort einen verstärkten feindlichen Kugelhagel bewirkte. Mir wurde die Fahne aus der Hand geschossen und der Prinz gleichzeitig in die Brust und in den Hals tödlich getroffen. Umsinkend sprach er (es war gegen 11 Uhr vormittags) seine beiden letzten Worte: „Grüßen Sie . . .“
Radlerstreiche.
Die Russen haben geschworen, jedem deutschen Radfahrersoldaten, den sie fangen, die Augen auszustechen. Warum? Weil ein Teufelskerl von einem blutjungen Leutnant ihnen mit einer Radfahrertruppe seit Beginn des Krieges die tollsten Streiche spielt. Husarenstreiche von einer Tollkühnheit, dass ich sie nicht glauben würde, wenn ich sie nicht aus der sichersten Quelle wüsste.
Mein Leutnant fährt mit seinen 60 Reservisten wie der Wind mitten in die feindliche Vorpostenkette hinein. Ein Auto mit russischen Generalstäblern hält da. Die Offiziere sehen die fabelhafte Erscheinung auftauchen, halten sie wahrscheinlich für einen Spuk, können jedenfalls ihre Verblüffung nicht so rasch bemeistern, dass sie von einer Waffe Gebrauch machen. Wie der Blitz ist der Leutnant vom Rade, knallt die Generalstäbler über den Haufen, springt ins Auto und saust mit seinen hohen Insassen davon, während seine Leute die ebenso rettungslos verblüffte Bedeckung beschießen. Die Russen sehen nur noch eine Staubwolke, einen Schwarm Radler, und wissen nicht recht, ob sie gewacht oder geträumt haben. In dem Auto aber befanden sich nicht nur die stolzen Generalstabsoffiziere, sondern auch die allerwichtigsten Aufschlüsse über die Bewegungen und Absichten des russischen Heeres, deren Kenntnis zu dem Sieg bei Gumbinnen nicht wenig beigetragen hat.
Der Flecken Marggrabowa ist von den Russen besetzt. Die Posten stehen vor dem Eingang, die Soldaten schlendern vor den Häusern herum. Plötzlich hören sie es knattern. Die Posten stürzen über den Haufen, die preußische Radfahrerabteilung ist schon zwischen den Häusern, knallt rechts und links alles zusammen, was nicht schnell in die Haustüren springt, und ist zum anderen Ende des Städtchens schon wieder ins freie Feld hinaus, als die Russen sich von ihrem Schrecken erholt haben und Alarm blasen.
Im Gefecht bei Hohenstein schwebt ein russischer Flieger hoch über unseren Truppen. Mein Leutnant ist mit seinen Radlern unterwegs, äugt nach dem Vogel da oben. „Ihr Leute, was hat der Kerl hier rumzuflattern. Abgesessen, legt an! Gut vorhalten! Feuer!“ Der Flieger saust herunter. Begraben können ihn andere. Wir haben keine Zeit. Gleich darauf geht es um den linken Flügel herum, den Russen in den Rücken. Es werden ein paar Offiziere von den Pferden heruntergeschossen, die Marschkolonne gleichfalls beschossen und einige Gefangene in Verwahrung gebracht. Der Leutnant hat bis vorgestern erst einen Mann von seiner Truppe verloren.
(Voss. Ztg.)
Ein gefährlicher Ordonnanzritt.
Aus dem Brief eines Feldartillerie-Offiziers.
Wir Offiziere lagen in tiefem Schlaf in einer Scheuer. Morgens 3 Uhr kam Befehl vom Regiment: „Ein Offizier der . . . Batterie Stellung erkunden und Übergänge über den . . . fluss.“ — „Leutnant . . . aufstehen! Zwei Unteroffiziere mit Karabinern mitnehmen und möglichst schnell losreiten! Bis 7.30 Meldung abgeben bei der Division!“ Also raus aus dem Stroh, Pistole entsichert und fort geht’s in die Nacht hinaus! Bei Dunkelheit und Nebel reite ich nach . . . einem französischen Dorf. Auf 30 Schritt sehe ich am Dorfeingang Leute stehen. Wir parieren zum Schritt. Ich halte sie für Zivilisten. Der Unteroffizier erkennt rote Hosen. Richtig verteilen sie sich rechts und links hinter die Kirchhofmauer. Ich sehe noch Gewehre im Anschlag. Dann rettet uns ein Sprung über den Graben und entlang der Kirchhofmauer reiten wir hinterm Dorf herum. Es wird allmählich Tag. Der Wald, in dem ich reite, um ins Tal vorzudringen, wird von feindlicher Artillerie beschossen. Macht uns weiter nichts. Wir reiten weiter. Ich allein herunter zur Straße, sehe, dass diese und die Brücke noch von feindlicher Infanterie wimmeln, die aber im Rückzug begriffen ist. Wir reiten auf die Höhe zurück, um Stellung für Verfolgung zu erkunden. Das Reiten war etwas erschwert durch Weinbergmauern, Steingruben u. dgl. Endlich habe ich eine wunderschöne Höhe und lege mich hinter einen Busch auf den Bauch, um zu krokieren. Die Unteroffiziere satteln nach. Da saust auch schon ein feindliches Schrapnell über uns weg und schlägt 30 Schritte vor uns in den Boden. Gleich darauf noch eins und noch eins und noch mehr und immer näher! „Aufsitzen! Galopp! Marsch!“ Mein Fuchs fliegt. In einer Minute sind wir aus dem feindlichen Feuer. Ich suche nun eine zweite Stellung auf der Höhe. Gedeckt reite ich heran und liege hinter einem auffallend großen Birnbaum mitten im Haberfeld, wieder auf dem Bauch, um zu zeichnen. Kaum habe ich die ersten Striche gemacht, schon wieder Pinkh — Bumms über mir und vor mir! Also schon wieder schießen sie auf mich! Und ich muss doch ein Kroki machen! „Aufsitzen! Galopp! Marsch!“ Ja, aufsitzen, wenn der Sattel am Bauch hängt!! Die Gurten waren weit geworden und wie ich in den Bügel steige, rutscht der Sattel und hängt nach unten! Ich muss allein nachsatteln: 1. Aufgurten, 2. Woilach vorziehen und 3. wieder zugurten. Dabei schlug mir’s den Dreck ins Gesicht von den Aufschlägen! Die Unteroffiziere in weiter Ferne. Endlich sitze ich oben. Aber nun musste der Fuchs laufen, was er konnte! Denn sonst war’s aus. Das Pferd ist ein alter Durchgänger durch die Schüsse unruhig gemacht, flog er durch den Haber. Bald hatte ich die beiden Unteroffiziere eingefangen und wir ritten gemütlich weiter, um die Meldung noch zur richtigen Zeit abzugeben. . . .
Heute früh 8 Uhr spielte ein Fahrer auf einer Handharmonika Choräle. Jeder hatte ein Gesangbuch. Wir sangen alle mit, auch wir Offiziere. Die Stimmung unserer Leute ist großartig. Ruhig und gefasst und jedem Befehle gehorchend. . . .
Ungarn und Montenegriner an der Drina.
Wenn die flusstäler der Drina, Lim, Tara und vieler anderer Gewässer, die durch das wildzerklüftete Gebirgsgelände Serbiens, Bosniens und Montenegros rauschen, erzählen könnten — was alles würde an kämpfereichen Ereignissen zu hören sein!
In jenen Gegenden fanden die erbittertsten Nahkämpfe statt, die man sich denken kann.
Es liegt in der landschaftlichen Gestaltung jener Länder, dass die Flinte oft mehr zum Stechen und Schlagen als zum Schießen benützt wurde und dass man von den Bäumen und Felsen, aus Höhlen und Felsspalten schoss. Doch manchmal geschahen noch ganz andere Dinge, die jeder Beschreibung spotten. Von den wildesten Leidenschaften entfesselt, wurden die Serben und Montenegriner zu Tieren, denen jedes Mittel zur Vernichtung des Angegriffenen recht ist. Oft rangen einzelne miteinander auf Leben und Tod, bissen sich, zerfleischten sich mit Messern, stießen sich gegenseitig in Abgründe, tauchten mit Gewalt den Kopf des Schwächeren unter Wasser, bis seine Lebenszeichen erloschen und quälten sich auf jede erdenkliche Weise.
In einer besonders gebirgsreichen Gegend an der Drina wollten ungarische Truppen eine teilweise von Bäumen bestandene Anhöhe nehmen und gingen mit aufgepflanztem Bajonett gegen die Montenegriner zum Sturm vor.
Der anführende Offizier schwenkte den Degen: „Hurra! Es lebe unser Kaiser!“
Siegen — oder sterben, das war die Losung.
Mit Löwenmut stürmte die ungarische Infanterie die steinige Anhöhe hinan, obwohl in nicht geringer Entfernung unausgesetzt ganze Salven niederprasselten und die Reihen der Ungarn bald zahlreiche Lücken aufwiesen, noch bevor die schneidigen Magyaren dazukamen, ihrerseits den Feind zu schwächen. Um so größer wurde ihre Wut und das Bestreben, die Stellung der Montenegriner zu erreichen.
Diese hatten sich nämlich hinter einen natürlichen Erddamm versteckt, so dass nur ihre ausgelegten Gewehrläufe und Bajonette zu sehen waren.
Doch die Situation änderte sich im Handumdrehen.
Als die Montenegriner die Ungarn in nur geringer Entfernung auf sich zukommen sahen, sprangen sie auf, gaben noch ein paar Schüsse ab und flüchteten dann mit Katzengeschwindigkeit die noch steilere Anhöhe hinauf, die oben ebenfalls von Montenegrinern besetzt war. Den Söhnen der Berge gelang es, ohne allzu große Verluste die Berglehne zu erklimmen.
Nun prasselten die Geschosse in doppelter Anzahl auf die nachrückenden Ungarn. Nicht genug damit, wälzten die Montenegriner auch noch große Steine und Felsstücke hinab, die sich gleich Lawinen auf die Verfolger stürzten und viele der Helden zermalmten oder verwundeten.
Doch die Ungarn ließen sich auch durch diese Gefahren nicht davon abbringen, die Berglehne bis zur höchsten Höhe zu erklimmen, mochten gleich zahlreiche Kameraden das Geröll mit ihrem Blute netzen.
Unter unsäglichen Schwierigkeiten und der Aufbietung aller Kräfte gelang es den tapferen Vorwärtsstürmern, endlich auch hier die Montenegriner zu fassen. Höher ging es nun nicht mehr! Wohl oder übel mussten sich die Montenegriner zum Nahkampfe stellen, wollten sie nicht den im Rücken liegenden, noch steileren Abhang zur Flucht benützen; denn der Kamm war schon auf beiden Seiten von den Ungarn besetzt.
Es wäre ja nun den Montenegrinern nicht darauf angekommen, einen Nahkampf mit Bajonett und Kolben zu liefern. Wäre nur das eine nicht gewesen: sie befanden sich den Ungarn gegenüber in starker Minderheit! Was wollten die dreihundertfünfzig Montenegriner gegen achthundert Ungarn ausrichten?
Der Zorn der Ungarn dagegen war aufs höchste gestiegen und sie ließen den Söhnen der Berge nicht viel Zeit zum Überlegen. Krach! sausten auch schon die Kolben auf den Feind nieder und auch das haarscharfe Bajonett tat seine Schuldigkeit.
Die umdrängten Montenegriner retirierten immer mehr dem steilen Abhange zu und konnten sich der wütend heranstürmenden Ungarn nicht erwehren. Obwohl sie sich tapfer verteidigten, verringerte sich ihre Zahl zusehends.
Schon nach wenigen Minuten erkannten sie die Unmöglichkeit, den Ungarn standzuhalten, und wollten sie nicht sämtlich gefangengenommen werden oder mit durchstochenem Leib, zertrümmertem Schädel auf der Walstatt bleiben, so mussten sie schleunigst sehen, wie sie den steilen Rücken des Berges hinabklimmen konnten, um sich in Sicherheit zu bringen.
Das war nun freilich eine äußerst schwierige Arbeit. Der Berg fiel an einigen Stellen so steil ab, dass das Terrain einem Abgrunde gleichkam. Aber was half’s ——: hinunter! Rette sich, wer kann!
Die Ungarn, die eben erst unter den Salven und Felsstürzen der Montenegriner zu leiden gehabt hatten und etwa hundert brave Kameraden opfern mussten, konnten nun Vergeltung üben und die Fliehenden mit Geschossen und rollenden Steinen überschütten.
Die Szenen, die sich abspielten, waren entsetzlich. Hier geriet ein Montenegriner ins Rutschen, überschlug sich und langte als zerschmetterte Leiche zwanzig Meter tiefer an. Dort brach ein anderer unter dem ungarischen Geschosshagel zusammen. Da wieder rollten dem abwärts Fliehenden Steine nach, die ihn im Sinne des Wortes „steinigten“. Selbst der, der am besten diese gefährliche Leistung überstand, hatte an allen Ecken und Enden seines Körpers Beulen und Hautschürfungen. Kaum hundertundachtzig Mann vermochten sich, über und über mit Schmutz und Schweiß bedeckt, teilweise blutend und hinkend, unten in Sicherheit zu bringen, ohne wohl so bald wieder den Wunsch zu verspüren, mit den Ungarn ins Handgemenge zu kommen.
Eben wollte der anführende Offizier der Ungarn seinen so unerschrocken vorgegangenen Mannschaften ein anerkennendes Wort sagen, als am Ufer der Drina neue Scharen von Montenegrinern auftauchten.
„Zurück!“ rief der Offizier, „wir suchen hinter jenem Erdwall Deckung, hinter dem vorhin die versagten Montenegriner lagen!“
Vorsichtig klommen die Ungarn die erreichte Anhöhe wieder hinab.
Doch sie kamen nicht weit.
Links und rechts aus dem schützenden Walde fielen Schüsse, zuerst einzeln, dann in Massen.
Sofort wurde nach drei Seiten Stellung genommen und dann ging es unerschrocken vor.
Fünf Minuten später gab es nicht nur auf halber Höhe der Lichtung, sondern auch links und rechts im Walde das heißeste Handgemenge. Diesmal standen aber den Ungarn nicht dreihundertundfünfzig, sondern etwa dreizehnhundert Montenegriner gegenüber! Dazu kam, dass die Ungarn teilweise schon sehr ermattet waren. Die durchgeschwitzten Uniformen klebten ihnen am Leibe. Wie sollten sie jetzt mit der Überzahl fertig werden?
Mit dem Mute der Verzweiflung stürzten sie sich auf den Feind. Bald war jeder Fußbreit Boden heiß umstritten. Massenhaft sanken Freund und Feind verwundet oder leblos nieder, kollerten dort ein Stück übers harte Gestein und ließen ihr warmes Blut über Moos und Erde rinnen. Die Luft war von Pulverdampf erfüllt; das Stöhnen der Verwundeten mischte sich schauerlich in das Knallen der Gewehre und in die dumpfen Schläge mit dem Kolben. Zwar gingen die Ungarn mit Todesverachtung drauf, um sich des anstürmenden Feindes zu erwehren, aber auch die Montenegriner stellten ihren Mann. Vorzüglich verstanden sie es, sich hinter Baumstämmen und Felsen zu verbergen.
Während der Kampf auf der halben Höhe des Berges unentschlossen hin und her tobte, versank die Sonne hinter dem bergigen Ufergelände der Drina und die Dämmerung breitete ihre grauen Schleier aus. Die ersten Sterne funkelten am Himmel.
Mancher der Kämpfenden hatte schon mehrfach Verletzungen erlitten, ohne seine Kameraden im Stich zu lassen; jeder Ungar wollte unter Aufbietung seiner letzten Kräfte dazu beitragen, die Montenegriner in die Flucht zu schlagen. Hunderte von Toten und Verwundeten lagen umher und noch immer hatte keine Partei irgend etwas erreicht. —
Der Offizier der ungarischen Truppen sah, dass sich seine Leute nur noch mühsam aus den Beinen halten konnten und nahe daran waren, zusammenzubrechen. Es ging einfach nicht mehr. — Was sollte er tun?
Da kam ihm ein Gedanke.
Er sammelte etwa hundert Mann und stellte ihnen die Aufgabe, die Montenegriner durch einen Bluff zu schrecken. Leise Anordnungen wurden gegeben. Darauf stiegen die hundert Mann, einzeln und vom dunklen Wald gedeckt, hinauf zur Höhe. Indessen wurde auf der Berglehne weitergekämpft.
Die Montenegriner hatten nicht das geringste von dem Abgange der hundert Ungarn gemerkt und setzten mit ermatteten Kräften das blutige Handgemenge fort.
Wie erschraken sie aber, als plötzlich von der Höhe hundert
Schüsse krachten und unter brausendem Hurra! eine ganze Menge Ungarn, deren Zahl man im Dunkel unmöglich feststellen konnte, den kämpfenden Ungarn zu Hilfe eilten.
Hei, das wirkte!
Ohne noch weiter ein entscheidendes Resultat herbeiführen zu wollen, gaben die Montenegriner den Kampf auf, sammelten sich und zogen ab. —
Der Mond stieg übers Gelände und sein bleiches Licht fiel auf eine ungarische Fahne, deren Schaft von zusammengetragenen Steinen aufrechtgehalten wurde. Um diese Fahne lagen in weiter Runde bis hinunter zur rauschenden Drina und hinauf zur Bergeshöhe Tote,
Verwundete und Schlafende, die kurz vorher, überwältigt von Müdigkeit, zusammengebrochen waren.
Mülhausen und Lagarde.
Die schneidigen Ungarn am Zbruz.
Mitten durch Galizien fließt der Dnjestr, ein durch zahllose Nebenflüsse bald stark anschwellender Strom. Sein letzter Zufluss auf österreichischem Boden ist der Zbruz, welcher zugleich in seinem ganzen Laufe ein Stück Landesgrenze zwischen Österreich und Russland darstellt.
Um nun festzustellen, ob sich hinter dem Flusse stärkere Kräfte des Feindes aufhalten mochten, wurde der aus Honved-Kavallerie bestehenden fünften Kavalleriedivision die schwierige Aufgabe zuteil, den fluss an einer geeigneten Stelle zu übersetzen, nötigenfalls sich den Übergang zu erzwingen und Erkundigungen einzuziehen.
Am 16. August ritten die schmucken Honveds hinaus.
Bei Satanow, einer Dorfschaft an der russischen Grenze, gelang es ihnen, den Übergang zu erzwingen und in russisches Gebiet einzufallen.
Zunächst ging alles ziemlich gut.
Bei Kuzmin stieß die Kavalleriedivision auf stärkere russische Kräfte — ebenfalls Kavallerie, die aber von Infanterie unterstützt wurde.
Die mutigen Reiter ließen sich aber dadurch nicht ins Bockshorn jagen, sondern unternahmen vielmehr einen Angriff auf den Feind, den sie auch wirklich in die Flucht trieben. Nicht genug damit, verfolgten sie ihn auch noch und ließen erst am nächsten Abschnitt des Smotritz-Baches, wo sich bei Gorodok russische Verstärkungen festgesetzt hatten, von ihm ab.
Mit waghalsigem Mute beschlossen die Honveds nun, den Feind in seiner befestigten Stellung anzugreifen. Wie wohl vorauszusehen war, erlitten sie hierbei stärkere Verluste. Doch zeigte es sich bei diesem Kampfe, in welcher ungefähren Stärke der Feind vorhanden war. Dies zu erfahren, war ja die Aufgabe ihres ganzen Unternehmens!
Zufrieden mit den erzielten Erkundigungen, kehrten die Reiter nach Satanow zurück. Und da nach getaner Arbeit gut ruhen ist, und der Tag zur Neige ging, quartierte sich die Division im Dorfe ein.
Es wurde Nacht; die abgejagten Honveds schliefen.
Aber währenddessen wurde es im Dorfe um so munterer.
Aus den Hütten trat der und jener, mit einer Waffe versehen. Tuschelnd steckte man die Köpfe zusammen, vereinigte sich wohl auch mit russischen Soldaten, und dann ging’s vorsichtig hin zu den schlafenden Honveds.
Piff! Paff!
Die schlummernden Reiter wussten gar nicht, wie ihnen geschah, als sie so unsanft durch Flintenschüsse geweckt wurden. Und ehe sie noch die ganze Lage der Sache begriffen, wälzten sich auch schon einige Kameraden in ihrem Blute.
Nun aber drauf! Vergeltung üben an der feigen Bande von Meuchelmördern !
Und was taten die Kavalleristen?
Sie steckten das Dorf in Brand.
Hei! wie die grelle Lohe schnalzend emporleckte und ihre vernichtende Arbeit tat!
Die Strafe war gerecht. —
Bald standen die schneidigen Ungarn wieder schlagfertig da und zurück ging’s, woher sie gekommen, um die nötigen Meldungen zu erstatten.
O. Promber.
Heldenhafter Untergang der „Zenta“.
In der Frühe des 16. August war’s, an einem schönen, klaren Sonntagmorgen. Ein flauer Südwind strich über das ruhigliegende Adriatische Meer.
Der kleine österreichisch-ungarische Kreuzer „Zenta“ befand sich vier bis fünf Seemeilen südwestlich der Spitze Menders; eine Seemeile weiter südlich konnte der Torpedozerstörer „Ulan“ wahrgenommen werden. Die Fahrzeuge lagen nahe dem südlichsten Ende der Blockadelinie, seewärts der montenegrinischen Küste.
Gegen ¾ 8 Uhr wurden plötzlich in der Ferne vier Rauchsäulen gesichtet und vom Krähennest des Kreuzers konnten sechs französische Schiffskolosse wahrgenommen werden, die — wie die mächtigen Schaumschnurrbärte am Bug zeigten — rasch näherkamen.
Der Schiffskommandant der „Zenta“, Fregattenkapitän Pachner, rief dem Führer des „Ulan“, Korvettenkapitän Panfilli, zu, dass er sich gegen die Bocche di Cattaro zurückziehen werde, da gegen eine solche Übermacht nichts auszurichten sei und zunächst verhindert werden müsse, vom Lande abgeschnitten zu werden.
Bald darauf nahmen die beiden Fahrzeuge bei höchster Geschwindigkeit den Kurs gegen die Bocche di Cattaro.
Doch kaum war eine halbe Stunde vergangen, als verschiedene neue Rauchsäulen und kurz darauf die Masten einer großen Flottenabteilung auftauchten — feindliche Schiffe, die mit anscheinend großer Geschwindigkeit gegen Punta d’Ostro steuerten. Weiter nördlich erschienen dann noch weißliche Rauchwolken, die sich nachher als 12 bis 20 Einheiten der französischen Flottille herausstellten.
Ha! Also die ganze französische Flotte dampfte heran, um die Österreicher in der Blockade der montenegrinischen Küste zu stören und gleichzeitig deren Schiffen den Rückzug nach der schützenden Bucht abzuschneiden.
Nun aber mit aller Kraft in den rettenden Hafen!
Der Zerstörer „Ulan“ konnte dank seiner Geschwindigkeit darauf rechnen, die schützende Bocche zu erreichen. Weniger aber die „Zenta“. Dennoch trachtete auch der Kreuzer mit allen Kräften danach, den Verfolgern zu entkommen; das Maschinen- und Heizerpersonal mit den wackeren Maschinenbetriebsleitern an der Spitze tat das menschenmögliche, um aus der alten Maschine und den Kesseln das Höchstmaß der Geschwindigkeit herauszuholen.
Um ¾ 9 Uhr waren die beiden feindlichen Geschwader in einer langen Linie im Kurse gegen Pnnta d’Ostro vereinigt.
Schon waren sie deutlich zu erkennen.
Die französischen Schlachtschiffe zählten zum Typ Courbet und zur Dantonklasse; sie führten am Masttopp übermäßig große Flaggen. 14 Einheiten waren zu erkennen.
Noch vor 9 Uhr krachten aus einer Entfernung von 7- bis 8000 Meter die feindlichen Geschütze.
Die ersten Geschosse hatten ein zu kurzes Ziel und sausten vor der „Zenta“ oder dem „Ulan“ in die See, wo eine hohe Wassergarbe um die andere aufspritzte. Dann wieder flogen die Geschosse zu weit und flitzten über die „Zenta“ oder den „Ulan“ hinweg. Doch muss gesagt werden, dass die Franzosen immerhin gut zielten und sich bald eingeschossen hatten.
Die vordersten von den feindlichen Schlachtschiffen überschütteten den „Ulan“, die hintersten die „Zenta“ mit einem solchen Eisenhagel, dass kaum noch an ein Entkommen zu denken war.
Doch die beiden österreichisch-ungarischen Fahrzeuge waren keineswegs müssig und feuerten mit aller Kaltblütigkeit fortgesetzt auf die zahlreich anrückenden Verfolger.
Die Situation wurde von Minute zu Minute gefahrvoller.
Granaten schleuderten ihre Splitter gegen die Bordwand und das Deck, wo sie teils abprallten, teils kraftlos liegenblieben. Immer stürmischer wogte die See, zerwühlt und gepeitscht von dem Hagel der schweren Geschosse. Hohe Wellen sprangen an der Schiffswand auf und überfluteten das Deck; infolge des Pulverdampfes und der ringsum aufspringenden Wassergarben war besonders die „Zenta“ zeitweise kaum noch zu sehen.
Schon hatte sich die Entfernung zwischen den französischen Schiffen und den beiden österreichisch-ungarischen Fahrzeugen auf 5—6000 Meter verringert, schließlich betrug sie nur noch 4000 Meter.
Infolge der Wendungen der französischen Flotte gelang es dem „Ulan“, einen Vorsprung nach Norden zu gewinnen.
Wohl eröffneten die feindlichen Kolosse nun ein rasendes Schnellfeuer aus allen Kalibern. Doch wie durch ein Wunder blieb der Torpedozerstörer unversehrt und er konnte endlich die Höhe der Spitze Kupa erreichen.
Immer weniger wurden die Schüsse der Verfolger, bis sie endlich ganz aufhörten.
Auch der „Ulan“ stellte nach 348 Schüssen das Feuer ein. Langsam fuhr er unter der Küste in die Bocche.
Dagegen die „Zenta“!
Der Kreuzer älterer Konstruktion hatte nicht vermocht, dem übermächtigen Feinde zu entrinnen und geriet schon gegen 9 Uhr in eine äußerst schwierige Lage.
Bald war das Schiff umstellt und wurde aus immer kürzerer Entfernung von den schweren Schiffsgeschützen der Franzosen überschüttet.
Todesmutig aber harrte die brave Besatzung auf ihrem Posten aus und ließ es auch ihrerseits an einer wirksamen Beschießung nicht fehlen.
Doch was konnte das kleine Schiff gegenüber einer ganzen Flotte ausrichten?
Da schlug ein Geschoss in die Schiffsmaschine. Sofort ließ die Geschwindigkeit der „Zenta“ nach.
Nun wurde das unglückliche Schiff auch noch in die Schraube getroffen; damit war ihm jede Bewegungsfreiheit geraubt.
Wie ein verwundetes Wild lag es da, von der Meute kläffender Hunde gestellt und umringt!
Eine immer größere Menschenmenge sammelte sich an der nahen montenegrinischen Küste an, um dem furchtbaren Schauspiel zuzusehen.
Von dichtem Qualm umhüllt, aus dem das Feuer der Geschütze hervorblitzte, umsprüht von mörderischen Geschossen und umspült von der aufgepeitschten Flut war die Besatzung der „Zenta“ in einer entsetzlichen Lage. Wie das dröhnte, krachte, brüllte, zischte —: hatte sich denn die Hölle aufgetan?
Zu Dutzenden lagen bereits die Verwundeten auf Deck. Das Blut bildete Lachen; die über Bord springenden Wellen spülten sie wieder hinweg.
Krach! da fiel auch schon ein Mast, von einer Granate zersplittert, über Bord.
Immer dichter und furchtbarer wurde jetzt der Geschosshagel, ganze Stücke flogen von dem todwunden Schiffe in die See.
Flammen loderten auf — hier — da — dort, leckten züngelnd am Holze empor und mischten in den Pulverdampf ihren beißenden, stinkenden Qualm.
Das bittere Ende nahte. . . .
Dennoch aber hörte man auch jetzt noch in dem schweren Dröhnen der französischen Turmgeschütze den helleren Klang der fortgesetzt feuernden Kanonen des Kreuzers.
Dies währte so lange, bis ein Geschütz nach dem andern außer Gefecht gesetzt wurde.
Zuletzt vermochte nur noch das Heckgeschütz das feindliche Feuer zu erwidern.
Nun schlug auch noch eine französische Granate in den Kesselraum — eine mächtige weiße Dampfwolke fegte zum Himmel und zerfloß hoch in der Luft.
Dies war wohl der Todesstoß!
Das Schiff legte sich auf die Seite und sank gleichzeitig mit dem Vorderteil unter Wasser.
Noch immer aber feuerte das Heckgeschütz.
Doch nun schwieg auch dieses.
Mit wehender Flagge sank die „Zenta“ in die Tiefe des Meeres. . . .
Die es aber am Meeresufer sahen, waren erschüttert. Die Christen bekreuzten sich, nahmen ihre Käppchen ab und beteten. Die Mohammedaner legten ihre Hand aufs Herz, dann auf Mund und Stirn und verharrten in andächtigem Schweigen.
Und obwohl sie Feinde der Österreicher waren, stürzten die Montenegriner nun in ihre Boote, um von den zu Hunderten umherschwimmenden Menschen und Schiffstrümmern zu retten, was noch zu retten war. 170 Mann, 13 Stabspersonen und der Kommandant wurden geborgen; sie blieben freilich als Kriegsgefangene in Montenegro.
Von den französischen Schiffen dagegen wurde auch nicht ein einziges Boot gestrichen; die Kolosse wendeten, mächtig blähte sich die Trikolore an ihren Hecks und nach Süden zu glitten sie in die Ferne . . .
Sie brauchten nicht besonders stolz zu sein!
Viele Große gegen einen Kleinen — sie hatten wahrlich leichtes Spiel.
Heldenhaft aber hielt sich die Besatzung der „Zenta“, und der Kommandant des Schiffes hatte recht, wenn er sagte: „Wir haben geschworen, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen, und haben, trotzdem über hundert Verwundete herumlagen, unsern Schwur bis zum Sinken des Schiffes gehalten. Die Maschinenmannschaft war bis zum letzten Augenblick auf ihrem Posten!“
O. Promber.





























