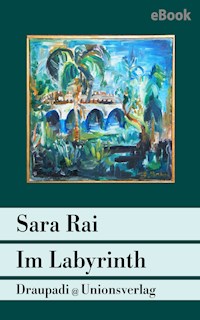
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was passiert mit einem Land wie Indien, wenn Turboglobalisierung und koloniale Vergangenheit aufeinanderprallen? In Sara Rais Geschichten steht die Welt Kopf: Mitten in der Stadt breitet sich Wildnis aus, Verbrecher entkommen ihrer gerechten Strafe, Paläste zerfallen zu Staub. Rais Helden sind häufig skurrile Einzelgänger oder Außenseiter, aber auch ganz normale Menschen in der indischen Großstadt. Ihr Alltag wird zum Ausgangspunkt für magische Momente. Die Protagonisten können alte Gewohnheiten abstreifen, neuen Mut schöpfen und in einer Zeit des Umbruchs ihren Platz finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Was passiert mit einem Land wie Indien, wenn Turboglobalisierung und koloniale Vergangenheit aufeinanderprallen? In Sara Rais Geschichten steht die Welt Kopf: Mitten in der Stadt breitet sich Wildnis aus, Verbrecher entkommen ihrer gerechten Strafe, Paläste zerfallen zu Staub.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Sara Rai (*1956) hat Modern History und Englische Literatur studiert. Das Zentrum ihres Schaffens bildet der Umgang mit der Vielfalt der indischen Sprachlandschaft. Sie schreibt in Hindi und Englisch und ist zudem mehrfach ausgezeichnete Übersetzerin (in den Sprachen Hindi, Urdu und Englisch).
Zur Webseite von Sara Rai.
Johanna Hahn ist promovierte Südasienwissenschaftlerin und Literaturübersetzerin aus dem Hindi.
Zur Webseite von Johanna Hahn.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Sara Rai
Im Labyrinth
Erzählungen
Aus dem Hindi von Johanna Hahn
E-Book-Ausgabe
Draupadi @ Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book des Draupadi-Verlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.
Die Übersetzerin bedankt sich bei der Robert Bosch Stiftung, dem Deutschen Übersetzerfonds, dem Literarischen Colloquium Berlin, dem Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen und dem Übersetzerhaus Looren (Schweiz) für die Unterstützung ihrer Arbeit.
Diese Publikation wurde vom Literaturforum Indien e.V. unterstützt.
Vier der hier abgedruckten Erzählungen sind bereits 2013 in dem Band In der Wildnis, Kommentierte Übersetzung und Interpretation moderner Hindi-Kurzgeschichten von Sara Rai erschienen und wurden hier mit freundlicher Genehmigung von Regiospectra Berlin in überarbeiteter Fassung abgedruckt.
Lektorat: Reinhold Schein
© by Sara Rai
© by Draupadi Verlag, Heidelberg 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Johanna Hahn
Umschlaggestaltung: Reinhard Sick
ISBN 978-3-293-31071-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 07:11h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
IM LABYRINTH
GrillenSchwalbenflugFlitterwochenAlte FreundeLabyrinthAmarvallariIn der WildnisBabu Devidins neue WeltDie Brücke ohne Anfang und ohne EndeAn der KanteTatverdächtiger flüchtigDas Bombay-Tagebuch»Du wirst die Katherine Mansfield der Hindi-Literatur sein.« — EssayNachwort der ÜbersetzerinWorterklärungenQuellennachweise und Werkverzeichnis von Sara RaiAnmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Sara Rai
Über Johanna Hahn
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Indien
Grillen
Schwarzes Hemd, dunkle Hose, Umhängetasche aus Stoff: Das ist Shekhar, den es durch die ausgestorbenen Nachmittagsstraßen treibt wie ein schwarzes Wölkchen, das sich am klaren Himmel verirrt hat. Er streunt durch eine Straße nach der anderen, mal in diesem Viertel, mal in jenem. Ich habe ihn in letzter Zeit ein paar Mal gesehen, immer in Eile. Schwer zu sagen, ob er schnell zum Ziel will oder vor etwas wegläuft. Oder ob ihm das Herumlaufen am Ende gar innere Ruhe verschafft.
Shekhars Haare lichten sich allmählich, wohl um der Schmach zu entgehen, andernfalls ergrauen zu müssen. Das schwarze Hemd wirkt an seinem nunmehr schmächtigen Leib seltsam fehl am Platz. Wie es so über die Schultern hin und her schlabbert, meinte man, es würde bei der erstbesten Gelegenheit die Flucht nach unten ergreifen. Schultern, die einem Hemd keinen Halt zu geben vermögen, sind zweifellos unter seiner Würde. Wie an der Wolkenfront, die über Shekhars glatten Wangen aufgezogenen ist, unschwer zu erkennen ist, hat er seit Tagen keine Zeit zum Rasieren gefunden oder es schlicht vergessen. Mag sein, dass er das Gestoppel absichtlich stehen lässt, weil ihm sein verschattetes Antlitz gefällt. Vielleicht findet er ja, das Dreitagetief im Gesicht sorgt für eine gepflegte Melancholie, die seinem bedeutungslosen Dasein das gewisse Etwas verleiht. Will er am Ende nur der eigenen Traurigkeit ins Gesicht sehen?
Kein Zweifel, sich selbst anzuschauen ist ein alter Tick von Shekhar. Das ist mir früher schon aufgefallen, als wir uns beinahe täglich abends bei ihm trafen. Wir lümmelten in einer Ecke des verqualmten Zimmers, während Shekhar kerzengerade auf einem Stuhl saß und rauchte. Sein Gesicht war spiegelglatt. Ich legte meine Hand auf seine Schulter, »Guck mal, wie der sich selbst vergessen kann!«, und zeigte auf Gopal, der auf den großen runden Tisch in der Ecke des Raums geklettert war und mit stampfenden Füßen tanzte. Gopal: Weil er so stämmig gebaut war, nannten wir ihn immer nur den »Ringer«. Unsere Freunde klatschten beschwipst-schwankend im Takt mit.
»Na, willst du dich nicht mal dem Tanz hingeben? Es guckt dir auch niemand zu!« stachelte ich ihn halb im Spaß an. Shekhar lehnte sich zurück und warf mir einen Blick zu, den ich nicht zu deuten wusste. »Ich gucke mir aber zu.« Er schaute hoch zum Kronleuchter direkt über uns, in dem hunderte Shekhars zurückgelehnt im Stuhl saßen.
Seitdem konnte ich von seinem Gesicht ablesen, wann er sich selbst anschaute. Egal was seine Augen zu welcher Zeit taten, selbst wenn sie wie Adleraugen in die Ferne blickten, waren sie doch immer auf sich selbst gerichtet. Sein Blick hätte es nicht gewagt, von dannen zu wandern. Als ich einmal zu Besuch in der National School of Drama war, hatte ich beobachtet, wie die Schauspieler im Schatten der Bäume ihre Sätze einübten. In ihren Gesichtern begegnete mir genau das wieder – ein grenzenloses Bemühtsein und diese auf sich selbst fixierten Augen. Mir wollte schier nicht einfallen, woher mir das nochmal bekannt vorkam. Schließlich platzte der Knoten: Shekhar! Möglich, dass das Bartkostüm Teil einer neuen Rolle war. Aber was bringt es, sich über solche Lappalien den Kopf zu zerbrechen?
Shekhar kreuzte jedenfalls öfters meinen Weg, meist wenn ich unterwegs zum Büro oder nach Hause war, oder wenn es tagsüber irgendetwas zu erledigen gab. Dann wechselte ich oft ein paar Worte mit ihm. Manchmal stellte ich mich aber auch blind. Wenn man so will, gestand ich mir damit nur meine Niederlage ein, denn obwohl ich ihn schon so lange kannte, kam ich nicht an ihn ran. Wann immer ich Shekhar ansah, wurde mir beklommen zumute. Irgendetwas hatte er an sich, das ich nicht zu fassen kriegte. Es war ja nun nicht so, dass alles an ihm seltsam gewesen wäre. Er war auch keine Kuriosität, für die ein besonderes Kunstverständnis vonnöten gewesen wäre. Trotzdem, wie auch immer die Saiten seiner Persönlichkeit gestimmt sein mochten, hatte ich immer den Eindruck, dass kein Ton richtig rauskam. Aus diesem Grund fiel es mir schwer, die ganze Melodie herauszuhören, und in mir blieb der Rest eines Zweifels zurück. Sein Anblick weckte Assoziationen, die aus meiner Sicht gar nichts mit Shekhar zu tun hatten. Der Gestank brennender Blätter, das Klirren von zerspringendem Glas, die ausgeleierte Saite eines Instruments. Nur, was bitte schön hatten diese Dinge mit Shekhar zu tun?
Als ich letzte Woche an der Kreuzung beim Safdarjang-Krankenhaus hielt, stand da direkt vor mir Shekhar. Er wartete wohl darauf, die Straße überqueren zu können. Als die Ampel auf Rot sprang, erstarrte die Autoschlange. Doch anstatt hinüberzugehen, blieb er wie angewurzelt stehen, so als wäre er plötzlich mit einem schwerwiegenden Problem konfrontiert. Offenbar stand er schon eine ganze Weile an der Ampel. Aber gerade in diesem Moment schien er wie von Zweifeln überwältigt, ob er wirklich über die Straße gehen sollte oder doch besser weiter geradeaus.
Die heiße Jahreszeit stand kurz bevor, und die Bäume verloren ihr Blätterkleid. Punkt zwölf begann die Traurigkeit vom Himmel herabzuregnen. Die Stadt ergab sich dann den gelben Blättern, welche sie ganz bedeckten. Niedergestreckt erbebte sie in der Sonnenglut. Die Hitze nahm den Tag hinterlistig ein; nur der Wind bewahrte sich im Kern noch einen Rest Kühle. Trotzdem hatte die Hitze schon soweit den Sieg davongetragen, dass Shekhars schwarze Kleidung den Augen keine Linderung vom grellen Sonnenlicht verschaffte.
Ich streckte den Kopf aus dem Fenster: »Na Kumpel, wohin des Wegs?«
Er starrte mich eine Weile mit ausdruckslosen Augen an. Erkannte er mich etwa nicht? Als er mich hörte, ließ er die schwarze Umhängetasche mit einer raschen Handbewegung hinter seinem Rücken verschwinden, obwohl ich ihr gar keine Beachtung geschenkt hatte. Ich versuchte es nochmal: »Hallo Shekhar, kann ich dich irgendwohin mitnehmen?«
Dieses Mal umspielte kurz ein vertrautes Lächeln seinen Mund. »Ach du bist’s, Vimal!« Der Ton in seiner Stimme kam mir fremd vor. Prüfenden Blicks inspizierte er mein Gesicht, als versuchte er davon abzulesen, was ich wohl gerade über ihn denken mochte. Dann antwortete er zögerlich: »Danke, ich gehe zu Fuß weiter. Ich hab’s nicht weit. Wie geht es dir?«
»Naja, es geht so! Sag, wenn du Zeit hast, können wir ja irgendwo einen Tee trinken gehen«, sagte ich fast überschwänglich.
Zum zweiten Mal huschte ein Schatten von Unsicherheit über sein Gesicht. »Nein, heute geht es nicht«, sagte er mit dünner Stimme.
»Wieso? Was gibt’s denn Dringendes zu erledigen?« spöttelte ich.
»Ach, nichts Besonderes …« Er quetschte ein fades Lachen heraus, das nicht sein eigenes, sondern das eines anderen zu sein schien, und mit dem er nicht so recht umzugehen wusste. Dann fügte er hinzu: »So komme ich wenigstens mal raus. Du weißt ja, wer rastet, rostet.«
Wieder lachte er dieses durchsichtige Lachen, das verschwand, noch bevor es die Augen erreichte.
Ich hatte wohl den Finger in die Wunde gelegt. Kam man auf dringende Erledigungen zu sprechen, wurde Shekhar unruhig. Seine Augen suchten die Umgebung nach Halt ab, und er setzte alles daran, zu beweisen, dass er wirklich gerade etwas Wichtiges zu erledigen hatte. Mit dieser Angewohnheit waren wir, seine Freunde, wohl vertraut. Mehr noch, wir wussten, woher diese Marotte rührte. Shekhar hatte einen reichen Vater, und er hatte sich nie im Leben um etwas bemühen müssen. Eben weil er nicht darauf angewiesen war, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, hielt er es nicht für nötig, irgendeinen Beruf auszuüben. Alles, was er haben wollte, war immer zu ihm gekommen und nicht umgekehrt. Deshalb bestimmte er auch mit fünfunddreißig noch frei über seine eigene Zeit.
Obwohl ich seine Geschichte kannte, staunte ich immer wieder aufs Neue, wie Shekhars Leben, frei von jeglichem Stress oder Erwartungsdruck, einer Arbeit nachgehen zu müssen, seinen gemächlichen Gang ging. Während die Freunde und ich uns im reißenden Strom des Berufslebens gerade so über Wasser hielten, plätscherte Shekhars Leben, weit weg von der Nichtigkeit unseres Alltags, in ruhigeren Gewässern dahin. Wenn wir sahen, wie leicht sein Leben war, wurden die anderen und ich neidisch. Wir malten uns aus, welche Möglichkeiten uns offenstünden, wenn wir an seiner Stelle wären. Wie viele Träume dann in greifbare Nähe rückten! Auf Shekhar jedoch hatte dieses unbeschwerte Dasein eine gänzlich andere Wirkung. Anstelle eines gesunden Selbstbewusstseins hatte er einen Minderwertigkeitskomplex entwickelt, der sich in einem Schuldgefühl äußerte, jedem immerzu Rechenschaft darüber ablegen zu müssen, was er alles Wichtiges zu tun hatte.
Jetzt bereute ich es, nach der dringenden Erledigung gefragt zu haben. Damit hatte ich ihn unnötig verletzt. Seinen knittrigen Sachen nach zu urteilen hatte er in ihnen geschlafen. Seine Schuhe, die oben offen waren, mussten vor ein, zwei Jahren in Mode gewesen sein, aber sie hatten jegliche Ähnlichkeit mit dem Original verloren, so ausgelatscht, wie sie waren. Mir kam in den Sinn, wie verrückt Shekhar früher nach teuren Schuhen gewesen war. Immer wenn wir über den Bazar bummelten, zog es ihn wie von selbst in Richtung Schuhladen. Und wenn er dann in den neuen Schuhen umherflanierte, waren sie nicht mehr bloßes Mittel zum Zweck, sondern sie entfalteten eine einzigartige Aura. Das beeindruckte uns tief. Wenn wir neue Schuhe trugen, und mochten sie noch so teuer sein, so waren und blieben es eben gemeine Treter. Es war nicht daran zu denken, dass sie sich in Unikate verwandeln könnten. Nein, bei Shekhar war das anders.
Aber bei unserer Begegnung heute packte mich wieder dieses unbestimmte Gefühl. In seinen Augen sah ich nun unbeschreiblich viel Ferne, Distanz – als wäre da ein langer weiter Weg, auf dem Shekhars inneres Ich ins Ungewisse aufgebrochen war. Mir schien, ich hätte Shekhar getroffen, ohne ihm wirklich begegnet zu sein. Vor meinem inneren Auge tauchte noch ein Bild auf, ein leerstehendes Haus an einem Flussufer. Die Fensterläden waren verschlossen, und auch drinnen deutete nichts darauf hin, dass es bewohnt war.
Mein Blick, der an seinen Schuhen klebte, ließ ihn wohl erraten, woran ich gerade dachte, denn er schaute verlegen zur Ampel, die in diesem Moment auf Grün sprang. Um schleunigst dem Dickicht unausgesprochener Worte zu entkommen, das uns umgab, sagte ich: »Shekhar, kann ich dich irgendwohin mitnehmen?«
»Nein«, antwortete er fast schon gezwungen.
»Also gut, ich fahr jetzt. Ich komme dich die Tage mal besuchen.«
»Okay, bis bald.«
Als ich Gas gab, machte das Auto einen Satz nach vorn, als wollte es, angeödet von unserem Smalltalk, nichts wie weiter. Ich konnte Shekhar noch im Rückspiegel sehen. Er schien seine Unentschlossenheit doch noch besiegt zu haben. Statt die Straße zu überqueren, trottete er weiter geradeaus. Noch aus der Ferne konnte ich erkennen, wie er leicht vornübergebeugt ging, als suchte er den Boden nach etwas ab. War ihm etwas abhandengekommen?, schoss es mir durch den Kopf. Seine Gestalt, die in immer weitere Ferne rückte, hatte so etwas Selbstvergessenes, dass es aussah, als grübelte er angestrengt über etwas nach.
Bei Shekhars vorgebeugtem Körper musste ich an einen unbedeutenden Vorfall denken, der sich vor kurzem ereignete. Als ich Mutter den Boden nach etwas abtasten sah, fragte ich: »Was ist, Mama, hast du was verloren?« Als sie sich zu mir umdrehte, machte sie ein verblüfftes Gesicht. »Junge, mir ist die Vase zu Bruch gegangen. Ich habe versucht, sie zu kitten, aber vergeblich. Hat am Ende doch eine Scherbe das Weite gesucht?«
Eine Woche später fand ich mich ohne große Mühe in Shekhars Viertel wieder. Ich wollte ihn schon seit Tagen besuchen. Ich hatte nämlich eines Tages in der Schallplattenkiste, die in der Ecke meines Zimmers stand, ganz zuunterst die Aufnahme von Suchitra Mitras Interpretation von Tagore-Liedern entdeckt.1 Es war Shekhars Lieblingsplatte. Eine Zeit lang hatten wir sie rauf und runter gehört, bis ich trotz fehlender Bengalischkenntnisse jedes Wort mitsingen konnte. Wir hatten sie schon ewig nicht mehr gehört. Ich dachte, Shekhar würde beim Anblick der Platte vor Freude einen Luftsprung machen, obwohl mich auf dem Weg zu ihm doch ein ungutes Gefühl überkam.
Als ich abends das Haus verließ, hatte ich noch gar nicht entschieden, ob ich zu ihm gehen würde, trotzdem packte ich die Platte vorsichtshalber ein. Sollte ich nach dem Markt noch Lust auf einen Spaziergang haben, würde ich einfach weiter zu Shekhar gehen. Auf dem Markt gab es allerhand Kleinkram zu erledigen. Seit Tagen lag mir Mutter in den Ohren, ich solle beim Elektrohändler Druck machen, dass die nach nunmehr einem Monat jemanden vorbeischicken sollten, um endlich den Raumkühler zu installieren. Normalerweise beließ sie es nicht nur bei einem Auftrag. Vom Schneider mussten Kleider abgeholt werden, der Zucker war aus, gestern war statt des »Dalda«-Öls ein Kanister »Postman« gekommen, es wäre schön, wenn ich den zurückgeben könnte. Und noch ein paar andere Aufgaben dieser Art, die alle erledigt werden wollten, was nicht wenig Zeit in Anspruch nahm. Außerdem war ich müde und dachte schon ans Heimgehen, aber die Vorstellung, alleine in meinem Zimmer zu hocken, war so bedrückend, dass ich in Shekhars Straße einbog, über die sich gerade der Abend legte. In der Straße herrschte völlige Stille. Es war kein einziges Fahrzeug unterwegs, man konnte meinen, die Stadt sei es leid, sich selbst von einem Ende zum anderen zu schleppen. Ich lief auf dem schmalen Streifen neben der Straße entlang. Die Straße war auf beiden Seiten mit kerzengeraden Pappeln gesäumt, die das Forstamt zur Verschönerung der Stadt angepflanzt hatte. Eine Weile betrachtete ich im Licht der Straßenbeleuchtung den matten Glanz auf den Stämmen. Sie sahen aus wie Silber, das nach Jahren in der Schublade schwarz angelaufen war und jetzt auf Hochglanz poliert worden war. Irgendwo in der Ferne war Hundegebell zu hören, und in der Luft lag der Gestank brennender Blätter. Direkt vor Shekhars Haus schwelte ein Laubhäufchen. Obwohl von dem Feuer eigentlich nur ein Funken übrig war, riss der Rauchfaden nicht ab, der daraus aufstieg.
Als ich hochschaute, konnte ich durch die Jasminranken sehen, dass in Shekhars Zimmer Licht brannte. Ich hatte schon öfters kehrt gemacht, wenn drinnen alles dunkel gewesen war. Als ich klingelte, hallte es bis in den hintersten Winkel wider, so als stünde das Haus leer und als wäre da nichts, was sich dem Läuten in den Weg stellen könnte. Doch durch einen schmalen Spalt in der Tür konnte ich einen Blick auf ein überraschend kleines und dafür umso vollgestopfteres Zimmer werfen. Mochten die Räume dahinter auch leer sein, in diesem Zimmer jedenfalls gab es allerhand, was meinen Blick behinderte. Als sich immer noch nichts regte, klingelte ich noch einmal. Auf meiner Uhr war es halb neun. Sollte er so früh schon schlafen?
Gerade als ich umkehren wollte, ging die Tür plötzlich auf. Shekhar trug auch heute wieder Schwarz, offenbar war es seine Lieblingsfarbe. Wenn man mich nach meiner Meinung fragte, würde ich sagen, dass Schwarz entweder gekünstelt oder unheilvoll wirkt. Einen Moment lang stand er stumm da. Er hatte eine heftige Fahne, die kurz in der Luft stand und alsbald abriss. Dann rang er sich ein fades Lächeln ab, und wieder hatte ich das eigenartige Gefühl, dass dieses Lächeln nur geborgt war, weshalb er so sparsam damit haushaltete.
»Komm rein, Vimal«, bat er mich und machte zwei Schritte zurück.
Wie schon der Blick von draußen vermuten ließ, war der Raum ziemlich klein, und wegen all der Dinge darin wirkte er noch kleiner. Dieses Haus hatte Shekhars Vater gerade erst für ihn besorgt. Obwohl ich ein paar Mal da gewesen war, sah es jedes Mal anders aus. Mir kam es so vor, als stellten sich die Gegenstände darin wie ein bockiges Kind mal in die Ecke, mal in jene. Hatte der dunkelviolette Sofastuhl letztens nicht hier gestanden?, versuchte ich mich zu erinnern. Nicht neu waren die Tee-, Zigaretten- und Wasserflecken auf der Glasplatte des runden Tischs in der Mitte, die gar nicht mehr wegzudenken waren, so sehr gehörten sie zum Bild des Tisches. Abgesehen davon war nie der Versuch unternommen worden, die Flecken wegzuwischen. Die Tür des Holzschranks in der Ecke stand offen – aus dem untersten Fach lugte ein Haufen Schuhe heraus, und oben stapelten sich Klamottenberge. Im Schrank lag auf einer Seite auch Shekhars schwarze Umhängetasche. Was er an jenem Tag bloß darin hatte? Die Stühle waren mit Klamotten und Büchern belegt. Das Licht der Ecklampe warf groteske Gestalten an die Wand. Das Bett war nicht gemacht.
Shekhar klaubte seine Klamotten und den anderen Kram zusammen, warf alles aufs Bett und bot mir den Stuhl an. »Whisky gefällig?« fragte er, als er sich mir gegenüber hinsetzte.
Der Zigarettenqualm gehörte zum festen Inventar des Zimmers. Von dem fahlen Licht, das sich röchelnd durch die verqualmte Luft kämpfte, den zusammengewürfelten Gegenständen und Shekhars schwarzen Kleidern wurde mir ganz schwindlig. Am liebsten hätte ich sein Angebot ausgeschlagen und mich auf der Stelle mit einer Ausrede aus dem Staub gemacht. Aber ganz aus Gewohnheit hatte ich mit einer Kopfbewegung schon zugestimmt.
Er nahm einen großen Schluck aus dem Glas, das auf dem runden Tisch stand, und erhob sich. »Bin gleich wieder da«, sagte er und ging ins hintere Zimmer. Ich setzte mich und sah ihm nach. Zwar ging er geradeaus, doch man konnte sich nicht des Eindrucks erwehren, dass er jeden seiner Schritte sorgfältig kontrollierte, fast wie ein Boot im nachtschwarzen Meer, das die scharfkantigen Felsen zu beiden Seiten umschiffen wollte. Wie er so den Stühlen und anderen Dingen auswich, konnte man meinen, er sei nicht mehr Herr im eigenen Haus. Als er einen Stuhl leicht streifte, legte er reflexartig seine Hand darauf, als wolle er sich bei ihm entschuldigen.
Dann verschwand er im hinteren Zimmer, aus dem es sogleich zu klappern und klirren begann. Sicher suchte er nach einem Glas für mich. Ich sah mich währenddessen im Zimmer um. Aber weil mein Blick über das Sammelsurium stolperte, richtete ich ihn auf das Buch auf dem Stuhl gegenüber. Der Schutzumschlag war alt und die Buchstaben darauf bereits verblichen. Ich nahm es in die Hand, um den Titel besser lesen zu können. Als etwas aus den Seiten heruntersegelte, bückte ich mich und hob es auf. Es war ein Foto von Rini. Es musste schon ein paar Jahre alt sein. Das Ende vom Sari lässig über die Schulter geworfen schaute sie nach oben und lächelte. Als ich ihr Bild sah, zuckte ich etwas zusammen, als wäre das kein Foto von ihr, sondern als stünde sie leibhaftig vor mir. Ich musste Shekhar fragen, wo sie eigentlich abgeblieben war. Es war Jahre her, dass ich sie zuletzt gesehen hatte.
Als Shekhar und Rini heirateten, meinten wir, Shekhar heiratete nicht, sondern er ließ sich heiraten. Rini hatte ihn eines Abends auf einer Party kennengelernt und sich auf den ersten Blick in ihn verliebt. Nachdem sie eine Woche lang zusammen ausgegangen waren, machte Rini ihm einen Antrag. Shekhar willigte ein. Die Hochzeit fand in Rinis Elternhaus statt, und Shekhar lebte zwei Jahre lang dort, weil seine Eltern nicht glücklich mit der Heirat waren. Eines Tages kam mir zu Ohren, Rini wollte Shekhar verlassen. Dass wir überhaupt davon erfuhren, war ein Wunder, denn in den zwei Jahren hatten wir ihn, wenn überhaupt, nur zwischen Tür und Angel zu Gesicht bekommen. Es war auch nicht so, dass wir mit Leuten Kontakt gehabt hätten, die Shekhar auch kannten. Ich konnte mich nicht erinnern, von jemandem direkt davon erfahren zu haben. Trotzdem breitete sich das Gerücht rasant in der ganzen Stadt aus.
Alles, was sich danach in Shekhars Leben änderte, war, dass er zurück in das Haus seines Vaters zog. Er hatte wieder mehr Zeit für uns, und das Leben lief seinen gewohnten Gang, so als hätte es nie eine andere Richtung eingeschlagen. Jene zwei Jahre von Shekhars Leben waren mit ganzer Gründlichkeit ausradiert worden. Eine zerplatzte Seifenblase.
Als Shekhar mit einem Glas in der Hand zurückkam, steckte ich das Foto schnell zurück ins Buch. Während ich es auf den Tisch legte, setzte ich ein förmliches Lächeln auf. Dabei hätte ich mir die Mühe sparen können, das Foto zu verstecken, denn als er sah, wie ich das Buch zurücklegte, wusste er sofort Bescheid. Eine Vertrautheit, die nicht recht zu ihm passen wollte, hatte sich in seine Stimme verirrt: »Hast du Rinis Foto gesehen?«
Vielleicht lag es am Alkohol, oder daran, dass wir unter uns waren, dass er Rinis Namen so offen aussprach. Mir hingegen war es peinlich, auf frischer Tat ertappt worden zu sein. Ich ignorierte seine Frage und stammelte stattdessen: »Wo lebt Rini jetzt?«
»In Bombay. Sie hat eine kleine Rolle in einem Film bekommen.« Er versuchte, von meinem Gesicht abzulesen, wie ich auf diese Neuigkeit reagierte. Als ich nichts sagte, kroch ein Schatten der Enttäuschung über sein Gesicht, der aber schnell wieder verschwand, und seine braunen Augen waren wieder auf mein Gesicht gerichtet. Es war klar, dass er darauf wartete, dass ich nachfragte, und als ich das sah, verließ ich meine Deckung, hinter dessen Schutz ich ihn bis jetzt beobachtet hatte, und preschte mutig vor: »Was war da zwischen euch, Shekhar?«
Prompt schämte ich mich so sehr; ich hätte mich auch gleich nackt ausziehen, meine Kleider wegwerfen und ihm mein wahres Ich offenbaren können, meine Vorliebe, in anderer Leute Leben herumzuschnüffeln, meine ganze Verächtlichkeit. Ich wollte meinen Fehler sofort gut machen. »Du musst auch gar nicht antworten, wenn du nicht willst … Ich meine, welches Recht habe ich, dich das alles zu fragen …« Aber sein Gesicht ließ nicht erkennen, ob er mir die Sache auch nur ansatzweise krumm nahm. Im Gegenteil, wie er so leise sprach, hatte es eher den Anschein, als würde er, ungeachtet meiner Frage, über etwas reden, worüber er selbst schon lange nachgedacht hatte und diesen Gedanken nun in Worte fassen: »Sie liebt mich immer noch. Zwischen uns ist alles in Ordnung. Sie wohnt halt nur woanders.«
Darauf wusste ich nichts zu antworten. »Ich kann niemanden verlassen. Vielleicht können wir ja eines Tages wieder zusammenleben.«
Er schwieg und stierte auf das Whiskyglas auf dem Tisch, in dem winzige Bläschen aufstiegen. Das gelbe Licht im Zimmer ließ sein Gesicht noch fahler ausschauen, und bei seinem starren Blick bildete ich mir ein, er trüge eine Maske, die er jeden Moment abziehen würde. Und dass mir der Mensch, der unter ihr zum Vorschein käme, sogleich vertraut wäre, bei dessen Anblick mich nicht mehr dieses halbgare Gefühl überkommen würde.
Ich wechselte das Thema: »Deinem Papa geht es gut?«
»Ja, er musste für ein paar Tage nach Dehradun. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass dein Glas leer ist!«
Er leerte sein Glas mit einem Schluck und schenkte dann in beide Gläser gleich viel Whisky nach. Danach füllte er sie mit Soda auf und fragte: »Willst du Eis?«
Als ich nickte, versuchte er mit einem Löffel zwei Eiswürfel aus dem Eimer zu fischen, der neben ihm stand. Obwohl seine Finger ausnahmslos schön und lang waren, erweckten sie nicht gerade den Eindruck, einer so anspruchsvollen Bewegung wie dieser gewachsen zu sein, und dass sie sich gleich ineinander verhakeln würden. Ich hielt die Luft an und schaute auf seine Finger. Seine Hände zitterten etwas, und als er das Eis in mein Glas manövriert hatte, atmete ich erleichtert aus.
Nach einer kurzen Pause beugte ich mich zu ihm vor und fragte: »Shekhar, hast du mal überlegt, was du mit deinem Leben anfangen willst?«
Einen Moment lang verlor er sich in nachdenkliches Schweigen, dessen bleierne Schwere mich fast erdrückte. Als er dann sprach, klang seine Stimme angespannt: »Was ich nicht alles machen wollte. Ich hätte Atomphysiker werden können oder Philosoph oder Mathematiker. Aber die Welt ist einfach riesig, und ich komme aus dem Staunen nicht raus.«
Er schaute mich aus seinen braunen Augen an wie ein Kind, das von mir wissen wollte, warum es den Mond nicht kriegen durfte, ja, dem im Leben nicht einfiel, dass es vielleicht nicht so einfach war, einen Traum zu verwirklichen. Mir schien, er sah sich selbst mit meinen Augen, also so, wie ich ihn seiner Meinung nach sehen musste, ohne jegliche Erwartung, ohne Ziel. Wollte er jetzt, da ich einmal miterlebt hatte, in welcher Verfassung er sich befand, seine Rolle erst recht auskosten?
Er versank in tiefes Schweigen, das mich von allen Seiten umströmte. Die Luft um ihn herum wog schwer ob all der verpassten Chancen. Wieder formte sich in mir ein vages Bild – in meiner Vorstellung lag da eine Insel im Nebel, die schwer zu erreichen war. Als ich aus der Papiertüte neben mir die Suchitra Mitra Platte herauszog, zerriss das Knistern des Papiers die Stille im Zimmer. Ich bemühte mich um einen lockeren Ton: »Guck mal, was ich ganz unten in einer Kiste gefunden habe!«
Er nahm mir die Platte aus der Hand und starrte sie kurz mit leerem Blick an. Nichts deutete darauf hin, dass er sie zuvor schon einmal gesehen hatte, geschweige denn wiedererkannte. Ich begann schon an mir selbst zu zweifeln. War es denn möglich, dass die Platte wirklich keine Erinnerungen bei ihm wachrief? War für ihn denn nichts von Bedeutung? Als er meine Blicke auf seinem Gesicht spürte, lächelte er.
»Willst du mal reinhören, soll ich’s abspielen?« fragte er, wie um mir einen Gefallen zu tun.
»Ein anderes Mal, Shekhar. Ich muss los, Mutter wartet sicher schon.«
Sofort sprang er auf, als müsste er, nachdem er mich verabschiedet hätte, noch unheimlich viel erledigen. Als ich mich draußen noch einmal umschaute, sah ich, wie er behutsam die Tür schloss, wie aus Furcht, jemanden zu wecken. Draußen war es stockfinster. Aus der samtigen Schwärze der Nacht war von irgendwoher gleichförmiges Grillenzirpen zu hören. Eigentlich war das doch gar nicht die Zeit für Grillen, sollten sie nicht erst zur Regenzeit rauskommen? Aber kein Zweifel, was da so monoton an mein Ohr drang, war unablässiges, arrhythmisches Grillengezirp, gleich einer in der Tiefe der Nacht verborgenen Lobeshymne. Die Grillen erzeugten diesen Laut, indem sie ihre Beine aneinanderrieben. Allein diesen Klang zu erzeugen war ihre Aufgabe, und sie taten es mit voller Hingabe. Könnten sie überhaupt ohne diese Aufgabe, ohne ihre Melodien überleben? Ich bewegte mich eine Weile nicht vom Fleck und lauschte ihrem Gesang, als hätte ich in ihm rein zufällig jenen Klang Shekhars Persönlichkeit wiedergefunden, den ich all die Jahre vergeblich versucht hatte herauszuhören.
Schwalbenflug
Über Nacht war eine Armee Mäuse ins Haus eingerückt. In allen Zimmern, vor allem in der Vorratskammer, konnte man die Spuren ihrer Existenz finden: angefressenes Papier, Brotstückchen und Mäusedreck in den Schränken, unter den Stühlen und hinter der schwarzen Eisentruhe in der Ecke der Vorratskammer. Die in Vergessenheit geratenen Winkel des Hauses erwachten plötzlich mit unsichtbarem Gewusel. Saß man eine Weile still da, durchzuckte einen augenblicklich die Ahnung, dass da glänzende schwarze Augen, wippende Schwänzchen und zitternde Ohren waren.
Als Reshma in ihrer Spielzeugkiste eine angenagte Kartoffel entdeckte, lachte sie hell auf. Sie fand die Mäuschen süß. Am liebsten hätte sie die Winzlinge aufgezogen und ihnen aus der Hand Brot zu fressen gegeben. Mutter war davon nicht gerade begeistert und schärfte ihr immer ein, dass Mäuse keine Haustiere seien und Krankheiten verbreiteten. Allein ihre Anwesenheit im Haus war ein böses Omen. Stand ihnen ein Unheil bevor? Sie wies den Gärtner an, in allen Zimmern des Hauses Giftkugeln auszulegen. Die Mausefalle lag mit spitzem, durch einen Draht aufgesperrten Rachen im Esszimmer auf der Lauer. Doch solange Reshma den ganzen Tag ihre Runden drehte und die Tiere freiließ, sollte sie keine Maus fangen.
Reshma war schon fast acht, aber die Erwachsenen hielten es für besser, sie noch ein Jahr länger zu Hause zu behalten. Denn wenn alle Kinder auf einmal zur Schule gingen, wäre das Haus wie ausgestorben. Außerdem sah Reshma jünger aus als sie war: Sie war nicht besonders groß, hatte kurze Haare und braune verschmitzte Augen. Sie selbst sah für sich nur Vorteile. Was gab es besseres, als den ganzen Tag dem Zauber von Schmetterlingsflügeln auf den Grund zu gehen oder Zitronenschalen im Wasser auszuquetschen und alle Farben des Regenbogens in den Brunnen zu zaubern? Und das alles, während die Geschwister sich mit Schulaufgaben herumschlagen mussten.
Reshma kletterte auf den Hocker und betrachtete ihr Gesicht im Spiegel über dem Badezimmerwaschbecken. Durch Kalk- und Seifenflecken hindurch gaffte sie ein Mädchen mit großen Zahnlücken und frechen Augen an. Ein weiterer ihrer Zähne wackelte gehörig. Sie nahm ihn zwischen Finger und Daumen der rechten Hand und rüttelte daran. Als er endlich in ihrer Hand landete, strahlte sie triumphierend.
»Was machst du da?« Mama stand plötzlich neben ihr. Reshma zuckte zusammen. Sie war so mit ihrem Zahn beschäftigt gewesen, dass sie Mutter nicht hatte kommen hören.
»Ich habe noch einen Zahn verloren!« brüstete sie sich.
»Wie oft muss ich dir noch sagen, du sollst deine Zähne in Ruhe lassen! Wenn die nächsten schief und krumm rauskommen, bekommst du die Quittung für den Quatsch!« Mamas Stirn war gerunzelt. »Geh und wirf ihn ins Mäuseloch. Dann bekommst du schöne kleine Mäusezähnchen.«
Mama hasste also Mäuse, nicht aber deren Zähne? Reshma rannte summend nach draußen. Ihr war eingefallen, dass sie unter dem Papageienbaum2 einen rundlichen Spalt entdeckt hatte, der das Mäuseloch sein könnte. Es war schon nach drei. Gleich würde die Schulrikscha3 vor der Veranda halten. Noch bevor sie ganz zum Stehen käme, würden die Kinder schon wie unbelehrbare Frösche heraushüpfen, und der Rikschafahrer würde eine Schimpfsalve loslassen.
Weil Reshma das jüngste Geschwisterkind war, verfügte sie über eine Menge Geheimwissen, von dem die anderen nichts ahnten. Ihre ältere Schwester Nilima zum Beispiel wusste nicht, dass, wenn man auf Zehenspitzen die Dachtreppe hochkletterte, sieben Mal an die Tür der kleinen Kammer auf dem Blechdach klopfte und bis vierundfünfzig zählte, die Tür simsalabim aufsprang und man alles bekam, was man sich wünschte, Süßes, Spielzeug, egal was. Obwohl Reshma es nie selbst ausprobiert hatte, glaubte sie fest daran, dass der Zauber wirkte, weil die Brüder es nur ihr erzählt hatten, nicht aber Nilima. Und das war längst nicht das einzige Geheimnis.
Wenn man in der Nachmittagshitze zum Tor ging, und zwar allein, würde einen todsicher die alte Hundefrau schnappen. Die war ganz in Rot gekleidet, aus den Augen sprühte Feuer, und von den gelben verfaulten Zähnen tropfte in einer Tour Speichel. In ihrem Gefolge waren schwarze scharfe Hunde, deren Gebell man noch weit in der Ferne hören konnte. Es gab nur eine Methode, die Alte zu besänftigen, man musste eine Handvoll Eis dabei haben. Solange man das Eis in der Hand hielt, konnte einem die Hexe nichts anhaben. Auch dieses Geheimnis, wie man den Zauber der alten Hundefrau abwehrte, kannte nur Reshma allein.
Noch auf halbem Weg zum Haus zwinkerten die Brüder ihr zu und sagten: »Hey, wir baden heute im Brunnen. Aber psst! Nichts Nilima sagen.« Keine Ahnung, warum die beiden ständig die arme Nilima auf dem Kieker hatten. Schon wahr, Nilima hatte ihren eigenen Kopf und verweigerte den Gehorsam, aber am Ende war sie halt die jüngere. Die Jungen planten alle möglichen Komplotte, um sie zu malträtieren. Und das war nicht alles, ab und zu hatten sie sogar versucht, das Übel bei der Wurzel zu packen und sie ein für alle Mal kalt zu stellen. Einmal hatten die Brüder sie hinter einen Busch gelockt, um sie dort nach allen Regeln der Scharia4 zu schächten. Sie wollten ihr schön langsam den Hals aufschlitzen. Aber Reshma hatte sie bei Mama verpetzt, und die Brüder bezogen Dresche. Trotzdem war und blieb Reshma der Liebling der Brüder.
Man denke auch an den Vorfall in jener Sommernacht, als sie alle im Freien schliefen. In jener Nacht hörten sie vom Pipalbaum5 aus deutlich die Stimme einer Hexe. Die Kinder waren überzeugt, dass die Alte mit ihren verdrehten Füßen sie verfolgen würde. So schnell sie konnten, rannten sie zum Haus, doch trotz dieser so bedrohlichen Situation hatte einer der Brüder vorher noch einen Dorn in Nilimas Schlappen gebohrt, um sie am Wegrennen zu hindern. Behaupte noch mal einer, Nilima sei auf den Kopf gefallen; sie zog die Schlappen aus und floh – sonst gäbe es sie heute auch nicht mehr.
Alle Kinder hatten sich um das Wasserbecken versammelt. Es war ein ziemlich großes Bassin, genauso alt wie das Haus. Auch die Nachbarskinder, Gita und Suresh, waren mit von der Partie. Alle sprangen zusammen vom Beckenrand ins Wasser. Beide Brüder riefen zusammen die Losung –
Reshma planscht im Wasser!
Gita planscht im Wasser!
Suresh planscht im Wasser!
Nilima planscht … unter Wasser!
Sie brachen in schallendes Gelächter aus und hopsten wild im Wasser auf und ab. Reshma blieb das Lachen im Halse stecken. Manchmal tat ihr Nilima richtig leid. Gleichzeitig fürchtete sie, ihren Status als Lieblingsschwester einzubüßen.





























