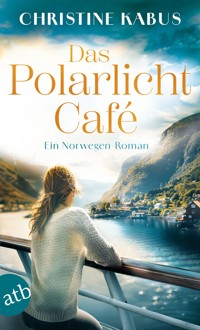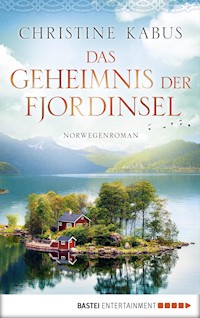6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tiefblaue Fjorde, einsame Gehöfte und eine verbotene Liebe ...
Nach dem Tod ihrer Mutter erfährt Lisa, dass sie als kleines Kind adoptiert wurde. Ein Medaillon mit einem vergilbten Foto ist die einzige Spur zu ihren Vorfahren. Sie führt Lisa nach Norwegen, in den beschaulichen Ort Nordfjordeid. Die Menschen dort reagieren sehr unterschiedlich auf die Ankunft der jungen Deutschen: Während sie in der warmherzigen Nora sogleich eine Vertraute findet, begegnet der alte Finn ihr mit kaum verborgener Ablehnung. Auch der wortkarge Reitlehrer Amund scheint Vorbehalte gegen Lisa zu haben. Je länger sie in das Leben am Fjord eintaucht, desto sicherer ist sie, dass sie auf der richtigen Fährte ist und dass in der Familiengeschichte ihrer Mutter dunkle Geheimnisse schlummern, deren Schatten bis in die Gegenwart reichen ...
Vor der eindrucksvollen Kulisse Norwegens nimmt Christine Kabus ihre Leserinnen und Leser mit auf eine Reise in die Vergangenheit - eine Reise zu einem dunklen Geheimnis ...
"Es gibt Frauenromane zum Verlieben. Dies ist so einer!" FREIZEIT EXKLUSIV
"Ein wirklich ganz toller Roman voller Romantik, Freundschaft, Tragik und Wärme. Sehr zu empfehlen!" LARISSA IMMEL, ALLITERATUS
Weitere Norwegen-Romane von Christine Kabus: Töchter des Nordlichts. Das Lied des Nordwinds. Das Geheimnis der Fjordinsel. Das Geheimnis der Mittsommernacht. Insel der blauen Gletscher.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 771
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Norwegen-Romane der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Stammbaum
Karten
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Tusen takk!
Weitere Norwegen-Romane der Autorin
Das Lied des Nordwinds
Töchter des Nordlichts
Das Geheimnis der Mittsommernacht
Insel der blauen Gletscher
Das Geheimnis der Fjordinsel
Über dieses Buch
Tiefblaue Fjorde, einsame Gehöfte und eine verbotene Liebe …
Nach dem Tod ihrer Mutter erfährt Lisa, dass sie als kleines Kind adoptiert wurde. Ein Medaillon mit einem vergilbten Foto ist die einzige Spur zu ihren Vorfahren. Sie führt Lisa nach Norwegen, in den beschaulichen Ort Nordfjordeid. Die Menschen dort reagieren sehr unterschiedlich auf die Ankunft der jungen Deutschen: Während sie in der warmherzigen Nora sogleich eine Vertraute findet, begegnet der alte Finn ihr mit kaum verborgener Ablehnung. Auch der wortkarge Reitlehrer Amund scheint Vorbehalte gegen Lisa zu haben. Je länger sie in das Leben am Fjord eintaucht, desto sicherer ist sie, dass sie auf der richtigen Fährte ist und dass in der Familiengeschichte ihrer Mutter dunkle Geheimnisse schlummern, deren Schatten bis in die Gegenwart reichen …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Christine Kabus, 1964 in Würzburg geboren, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte als Dramaturgin und Lektorin bei verschiedenen Film- und Theaterproduktionen, bevor sie sich 2003 als Drehbuchautorin selbstständig machte. Schon als Kind faszinierte sie der hohe Norden. Vor allem die ursprüngliche, mythische Landschaft Norwegens beflügelte ihre Phantasie. Sie begann, die Sprache zu lernen und sich intensiv mit der Geschichte Norwegens zu beschäftigen – auch mit den dunklen Seiten wie in »Töchter des Nordlichts«. Insgesamt liegen bei Bastei Lübbe sechs Norwegen-Romane von Christine Kabus vor.
CHRISTINE KABUS
IM LANDDER WEITENFJORDE
Norwegen-Roman
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Covergestaltung: Johannes Wiebel unter Verwendung von Motiven von © Alexander Vershinin/Shutterstock; Claudia Carlsen/Shutterstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1625-3
be-ebooks.de
lesejury.de
Var det ikke for mørket,så visste vi ikke om sternene.
Gäbe es das Dunkel nicht,
Region Sogn og Fjordane
Prolog
»Du darfst die Augen jetzt aufmachen.«
Die junge Frau kam der Aufforderung nach und hielt die Luft an. Vor ihr auf dem Bett war eine bunad drapiert. Überrascht wandte sie sich ihrer Mutter zu, die sie erwartungsvoll ansah. »Ist das für mich?«
»Ja, mein Liebes. Du brauchst doch ein angemessenes Gewand für deine Hochzeit«, erwiderte die Mutter lächelnd.
»Es ist wunderschön«, hauchte die junge Frau und berührte scheu die festliche Tracht. Über einem knöchellangen schwarzen Rock war eine bunt bestickte Schürze ausgebreitet, an der ein kleiner Stoffbeutel befestigt war. Aus einem dunkelroten, ärmellosen Schnürmieder, das mit einer bestickten Borte eingefasst war, ragten die bauschigen Ärmel einer weißen Bluse.
»Aber das Wichtigste fehlt noch«, sagte die Mutter, holte eine kleine Schachtel hervor und hielt sie ihrer Tochter mit einem auffordernden Lächeln hin.
Die junge Frau öffnete die Schachtel und zog einen runden, silbernen Anhänger heraus, der an einem schwarzen Samtband baumelte.
»Das ist doch dein Hochzeitsmedaillon«, rief sie.
Die Mutter nickte. »Meine Mutter hat es mir geschenkt, als ich deinen Vater geheiratet habe. Jetzt möchte ich es an dich weitergeben, damit du eure Fotos hineintun kannst«, sagte sie.
Die junge Frau drehte das Schmuckstück mit den kunstvollen Ziselierungen in ihren Händen und entdeckte auf der Rückseite eine eingravierte Inschrift. Fragend sah sie die Mutter an.
»Die Widmung ist von mir«, erklärte diese.
Ihre Tochter las die liebevollen Worte, schluchzte auf und schloss ihre Mutter fest in die Arme. »Ich werde dich so vermissen«, murmelte sie.
»Ich dich auch, mein Kind, ich dich auch«, kam es leise zurück.
1
Frankfurt, April 2010
Erleichtert stellte Lisa die schwere Tasche mit der Fotoausrüstung ab, zog den Rollkoffer zu sich heran und schloss die Tür ihres kleinen Apartments auf, das sie im vierten Stock eines Mietshauses in einer ruhigen Straße hinter der Alten Oper bewohnte. Noch bevor sie ihre Jacke auszog, eilte sie in das großzügig geschnittene Wohnzimmer und öffnete die Tür zu dem winzigen Balkon, um frische Luft hereinzulassen. Sie trat hinaus und schaute in den Innenhof. Eine einsame Birke stand dort, an deren Ästen sich ein erstes helles Grün zeigte. Eine Amsel saß auf der Dachrinne des gegenüberliegenden Hauses und sang ihr melodisches Lied in die Abenddämmerung. Endlich Frühling! Lisa lächelte, schloss die Augen und atmete die kühle Luft in tiefen Zügen ein.
Wie fern erschien ihr jetzt Mumbai mit seiner schwülen Hitze, in der sie keine vierundzwanzig Stunden vorher noch geschmort hatte. Im Auftrag eines Forschungsinstituts für Städteplanung hatte sie in Dharavi, einem riesigen, mitten in der Stadt gelegenen Slum, eine Art fotografische Bestandsaufnahme gemacht. Denn das unübersichtliche Meer aus Wellblechhütten, Töpfereien und anderen Handwerksbetrieben, Geschäften und Bordellen sollte demnächst einem modernen Viertel mit Büro- und Wohntürmen weichen und als Vorbild für andere Slumsanierungen dienen. Ein Vorhaben, das bei den Betroffenen gemischte Gefühle hervorrief, wie Lisa schnell festgestellt hatte. Zwar sollten die Bewohner in günstige Wohnungen umgesiedelt werden, doch vor allem die Handwerker fürchteten, dass sie dort ihrer Arbeit nicht länger nachgehen könnten.
Lisa war in diese faszinierende Welt eingetaucht und mit einer reichen Ausbeute an Fotos und neuen Erfahrungen zurückgekehrt. Viel Zeit, das alles zu verdauen, blieb ihr nicht. In ein paar Tagen bereits würde sie wieder unterwegs sein, diesmal nach Dubai, wo sie in den letzten Jahren regelmäßig die Entwicklung der gigantischen Bauvorhaben mit der Kamera festhielt.
Es schellte drei Mal – das Zeichen für Susanne. Lisa ging zurück in die Wohnung und öffnete die Tür.
Ihre Nachbarin und Freundin Susanne begrüßte sie mit einem strahlenden Lächeln. Sie war fast einen Kopf kleiner als Lisa und sehr zierlich. Ihre mahagonifarbenen langen Haare, die das herzförmige Gesicht mit dem hellen Teint umschmeichelten, die lang bewimperten braunen Augen und die kirschroten Lippen ließen Lisa an Schneewittchen denken. So jedenfalls hatte sie sich die Märchengestalt als Kind vorgestellt.
An diesem Tag trug Susanne ein burgunderrotes Kleid aus einem fließenden Stoff, der ihre weiblichen Formen zur Geltung brachte. Neben ihr kam sich Lisa immer besonders schlaksig vor. Was nicht nur an ihrer Größe lag, sondern auch an ihrer legeren, sportlichen Kleidung, die ihre schlanke Figur eher verbarg als betonte.
Wegen ihres mädchenhaften Aussehens wurde Susanne von Männern häufig für ein zartes, hilfloses Wesen gehalten – ein Irrtum, den sie mit diebischer Freude auszunutzen wusste. Lisa dagegen behandelten die meisten auf eine freundliche, kumpelhafte Art. Das war ihr eigentlich sehr angenehm, doch manchmal, wenn sie mit Susanne unterwegs war, gab es ihr schon einen Stich, dass sich alle Blicke wie ferngesteuert auf ihre Freundin richteten, während sie plötzlich das Gefühl hatte, unsichtbar zu sein. Auf die Idee, sich deswegen ernsthaft zu grämen oder gar ihr Äußeres zu verändern, wäre sie allerdings nie gekommen.
Kurz nachdem sie vor fünf Jahren hier eingezogen war, hatte sie sich mit Susanne, die auf dem gleichen Stock wohnte, angefreundet. Die beiden jungen Frauen waren sich auf Anhieb sympathisch gewesen, obwohl oder gerade weil sie so unterschiedlich waren. Von da an sammelte Susanne ihre Post, wenn Lisa verreist war. Diese revanchierte sich, indem sie Susannes Katzensammlung bereicherte und ihr von jedem Ort Katzenfiguren und -darstellungen aus allen nur erdenklichen Materialien mitbrachte. Diesmal hatte sie eine kleine rote Lederhandtasche mit Katzenmotiv im Gepäck.
Susanne hielt in der einen Hand einen Stapel Briefe, in der anderen einen riesigen Strauß gelber Teerosen, deren intensiver Duft Lisa entgegenwehte. Überrascht fuhr sie sich durch die widerspenstigen, kurzen dunkelblonden Locken und lächelte die Freundin an.
»Nein, nein, die sind nicht von mir«, sagte Susanne. »Sie sind vorhin für dich abgegeben worden. Hier ist ein Kärtchen.« Mit dem Kinn deutete sie auf einen kleinen Briefumschlag, der in den Rosen steckte. »Ich hab sie ausgewickelt und ins Wasser gestellt. Ich wusste ja nicht, wann genau du kommst. Aber die Karte habe ich nicht gelesen, Ehrenwort!«
Lisa grinste Susanne an. Sie wusste, dass diese vor Neugier fast platzte. Um die Freundin nicht länger auf die Folter zu spannen, pflückte sie den kleinen Umschlag aus den Rosen und zog das Kärtchen hervor.
»Cara, bin morgen in der Stadt. Erwarte Dich um acht im Da Vinci. Kuss, Marco«, las Lisa vor. Das erwartungsvolle Leuchten in Susannes Gesicht erlosch.
»Ach so, von Marco. Und ich dachte schon, du hättest einen geheimnisvollen Verehrer!«
Lisa schaute sie mit gespielter Entrüstung an, nahm ihr den Rosenstrauß und die Briefe ab und machte eine einladende Kopfbewegung in die Wohnung.
»Lust auf einen Masala Chai? Der ist echt lecker.«
Susanne schüttelte den Kopf. »Leider keine Zeit, ich bin auf dem Sprung. Abendschicht im Bistro.«
Susanne war freischaffende Grafikerin und Webdesignerin. Und das wollte sie auch bleiben. Wenn es nicht genug Aufträge gab, arbeitete sie lieber als Kellnerin, um ihre Miete zu zahlen, als sich in einem Büro schinden zu lassen. Das Kapitel hatte sie hinter sich – ein für alle Mal. Lisa konnte das gut verstehen. Der Gedanke, tagein, tagaus in ein Büro gepfercht zu sein, war ihr unerträglich. Das war einer der Gründe, warum sie ihren Beruf so liebte.
»Dann komm doch morgen zum Frühstück zu mir«, schlug sie vor.
»Prima Idee«, antwortete Susanne, »ich bin schon sehr gespannt, wie es in Indien war.« Sie berührte Lisa leicht am Arm. »Und wie’s dir überhaupt so geht.«
Ja, wie geht es mir? Nachdenklich starrte Lisa in den Spiegel im Flur, nachdem sich die Wohnungstür hinter Susanne geschlossen hatte. Die häufigen Aufenthalte in sonnigen Gegenden hatten ihre von Natur aus helle Haut gebräunt, was ihre großen, tiefblauen Augen mit den dichten Wimpern gut zur Geltung brachte. Dem Blick nach innen war sie in den letzten Monaten ausgewichen, hatte sich von einem Auftrag in den nächsten gestürzt und sich ganz auf ihre Arbeit konzentriert. Das hatte ihr geholfen, den ersten Schock zu verkraften und sich für die Auseinandersetzung mit dem Verlust zu wappnen, der sie so unerwartet getroffen hatte. Sie konnte es immer noch nicht glauben, dass sie ihre Eltern Simone und Rainer nie wieder sehen würde.
Wenn Lisa an sie dachte, sah sie die beiden in einem griechischen Kafenion sitzen, mit einem Jeep das australische Outback erkunden oder über einen marokkanischen Basar schlendern. Nach der Pensionierung ihres Vaters vor sieben Jahren hatten ihre Eltern sich ununterbrochen auf Weltreise befunden und damit das unstete Leben fortgesetzt, das sie während Rainer Wagners Diplomatenlaufbahn geführt hatten. Im Grunde rechnete sie immer noch damit, dass das Telefon jeden Augenblick klingeln und die muntere Stimme ihrer Mutter von ihren neuesten Erlebnissen berichten würde.
Lisa holte in der Küche eine Vase für den Rosenstrauß, stellte ihn auf den Couchtisch im Wohnzimmer und ließ sich mit untergeschlagenen Beinen auf ihrem geliebten dunkelroten Sofa nieder. Sie schaute sich um und kam allmählich ein wenig zur Ruhe. Ein dicker, handgeknüpfter Perserteppich dominierte mit seinen leuchtenden Farben den Raum, der ansonsten kaum möbliert war. Auf dem großen Regal an der Wand gegenüber dem Sofa standen Töpferwaren, Gläser, geflochtene Körbe, geschnitzte Holzdosen und anderes Kunsthandwerk, das ihr ihre Eltern aus allen Ecken der Welt mitgebracht hatten. Dazwischen quetschten sich Reiseführer und Bildbände, Krimis und Romane in buntem Durcheinander. Lisas Blick blieb an Marcos Begrüßungsstrauß hängen.
Rosen. Die Lieblingsblumen ihres Vaters, der zeitlebens davon geträumt hatte, einen eigenen Rosengarten anzulegen. Und dem es noch an den unwahrscheinlichsten Orten gelungen war, seine Frau mit frischen Rosen zu beschenken. Onkel Robert hatte dafür gesorgt, dass die kleine Aussegnungskapelle auf dem Heidelberger Bergfriedhof mit Rosengebinden geschmückt gewesen war. Und die zahlreichen Kränze und Blumensträuße, unter denen die beiden Särge fast verschwunden waren, hatten ebenfalls überwiegend aus Rosen bestanden.
Sich vorzustellen, dass ihre Eltern in diesen Särgen lagen, war Lisa schwergefallen. Das konnte einfach nicht sein. Die beiden waren zwar schon Anfang siebzig gewesen, hatten aber viel jünger gewirkt. Sie hatten das Leben geliebt und genossen und noch so viele Pläne gehabt. Der letzte Plan hatte sie das Leben gekostet: Auf einem Segeltörn mit Freunden in der Karibik war das Boot gekentert. Für Simone und Rainer Wagner war jede Rettung zu spät gekommen. Sie hatten nur noch tot geborgen werden können.
Am nächsten Morgen fühlte sich Lisa völlig zerschlagen. Nach einer schlaflosen Nacht voller sich im Kreise drehender Gedanken und Grübeleien hätte sie sich am liebsten den ganzen Tag verkrochen. Dabei hatte sie sich so auf das gemeinsame Frühstück mit Susanne gefreut! Viel zu lange hatten sie sich nicht mehr gesehen und ausgetauscht. Lisa war ihrer Freundin dankbar gewesen, dass diese ihren Rückzug nach dem Tod ihrer Eltern stillschweigend akzeptiert und sie nicht mit gut gemeinten Ratschlägen bedrängt hatte. Aber in den letzten Tagen vor ihrem Abflug aus Indien hatte Lisa gemerkt, wie sehr sie ihre Gespräche vermisste und dass sie nun bereit war, über ihren Verlust zu reden. Sie hatte sich sogar danach gesehnt. Doch als jetzt das vertraute Klingelzeichen ertönte, zögerte Lisa, die Freundin hereinzulassen.
Nach kurzem inneren Kampf öffnete sie die Tür und stand Susanne gegenüber, deren fröhliches Lächeln einem bestürzten Gesichtsausdruck wich.
»Um Gottes willen, was ist passiert?«, entfuhr es ihr. »Bist du krank?«
Lisa schüttelte den Kopf und versuchte ein schiefes Grinsen. Sie musste furchtbar aussehen: gerade aus dem Bett gekrochen, nur im Morgenmantel, bleich und mit dunklen Augenringen. »Halb so schlimm«, murmelte sie. »Wirklich, es ist alles in Ordnung«, beteuerte sie, als sie Susannes besorgtes Gesicht sah. »Es ist nur … ach, ich weiß auch nicht, es ist alles so verwirrend … Sorry, aber ich glaub, ich bin gerade keine gute Gesellschaft …«
Susanne sah ihr prüfend in die Augen. »So hab ich dich noch nie erlebt, also sag mir nicht, dass alles in Ordnung ist!«
Lisa seufzte. Es fiel ihr schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. »Du hast ja recht. Ich erzähl’s dir später, o. k.? Jetzt sollte ich vielleicht besser allein …«
Susanne schüttelte resolut den Kopf, schob Lisa sanft beiseite und trat in die Wohnung. »Jetzt frühstücken wir erst mal, und dann erzählst du mir alles.«
Kurz darauf saßen die beiden Freundinnen im Wohnzimmer auf dem Sofa und tranken würzigen Masala Chai, den Susanne gekocht hatte, während Lisa sich rasch geduscht und angezogen hatte. Auf dem niedrigen Tisch vor dem Sofa stand die Kanne mit dem Tee, dessen aromatischer Duft nach Kardamom, Zimt und Ingwer die Luft erfüllte. Dazu gab es frische Croissants, die Susanne mitgebracht hatte.
Lisa biss hungrig in das blättrige Gebäck und lächelte Susanne dankbar an. »Jetzt geht’s mir schon besser. Du bist echt ein Schatz!«
Susanne lächelte und sah Lisa erwartungsvoll an.
»Am besten, du liest es selbst«, sagte Lisa und legte das Croissant auf den Teller zurück. Sie griff zu einem gepolsterten DIN-A4-Umschlag, der zusammen mit anderen Briefen auf dem Tisch lag. »Der war in der Post, die du für mich gesammelt hast«, sagte sie und zog eine kleine Schachtel und zwei Briefbögen heraus, die sie Susanne reichte. Mit einem Nicken forderte sie sie zum Lesen auf.
Heidelberg, 12. Januar 2010
Sehr geehrte Frau Wagner,
zunächst möchte ich Ihnen mein herzliches Beileid ausdrücken.
Vor einigen Jahren hat Ihre Mutter bei mir den beiliegenden Brief und die Schachtel deponiert und mich beauftragt, im Falle ihres Todes beides an Sie weiterzuleiten.
Wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein kann, lassen Sie es mich bitte wissen.
Mit freundlichen Grüßen
Walter Schneider
Notar und Anwaltskanzlei Schneider & Söhne
Hauptstraße 37
69117 Heidelberg
Susanne legte das maschinengetippte Schreiben des Notars beiseite und wandte sich dem zweiten Brief zu, der mit der Hand geschrieben war.
12. August 1993
Liebe Lisa,
eigentlich wollte ich es Dir heute persönlich sagen, aber ich bringe es nicht über mich. Ich will Dir Deinen achtzehnten Geburtstag nicht mit dieser alten Geschichte vermiesen.
Wenn Du diesen Brief eines Tages liest – was ich nicht hoffe –, bedeutet das leider, dass ich entweder keine Gelegenheit mehr hatte oder zu feige war, Dir selber die Wahrheit anzuvertrauen: Ich wurde als kleines Kind adoptiert und kenne meine leiblichen Eltern nicht. »Unsere« Heidelberger Familie Lenz ist also nicht mit Dir verwandt.
Ich hätte mir keine besseren Eltern und Brüder vorstellen können. Sie haben mir niemals das Gefühl gegeben, nicht dazuzugehören, und mir bedingungslos ihre Liebe geschenkt. Auch nachdem ich von der Adoption erfahren hatte, habe ich sie immer als meine wahre Familie gesehen. Ich hoffe, Du kannst das auch.
In Liebe, Deine Mutter
P. S. Das Medaillon ist das einzige »Erbe«, das ich von meinen leiblichen Eltern habe.
Susanne ließ den Brief sinken und schaute Lisa betroffen an. »Sie hat das wirklich all die Jahre für sich behalten?«
Lisa zuckte die Achseln. »Du hast sie nicht gekannt. Sie wirkte zwar offen und extrovertiert, aber eigentlich war sie sehr verschlossen.«
Susanne nickte. »Verstehe. Und was ist das für ein Medaillon?«, fragte sie.
Lisa öffnete die kleine Schachtel und zog einen runden silbernen Anhänger heraus. Sie ließ den Deckel aufschnappen, hielt Susanne das Medaillon hin und sagte: »Das müssen die Eltern meiner Mutter sein.«
Susanne betrachtete die bräunlich angelaufenen Porträtfotos eines jungen Mannes und einer jungen Frau, die scheu lächelte. Susanne sog scharf die Luft ein und deutete auf die Frau: »Aber das bist ja du!« Lisa grinste schief. »Schon irgendwie unheimlich, oder?«
2
Nordfjordeid, Frühjahr 1940
»Los, Fenna. Noch einmal pressen. Gleich hast du’s geschafft«, ermutigte Mari die Stute, die auf dem dick mit Stroh bestreuten Boden ihrer Box lag.
Fenna reckte den Kopf, schaute kurz zu dem Mädchen, das hinter ihr kniete, und presste bei der nächsten Wehe kräftig mit. Mit einem Flutschen glitt ein großes, nasses Bündel in Maris Arme. Rasch zerriss sie die Eihaut, legte das Köpfchen des Fohlens frei und wischte Nüstern und Maul sauber. Ein Zittern durchlief den kleinen Körper, die Nüstern kräuselten sich, und mit seinem ersten, tiefen Atemzug öffnete der kleine Hengst seine Augen. Während die Stute aufstand und sich hungrig über den Kleiebrei hermachte, den Mari ihr als Belohnung zubereitet hatte, rubbelte diese das Neugeborene mit Stroh ab, um seinen Blutkreislauf in Schwung zu bringen.
»Da hab ich die Hauptsache wohl verpasst«, ertönte eine Stimme über Mari.
Die Achtzehnjährige blickte auf und erkannte im Schein der Petroleumlampe, die in der Stallgasse neben Fennas Box hing, ihren älteren Bruder Ole. Glücklich lächelte sie ihn an und präsentierte ihm den kleinen Hengst, dessen Fell etwas heller war als das seiner Mutter. Auf dem Rücken und in der Mähne war der für die Fjordpferde typische dunkle Aalstrich zu erkennen.
»Ein prächtiges Kerlchen«, sagte Ole anerkennend. Mari nickte stolz. »Ist alles glattgegangen?«, erkundigte sich ihr Bruder. »Hat ja doch ziemlich lang gedauert.«
»Stimmt«, sagte Mari und stand auf.
Erst jetzt merkte sie, wie müde sie war. In den letzten Nächten hatte sie kaum geschlafen, um zur Stelle zu sein, wenn die Geburt losging. Oles Angebot, sich mit den Nachtwachen abzuwechseln, hatte sie abgelehnt. Es war schließlich ihr Pferd.
»Fenna hat das ganz prima gemacht. Kaum zu glauben, dass es ihr erstes Fohlen ist.« Mari streichelte die Stute, streute eine weitere Lage Stroh aus und verließ die Box. »Und wie steht es bei Bjelle?«, fragte sie.
Ole zuckte die Achseln. »Vielleicht morgen Nacht. Heute sicher nicht mehr. Deshalb hab ich sie noch auf der Weide gelassen«, antwortete er.
An die Holzbrüstung der Stallbox gelehnt, beobachtete Mari Seite an Seite mit ihrem Bruder in der nächsten Stunde, wie Fenna ihren kleinen Sohn gründlich ableckte und ihn immer wieder zart anstupste, um ihn zum Aufstehen zu animieren. Er machte einige Anläufe und plumpste ein paar Mal ins Stroh, aber dann hatte der Kleine endlich alle vier Beine gleichzeitig unter Kontrolle und stakste wackelig zu seiner Mutter. Auch die Suche nach den Milchzitzen brauchte ihre Zeit, doch schließlich schmatzte das Fohlen zufrieden. Anschließend sank es erschöpft ins Stroh und schlief sofort ein.
Als die Geschwister morgens gegen sieben Uhr den Stall verließen, war es schon taghell. Mari gähnte und dehnte ihre verspannten Glieder. Sie war wie ihr drei Jahre älterer Bruder hochgewachsen und schlank. Ihre klaren, ebenmäßigen Gesichtszüge mit dem markant geschwungenen Mund und den tiefblauen Augen wurden von dunkelblonden, gelockten Haaren umrahmt, die sie wie immer zu einem dicken Zopf geflochten hatte. Ole hatte ebenfalls dunkelblaue Augen, seine kurz geschnittenen Haare dagegen waren glatt und nach der Nacht im Stall verstrubbelt.
»Hoffentlich hat Mutter schon grøt gekocht«, sagte Mari.
»Oh, ja, das hoffe ich auch«, rief Ole, »ich könnte einen ganzen Topf Hafergrütze allein verschlingen!«
»Untersteh dich, du Vielfraß!«, entgegnete Mari und begann unvermittelt, über den Platz zu rennen, der zwischen dem Pferdestall und dem alten Wohnhaus lag. »Wer zuerst in der Küche ist«, rief sie ihm über die Schulter zu und stürmte weiter.
Atemlos sprang sie die Stufen zur Haustür hinauf, durchquerte den Flur, riss die Tür zur Küche auf – und blieb erschrocken auf der Schwelle stehen. Ole, der ihr dicht auf den Fersen war, wäre fast in sie hineingestolpert, konnte aber gerade noch rechtzeitig abbremsen.
»He, was ist denn in dich …« Seine ungehaltene Frage blieb ihm im Halse stecken, als er über die Schulter seiner Schwester in den Raum schaute.
Um den großen Tisch, der in einer Ecke stand, saß die ganze Familie und schien in einer Art Schockzustand erstarrt. Aus dem Radiogerät, das auf einem Wandbrett über dem Tisch stand, tönte getragene Musik.
Zaghaft trat Mari in die Küche und fragte ängstlich: »Was ist passiert? Ist jemand krank?«
Rasch ließ sie den Blick über die Anwesenden gleiten und atmete unwillkürlich erleichtert aus. Nein, es waren alle da. Vater und Mutter, Großmutter Agna und Maris Zwillingsbruder Finn, der äußerlich ganz nach Enar, dem fünfzigjährigen Vater der drei Geschwister, kam. Von ihm hatte er die kräftige, etwas untersetzte Statur, die strohblonden glatten Haare und die hellblauen Augen unter den fast weißen Augenbrauen. Deshalb wurden Ole und Mari oft für die Zwillinge gehalten, zumal Finn mit seiner nachdenklichen, bedächtigen Art älter wirkte als achtzehn Jahre. Auch die Liebe zu den Pferden, ohne die sie sich ein Leben nicht vorstellen konnte, teilte Mari mit Ole, während sich Finn gern hinter seinen Büchern verkroch und von einem Literaturstudium träumte.
Wie in Zeitlupe hob ihre Mutter Lisbet den Kopf und hauchte tonlos: »Heute Nacht haben die Deutschen unser Land überfallen.«
Mari und Ole tauschten ungläubige Blicke.
»Aber wir sind doch neutral!«, rief Ole empört.
»Als ob das jemanden wie diesen größenwahnsinnigen Diktator interessieren würde«, kam es sarkastisch von Finn.
»Was genau bedeutet überfallen?«, wollte Mari wissen. Ihr Vater, der mit grauem Gesicht und zusammengepressten Lippen stumm auf den Radioapparat starrte, drehte den Kopf zu ihr und schien sie erst jetzt zu bemerken.
»Sie haben gleichzeitig mehrere Küstenstädte mit Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen angegriffen.«
Mari wurde es schwindelig. Kraftlos ließ sie sich auf einen Schemel sinken. Vielleicht träumte sie das alles nur? »Wir haben also Krieg?«, fragte sie heiser.
Ihr Vater nickte grimmig. »Ich glaube schon. Allerdings scheint keiner so recht zu wissen, was zu tun ist.«
Ole setzte sich ebenfalls an den Tisch. »Das ist doch klar. Wir müssen kämpfen! Die Regierung hat doch sicher die Mobilmachung bekannt gegeben?«
»Das sollte man meinen«, antwortete Finn anstelle des Vaters. »Tatsächlich konnte der König mit seiner Familie und den Parlamentsabgeordneten kurz vor dem Einmarsch der Deutschen aus Oslo fliehen. Keiner weiß, wo sie sich momentan befinden und wie es nun weitergehen soll.«
Bevor Ole nachhaken konnte, wurde die Musik im Radio für eine Ansprache unterbrochen. Gebannt lauschten Mari und ihre Familie, doch es war nicht die ersehnte Stimme von König Håkon, die aus dem Apparat tönte. Vielmehr verkündete Vidkun Quisling, der Führer der Nasjonal Samling, die Machtübernahme durch seine faschistische, antidemokratische Partei. Jeglichen Widerstand gegen die deutschen Truppen erklärte er zu einer kriminellen Tat, norwegische Offiziere hätten nur den Befehlen »der neuen nationalen Regierung« zu gehorchen.
Enar ließ seine Faust auf den Tisch krachen und schüttelte sie dann drohend Richtung Radio. »Das sieht diesem Vaterlandsverräter ähnlich. Nutzt schamlos das Chaos für einen Putschversuch!«
Lisbet legte die Hand auf den Arm ihres Mannes. »Damit kommt er gewiss nicht durch«, versuchte sie ihn zu beruhigen. »Ich bin mir sicher, dass unser König schon bald den Gegenangriff organisieren wird. Es konnte ja keiner ahnen, dass die Deutschen ohne Kriegserklärung über uns herfallen würden.«
Benommen schaute Mari in die vertrauten Gesichter, in denen sie ihre eigenen Gefühle gespiegelt sah – eine Mischung aus Wut, Angst und Ratlosigkeit. Nur Agna, die Mutter ihres Vaters, wirkte gelassen und lächelte ihrer Enkelin freundlich zu. Mit dem ihr eigenen Gottvertrauen verkündete sie leise, aber bestimmt: »Der Herrgott wird nicht zulassen, dass unser Norwegen in die Hände dieser Teufel fällt.«
Mari hätte viel darum gegeben, diese Zuversicht teilen zu können. Sie hielt es nicht mehr aus in der Küche und lief nach draußen. Auf dem Treppenabsatz vor der Haustür blieb sie stehen und atmete tief die kühle Morgenluft ein. Von hier hatte sie einen weiten Blick auf den Fjord und das gegenüberliegende Ufer mit seinen bewaldeten Bergen und ihren verschneiten Gipfeln. Der Urgroßvater ihres Vaters hatte einst das Grundstück an dem sanft ansteigenden Hang erworben und hier das Wohnhaus und den Pferdestall gebaut. Im Lauf der Zeit hatten seine Nachkommen den Hof um einen Stall für die Kühe, Ziegen und Hühner, eine geräumige Scheune und einen großen Ofen zum Brotbacken erweitert und nach und nach die Pferdekoppeln und Viehweiden gekauft, die sich direkt am Ufer des Fjords gen Westen erstreckten.
Alles sah so friedlich aus. Mari ertappte sich dabei, wie sie angestrengt lauschte und den Himmel nach Flugzeugen absuchte. Wie sich Krieg wohl anhörte? Wie klang Kanonendonner? Oder ein Fliegerangriff? Wie auch immer, hier war alles ruhig. Nur das gleichmäßige Tuckern eines Fischerbootes auf dem Fjord und das Gezwitscher einiger Meisen waren zu hören, die sich in den noch kahlen Zweigen des alten Apfelbaumes neben dem Haus tummelten. Mari schüttelte sich und ging zum Stall. Auch heute musste schließlich ausgemistet, die Hühner mussten gefüttert, die Ziegen gemolken und die Kühe auf die Weide getrieben werden.
Nachdem Mari ihren morgendlichen Pflichten nachgekommen war, zog es sie in den Pferdestall. Behutsam näherte sie sich der Box von Fenna und ihrem Fohlen. Die Stute begrüßte sie mit einem Schnauben. Ihr kleiner Sohn versteckte sich hinter ihr und lugte vorsichtig zu Mari hinüber. Um ihn möglichst früh an sich zu gewöhnen, öffnete Mari die Box und führte Fenna hinaus in den kleinen umzäunten Auslauf hinter dem Stall. Dabei murmelte sie unablässig beruhigende Worte vor sich hin. Nach kurzem Zögern folgte der Kleine seiner Mutter, die sich immer wieder nach ihm umsah.
Draußen ließ Mari die Stute los und beobachtete die beiden vom Gatter aus.
»Wie sollen wir deinen Kleinen denn nennen?«, fragte Mari.
Fenna hob den Kopf und wieherte leise. Mari betrachtete sie nachdenklich. Fenna – der Name bedeutete Frieden. Sie konnte es immer noch nicht fassen, dass in ihrem Land nun kein Frieden mehr herrschte. Und bald vielleicht auch keine Freiheit mehr. Die nahezu mühelosen Siege der Deutschen in den von ihnen bisher besetzten Ländern ließen nichts Gutes ahnen.
»Frihet«, verkündete Mari nach einer Weile, »so soll er heißen.«
Es dauerte fast eine Woche, bis Håkon VII. sich eines Morgens per Radioansprache an sein Volk wandte und die Mobilmachung verkündete. Seit dem deutschen Überfall war er mit seiner Familie und den Ministern der Regierung in Richtung Norden auf der Flucht – verfolgt von deutschen Jagdfliegern, die mehrere Städte bombardierten, ohne jedoch die Fliehenden aufhalten zu können. In seiner Ansprache hatte der König noch einmal unmissverständlich klargemacht, dass er eine Zusammenarbeit mit den Deutschen kategorisch ablehnte, ebenso die von ihnen geforderte bedingungslose Kapitulation.
Mari trat mit ihrer Familie hinaus aus der weiß gestrichenen Holzkirche von Nordfjordeid, dem kleinen Städtchen am Ende des Eidsfjorden, einem Seitenarm des Nordfjords. Wie jeden Sonntag nach dem Gottesdienst – wenn das Wetter nicht allzu ungemütlich war – standen die Gemeindemitglieder noch eine Weile in kleinen Gruppen zusammen, bevor sie sich wieder auf den Weg zu ihren Höfen oder Stadthäusern machten. Doch an diesem Tag wurde nicht der neueste Klatsch ausgetauscht, die Predigt von Pfarrer Hurdal kommentiert oder über landwirtschaftliche Themen gefachsimpelt. Alles drehte sich um den Krieg, den die Deutschen nach Norwegen gebracht hatten. Und der nun auch hier greifbarer geworden war. In einer Stunde sollten sich die wehrfähigen Männer des Ortes und der Umgebung zur Musterung auf dem plassen einfinden. Der alte Exerzierplatz war bereits 1649 als erster militärischer Übungsplatz Norwegens für die Region eingerichtet worden und diente nun als Sammelstelle für die Soldaten.
»Auf keinen Fall! Ich verbiete es dir!«
Die energische Stimme ihres Vaters ließ Mari zusammenzucken. Sie drehte sich zu ihm um und sah, dass er sich in einer heftigen Diskussion mit Ole befand.
»Aber Vater«, begehrte Ole auf, »es ist unsere Pflicht, unser Land und den König zu verteidigen!«
»Womit denn?«, fragte Enar mit bitterem Unterton. »Es gibt ja nicht mal Uniformen für alle, ganz zu schweigen von Gewehren oder gar Artilleriegeschützen. Bisher wurden uns jedenfalls keine Waffen geschickt. Wollt ihr euch wie die Schafe abschlachten lassen?«
Bevor Ole etwas erwidern konnte, ergriff Finn, der neben ihm stand, das Wort. »Vater hat recht. Du hast doch gehört, was der Schwager vom alten Nylund berichtet hat. In Stryn haben sie sich Molotowcocktails gebastelt, weil sie sonst nichts hatten, um sich zu bewaffnen.«
Ole zuckte hilflos mit den Schultern. »Aber wir können doch nicht kampflos aufgeben!«
Enar klopfte seinem Ältesten auf die Schulter. »Ich kann dich ja verstehen«, sagte er. »Aber gerade jetzt wird auf dem Hof jede Hand gebraucht.«
Ole schaute ihn trotzig an. »Norwegen braucht auch jede Hand.«
Enar schüttelte den Kopf. »Du hast ja noch nicht mal eine militärische Ausbildung. Ich glaube nicht, dass sie dich überhaupt nehmen würden.«
Ole wollte etwas erwidern, besann sich aber und nickte ergeben.
Mari fing seinen Blick auf und wusste, dass für ihren Bruder das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch lange nicht gesprochen war. Dieses aufmüpfige Funkeln in seinen Augen kannte sie nur zu gut. Besorgt runzelte sie die Stirn.
Ole bemerkte es, hakte sie unter und flüsterte: »Keine Sorge, Schwesterherz, ich werde brav sein.«
Mari knuffte ihn leicht in die Seite. »Aus deinem Mund klingt das wie eine Drohung.« Ole grinste. »Im Ernst, Ole, mach bitte keine Dummheiten. Versprich es mir!«
Ole löste sich von Mari, legte mit pathetischer Geste seine rechte Hand auf die linke Brust und sagte: »Großes Indianerehrenwort. Ich glaube sowieso nicht, dass ich zum Soldaten tauge.«
Mari war nur halbwegs beruhigt. Dazu liebte ihr Bruder Abenteuer viel zu sehr. Auch und gerade wenn sie gefährlich waren.
Zu Maris Erleichterung hatte Ole kaum Gelegenheit, es sich anders zu überlegen und sich doch noch mustern zu lassen. Im Radio verfolgten sie, dass der Kriegseinsatz des kleinen Bataillons, das unter General Steffens von Nordfjordeid aufbrach, um den Feind zurückzuschlagen, eine kurze Episode blieb. Bereits am 1. Mai kapitulierte die hundertköpfige Einheit angesichts der erdrückenden Übermacht der Deutschen – ein Schicksal, das sie mit den meisten norwegischen Soldaten im Süden und Westen des Landes teilte, wo die Wehrmacht nahezu kampflos vorrückte. Im Norden dagegen stieß sie auf erbitterte Gegenwehr. Unterstützt von alliierten Truppen verteidigten die Norweger wochenlang die Stadt Narvik und brachten den Deutschen empfindliche Verluste bei.
»Meinst du, wir können sie wieder vertreiben?«, fragte Mari ihren Bruder Finn hoffnungsvoll.
Gerade hatte der Nachrichtensprecher des Britischen Rundfunks einen weiteren Erfolg der Alliierten im Kampf um Narvik gemeldet. Die Zwillinge saßen vor dem Radiogerät in der Küche, zu dem es sie – wie auch die anderen Familienmitglieder – seit dem Einmarsch der Wehrmacht immer wieder zog, wenn es die Arbeit gerade zuließ.
Finn hob unschlüssig die Schultern. »Schwer zu sagen. Hier bei uns und unten im Süden haben die Deutschen alles fest im Griff. Ich glaube nicht, dass wir die so rasch wieder loswerden.«
Mari nickte nachdenklich. »Wahrscheinlich hast du recht. Es sind so schrecklich viele. Nillas Vetter Ingolf hat erzählt, dass allein auf Vågsøy Hunderte von Soldaten stationiert sind.«
Mit Schaudern stellte sich Mari vor, was das für die kleine Insel an der Westküste bedeuten mochte. Wie fühlte sich das an, in Feindeshand zu sein? Leider hatte der Vetter von Maris Freundin Nilla, der aus einer Fischerfamilie kam, nur kurz im Postamt von Måløy, dem Hauptort auf Vågsøy, mit seinen Verwandten in Nordfjordeid telefonieren können und kaum etwas über das Leben mit den Deutschen berichtet.
Hier am Eidsfjorden bekamen sie bislang vom Krieg kaum etwas mit. Es war aber sicher nur eine Frage der Zeit, bis die Deutschen auch hier Einheiten stationieren und ihre Verwalter herschicken würden.
»Ich werde mir von diesen brutalen Hunnen nichts gefallen lassen«, verkündete Mari mit grimmiger Entschlossenheit.
Finn strich ihr leicht übers Haar. »Was anderes hätte ich auch nicht von dir erwartet«, sagte er.
Zunächst ging aber alles seinen gewohnten Gang. Der Beginn des Frühlings brachte wie jedes Jahr viel Arbeit mit sich. Fenna hatte mit der Geburt des kleinen Frihet die Abfohlsaison eingeläutet, viele weitere Stuten erwarteten ihre Fohlen und bescherten Mari und Ole zahlreiche schlaflose Nächte. Ihr Vater und Finn besserten an den Gebäuden des Hofes die Schäden aus, die im Laufe des langen, schneereichen Winters entstanden waren, und reparierten die Weidezäune. Die kleinen Äcker mussten gedüngt und für die Aussaat von Hafer und Gerste vorbereitet werden, Kartoffeln wurden gesetzt, die Beete des Gemüsegartens hinterm Haus umgegraben und von Lisbet bepflanzt. Großmutter Agna blies indessen zum alljährlichen Frühjahrsputz – eine Arbeit, die Mari besonders verhasst war. So nachgiebig Agna ihrer Enkelin sonst auch begegnete, hier ließ sie keine Ausreden gelten. Dem großen Reinemachen entkam Mari auch dieses Jahr nicht.
Sie rieb gerade die Fenster in der Wohnstube blank, als sie von draußen laute Rufe hörte. Neugierig streckte sie den Kopf aus dem Fenster, das zu dem kleinen Platz hinausging, der zwischen dem Wohnhaus, den Ställen und der Scheune lag. Ihr Bruder Finn stand dort mit dem Vater und zeigte aufgeregt Richtung Fjord. Ole kam aus dem Stall dazu und schaute ebenfalls gebannt zum Wasser. Mari hielt es nicht länger aus und rannte hinaus.
»Was ist los?«, rief sie, als sie die Türschwelle erreicht hatte.
»Die Deutschen kommen«, antwortete Finn.
»Was? Wo?«, fragte Mari und stellte sich neben die Brüder.
Ole streckte den Arm aus und deutete auf die andere Seite des Fjords.
Mari kniff die Augen zusammen und riss sie gleich darauf erschrocken wieder auf. »Das ist ja eine ganze Armee!«
Auf der Uferstraße fuhr ein Konvoi von Lastwagen und kleinen Geländewagen, gefolgt von Pferdegespannen und Fahrradfahrern. Am Ende marschierte eine endlos scheinende Kette von Soldaten.
»Was ist das für ein seltsamer Lärm?«, fragte Lisbet, die ebenfalls aus dem Haus gekommen war. Mari konzentrierte sich auf die Geräusche, die über den Fjord zu ihnen drangen. Neben dem Brummen der Fahrzeugmotoren trug der Wind tatsächlich noch etwas anderes herüber.
Ratlos zuckte Mari die Schultern. »Keine Ahnung, klingt wie …«
»Die singen!«, fiel ihr Finn überrascht ins Wort. Schweigend lauschten sie dem Gesang.
»Komisch«, meinte Mari nach einer Weile, »das passt irgendwie nicht. Ich meine, das wirkt so, als würden sie einen Schulausflug machen. Ein Eroberungsheer habe ich mir anders vorgestellt.«
Ole warf ihr einen spöttischen Blick zu. »Vielleicht wie eine Horde grölender Wikinger mit Messern zwischen den Zähnen?«
Mari rollte mit den Augen. »Blödmann.«
Finn lächelte seiner Schwester zu. »Ich weiß, was du meinst. Erinnert ihr euch an dieses deutsche Kreuzfahrtschiff, das hier vor zwei Jahren geankert hat? Da wurde doch auch ständig gesungen. Das lieben die anscheinend.«
Ole zuckte mit den Achseln. »Vielleicht empfinden diese Soldaten ihren Feldzug wie eine Urlaubsreise«, sagte er und fügte bitter hinzu: »Hier geben wir ihnen ja auch kaum einen Grund, das anders zu sehen.«
»Wohin die wohl wollen?«, fragte Mari.
»Warten wir’s ab«, meinte Ole und kehrte in den Stall zurück.
Die Antwort auf Maris Frage kam einige Stunden später. Sie goss gerade das Spülwasser aus, mit dem sie die Böden im Haus geschrubbt hatte, als sie mehrstimmiges Fahrradklingeln vom Sträßchen her hörte, das unten am Grundstück des Hofes vorbeiführte. Vor der Auffahrt standen vier junge Männer mit Fahrrädern. Sie trugen blaugraue Uniformen und hatten ihre Mützen keck in die Stirn gezogen. Sie winkten Mari mit freundlichem Lächeln zu. Als sie Anstalten machten, die Fahrräder in ihre Richtung zu schieben, ließ Mari erschrocken den Putzeimer fallen und rannte zum Haus.
»Haben Sie keine Angst«, sagte jemand in holprigem Norwegisch.
Überrascht drehte sich Mari um. Einer der Soldaten war ihr hinterhergeeilt und stand nur ein paar Schritte von ihr entfernt.
»Bitte, wir tun Ihnen doch nichts«, fuhr er fort und hielt ihr seine geöffneten Hände entgegen, als wolle er so seine Harmlosigkeit beweisen.
Mari musste unwillkürlich kichern, als sie seinen Gesichtsausdruck sah, der zwischen Zerknirschung und Schalk schwankte. Der Soldat, den sie auf Anfang zwanzig schätzte, machte in seiner schnittigen Uniform eine gute Figur. Sein schmales Gesicht mit den hohen Wangenknochen wurde von mandelförmigen, leicht schräg stehenden braunen Augen beherrscht, in denen Mari goldene Sprengsel aufblitzen sah.
Ich starre ihn an, stellte Mari entsetzt fest und senkte den Blick. Und dann wurde sie auch noch rot. Wie peinlich! Am liebsten wäre sie wortlos geflüchtet. Ein Blatt Papier erschien in ihrem Gesichtsfeld.
»Entschuldigung, aber wir haben Befehl, hier Quartier zu nehmen, bis wir eigene Unterkünfte gebaut haben«, sagte der Soldat. »Hier ist die Anordnung.«
Ohne ihn noch einmal anzusehen, griff Mari nach dem Dokument, murmelte: »Ich hole meinen Vater«, und eilte zur Scheune, in der Enar gerade mit Ole und Finn arbeitete. Ihr Herz klopfte so stark wie nach einem steilen Berganstieg oder einem Wettrennen. Vergeblich versuchte sie sich einzureden, dass das unvermutete Auftauchen der feindlichen Soldaten sie so aufregte. Es war nur einer von ihnen, der dieses Gefühl in ihr auslöste – diese Mischung aus banger Erwartung, diffuser Furcht und einem heißen Glücksgefühl.
3
Frankfurt, April 2010
Das Gespräch mit Susanne am Morgen nach ihrer Rückkehr aus Indien hatte Lisa gutgetan. Sie fühlte sich nicht mehr so verloren und verletzt, konnte sich den Fragen, die in ihr aufkamen, gelassener stellen. Lisa schenkte sich Tee nach und stellte sich mit der Tasse ans Fenster. So vieles, was sie als Kind selbstverständlich hingenommen hatte, erschien ihr nun, wo sie von der Adoption ihrer Mutter wusste, in einem neuen Licht. Vor allem dieses ewig Unbehauste, Simones Weigerung, sich irgendwo niederzulassen und Wurzeln zu schlagen. Zwar hatte sie dem Wunsch ihres Mannes Rainer nachgegeben und mit ihm in Südfrankreich ein Häuschen für ihren Lebensabend gemietet. Doch ihre innere Unruhe war stärker gewesen und hatte sie immer wieder fortgetrieben. Und da Rainer sie liebte und glücklich sehen wollte, war er mit ihr durch die Welt gezogen. Schließlich war sie ihm früher auch an jeden noch so exotischen Ort gefolgt, in den man ihn versetzt hatte.
Lisa stutzte. Nein, eine Ausnahme hatte es gegeben. An jenem Tag vor etwa zwanzig Jahren. Lisa erinnerte sich noch gut daran. Sie hatten auf einer weinumrankten Terrasse mit Blick auf die Meerenge von Gibraltar gesessen und zu Mittag gegessen. Das musste in der marokkanischen Hafenstadt Tanger gewesen sein. Ihr Vater hatte an diesem Vormittag erfahren, in welches Land er als Nächstes versetzt werden würde. Nach einem eingespielten Ritual mussten Simone und Lisa ihren neuen Wohnort raten und Rainer Fragen stellen, auf die er nur mit Ja oder Nein antworten konnte. Also zum Beispiel: Gibt es dort Elefanten? Benutzen die Menschen lateinische Buchstaben? Gibt es im Winter Schnee? Liegt das Land auf der nördlichen Halbkugel?
Es war Lisa, die schließlich stolz die richtige Antwort verkündet hatte: Norwegen! Rainer hatte seine kluge Tochter beglückwünscht, doch Simone war plötzlich aufgesprungen. Unter der Sonnenbräune war sie ganz blass geworden und hatte nach Luft gerungen. Auf Rainers erschrockene Frage, was ihr denn fehle, hatte Simone heftig hervorgestoßen: »Nicht nach Norwegen. Niemals werde ich einen Fuß in dieses Land setzen!«, und war ins Haus gestürmt. Vater und Tochter hatten sich ratlos angesehen, völlig überrumpelt von diesem unerwarteten und unerklärlichen Ausbruch. Bislang war Simone ihrem Mann vorbehaltlos in die entlegensten Winkel der Erde gefolgt, immer bereit, sich auf neue Länder und Kulturen einzulassen. Was um alles in der Welt hatte sie ausgerechnet gegen Norwegen? Weder Rainer noch Lisa konnten sich Simones seltsame Reaktion erklären oder sie später zu einer nachvollziehbaren Begründung bewegen. Rainer bat schließlich um eine andere Stelle und ließ die Sache auf sich beruhen.
Lisa wurde klar, wie sehr sie von diesem unsteten Leben geprägt worden war. Denn auch sie führte im Grunde ein Nomadendasein. Die kleine Wohnung in Frankfurt war mehr ein Basislager für kurze Zwischenstopps als ein richtiges Zuhause. Die Stadt selbst kannte sie kaum und hätte sie ohne Abschiedsschmerz gegen eine andere eingetauscht. Nur Susanne, deren Freundschaft ihr eher zufällig »passiert« war, als dass sie sich aktiv um einen solchen Kontakt bemüht hatte, würde sie ernsthaft vermissen. Außerdem schien sie die Abneigung ihrer Mutter gegen Norwegen unbewusst übernommen zu haben – in all den Jahren, in denen sie die Welt bereiste, hatte sie noch nie einen Fuß in dieses Land gesetzt. Ja, sie war nicht einmal in seine Nähe gekommen, denn auch Schweden und Finnland waren tabu gewesen.
Lisa schüttelte ungläubig den Kopf. Da bildete man sich ein, Herr über die eigenen Entscheidungen zu sein, nur um dann festzustellen, wie sehr man durch fremde Einflüsse manipuliert wurde. Sie wandte sich vom Fenster ab und nahm das silberne Medaillon vom Couchtisch. Auf der Rückseite waren ein paar Wörter in einer fremden Sprache eingraviert – »For veslepusen min til minne om din lykkeligste dagen« –, die Lisa dem skandinavischen Raum zuordnete. Vielleicht norwegisch? Lisa merkte, wie sich ihr Puls beschleunigte. Die heftige Reaktion ihrer Mutter auf die Erwähnung Norwegens war kein Zufall gewesen, keine exzentrische Laune, wie Lisa all die Jahre geglaubt hatte. Rasch holte sie ihren Laptop, setzte sich aufs Sofa und ging ins Internet. Sie gab ein paar Worte der Inschrift ein und hatte binnen Sekunden Gewissheit: Die Widmung auf dem Medaillon war auf Norwegisch geschrieben. Mithilfe eines norwegisch-deutschen Onlinewörterbuchs gelang Lisa eine ungefähre Übersetzung: Für meine kleine Katze zur Erinnerung an deinen glücklichsten Tag.
Mit dem »glücklichsten Tag« war wohl der Hochzeitstag gemeint. Und die kleine Katze war ziemlich sicher die junge Frau, die ihr selbst so ähnlich sah. Aber wer hatte ihr das Schmuckstück geschenkt? Ihr Bräutigam? Oder stammte die Widmung vom Vater oder der Mutter der Braut?
Lisa öffnete das Medaillon und betrachtete die alten Fotografien. Der junge Mann trug eindeutig eine Uniform. Aber von welcher Armee? Wie sah eine norwegische Uniform aus? Sie holte sich eine Lupe, um mehr Details erkennen zu können. Auf dem hochgestellten Kragen der Jacke waren rechts und links Doppelbalken aufgenäht, auf den Schulterklappen erkannte Lisa Schlangen, die sich um einen Stab wanden. War der junge Mann Arzt gewesen? Auf dem schiffsförmigen Käppi, das er etwas schief auf dem Kopf trug, entdeckte Lisa über einem runden Emblem einen aufgenähten Adler mit ausgebreiteten Schwingen und ein winziges Hakenkreuz. Also Wehrmacht.
Lisa ließ die Lupe sinken. Wie kam ein deutscher Soldat zu einer norwegischen Braut? Lisa beugte sich erneut zu ihrem Laptop. Die Suche nach Informationen zu Norwegen im Zweiten Weltkrieg bescherte ihr eine Flut von Links. Ihr war gar nicht bewusst gewesen, dass Norwegen eine derart wichtige Rolle in der Kriegsplanung der Deutschen gespielt hatte. Bei einer Bevölkerungszahl von etwas über drei Millionen in den 1940er Jahren war das kleine Land mit bis zu vierhunderttausend Deutschen regelrecht von den Besatzern überschwemmt gewesen, die vor allem die Westküste gegen alliierte Angriffe sichern sollten, las sie. Im Vergleich mit okkupierten Ländern im Osten, deren als »rassisch minderwertig« geltende Bevölkerung unter der brutalen Willkür der Sieger zu leiden hatte, zählte Norwegen jedoch zu den sogenannten »friedlich besetzten« Ländern mit arischen Einwohnern – was immer man sich darunter vorzustellen hatte.
Lisa schwirrte der Kopf. Auf der Suche nach Antworten stieß sie auf immer neue Fragen. War ihr Großvater ein Nazi gewesen? Wie hatten seine norwegische Braut und deren Familie zu den Besatzern und dem Dritten Reich gestanden? Gab es überhaupt noch eine Chance, das herauszufinden? Lisa klappte den Laptop zu. So schnell würde sie nicht aufgeben. Sie war fest entschlossen, diese weißen Flecken ihrer Familiengeschichte zu beseitigen und ihre Großeltern posthum so gut wie möglich kennenzulernen.
Eine Stunde später stand sie vor dem Garten, den ihre Heidelberger Familie seit Langem am Hang unterhalb des Philosophenweges gegenüber der Altstadt besaß. Lisa hielt kurz inne, bevor sie die Tür öffnete, und atmete tief durch. Ihr spontaner Einfall, ihre Onkel im nahen Heidelberg zu besuchen und persönlich zum Schicksal ihrer Adoptivschwester zu befragen, erschien ihr plötzlich gar nicht mehr so brillant. Was, wenn Robert und Hans sich überrumpelt fühlten, das Thema unangenehm fanden, nicht darüber sprechen wollten? Oder vielleicht gar nichts Genaues wussten?
Sei kein Frosch, schimpfte Lisa mit sich selbst und stieß das Gartentor auf. Aus dem hinteren Teil des kleinen, mit Obstbäumen bewachsenen Grundstücks kam ein älterer Mann auf sie zu. Er war mittelgroß, von kräftiger Gestalt, und sein dichtes dunkles Haar war nur von einzelnen Silberfäden durchzogen. Er trug Jeans, Rollkragenpullover und derbe Stiefel, die mit Erde verkrustet waren. Als er Lisa sah, breitete sich ein herzliches Lächeln auf seinem Gesicht aus.
»Hallo, Onkel Robert«, rief sie ihm entgegen.
»Lisa! Ich freue mich so, dich zu sehen!«, sagte er, legte eine Harke, die er in der Hand hielt, beiseite und öffnete die Arme.
Ehe sie es sich versah, fühlte sich Lisa fest umarmt. Ein warmes Gefühl durchströmte sie. Das neu gewonnene Wissen, dass Robert und sein Bruder Hans nicht ihre leiblichen Onkel waren, blieb eine abstrakte Tatsache. Für Lisa würden es immer ihre Verwandten sein.
Robert ließ Lisa los und führte sie zu einem kleinen Bänkchen, das in der warmen Mittagssonne unter einem blühenden Apfelbaum stand. Überall auf dem Rasen leuchteten dicke Büschel Osterglocken und Tulpen, und die Dolden eines Fliederbuschs standen kurz vor der Blüte. Lisa und Robert setzten sich auf die Bank, von der aus man einen weiten Blick ins Neckartal und auf die gegenüberliegende Stadt mit dem Schloss hatte. Schon als Kind, wenn sie ihre Großeltern in den Ferien besucht hatte, war Lisa gern hierhergekommen, um ungestört zu lesen oder einfach nur vor sich hinzuträumen.
»Hans ist leider unterwegs, er wird es sehr bedauern, dass er dich verpasst hat«, sagte Robert. »Oder kannst du länger bleiben?«
Lisa schüttelte den Kopf. »Heute leider nicht. Aber ich möchte euch bald mal für ein paar Tage besuchen.«
Robert drückte Lisas Arm und sagte: »Du weißt ja, wir freuen uns immer, wenn du kommst. Das letzte Mal war’s ja leider ein trauriger Anlass.« Er schaute sie aufmerksam an. »Kommst du zurecht?«
Lisa erwiderte seinen Blick. »Schwer zu sagen. Ich vermisse sie sehr. Aber so ganz kapiert habe ich es wohl noch nicht, dass sie nicht mehr da sind.«
Robert nickte. »Geht mir ähnlich, es ist einfach unfassbar. Aber für dich ist es natürlich noch viel schlimmer.«
Lisa beschloss, den Stier direkt bei den Hörnern zu packen. »Ich habe Post von einem Heidelberger Notar bekommen«, begann sie.
»Von Walter Schneider?«, fragte ihr Onkel.
»Ja, genau«, sagte Lisa überrascht.
»Seine Kanzlei betreut unsere Familie schon ewig«, erklärte Robert. »Was wollte er denn von dir? Ich dachte, die Formalitäten wegen des Nachlasses deiner Eltern wären alle geklärt?«
»Das sind sie auch«, sagte Lisa. »Es ging um einen Brief meiner Mutter, den sie mir vor vielen Jahren geschrieben hat.« Sie hielt kurz inne und schluckte trocken. »Ich hatte keine Ahnung, dass sie ein Adoptivkind war.«
Die Augen ihres Onkels weiteten sich erschrocken. Er stand auf und ging ein paar Schritte von der Bank weg. Lisa beobachtete ihn verunsichert. Mit einem Räuspern drehte sich Robert wieder zu ihr um. »Lisa, es tut mir unendlich leid. Ich wollte mich nicht einmischen und hatte einfach gehofft, dass deine Mutter es dir längst erzählt hat.«
Lisa stand auf und stellte sich neben ihn. »Du kanntest sie doch. Sie war ein Meister darin, aus ihrem Herzen eine Mördergrube zu machen.«
Robert brummte zustimmend. »Da hast du wohl recht. Deshalb mache ich mir ja Vorwürfe. Ich hätte zumindest ahnen müssen, dass sie dir nichts erzählt.«
Lisa hakte Robert unter. »Mach dir bitte keine Vorwürfe. Ich wäre einfach nur dankbar, wenn ich jetzt mehr erfahren könnte.«
Robert nickte. »Natürlich. Ich erzähle dir gern alles, was ich noch weiß.«
»Also«, sagte Lisa, als sie wieder nebeneinander auf der Bank saßen, »wie kam Simone zu euch?«
Robert räusperte sich. »Meine Mutter hat nach dem Krieg in einem Auffanglager für displaced persons in der Nähe von Heidelberg als Rotkreuzschwester gearbeitet«, begann er. »Da hat sie natürlich viele schlimme Schicksale kennengelernt. Aber besonders zu Herzen ging ihr dieses kleine, ungefähr vierjährige Mädchen, das völlig allein nach monatelanger Irrfahrt in dem Lager gestrandet war. Immer wieder hat Mutter von der Kleinen erzählt, die nach ihren traumatischen Erlebnissen verstummt war. Auch als sie wieder anfing zu sprechen, konnte sie nicht sagen, woher sie kam und ob sie noch irgendwo Verwandte hatte. Und sie hatte nichts bei sich, was Aufschluss über ihre Herkunft gegeben hätte. Nur eine Kette mit einem Medaillon, in dem zwei Porträtfotos steckten.«
»Hätte man die Eltern der Kleinen nicht anhand der Porträtbilder suchen können?«, fragte Lisa.
Robert lachte kurz auf. »Ich fürchte, du hast ein völlig falsches Bild von den Möglichkeiten, die man so kurz nach dem Krieg hatte. Vielleicht, wenn es damals schon Fernsehen und Internet gegeben hätte …«
Lisa nickte. »Schon klar, ich hatte nur gehofft …«
»Ich versteh dich sehr gut«, sagte Robert, »aber du kannst dir nicht vorstellen, wie chaotisch es damals zuging. Millionen Menschen ohne ein festes Dach überm Kopf irrten durch die verwüsteten Städte. Flüchtlinge aus dem Osten, ehemalige Zwangsarbeiter und Lagerinsassen, Kriegsheimkehrer, alle auf der Suche nach ihren Familien.«
Lisa versuchte, sich ihre Enttäuschung über diese spärlichen Auskünfte nicht anmerken zu lassen. »Und, wie ging es weiter?«, fragte sie.
»Als meine Mutter erkannte, dass das Kind im Heim landen würde, weil es kaum Hoffnung gab, seine Familie zu finden, beschloss sie kurzerhand, es zu uns zu holen und ihm ein neues Zuhause zu geben«, antwortete Robert.
»Großmutter war wirklich eine großherzige Frau«, sagte Lisa. »Schließlich hatte sie schon zwei Kinder. Ich nehme an, dass es nicht einfach war, die satt zu kriegen … Was hat denn euer Vater dazu gesagt?«
Robert grinste. »Wenn sich Mutter etwas in den Kopf setzte, hatte er keine Chance. Sie hat ihn immer um den Finger gewickelt … Aber Spaß beiseite. Mein Vater hat sich auch sofort in die Kleine verliebt. Genau wie Hans und ich.«
»Meine Mutter hatte wirklich großes Glück«, stellte Lisa fest. »Den meisten Kriegswaisen ist es sicher nicht so gut ergangen.«
»Das ist wohl wahr«, sagte Robert und stand auf. »Ich hole uns einen Tee, meine Kehle ist schon ganz trocken.«
Er ging zu einem kleinen Geräteschuppen und kehrte mit einem Korb zurück, aus dem er eine Thermoskanne, zwei zerbeulte Emaillebecher und eine Papiertüte nahm. Er öffnete die Tüte und hielt sie Lisa hin. Verführerisch duftendes Gebäck aus der Bäckerei Lenz, die mittlerweile von Roberts Sohn Christian geleitet wurde. Lisa nahm sich eine Mohnschnecke, die dick mit Streuseln belegt war. Sie biss hinein und fühlte sich in alte Zeiten zurückversetzt. Als kleinem Mädchen war ihr die Backstube des Familienbetriebs wie das Paradies erschienen. Sie hatte es geliebt, ihrem Großvater zuzusehen, wie er mit wenigen geübten Handbewegungen Brezeln, Apfeltaschen oder eben diese Mohnschnecken formte. Damals stand für sie fest, dass sie einmal einen Bäcker heiraten würde.
»Da fällt mir ein, in dem Medaillon war noch eine Ansichtskarte«, sagte Robert und reichte Lisa einen Becher mit Tee.
»Was für eine Karte?«, fragte Lisa. »Die hat mir der Anwalt nicht geschickt.«
»Oh, dann ist sie wohl bei den Sachen gewesen, die deine Mutter nach der missglückten Suche weggeworfen hat«, meinte Robert. »Jedenfalls war in dem Medaillon eine mehrfach zusammengefaltete Postkarte.«
»Und, was stand drauf?«, fragte Lisa gespannt.
»Gar nichts«, antwortete Robert. »Es war eine unbeschriebene Ansichtskarte von einem Ort in Norwegen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Irgendwas mit Nordfjord, wenn ich mich recht erinnere.«
»Hm, nicht sehr aufschlussreich«, sagte Lisa und schluckte. Ihre Hoffnung, mehr über ihre Mutter zu erfahren, schwand dahin. Sie schwieg einen Moment und fragte dann: »Was meintest du gerade eigentlich mit missglückter Suche? Hat meine Mutter selbst nach ihren leiblichen Eltern gesucht?«
»Ja, das hat sie«, bestätigte ihr Onkel. »An ihrem einundzwanzigsten Geburtstag, als sie volljährig wurde, haben meine Eltern ihr von der Adoption erzählt. Simone wollte verständlicherweise mehr über ihre leiblichen Eltern erfahren. Anfang der Sechzigerjahre war es sehr viel einfacher geworden, nach vermissten Personen zu suchen beziehungsweise ihre Schicksale zu recherchieren. Leider haben Hans und ich nur am Rande mitbekommen, wie Simone vorging und was genau sie herausfand. Hans studierte damals in München. Und ich war bei einem Bäcker in Karlsruhe in der Lehre und nur selten in Heidelberg«, sagte er und zuckte bedauernd die Schultern. »Unser Vater gab ihr den Rat, sich an Veteranen der Infanterieeinheit zu wenden, die während des Zweiten Weltkriegs in diesem norwegischen Städtchen stationiert war. Simone konnte ein paar Angehörige dieser Einheit ausfindig machen und hat ihnen das Foto aus dem Medaillon gezeigt. So hat sie dann tatsächlich einen ehemaligen Kameraden ihres Vaters getroffen, der sich noch gut an ihn erinnerte. Nicht zuletzt deswegen, weil er eine junge Norwegerin heiraten wollte, die auf einem Gestüt in der Nähe des Städtchens, wo sie stationiert waren, lebte.«
»Wahnsinn!«, entfuhr es Lisa. »Das ist ja der reinste Krimi!«
Robert lächelte traurig. »Leider ohne Happy End. Simone war es zwar gelungen, sich die Adresse zu beschaffen. Aber als sie dann voller Hoffnung, mehr über ihre Mutter zu erfahren, nach Norwegen schrieb, kam nach wochenlangem Warten die Antwort, dass man keinen Kontakt zu ihr wünsche und sich weitere Belästigungen verbitte.«
»Wie schrecklich«, rief Lisa, »sie muss furchtbar enttäuscht gewesen sein!«
»Ja«, sagte Robert. »Simone hat es wohl so empfunden, als sei sie zum zweiten Mal verlassen worden. Deshalb hat sie damals beschlossen, die Sache ein für alle Mal auf sich beruhen zu lassen, und alle Unterlagen weggeworfen.«
»Verstehe«, sagte Lisa und spürte, wie ihr die Tränen kamen. »Lass mich raten: Sie hat dann nie wieder darüber gesprochen.«
Robert nickte. »Das Thema war seitdem absolut tabu.«
»War Simone eigentlich ihr ursprünglicher Name?«, fragte Lisa, als sie sich wieder einigermaßen gefasst hatte.
»Nein, den hat ihr unsere Mutter gegeben«, antwortete Robert. »Wie ich schon sagte, die Kleine hat ja monatelang gar nicht gesprochen. Nach einer Weile hat ihr meine Mutter ein paar Namen vorgeschlagen. Simone schien dem Mädchen am besten zu gefallen.« Er hob bedauernd die Schultern. »Ich fürchte, das ist schon alles, was ich dir erzählen kann.«
»Na, es ist auf jeden Fall sehr viel mehr, als ich bisher wusste«, sagte Lisa.
Robert legte einen Arm um sie. »Es tut mir wirklich leid, dass sich deine Mutter dir nicht selbst anvertraut hat. Ich kann mir vorstellen, wie schmerzlich das für dich ist.«
»Ist schon in Ordnung«, versicherte Lisa.
4
Frankfurt, April 2010
Am Abend saß Lisa wie verabredet im Da Vinci, einem italienischen Restaurant der gehobeneren Klasse am Frankfurter Westhafen. Versonnen schaute sie aus dem großen Fenster, vor dem der Main langsam vorbeifloss. Die Lichter der abendlich beleuchteten Gebäude spiegelten sich im dunklen Wasser. Marco würde sich ein paar Minuten verspäten, er war noch auf der Suche nach einem Parkplatz. Er hatte »ihren« Tisch reservieren lassen, an dem sie sich schon oft bei köstlichen Speisen und exquisiten Weinen angeregt unterhalten hatten. In einer Vase stand eine gelbe Teerose – Marco musste sie extra vorbeigebracht haben, denn die anderen Tische waren mit Tulpen dekoriert.
Lisa lächelte. Sie freute sich auf diesen Abend. Nach ihrem aufwühlenden Eintauchen in die Abgründe ihrer Familiengeschichte mit den vielen offenen Fragen sehnte sie sich nach verlässlichen Gewissheiten – und die Beziehung zu Marco Köster zählte für sie dazu. Zwar sahen sie sich nicht sehr oft, doch dank E-Mail und Mobiltelefon kommunizierten sie fast täglich miteinander. Das letzte Mal hatten sie sich vor knapp drei Wochen getroffen. Vor ihrem Flug nach Mumbai hatte Lisa ihren Freund kurz in Hamburg besucht, wo er als Bildredakteur einer renommierten Architekturzeitschrift arbeitete.
Es war nun vier Jahre her, dass sie den damals Dreiunddreißigjährigen kennengelernt hatte, als sie für eine von ihm betreute Reportage die Bilder machte. Anschließend hatte Marco sie in ein schickes Fischrestaurant an der Alster eingeladen, um die gelungene Zusammenarbeit zu feiern. Stundenlang hatten sie sich die Köpfe heißgeredet über die gegenwärtigen Architekturtrends und die Vor- und Nachteile der digitalen beziehungsweise der analogen Fotografie, hatten sich heftig gestritten und schließlich ebenso leidenschaftlich geliebt. Lisa musste unwillkürlich lächeln, als sie an diese erste gemeinsame Nacht zurückdachte – die sie damals für einen One-Night-Stand gehalten hatte. Denn Marco hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich gerade in einer »Orientierungsphase« befand, in der er sich nicht auf eine Frau festlegen wollte. Lisa hatte sich nicht daran gestört – in ihrem unsteten Leben war ohnehin kein Platz für eine feste Beziehung. Zu ihrer Überraschung hatte Marco dann aber den Kontakt gehalten, sie mit witzigen SMS amüsiert und per E-Mail ihre Unterhaltung über Architektur und Fotografie fortgesetzt. Lisa schätzte diese anregenden fachlichen Diskussionen, obwohl oder gerade weil sie meistens sehr unterschiedliche Ansichten hatten.
Sie hatte sich zunächst geschmeichelt gefühlt und dann verliebt. Marcos Großmutter war Italienerin gewesen und hatte ihrem Enkel den olivfarbenen Teint und kräftiges schwarzes Haar vererbt, das reizvoll mit seinen grünen Augen kontrastierte. Marco war zweifellos ein attraktiver Mann.
»Entschuldige, dass du warten musstest.«
Lisa wandte ihrem Freund ihr schmales Gesicht mit dem lebhaft geschwungenen Mund zu und stand rasch auf, um ihn zu umarmen. »So konnte die Vorfreude noch wachsen«, sagte sie leise, was Marco mit einem leidenschaftlichen Kuss beantwortete.
Nachdem sie ihre Bestellung aufgegeben hatten, nahm Marco Lisas Hand und schaute ihr in die Augen. »Cara, ich freue mich so, dich zu sehen! Ich habe tolle Neuigkeiten.«
Lisa lächelte und erwiderte seinen Händedruck. »Bei mir hat sich auch einiges getan«, sagte sie. Marco nickte ihr auffordernd zu. Lisa schüttelte leicht den Kopf. »Nein, nein, du zuerst. Was für Neuigkeiten?«
Marco richtete sich auf und verkündete mit leuchtenden Augen: »Vor dir sitzt der frischgebackene Gründer einer Fotoagentur.«
Lisa lächelte erfreut. »Das ist ja … Mensch, Marco, herzlichen Glückwunsch! Ich hatte ja keine Ahnung, dass deine Planungen schon so weit …« Sie unterbrach sich und runzelte die Stirn. »Was ist mit deinem Vertrag beim Verlag? Kannst du da so einfach raus?«
Marco hob lachend die Hand. »Entschuldige, ich hab wohl etwas übertrieben. Es dauert natürlich noch ein Weilchen, bis wir loslegen können. Aber ab Juni bin ich ein freier Mann.«
Lisa hob ihr Glas und prostete Marco zu. »Auf die Selbstständigkeit!«
»Und auf eine gute Zusammenarbeit!«, sagte Marco und stieß mit ihr an.
Lisa schaute ihn fragend an. »Was meinst du?«
»Na, du wirst natürlich meine Topfotografin«, antwortete Marco und strahlte sie an.
Lisa zog eine Augenbraue hoch und sagte mit leicht ironischem Unterton: »Sehr schmeichelhaft. Ich darf also dein Zugpferd spielen.«
Marco zog die Stirn kraus. »Ich dachte eher an eine Partnerschaft.«
Lisa schaute ihn überrascht an. »Ich weiß nicht, ich mag meine Unabhängigkeit eigentlich sehr.«
Marco wischte ihren Einwand mit einer ausladenden Geste beiseite und hätte dabei fast sein Weinglas vom Tisch gefegt. »Aber die behältst du doch«, versicherte er ihr und nahm ihre Hand. »Im Gegenteil, dann bist du ganz deine eigene Herrin und musst dich nicht mehr mit zickigen Auftraggebern herumschlagen.«
Das Erscheinen des Kellners mit ihrem Essen unterbrach das Gespräch. Lisa schaute zu Marco, der sich mit großem Appetit über seine gegrillte Dorade hermachte. Für ihn war alles so einfach. Gewiss, sie hatten in der Vergangenheit schon oft zusammengearbeitet, sie waren ein gutes Team. Aber nur noch ausschließlich für ihn zu fotografieren? Partnerin in seiner Agentur zu werden? Alles auf eine Karte zu setzen und die anderen langjährigen Kunden vor den Kopf zu stoßen? Und was wäre, wenn das mit ihnen beiden als Geschäftspartnern nicht funktionierte? Es war immer heikel, Berufliches und Privates allzu eng miteinander zu verbinden.
Marco schaute auf und bemerkte ihren Blick. »Cara«, sagte er, »mach dir nicht so viele Gedanken. Ich kann es in deinem Kopf förmlich rattern hören.«
Lisa lächelte verlegen. War sie so leicht zu durchschauen?
»Glaub mir, ich hab mir alles gründlich überlegt. Wir passen einfach perfekt zueinander. In jeder Beziehung«, sagte Marco.
»Ja, schon«, setzte Lisa an, »es ist nur …«