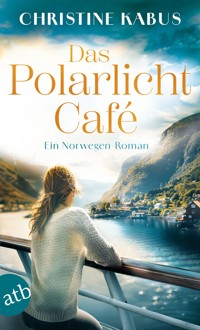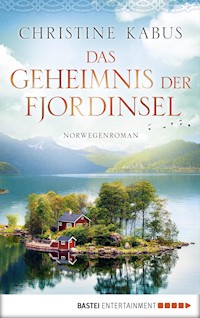6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, ein Geheimnis und eine unverhoffte Reise ...
Norwegen, 1905. Das Jahr, in dem das Land um seine Unabhängigkeit ringt, markiert auch für zwei sehr unterschiedliche Frauen einen Wendepunkt: In Stavanger tritt Liv eine Stelle als Dienstmagd an und muss schon bald die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen. Darf sie sich gegen ihren Dienstherren stellen, um einem kleinen Jungen zu helfen, den ein trauriges Schicksal erwartet?
Auch für die junge Gräfin Karoline im fernen Schlesien steht ihre Existenz auf dem Spiel. Der Familienbesitz würde an einen entfernten Verwandten gehen, wenn ihr schwerkranker Mann ohne Erben stirbt. Als sie erfährt, dass er kurz vor der Hochzeit in Norwegen ein Kind gezeugt hat, schmiedet sie einen abenteuerlichen Plan ...
Große Gefühle und dunkle Geheimnisse vor der eindrucksvollen Kulisse Norwegens: Mit "Das Lied des Nordwinds" legt Christine Kabus einen opulent erzählten, mitreißenden Roman vor.
Weitere Norwegen-Romane von Christine Kabus: Töchter des Nordlichts. Das Geheimnis der Fjordinsel. Das Geheimnis der Mittsommernacht. Im Land der weiten Fjorde. Insel der blauen Gletscher.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 795
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Norwegen-Romane der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Figuren der Handlung
Karte
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Epilog
Anmerkungen
DANKE
Weitere Norwegen-Romane der Autorin
Töchter des Nordlichts
Das Geheimnis der Mittsommernacht
Im Land der weiten Fjorde
Insel der blauen Gletscher
Das Geheimnis der Fjordinsel
Über dieses Buch
Zwei Frauen, ein Geheimnis und eine unverhoffte Reise …
Norwegen, 1905. Das Jahr, in dem das Land um seine Unabhängigkeit ringt, markiert auch für zwei sehr unterschiedliche Frauen einen Wendepunkt: In Stavanger tritt Liv eine Stelle als Dienstmagd an und muss schon bald die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen. Darf sie sich gegen ihren Dienstherren stellen, um einem kleinen Jungen zu helfen, den ein trauriges Schicksal erwartet?
Auch für die junge Gräfin Karoline im fernen Schlesien steht ihre Existenz auf dem Spiel. Der Familienbesitz würde an einen entfernten Verwandten gehen, wenn ihr schwerkranker Mann ohne Erben stirbt. Als sie erfährt, dass er kurz vor der Hochzeit in Norwegen ein Kind gezeugt hat, schmiedet sie einen abenteuerlichen Plan …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Christine Kabus, 1964 in Würzburg geboren, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte als Dramaturgin und Lektorin bei verschiedenen Film- und Theaterproduktionen, bevor sie sich 2003 als Drehbuchautorin selbstständig machte. Schon als Kind faszinierte sie der hohe Norden. Vor allem die ursprüngliche, mythische Landschaft Norwegens beflügelte ihre Phantasie. Sie begann, die Sprache zu lernen und sich intensiv mit der Geschichte Norwegens zu beschäftigen. Insgesamt liegen bei Bastei Lübbe sechs Norwegen-Romane von Christine Kabus vor.
CHRISTINE KABUS
DAS LIEDDESNORDWINDS
Norwegen-Roman
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2018/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Kharchenko_irina7/GettyImages; WangAnQi/GettyImages; Skazzjy/GettyImages; StreetFlash/GettyImages
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0619-3
be-ebooks.de
lesejury.de
Für Lilian
Friheten er som luften.Først når en ikke har den, merker en hva det betyr.
Die Freiheit ist wie Luft.
Figuren der Handlung
SCHLESIEN
Grafen von Blankenburg-Marwitz auf Schloss Katzbach (Kreis Goldberg)
Karoline, geb. Jauer
Moritz, ihr Ehemann
Gräfin Alwina, Mutter von Moritz
Graf Hermann, Vater von Moritz
Freiherr Waldemar von Dyhrenfurth, Bruder von Gräfin Alwina
Agnes, Zofe von Karoline
Anton, Bursche von Moritz
Ida Krusche, Schulfreundin von Karoline, Görlitz
Gustav Krusche, ihr Ehemann, Görlitz
Rosalie und Kurtchen, ihre Kinder
NORWEGEN
Stavanger und Umgebung
Oddvar Treske, Lehrer an der Missionsschule
Ingrid Treske, seine Ehefrau
Elias, ihr Sohn
Liv Svale, Hausmädchen
Frau Bryne, Köchin
Halvor Eik, Missionar
Bjarne Morell, Mitarbeiter des Freiluftmuseums von Kristiania
Ruth Svale, Mutter von Liv, Sandnes
Pfarrer Nylund, Sandnes
AUFDER REISE
Leuthold Schilling, Hauslehrer aus Meißen
Flora Bakken, Mitarbeiterin von Martha Tynæs, Kristiania
Clara Hætta, Pensionswirtin und Freundin von Sofie, Røros
Sofie Hauke, geb. Svartstein, Trondheim
Toril Hustad, ihre Großmutter, Trondheim
Eline Hansen (1859–1919), Frauenrechtlerin und Pazifistin, Kopenhagen
Ingeborg Suhr (1871–1969), Haushaltsschulleiterin und Autorin, Kopenhagen
Frigga Carlberg (1851–1925), Sozialarbeiterin, Frauen- rechtlerin und Autorin, Göteborg
Martha Tynæs (1870–1930), Sozialarbeiterin, Frauenrechtlerin und Politikerin, Kristiania
Prolog
Breslau, den 1. Mai 1896
Liebe Ida,
entschuldige bitte, dass ich erst jetzt zur Feder greife und Dir auf Deinen langen Brief vom März antworte, in dem Du mir so anschaulich von Eurem Leben in Buenos Aires berichtet hast. Auch wenn ich nun einen guten Einblick in Deinen dortigen Alltag gewonnen habe, fällt mir die Vorstellung schwer, dass so viele tausend Kilometer zwischen uns liegen und Du in einem so fremden Land weilst. Da mag ich es kaum glauben, dass wir noch vor einem halben Jahr im Mädchenpensionat der gestrengen Matrone Schroeder die Köpfe zusammengesteckt, Zukunftspläne geschmiedet und uns gelobt haben, uns nie aus den Augen zu lassen. Wie anders ist es gekommen! Dich hat die Versetzung Deines Vaters ans andere Ende der Welt verschlagen, und ich werde in Kürze mein Elternhaus verlassen und den Gefilden der Kindheit endgültig den Rücken kehren.
Die letzten Wochen standen bei mir ganz im Zeichen der bevorstehenden Hochzeit. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin! Und wie glücklich! Ein Traum wird wahr: Ich werde Gräfin und in einem echten Schloss wohnen! Einziger Wermutstropfen ist mir die Tatsache, dass Du bei der Feier nicht dabei sein kannst! Ich hätte Dich so gern als Brautjungfer an meiner Seite gewusst. So, wie wir es uns gegenseitig versprochen haben. Aber Jammern hilft nun einmal nichts – und so komme ich einem anderen Versprechen nach und berichte Dir ausführlich – so wie Du es ausdrücklich gewünscht hast.
Die Trauung wird Pastor Hinrichs, der mich einst konfirmiert hat, in der altehrwürdigen Christophori-Kirche vornehmen. Das anschließende Bankett wird nicht – wie zunächst geplant – bei uns zu Hause stattfinden, sondern im Hotel Monopol. Vater hat den Festsaal gemietet – gemäß dem Motto, das er dieser Tage ständig im Munde führt: »Ich lasse mich doch nicht lumpen, wenn meine einzige Tochter adlig wird.« Alles muss vom Feinsten sein, das Beste ist ihm gerade gut genug.
Heute Morgen hatte ich die erste Anprobe des Kleides. Es wird ein Traum aus goldfarbenem Seiden-Satin. Der Rock ist gerade geschnitten und läuft in einer langen Schleppe aus. Das Oberteil ist aufwendig mit Tüll verarbeitet, die langen Ärmel sind gerafft und an den Schultern gepufft. Den Ausschnitt werden kleine Röschen aus Wachs zieren. Dazu werde ich den Schleier tragen, den meine Mutter zu ihrer Hochzeit aus Brüsseler Spitze anfertigen ließ.
In den nächsten Tagen erwarten wir die Menükarten, die mein Vater bei der Guttmannschen Druckerei in Auftrag gegeben hat. Sie werden allerliebst! Zwei Amoretten halten am unteren Bildrand einen roten Samtvorhang, der den Blick auf Schloss Katzbach freigibt, dem Stammsitz der Grafenfamilie. Darüber wird die Speisefolge gedruckt (Schildkrötensuppe/Steinbutt in Austernsauce/Tafelstück vom Rind mit Steinpilzen/ Hummersalat/Haselhuhnpastetchen/Bayrische Creme mit Baisers/Käse, Kompott, Eis) – umflattert von einem Taubenpaar, das mit seinen Schnäbeln ein weißes Band zwischen sich spannt, auf dem ein Segensspruch steht. Über dem Ganzen umrahmt ein aus Rosen geformtes Herz die Initialen von Moritz und mir.
Ach Ida, ich kann mein Glück kaum fassen. Nur noch zwei Wochen trennen mich vom schönsten Tag meines Lebens! Ich wünsche Dir von ganzem Herzen, dass auch Du bald als Braut vor den Altar treten wirst (auch wenn ich egoistisch genug bin, mir für Dich einen Mann zu wünschen, der Dich zurück nach Deutschland bringt, damit Du wieder in meiner Nähe lebst. Zu schade, dass Moritz keinen Bruder hat …).
Eben lässt Mutter nach mir schicken. Der Sattler hat uns eine Auswahl an Koffern für die Hochzeitsreise vorbeigebracht. Für heute muss ich meine Zeilen an Dich daher leider doch schon jetzt beenden. Ich schreibe Dir aber so bald als möglich mehr, versprochen!
Ich schicke Dir meine innigsten Grüße über den weiten Ozean,
herzlichst, Deine Freundin Karoline
1
Stavanger, April 1905 – Liv
Die Töne einer Glocke drangen an Livs Ohr und rissen sie aus ihren Gedanken, in die sie beim Gehen versunken war. Seit gut drei Stunden war sie auf einer von niedrigen Feldsteinwällen gesäumten Landstraße unterwegs, die durch eine hügelige, von Wiesen und Weiden geprägte Landschaft verlief. Die Achtzehnjährige hob den Kopf und sah sich um. Sie hatte die Ausläufer der Stadt erreicht, die sich vom Fjordufer nördlich vor ihr hinauf zu der Anhöhe hin ausbreitete, auf der sie nun einherschritt. Über ihr wölbte sich ein blassblauer Himmel. Die Wolken, die in der Nacht für Regen gesorgt hatten, waren verschwunden. Einige Meter die Straße hinunter erstreckte sich rechter Hand jenseits der Bahngleise, die parallel zum Ladegårdsveien verliefen, ein weitläufiger Friedhof. Ihm gegenüber ragte direkt neben der Straße eine hohe Mauer auf, die das Gefängnis von Stavanger umschloss. Liv blieb stehen, ließ das Bündel, in das sie Wäsche zum Wechseln, ein Nachthemd und ihr Gebetbuch geschnürt hatte, zu Boden sinken und zählte mit angehaltenem Atem die Glockenschläge. Als der letzte Ton verklang, stieß sie die Luft aus und entspannte sich. Acht Uhr. Sie war nicht zu spät.
»Sie erwarten dich am Dienstagmorgen gegen halb neun«, hatte Pfarrer Nylund zwei Tage zuvor nach dem Ostergottesdienst zu Liv gesagt, ihr den Brief von Oddvar Treske gezeigt und lächelnd hinzugefügt: »Ich freue mich, dass du die Stelle bekommst.«
Ihre Zweifel, ob sie den Anforderungen in einem gehobenen Haushalt gewachsen sein würde und nicht besser in einer Fabrik als Hilfsarbeiterin ihr Glück versuchen sollte, hatte er mit einem ebenso energischen wie freundlichen Kopfschütteln zu entkräften versucht. »Ich habe dich stets als tüchtig, pflichtbewusst und aufgeweckt erlebt. Falls bei Familie Treske Arbeiten auf dich warten sollten, die du noch nicht kennst, wirst du die dazu nötigen Fertigkeiten rasch erlernen. Also, nur Mut! Die Treskes sind anständige Leute, die ihre Untergebenen gerecht behandeln. Erfülle du nur fleißig deine Aufgaben – dann wirst du dort ein gesichertes Einkommen haben und deine Mutter unterstützen können.« Nach einer kurzen Pause hatte er hinzugefügt: »Ganz zu schweigen davon, dass es sehr viel gesünder und ungefährlicher ist als in einer Fabrik.«
Liv war zusammengezuckt und hatte wieder das Bild ihres Vaters vor Augen gehabt, wie er drei Jahre zuvor blutüberströmt und vor Schmerzen schreiend aus Graverens Teglverk getragen worden war, wo Ziegeln und Töpferwaren hergestellt wurden. Sein rechter Arm war in eine Pressmaschine geraten und nicht mehr zu retten gewesen. Sein Verlust hatte dem ohnehin schwachen Lebensmut von Anders Svale den letzten Stoß versetzt und ihm jeden Willen genommen, wieder auf die Beine zu kommen und zum Unterhalt seiner Frau und der fünf Kinder beizutragen. Er verdämmerte seine Tage auf seinem Bett oder in einer Schänke, wo er die Verzweiflung über die zunehmende Not seiner Familie in Weinbrand ertränkte.
Die Erinnerung an das Gespräch mit Pfarrer Nylund, der sie mit der eindringlichen Ermahnung, ihre Tochterpflicht zu erfüllen, entlassen hatte, ließ Liv ihre Lippen zusammenpressen. Seit sie denken konnte, tat sie nichts anderes, als ihrer Mutter zu helfen. Das Leben war ungerecht! Warum durfte sie sich nicht wie ihre Freundin Janne eine Stellung suchen, bei der sie nicht die Bevormundung durch die Eltern gegen die durch fremde Dienstherren eintauschte? Weil du eben nicht Janne bist, rief sie sich zur Ordnung. Sie muss für niemanden als sich selbst sorgen.
Janne, mit der Liv die Volksschule besucht hatte, war das jüngste Kind in ihrer Familie, ihre beiden Schwestern waren bereits verheiratet. Der Vater verdiente als Monteur genug, um sich und den Seinen ein bescheidenes Auskommen zu sichern. Janne hatte nie die Schule schwänzen müssen, um wie Liv ihre Mutter als Näherin zu unterstützen. Ein findiger Unternehmer aus Sandnes ließ Frauen in Heimarbeit Hemden fertigen und zahlte ihnen einen sehr niedrigen Stücklohn. Für Familien wie die Svales war es dennoch eine unverzichtbare Verdienstmöglichkeit. So kamen wenigstens ein paar Kronen für die nötigsten Dinge des täglichen Lebens zusammen – während der Vater seine knapp bemessene Invalidenrente vertrank.
Kurz nach ihrer Konfirmation hatte Janne ihrer Freundin Liv verkündet, dass sie ihren Heimatort verlassen würde. Dank ihres guten Abschlusszeugnisses hatte sie eine Stelle im Telegrafenamt von Egersund bekommen. Liv hatte sich für sie gefreut und sich zugleich beschämt eingestanden, dass sie neidisch war. Was hätte sie darum gegeben, wie Janne fortzugehen! Sich wie diese mit zwei Kolleginnen eine Wohnung zu teilen, über ihr Gehalt verfügen zu können, sich ab und zu kleine Freuden zu gönnen, an Sonntagen nicht arbeiten zu müssen und stattdessen Ausflüge zu unternehmen oder Zeit zum Lesen zu haben.
Liv verscheuchte die Bilder von Jannes sorglosem Leben, in dem es freie Tage, Tanzveranstaltungen und andere Vergnügungen gab. Der Pfarrer hatte recht. Der Gedanke an die hungrigen Augen in den hohlwangigen Gesichtern ihrer Geschwister, die sich abends selten mit gefüllten Mägen auf ihre Strohsäcke legten, ließ den Wunsch nach Ungebundenheit und weniger Verantwortung selbstsüchtig erscheinen. In einer der Konservenfabriken, die seit einigen Jahren Stavangers Wirtschaft ankurbelten und in denen man gern Frauen beschäftigte, würde sie in langen Schichten im Akkord schuften und sich mit einem Bruchteil des Geldes begnügen müssen, das den Männern für die gleiche Tätigkeit bezahlt wurde. Als Hausmädchen musste sie nicht für Kost und Logis aufkommen, würde mit abgelegten Kleidungsstücken ihrer Herrin versorgt und durfte bei gutem Betragen mit Zuwendungen zu Weihnachten und Geburtstagen rechnen. So würde sie in der Lage sein, ihren gesamten Lohn nach Hause zu schicken – wie es ihre Mutter von ihr erwartete.
Als Liv sich an diesem Morgen lange vor Sonnenaufgang angezogen hatte – im Licht einer Tranfunzel, die den einzigen Raum der Kate kaum erhellte –, war Ruth Svale zu ihrer ältesten Tochter getreten, die zum ersten Mal allein in die Fremde ging.
»Sie werden dir deinen Lohn wöchentlich auszahlen und nicht nur zweimal im Jahr an den flyttedager, wie es eigentlich üblich ist«, hatte sie mit gesenkter Stimme und einem ängstlichen Blick auf ihren Mann, der sich im Schlaf unruhig hin und her wälzte, gesagt. »Pfarrer Nylund hat das mit deinem Dienstherrn ausgehandelt. Dann kannst du mir das Geld immer gleich montags per Postanweisung schicken. An mich! Hörst du! Nur ja nicht an ihn. Er würde es doch nur sofort ins Wirtshaus tragen.«
Liv hatte stumm genickt und die Tränen hinuntergeschluckt, die ihr in die Augen schossen. Sie hatte sich so sehr nach einer Umarmung, einem lieben Wort gesehnt, das ihr den Abschied leichter gemacht, ihr gezeigt hätte, dass ihre Mutter sie vermissen würde.
Doch diese hatte nur auf die Tür gedeutet. »Und nun geh mit Gott! Sei gehorsam und mach uns keine Schande.«
Noch bevor Liv die Hütte verlassen hatte, hatte sich Ruth Svale umgewandt und war wieder zum Ofen geeilt, um den dünnen Haferbrei umzurühren, den es zum Frühstück geben würde.
Beim Gedanken an eine Schale mit warmer Grütze zog sich Livs Magen zusammen. Ob man ihr wohl etwas zu essen anbieten würde, bevor sie mit der Arbeit beginnen musste? Liv streifte ihre rechte Holzpantine ab, schüttete ein Steinchen heraus, das sich hinein verirrt hatte, schulterte ihr Bündel und lief zügig weiter zum Ortskern. Der älteste Teil von Stavanger lag in ihrer Laufrichtung unten am Vågen, einer Bucht, die durch die Halbinsel Holmen geschützt wurde und Schiffen seit alters einen sicheren Hafen bot. Im Nordosten breiteten sich am Østre Havn die neueren Stadtteile aus, mit schmucken Holzhäusern, dem Fischmarkt und mehreren Werften, Werkstätten und Fabriken.
Livs bloße Füße waren nach dem Marsch wundgescheuert. Sie war es nicht gewohnt, stundenlang zu laufen. Die vergangenen Monate hatte sie nahezu vollständig zu Hause verbracht – von frühmorgens bis spät in die Nächte hinein über die Näharbeiten gebeugt. Sehnsüchtig schaute sie zu den Schienen, die im Licht der Morgensonne glänzten. Sie stellte es sich herrlich vor, in einem Waggon der Jæderbanen zu sitzen und sich binnen einer halben Stunde von ihrem Heimatort Sandnes, der gut fünfzehn Kilometer südlich am Ende des Gandsfjords lag, zur Provinzhauptstadt an dessen Mündung fahren zu lassen. Ob sie sich jemals die vierzig Øre würde leisten können, die ein Billett für die dritte Klasse auf dieser Strecke kostete? Liv schüttelte den Kopf. Nein, das entsprach in etwa dem Tageslohn, den ihr die Treskes zahlen würden. Undenkbar, das Geld für einen Luxus wie eine Zugfahrt zu verplempern.
Liv passierte den Friedhof und sah den Bahnhofsplatz vor sich. Dahinter machte sie einen Teich und einen Park aus, über dem sich die mächtige Silhouette der Domkirche erhob. Im Hintergrund glitzerte das Wasser des Fjords, in dem mehrere Inselchen lagen. Liv rief sich die Wegbeschreibung von Pfarrer Nylund ins Gedächtnis und bog nach dem Theater in den Løkkeveien ein, der sie wieder aufwärts führte – vorbei an einem großzügigen Gartengrundstück mit Villa zu einem kleinen Friedhof. Von dort ging es nach links auf einem Feldweg weiter, über den sie in kaum bebautes Gelände gelangte. Kurz nachdem sie an einem geweißelten Holzhaus mit Säulenveranda vorbeigelaufen war, sah sie diesem schräg gegenüber am Ende einer großen Wiese ihr Ziel vor sich: das Anwesen der Missionsschule von Stavanger.
Blickfang war ein stattliches zweistöckiges Gebäude inmitten eines Gartens, dessen zahlreiche Apfelbäume in voller Blüte standen. In die Längsseite des Daches war ein breiter Zwerchgiebel mit drei Fenstern eingelassen, auf dessen First ein großes Kreuz befestigt war. Liv verengte die Augen und entzifferte die Worte, die in die Außenleisten der Schrägen unter dem Kreuz geschnitzt waren:
Gaar ud i al verden og prædiker Evangelium for al Skabningen.
Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur.
Etwas abseits hinter dem Hauptgebäude machte sie neben Stallungen, einer Scheune und mehreren Schuppen ein kleineres Haus aus, in dem laut Pfarrer Nylund Oddvar Treske, der zweite Lehrer der Schule, mit seiner Familie wohnte. Der Direktor, der ebenfalls unterrichtete, war im Schulhaus untergebracht.
Liv spürte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. In wenigen Augenblicken würde ihr neues Leben als Dienstmädchen beginnen. Sie schloss kurz die Augen.
»Lieber Gott, ich fürchte mich so!«, flüsterte sie. »Was, wenn sie nicht zufrieden mit mir sind? Was, wenn sie mich davonjagen? Bitte, lieber Gott, steh mir bei.«
Der fröhliche Gesang einer Mönchsgrasmücke unterbrach ihr Stoßgebet. Liv öffnete die Augen und erspähte den hellgrauen Vogel mit der schwarzen Kappe, der auf dem obersten Ast eines Holunderstrauchs saß und aus voller Kehle sein Lied hinausschmetterte. Sie lächelte und beschloss, diese Begrüßung als gutes Vorzeichen zu nehmen. Sie umrundete den eingezäunten Garten, hielt kurz an der Schmalseite der Schule vor einem Fenster inne und prüfte in der Spiegelung der Scheibe, ob sie ordentlich aussah. Unter den dichten Brauen blickten ihr ihre grauen Augen fragend und ein wenig ängstlich entgegen. Das schnelle Gehen hatte einen rosigen Hauch auf ihre Haut gezaubert, die während der Wintermonate blass und fahl geworden war. Aus ihrem Zopf hatte sich eine dunkelblonde Haarsträhne gelöst, die sie sich hinters Ohr strich. Liv sah an sich hinunter und zog die Schürze glatt, die sie über einem dunkelblauen Kattunkleid trug. Es war ausgeblichen, mehrfach geflickt und an den Armen ein wenig zu kurz. Auch das Wolltuch, das sie gegen die morgendliche Kühle umgelegt hatte, hatte schon bessere Tage gesehen.
Als sie sich gerade von dem Fenster abwenden wollte, fiel ein Sonnenstrahl ins Innere und ließ ein seltsames Gebilde matt aufleuchten. Liv trat näher, beschattete ihre Augen und spähte durch die Scheibe. Auf einem Tischchen stand ein riesiges Ei. Es war mindestens so hoch wie ihr Unterarm und hatte einen gewaltigen Durchmesser. Daneben stand ein weiteres Ei, das ebenfalls sehr viel größer als jedes Hühner- oder Entenei war, das Liv jemals gesehen hatte, sich im Vergleich zu dem anderen jedoch klein ausnahm. Während sich Liv fragte, welche Ausmaße die dazugehörigen Vögel wohl besaßen, wanderten ihre Augen weiter. Das Zimmer beherbergte ein – in ihren Augen willkürlich zusammengewürfeltes – Sammelsurium unterschiedlichster Gegenstände. Neben einem tragbaren Klappaltar hing an einer Wand ein Mantel aus schimmernder Seide, der mit Drachen und floralen Mustern bestickt war. In einem Regal lagen ein geflochtener Gürtel, an den Muscheln genäht waren, ein Halsband mit Silberornamenten, die Liv an Bärenklauen erinnerten, geschnitzte Holzlöffel, einfache Tonschalen und ein aus Bast gefertigter Fächer. In einer Ecke standen mit Tierhäuten bespannte Trommeln in verschiedenen Größen und meterhohe Bambusröhren, an denen dünne Metallsaiten befestigt waren.
»Hier treibst du dich herum! Was hast du da zu suchen?«
Der Klang der scharfen Stimme ließ Liv zusammenzucken. Schlechter hättest du dich gar nicht bei deiner neuen Herrschaft einführen können, schoss es ihr durch den Kopf. Noch bevor du die Stelle überhaupt angetreten hast, halten sie dich schon für eine Trödelliese. Sie holte tief Luft und drehte sich um. Kein Mensch war zu sehen.
»Wie kommst du dazu, das Haus zu verlassen?«, fuhr die Stimme fort.
Liv wurde flau vor Erleichterung. Sie war nicht gemeint! Der unsichtbare Sprecher musste sich irgendwo hinter der Missionsschule befinden und hatte sie gar nicht bemerkt.
»Du weißt ganz genau, dass du noch drei Tage Arrest hast! Wie kannst du es bloß wagen …«
»Es tut mir leid«, antwortete eine helle Stimme. »Aber ich musste …«
»Gar nichts musst du! Außer gehorchen!«
Der schneidende Ton jagte Liv einen Schauer über den Rücken. Wer wurde da so streng gescholten? Auf Zehenspitzen lief sie zur Ecke des Schulgebäudes und spähte auf den Platz dahinter. Vor einem Schuppen neben dem Lehrerhaus entdeckte sie einen mittelgroßen Mann in dunklem Anzug. Das musste Oddvar Treske sein. Er war um die fünfzig Jahre alt, hatte kurz geschorene graue Haare und ein rundliches Gesicht. An seiner Schläfe war eine Ader bläulich angeschwollen, seine Stirn war in tiefe Falten gelegt, und seine Augen waren auf den etwa neunjährigen Jungen heftet, der vor ihm stand. Dieser trug einen beigen Russenkittel mit rotem Gürtel und kurze Hosen, die den Blick auf verschorfte Knie und zerkratzte Schenkel freigaben. Seine dunklen Locken waren verstrubbelt. Als spiegelten sie den Widerstandsgeist, der aus seinen einen Tick zu weit auseinanderstehenden Augen sprach.
»Es ist wirklich wichtig, Vater!«, sagte er.
Oddvar Treskes Miene verfinsterte sich noch mehr. Er fasste den Jungen an der Schulter.
»Schluss damit, Elias! Geh sofort hinein!«
»Aber es geht um Leben und Tod!«, rief Elias und riss sich los.
Der Mann holte aus und versetzte ihm eine Ohrfeige, die den Kleinen ins Wanken brachte. »Ich werd dir die Flausen schon noch austreiben!«, schrie er, packte den Jungen am Arm und zerrte ihn zum Haus.
Liv schaute ihnen mit vor Schreck geweiteten Augen nach. Sie hatte sich eine Faust vor den Mund gepresst, um den Aufschrei zu ersticken, der ihr beim Anblick des Hiebs zu entfahren drohte. Ihr war, als würde ihre eigene Wange brennen, als hätte sie selbst die Hand des Mannes zu spüren bekommen. Dem Akt hatte eine Brutalität und Kälte innegewohnt, die sie tief erschütterten. Sie selbst war Schläge gewöhnt. Ihrer Mutter rutschte immer wieder einmal die Hand aus, wenn ihr eines der Kinder im Weg war, etwas verschüttet oder zerbrochen hatte oder sich mit seinen Geschwistern zankte. Bei schweren Vergehen wurde der Vater eingeschaltet, der dem Übeltäter ein paar Streiche mit einer Rute verpasste. Liv hatte diese Bestrafungen wie Unwetter über sich ergehen lassen – es hatte keinen Zweck, sich dagegen aufzulehnen. Instinktiv hatte sie immer gespürt, dass ihre Mutter aus Überforderung und Erschöpfung die Hand gegen ihre Kinder erhob. Ihre Schläge schmerzten nur an der Oberfläche. Im Gegensatz zu der Ohrfeige, die der Junge eben bekommen hatte. Warum hatte er diese Bestrafung riskiert? Was war so wichtig, dass er seinen Stubenarrest missachtete und den Groll seines Vaters in Kauf nahm?
Liv sah zu dem Schuppen, vor dem Oddvar Treske seinen Sohn zur Rede gestellt hatte. Die Tür stand einen Spalt weit offen. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass sie unbeobachtet war, huschte sie über den Platz und schlüpfte in den Verschlag. Ein muffiger Geruch schlug ihr entgegen. Nachdem sich ihre Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sah sie rechts neben dem Eingang Gießkannen, Rechen, Schaufeln, Hacken und andere Gartenwerkzeuge. Links waren Brennholzscheite gestapelt. Im hinteren Teil türmten sich entzweigegangene Geräte und andere ausrangierte Dinge – der ideale Platz für ein Versteck. Ein Geräusch lenkte Livs Aufmerksamkeit auf eine Kiste, die halb verborgen von einem leeren Gurkenfass und einem Stapel zusammengefalteter Kartoffelsäcke auf dem Boden stand. Sie beugte sich darüber und sah in ein kleines Auge, das ihr aus einem zerzausten Federbündel hellblau entgegenleuchtete. Es war eine Dohle. Der bräunlichen, matten Färbung des Gefieders nach zu schließen, eine sehr junge.
Wieder gab der Vogel ein klagendes Fiepen von sich.
»Wie kommst du denn hierher?«, fragte Liv leise.
Ihr Blick fiel auf einen der Flügel, den der Vogel abspreizte. Die Schwungfedern fehlten oder waren zerfetzt.
»Oh weh, bist du einer Katze in die Krallen geraten?«, murmelte Liv. »Und Elias hat dich gerettet und hier versteckt.« Vermutlich hatte er seinen Pflegling füttern wollen, als der Vater ihn überraschte. Neben der Kiste entdeckte Liv ein Einweckglas mit Brotstückchen, Apfelschnitzen und winzigen Fleischbrocken. Sie schraubte es auf und hielt der Dohle einen Bissen hin. Im Nu verschwand der Inhalt des Glases im Schnabel des Vogels. Anschließend flößte ihm Liv ein paar Schlucke Wasser ein, das in einer Flasche bereitstand. Elias hatte an alles gedacht. So, wie Gøran es getan hätte. Vor das Gesicht des fremden Jungen schoben sich die vertrauten Züge ihres Bruders, der sich mit Hingabe um alles Getier gekümmert hatte, das seiner Hilfe bedurfte. Liv schluckte. Wie Gøran jetzt wohl ausgesehen hätte? Dreizehn Jahre wäre er diesen Sommer geworden. Liv verscheuchte das Bild des windschiefen Holzkreuzes, unter dem ihr Lieblingsbruder seit drei Jahren begraben lag.
Liv erhob sich. Die Dohle sah mit schief gelegtem Kopf zu ihr auf.
»Ich muss dich jetzt leider allein lassen«, sagte Liv leise. »Aber ich komme wieder, sobald ich kann, versprochen.«
2
Schlesien, April 1905 – Karoline
»So konnte sie ungestört dasitzen und in die Stille hinausträumen, die bläulichklare, sternhelle Wüstennacht, die ringsum, als sei man auf hoher See, in das Dämmernde, Grenzenlose verschwamm. Die Reihen der Sanddünen hatten jetzt nicht mehr das Wilde, Fahle, die Senkungen der Salztümpel nicht mehr das geisterhaft Weiße und Unheimliche wie unter den sengenden, unerbittlichen Strahlen der Sonne. Die Milde des Mondes verklärte alles. Sie löste die harten, trotzig und unvermittelt nebeneinander stehenden Farbtöne des Tages – diesen Dreiklang vom Blau des Himmels und Gelb des Sandes und Weiß des Salzes, der dort in tiefdunklen Schatten über die Öde wob, ihre Unfruchtbarkeit verhüllte, ihre Furchtbarkeit dämpfte und aus dem, was unter dem Schein der Sonne ein Reich des Todes war, in der stillen Nacht ein geheimnisvolles Traum- und Zauberland machte.«
Karoline ließ die Zeitschrift auf ihre Knie sinken, schloss die Augen und versuchte sich vorzustellen, wie die Wüste aussah, wie sich sengende Hitze anfühlte, wie es war, wenn der Mund austrocknete und ein Schluck Wasser das Köstlichste war, was man sich nur wünschen konnte. Seit Januar begleitete sie nun Gerta, die Heldin von Rudolf Stratz’ Roman »Die Hand der Fatme«, der in Fortsetzungen in der »Gartenlaube« gedruckt wurde. Jede Woche fieberte sie dem Erscheinen der nächsten Ausgabe entgegen, um die Geschicke der jungen Adligen weiter zu verfolgen. Gerta, die unter falschem Namen nach Tunesien gereist war, um ihren Bruder zu suchen, war Karoline in den vergangenen Monaten eine vertraute Freundin geworden, mit der sie zuweilen innere Zwiesprache hielt.
Mit ihren zweiundzwanzig Jahren war die Romanfigur zwar vier Jahre jünger als Karoline, nahm sich in deren Augen jedoch um Längen selbstbewusster und mutiger aus als sie selbst. Nie im Leben würde sie sich getrauen, gegen den Willen ihrer Familie mutterseelenallein in die Fremde zu reisen, noch dazu in ein Land, wo an jeder Ecke Gefahren lauerten – nicht nur für Leib und Leben. Gerta wandelte mit ihrem unkonventionellen Verhalten auf einem schmalen Grat zwischen Ehrbarkeit und dem Verlust ihres guten Rufs. Sie hatte ihrem Verlobten, einem eingebildeten Schnösel, der sie von oben herab behandelte und sich nicht um die Gefühle anderer scherte, den Laufpass gegeben. Gertas Unerschrockenheit imponierte Karoline. Dabei kannte die Romanheldin durchaus auch Momente, in denen sie verzagte und am liebsten aufgegeben hätte. Doch der Gedanke an Frank, den verwegenen Abenteurer, den sie in der Sahara kennen- und lieben gelernt hatte, gab ihr stets neue Kraft und Zuversicht.
Karoline öffnete die Augen. Ja, mit einem Mann wie Frank ben Salem an der Seite mochte es wohl leicht für eine Frau sein, Stärke zu beweisen und unbeirrt ihren Weg zu gehen. Einem Mann, der an sie glaubte, sie mit Respekt behandelte und ihr ritterlich zu Hilfe eilte, wenn sie in der Patsche saß.
Ein kühler Luftzug ließ Karoline erschauern und verwehte die Bilder von der lauen Wüstennacht, in die sie beim Lesen eingetaucht war. Das Rascheln der Palmenblätter wurde vom Rauschen des Regens übertönt, der seit zwei Tagen ohne Unterlass niederging. Karoline stand auf und ging zum Fenster, das eine Böe aufgedrückt hatte. Bevor sie es schloss, warf sie einen Blick zum Himmel. Dunkel lastete er dicht über den Bäumen des Parks, der sich hinter dem Herrenhaus ausbreitete, das seit neun Jahren ihr Zuhause war. Die Wolkendecke war lückenlos, kein Lichtstreif erhellte das Grau. Aus südlicher Richtung, vom Riesengebirge her, tönte dumpfes Donnergrollen. Das trübe Dämmerlicht verriet nicht, wie weit der Tag fortgeschritten war. Der Geruch feuchten Mauerwerks drang in Karolines Nase, gemischt mit dem herben Duft des Efeus, der an der Rückseite von Schloss Katzbach emporrankte. Sie drückte die Fensterflügel fest in den Rahmen und legte den Riegel um. Er hatte zu viel Spiel und würde sich beim nächsten starken Windstoß erneut lösen. Auch die Scharniere der Fenster und Läden waren ausgeleiert und vom Rost zerfressen. Sie gehörten längst repariert oder durch neue ersetzt. Wie so vieles in diesem Haus.
Mitte des achtzehnten Jahrhunderts war das Schloss von einem Vorfahren ihres Schwiegervaters auf einer Anhöhe im Katzbachtal erbaut worden – ein paar Kilometer nördlich der kleinen Kreisstadt Schönau. Der zweigeschossige Bau hatte einen rechteckigen Grundriss und ein Mansarddach, unter dem sich Speicherräume und die Kammern für die Dienstboten befanden. Die Eingangstür auf der zum Tal hin gelegenen Frontseite wurde von einem Säulenportal überwölbt, in dessen Giebel das Wappen der Familie eingefügt war: ein roter Hirsch auf grünem Grund, der über drei gewellte, blaue Linien sprang. An der südlichen Flanke erhob sich ein runder Turm mit Spitzdach. Stallungen, Scheunen und Remisen lagen – von einigen alten Buchen verborgen – im Norden des Schlosses auf halbem Weg nach Moritzwaldau, einem kleinen Weiler, in dem von jeher die Bauern und Handwerker lebten, die die gräflichen Güter bewirtschafteten.
Karoline kehrte zu dem Sofa vor dem Kachelofen zurück. Es war – wie die beiden Sessel, die ihm gegenüberstanden – aus hellem Kirschholz und mit einem altrosa-beige gestreiften Satinstoff bezogen. Das Ensemble stammte wie das runde Tischchen, der verglaste Bücherschrank und der Sekretär aus ihrem Jungmädchenzimmer im Breslauer Haus ihrer Eltern. Das Bett und die Waschkommode im angrenzenden Schlafgemach dagegen hatte sie zur Hochzeit als Teil ihrer Mitgift erhalten, ebenso die Ausstattung ihrer beiden Zimmer mit zartfarbenen Seidentapeten und zierlichen Glasleuchtern, die von der Decke hingen. Sie setzte sich, streifte ihre Pantoffeln ab, schlug ihre Beine unter den Rock ihres Hauskleides und vertiefte sich wieder in ihre Lektüre.
»Die Einsamkeit der Wüste … Allmählich fing Gerta in diesen Tagen an zu verstehen, warum einer die Menschen mied und in der Wildnis lebte, um sich selber zu finden.
So ähnlich ging es ihr jetzt. Manchmal war ihr, als sei sie nun erst recht zum Leben aufgewacht und habe bis dahin ihre Tage so hingebracht, ohne es zu wissen.«
Ein Klopfen an der Tür schreckte Karoline auf. Sie verbarg die »Gartenlaube« unter einem der Sofakissen, setzte sich aufrecht hin und schlüpfte in ihre Hausschuhe. Dabei warf sie einen Blick auf die kastenförmige Tischuhr aus Messing, die auf dem Bücherschrank stand. Hatte sie die Zeit vergessen und versäumt, sich rechtzeitig zum Abendessen umzuziehen? Es wäre nicht das erste Mal, dass ihre Zofe Agnes sie daran erinnern musste und verhinderte, dass Karoline zu spät im Speisesaal erschien. Nein, es war erst vier Uhr nachmittags. Sie atmete tief durch und rief: »Herein!«
Beim Anblick ihrer Schwiegermutter, die über die Schwelle trat und drei Schritte vor ihr stehen blieb, zog Karoline unwillkürlich den Kopf zwischen die Schultern. Die Gräfin strahlte eine Energie und Tatkraft aus, die sie jünger als ihre sechzig Jahre wirken ließ. Ihre hellen Augen, die sie unverwandt auf ihr Gegenüber zu richten pflegte, flößten Karoline Unbehagen ein. Sie ertappte sich wie so häufig bei der Frage, ob sie etwas getan oder unterlassen hatte, was den Unwillen von Alwina von Blankenburg-Marwitz erregt haben konnte.
Sei nicht albern, ermahnte sie sich. Du bist kein kleines Schulmädchen mehr, sondern eine erwachsene Frau. Also benimm dich auch so! Denk an Gerta. Sie würde sich nie so einschüchtern lassen. Karoline erhob sich. Neben der sehnigen Gestalt ihrer Schwiegermutter, die sie um einen halben Kopf überragte, kam sie sich stets besonders klein und pummelig vor. Alles an ihr wirkte weich und rund im Gegensatz zu den kantigen Formen der Gräfin, die Karoline an eine geschnitzte Märtyrerfigur aus dem Mittelalter erinnerte. Die Falten um Mund und Augen waren wie eingekerbt, die Gliedmaßen knochig. Selbst ihr ergrautes Haar sah aus, als wäre es aus Draht.
»Entschuldige, wenn ich dich – bei was auch immer – störe«, sagte Gräfin Alwina. Sie schaute mit stummem Vorwurf zu dem Nähkorb, der unter dem Sofa verstaubte, wohin ihn Karoline Wochen zuvor mit einem Fußtritt befördert hatte. »Ich wollte dich nur in Kenntnis setzen, dass mein Sohn in Kürze eintreffen wird.«
Karoline zog die Augenbrauen hoch. »In Kürze?«
»Mit dem Abendzug.«
»Heute? Aber ich dachte …«, begann Karoline. Die steile Falte, die sich auf der Stirn ihrer Schwiegermutter bildete, ließ sie den Rest des Satzes verschlucken. …dass Moritz noch mindestens bis zur Eröffnung der Rennsaison in Berlin bleibt, hatte sie sagen wollen. Sie räusperte sich. »Wie freundlich«, fuhr sie, um Fassung bemüht, fort, »dass du dich eigens her bemühst, um mir das mitzuteilen.«
Und nicht einen Diener damit beauftragt hast, fügte sie im Stillen hinzu. Damit nur ja der schöne Schein gewahrt bleibt und keiner merkt, dass ich keinen Schimmer habe, was mein Gatte so treibt und wann er beliebt, sich hier blicken zu lassen. Ganz zu schweigen davon, dass er keinen Wert auf meine Begleitung legt. Dabei wissen doch alle vom Stalljungen bis zum Gutsverwalter, wie es um meine Ehe bestellt ist.
Die Gräfin warf ihr einen kühlen Blick zu. »Nun, es schien mir angebracht. In dem Aufzug«, sie musterte Karolines einfachen Zopf und das kaum taillierte Kleid mit Abscheu, »willst du ihn gewiss nicht begrüßen. So hast du noch Gelegenheit, dich zurechtzumachen. So gut es eben geht.«
Der verächtliche Ton machte Karolines Vorsatz zunichte, sich nicht verunsichern zu lassen. Sie senkte den Kopf. Was war gegen das Tragen bequemer Kleidung in den eigenen vier Wänden einzuwenden? Wozu sollte sie sich an Tagen, an denen kein Besuch erwartet wurde, aufwendige Frisuren machen lassen, die außer dem Personal und ihren Schwiegereltern niemand zu Gesicht bekommen würde?
»Ich begreife nicht, wie man sich derart gehen lassen kann. Kein Wunder, dass du meinen Sohn nicht hier halten kannst. Wenn du ihm wenigstens ein Kind …« Die Gräfin unterbrach sich selbst mit einem unwilligen Schnauben und verließ das Zimmer.
Karolines Hals wurde eng. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten, starrte auf die Stelle, an der ihre Schwiegermutter eben noch gestanden hatte, und dachte: Es ist so ungerecht! Als ob sich Moritz je auch nur im Geringsten um mich geschert hätte. Als ob er mir mehr Beachtung schenken würde, wenn ich mich auftakeln und nach dem letzten Schrei der Pariser und Berliner Modehäuser richten würde. Für ihn bin ich ein notwendiges Übel, das er vergisst, sobald er Schloss Katzbach den Rücken kehrt. Und da er so gut wie nie hier ist, spiele ich in seinem Leben allenfalls eine Statistenrolle. Ach, wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte! Nie im Leben hätte ich ihm mein Jawort gegeben, wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet.
Die Wochen vor der Hochzeit waren für Karoline im Nachhinein betrachtet die glücklichsten ihres bisherigen Lebens gewesen. Wobei sich in die Vorfreude auf ihr Dasein als Gräfin zunehmend ein banger Ton geschlichen hatte: die Furcht vor dem ominösen Geschlechtlichen, das sie erwartete. Bis kurz vor der Heirat hatte Karoline keine Vorstellung davon gehabt, was sie in der Hochzeitsnacht erwartete. Ihre Mutter hatte sie am Abend vor der Trauung beiseitegenommen und ihr mit einem verlegenen Lächeln das Büchlein »Die eheliche Pflicht« von Dr. Karl Weißbrodt in die Hand gedrückt, aus dem sie alles Wissenswerte erfahren würde. Mit klopfendem Herzen hatte Karoline den größten Teil ihrer letzten Nacht als Jungfrau mit der Lektüre dieses ärztlichen Führers »zu heilsamem Verständnis und notwendigem Wissen im ehelichen Leben« verbracht, dessen Autor in vierzehn Kapiteln die religiösen, wissenschaftlichen und praktischen Gesichtspunkte dieses »heiklen Gegenstandes« beleuchtete. Am Morgen hatte sich Karoline verstört eingestanden, dass sie die in ihren Kreisen übliche Scheu nachvollziehen konnte, über dieses Thema zu sprechen. Ihre Fantasie von zwei liebenden Seelen, die sich zärtlich und rücksichtsvoll miteinander vereinigten – was auch immer man sich darunter genau vorzustellen hatte –, war in Stücke geschlagen. Vor allem die fortwährende Betonung, dass sich die Frau dem Willen des Mannes vollständig unterzuordnen hätte, war ernüchternd gewesen. Noch Jahre später hatte Karoline die betreffenden Passagen im Kopf:
»Im Sinne des göttlichen Wortes … dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, und er soll dein Herr sein. Ist es der Mann, dessen Wille allein entscheidend ist für die Vornahme des Begattungswerkes. Beim weiblichen Geschlechte ist dieser Trieb in der Regel weit weniger entwickelt als beim männlichen. Nach hausärztlicher Erfahrung tritt bei verheirateten Frauen das geschlechtliche Verlangen meistens erst längere Zeit nach Beginn des Ehelebens, gewöhnlich erst nach einer oder mehreren Entbindungen ein. Bis dahin gibt sich die Frau dem Manne mehr aus Pflichtgefühl als aus eigenem Verlangen hin; manche Frauen empfinden geradezu Widerwillen gegen den ehelichen Akt, und wenn sie ihn dennoch zulassen, so erfüllen sie nur das Gebot des Herrn, das sie heißt, dem Manne untertänig zu sein.«
Der Verfasser hat recht, dachte Karoline und ließ die Schultern hängen. Ich ahne nicht einmal im Entferntesten, was an der Sache schön sein soll. Ihre schlimmsten Jungmädchen-Befürchtungen, was ihr Mann kraft des Eheversprechens mit ihr anstellen durfte, kamen ihr im Rückblick lächerlich vor. Es verletzte zwar nach wie vor ihr Schamgefühl und mutete sie unanständig an, an Stellen berührt zu werden, von denen ein wohlerzogenes Mädchen im Grunde gar keine Kenntnis haben sollte. Es ließ sich aber aushalten, war in der Regel rasch vorbei und in den letzten Jahren immer seltener vorgekommen.
Demütigend dagegen war die unverhohlene Missachtung, mit der Moritz sie behandelte. Er war nie unhöflich oder beleidigend, ging aber jeder vermeidbaren Begegnung unter vier Augen aus dem Weg. Bereits in der Hochzeitsnacht hatte er seine eigenen Gemächer aufgesucht, nachdem er seiner ehelichen Pflicht nachgekommen war. In den darauffolgenden Wochen hatte Karoline sich bemüht, seine Aufmerksamkeit zu erregen, im Gespräch interessante Themen anzuschneiden oder gemeinsame Unternehmungen vorzuschlagen. Moritz hatte ihre Versuche mit freundlichen Floskeln im Keim erstickt, wenn er sie überhaupt zur Kenntnis nahm. Nächtelang hatte sich Karoline den Kopf zermartert, was sie falsch machte und warum Moritz sich von ihr zurückzog.
Den Grund dafür hatte sie an einem lauen Sommerabend noch im Jahr ihrer Hochzeit erfahren. Sie hatte sich nach dem Dinner in ihre Zimmer zurückgezogen und saß lesend am offenen Fenster. Moritz hatte einen alten Kameraden aus seiner Zeit beim Regiment in Ratibor zu Besuch, mit dem er auf der Terrasse hinter dem Haus noch eine Flasche Wein leerte. Eine Weile hatte Karoline ihre Unterhaltung nur als gedämpftes Gemurmel wahrgenommen. Der Alkohol schien die Zungen zu lösen, die Stimmen wurden lauter und drangen schließlich gut verständlich zu ihr hinauf.
»Verrätst du mir, warum zum Teufel du dir diesen Klotz ans Bein gebunden hast? Es sieht ja ein Blinder, dass du dir nichts aus ihr machst.«
Die Frage des Freundes hatte Karoline erstarren lassen.
Moritz hatte bitter aufgelacht und geantwortet: »Meine Eltern hatten mir die Wechsel gesperrt und darauf bestanden, dass ich eine gute Partie mache. Dass es Karoline geworden ist … nun, ihr Vater hat die höchste Mitgift geboten. Und ist für meine Schulden aufgekommen.«
»Verstehe, sie ist dein Goldeselchen«, hatte der Kamerad gerufen und mit einem Lachen hinzugefügt: »Ihr Vater muss ja mächtig reich sein. Nicht jeder könnte sich einen Schwiegersohn wie dich leisten.«
Die Erinnerung an die Scham, die sie in jener Nacht am Fenster verspürt hatte, trieb Karoline erneut das Blut ins Gesicht. Wie naiv sie gewesen war! Geblendet von dem schneidigen Offizier in seiner schmucken Husarenuniform, der ihr so galant den Hof gemacht und das Gefühl gegeben hatte, begehrenswert zu sein. Beflügelt vom Stolz ihrer Eltern, die sich vor Begeisterung überschlugen, dass ihre Tochter die Gunst eines jungen Grafen errungen hatte, dessen Familie dem alten schlesischen Adel angehörte. Geschmeichelt vom Neid ihrer alten Schulfreundinnen, in deren Augen für Karoline ein Mädchentraum in Erfüllung ging: die märchenhafte Verwandlung einer unbedeutenden Bürgerlichen in eine angesehene Frau von Stand, die ein rauschendes Leben auf einem Schloss führen und in den besten Kreisen verkehren würde.
Wie bitter war die Realität, in der sie gelandet war! Die Einsamkeit, zu der Moritz sie verdammte. Die Nutzlosigkeit ihrer Existenz, die Eintönigkeit, mit der ihre Tage dahingingen. Sie war ein geduldetes Übel, ein Fremdkörper in seiner Familie, die keinen Hehl daraus machte, wie gering sie ihre Herkunft als Tochter eines Industriellen schätzte. Schloss Katzbach war ihr Gefängnis, bewacht von ihren Schwiegereltern, die ihr die Schuld dafür gaben, dass sie keinen Enkel auf ihren Knien schaukelten. Nach dem frühen Tod von Moritz’ älterer Schwester, die an Schwindsucht gelitten hatte, ruhten alle diesbezüglichen Hoffnungen auf ihm. Seine jüngere Schwester hatte sich von der Welt abgekehrt und führte als Kanonissin ein zurückgezogenes Leben in einem Stift für adlige Fräulein.
Karoline presste ihre Lippen aufeinander und wappnete sich innerlich gegen die Spitzen, die ihre Schwiegermutter regelmäßig wegen ihrer Kinderlosigkeit abschoss, wenn ihr Sohn – selten genug – nach Hause kam. Ob sie jemals darüber nachgedacht hat, dass sie ihn mit ihren Vorwürfen verprellt?, fragte sich Karoline. Nun, ich werde dem alten Drachen heute zumindest keine Munition liefern und mich ordentlich in Schale werfen. Das wäre doch gelacht!
Sie ging hinüber in ihr Schlafzimmer und stellte sich vor den Spiegel, der über der Waschkommode an der Wand hing. Sie seufzte auf. Ihre Zuversicht schwand. Sie war einfach keine Schönheit. Schon als junges Mädchen hatte sie mit der feinen Beschaffenheit ihrer dunklen Haare gehadert und ihre Freundin Ida um deren üppige Lockenpracht beneidet. Während diese unzählige Kämme, Nadeln und Spangen benötigte, um ihre Haare in einen ansehnlichen Dutt zu bändigen, reichten für Karolines dünnen Zopf drei Klämmerchen. Ihre Wangen waren eine Spur zu füllig, ihre Nasenflügel etwas zu breit, und ihre braunen Augen zu rund, um dem gängigen Ideal eines herzförmigen Gesichts mit mandelförmigen Augen und ausgewogenen Proportionen zu entsprechen. Wenigstens ist deine Haut rein, versuchte sie sich zu trösten. Und du hast hübsche Hände, das hat zumindest deine Klavierlehrerin immer behauptet. Karoline zuckte mit den Schultern, drehte sich vom Spiegel weg und öffnete den Kleiderschrank, der neben einem Paravent dem Bett gegenüber an der Wand stand.
Was soll ich nur anziehen?, dachte sie. Am liebsten würde ich mich entschuldigen lassen und mich hier verkriechen.
3
Stavanger, April 1905 – Liv
Als Liv gerade an die Tür des Wohnhauses klopfen wollte, wurde diese geöffnet und Oddvar Treske trat heraus. Liv zuckte unwillkürlich zusammen. Er lächelte freundlich.
»Du musst Liv sein, nicht wahr?«, sagte er. »Ich hoffe, du hast gut zu uns hergefunden.«
Liv nickte stumm.
Er hielt ihr seine Rechte hin. »Herzlich willkommen.«
Liv schüttelte seine Hand und murmelte: »Danke sehr.«
Es war seltsam, diese Hand zu berühren, die wenige Minuten zuvor dem kleinen Jungen mit Wucht ins Gesicht geschlagen hatte. Die Höflichkeit, mit der der Missionslehrer sie begrüßte, wollte so gar nicht zu dem Wutausbruch passen, dessen Zeugin sie geworden war.
Oddvar Treske wies zur Tür. »Geh nur hinein. Meine Frau ist oben mit der Kleinen. Die zweite Tür rechts. Ich muss nun hinüber zur Schule, der Unterricht beginnt gleich. Wir sehen uns später beim Essen.« Er nickte ihr zu und eilte über den Hof.
Liv trat in den Hausflur. Direkt links neben der Tür führte eine Treppe ins obere Stockwerk. Rechter Hand befand sich eine Tür mit Milchglasfenster, hinter der sie die Küche vermutete – dem Geruch von frisch gebrühtem Kaffee nach zu schließen, der durch den Spalt über dem Boden drang. Weiter hinten schlossen sich drei weitere Räume an. Die Dielen schimmerten matt und dufteten nach Bohnerwachs, das Geländer der Treppe, die Garderobe und der Holzrahmen des Spiegels, der daneben an der Wand hing, waren auf Hochglanz poliert. Alles atmete Ordnung und Sauberkeit.
Liv stieg nach oben. Die Tür zum zweiten Zimmer stand offen. Sie hielt auf der Schwelle inne – gebannt von dem Bild, das sich ihr bot. Auf einem Schaukelstuhl vor dem Fenster saß eine Frau. In ihren Armen hielt sie ein weißes Bündel, aus dem ein rosiges Gesichtchen leuchtete. Ingrid Treske war über ihr Kind gebeugt, wiegte es hin und her und sang.
Nå ska’ en liten få sova så søtt,vøgga står reie te bånet.Der ska’ en ligga så vart og så bløtt,trygt kan det sova det bånet.Ro, ro, sova så søtt,Guds engel tar vare på bånet.
»Nun soll das Kleine schlafen so süß,die Wiege ist für das Kind gerichtet.Es soll darin liegen so zart und weich,sicher kann das Kind schlafen.Ruhe, ruhe, schlafe so süß,Gottes Engel passt auf das Kind auf.«
Die sanfte Melodie, die Zärtlichkeit auf dem Antlitz der Mutter und die Innigkeit, die zwischen ihr und dem Säugling herrschte, berührten Liv tief. Mit angehaltenem Atem lauschte sie dem Lied. Nach einer Weile stand Ingrid Treske auf und ging zu einem Korbbettchen, das in einer Ecke stand. Behutsam legte sie das Kind hinein, drehte sich um und fuhr erschrocken zurück, als sie Liv entdeckte. Sie hatte etwa ihre Größe und hellblondes Haar. Wenn Liv nicht von Pfarrer Nylund erfahren hätte, dass Frau Treske das gleiche Alter wie ihre Mutter hatte, wäre sie nie auf den Gedanken gekommen, dass beide Frauen neununddreißig Jahre alt waren. Ingrid Treske hätte sie um einiges jünger geschätzt. Im Vergleich zu ihr wirkte ihre Mutter mit ihren eingefallenen Wangen, den tiefen Falten, den vom vielen Nähen zerstochenen Händen und ihrer gebeugten Haltung wie eine alte Frau.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte Liv leise. »Ihr Mann sagte mir, dass ich zu Ihnen gehen soll und …«
»Mach dir keine Vorwürfe. Ich bin ein wenig schreckhaft«, unterbrach sie Frau Treske. »Ich freue mich, dass du da bist. Pfarrer Nylund hat dich in den höchsten Tönen gelobt.«
Liv schlug verlegen die Augen nieder. »Hoffentlich enttäusche ich Sie nicht.«
»Das glaube ich nicht. Pfarrer Nylund ist ein guter Menschenkenner. Du findest dich sicher schnell bei uns zurecht«, sagte Frau Treske. »Jetzt zeig ich dir erst mal deine Kammer, damit du deine Sachen ablegen kannst. Und dann führe ich dich durchs Haus und sage dir, welche Aufgaben dich hier erwarten.«
Sie ging Liv voraus zu einer schmalen Stiege, die zum Dachboden führte. Neben einem geräumigen Speicher, der von Holzlatten umgeben war, bot er drei Kammern Platz. Frau Treske öffnete eine der Türen und wies in den Raum. »Momentan wohnst du allein hier oben. Unsere Köchin hat vor Kurzem geheiratet und kommt nur tagsüber ein paar Stunden zu uns. Darüber sind wir sehr froh, denn es ist heutzutage schwer, eine gute Köchin zu finden.«
Liv hörte ihr nur mit halbem Ohr zu. Sie stand in dem kleinen Zimmer, dessen Wände mit einer Blümchentapete beklebt waren. Auf dem Boden lag ein blau-weiß gestreifter Webteppich, das gleiche Muster hatte auch die Tagesdecke, die über das schmale Bett gebreitet war. Ein schlichter eintüriger Schrank, ein Schemel und ein Tisch, auf dem eine Waschschüssel aus Emaille stand, vervollständigten die Möblierung. Über dem Bett war ein Kreuz aus dunklem Holz angebracht, und vor dem Fenster in einer Dachgaube hing ein blauer Vorhang.
Ingrid Treske zog ihn beiseite. Das hereinflutende Licht ließ das Stübchen in Livs Augen noch heimeliger erscheinen. Sie legte sich eine Hand aufs Brustbein, um ihr schnell pochendes Herz zu beruhigen. Ihr erstes Zimmer! Klein und bescheiden zwar, aber nur für sie! Noch nie hatte Liv auch nur ein ungestörtes Eckchen ihr eigen genannt. Ihre Familie teilte sich einen Raum, der kaum dreimal so groß war wie diese Kammer. Darin wurde geschlafen, gekocht, gegessen und gewaschen, es wurden Schulaufgaben gemacht und Hemden genäht.
»… hoffe, du wirst dich hier wohlfühlen«, drang die Stimme von Frau Treske an ihr Ohr.
Liv drehte sich zu ihr und nickte. Sie wollte sich bedanken, ihrer Freude Ausdruck verleihen, brachte jedoch keinen Ton heraus.
»Gut, dann zeige ich dir jetzt den Rest des Hauses«, sagte Frau Treske, als sie wieder im Flur des Obergeschosses standen. »Das Kinderzimmer unserer kleinen Margit kennst du ja schon. Am Ende des Ganges schlafen mein Mann und ich.« Sie deutete auf die Wand auf der den Zimmern gegenüberliegenden Seite. »Hier sind Schränke eingebaut für Bettwäsche, Handtücher, Tischdecken, Servietten und andere Textilien. Außerdem verstauen wir darin im Sommer die dicken Daunendecken, Wollpullover und Mäntel.« Sie zog eine Schublade heraus und reichte Liv eine zusammengefaltete Schürze aus ungefärbtem Leinen. »Die ist für die tägliche Arbeit. Wenn wir Gäste haben und du bei Tisch aufwartest, ziehst du dir bitte eine weiße an.«
Liv nickte und folgte ihr zur Treppe.
»Du wirst morgens als Erste aufstehen, den Küchenherd anfeuern und Wasser zum Waschen und für den Kaffee heiß machen«, erklärte Frau Treske.
»Um wie viel Uhr?«, fragte Liv.
»Halb sechs dürfte reichen. Brauchst du einen Wecker?«
»Nein, um die Zeit stehe ich bei uns auch immer auf, manchmal sogar früher«, antwortete Liv.
»Sehr gut. Vor dem Frühstück versammeln wir uns übrigens jeden Morgen um halb sieben zu einer Andacht im Speisezimmer. Abends sprechen wir dort ebenfalls noch zusammen ein Gebet.«
Dem Ton dieser Feststellung entnahm Liv, dass ihre Teilnahme vorausgesetzt wurde. Die Tür zu dem Zimmer am Anfang des Flurs war geschlossen, der Schlüssel steckte außen. Ingrid Treske machte keine Anstalten, es zu betreten.
»Und wer wohnt hier?«, rutschte es Liv heraus.
Die Miene ihrer Dienstherrin verdüsterte sich.
»Elias. Unser Sorgenkind. Du wirst ihn später kennenlernen.«
»Bitte, lass mich raus!«, rief der Junge von innen und trommelte gegen die Tür.
Ingrid Treske kniff ihren Mund zusammen.
»Bitte! Bitte!«
Das Flehen in seiner Stimme schnitt Liv ins Herz. Sie schielte zu seiner Mutter in der Erwartung, dass sie sich erweichen lassen und ihn aus seinem Gefängnis befreien würde. Doch Ingrid Treske wandte sich ab und eilte die Treppe hinunter. Liv blieb nichts anderes übrig, als ihr in die Küche zu folgen. Auch hier war kein Stäubchen zu sehen, alles glänzte und blitzte: von den weiß-schwarzen Bodenfliesen über die Messingarmaturen des Herdes und der Spüle, die Glasscheiben des Buffetschrankes sowie die lackierten Oberflächen der Arbeitstische und Seitenborde bis hin zu den Kupferpfannen und Brätern, die an der Wand hingen.
»Elias weiß ganz genau, dass er nicht sprechen darf«, stieß Ingrid Treske hervor. »Mein Mann hat es ihm ausdrücklich verboten. Er soll still über seine Untaten nachdenken und die Gelegenheit nutzen, seine Fehler einzusehen. Stattdessen ist er schon wieder ungezogen und handelt seinem Vater zuwider.«
In ihrem Ausbruch lag weniger Zorn als Ratlosigkeit. Und Furcht. Livs Magen zog sich zusammen. Hatte Ingrid Treske Angst vor ihrem Mann? Es hätte sie nicht gewundert nach der Szene vor dem Schuppen. Ob er die Hand auch gegen seine Frau erhob? Erheben würde, korrigierte sie sich. Es käme ihr wohl nicht in den Sinn, seinen Unmut herauszufordern oder ihm Widerworte zu geben. Dazu ist sie viel zu eingeschüchtert.
»Ich weiß auch nicht, warum der Junge so bockig ist«, sagte Elias’ Mutter. »Es bringt ihm doch nichts. Im Gegenteil. Er macht damit alles noch schlimmer.«
Während Liv noch überlegte, ob eine Antwort von ihr erwartet wurde, straffte sich Frau Treske und wechselte das Thema.
»Also, das ist das Reich von Frau Bryne, unserer Köchin. Du wirst ihr bei der Zubereitung der Speisen helfen und den Abwasch erledigen.« Sie deutete auf den Pumpschwengel neben dem Spülstein. »Wir haben fließendes Wasser.« In ihrer Stimme schwang Stolz mit. »Die Reinigungsmittel, Scheuersand, Essig, Schuhputzzeug, Polierpaste, Bohnerwachs und so weiter findest du hier«, fuhr sie fort und deutete auf einen hüfthohen Schrank.
Daneben befand sich die Vorratskammer, deren Regale gut gefüllt waren. Livs Blick glitt über sorgfältig beschriftete Gläser mit Kompott, eingelegtem Gemüse und Konfitüren, Flaschen mit Saft und Öl, Blechdosen für Mehl, Graupen, Reis, Nüsse und andere haltbare Lebensmittel, eine Schüssel mit Eiern, einen Steinguttopf mit Butter und einige runde Käselaibe. Von der Decke hingen geräucherte Würste und Schinken, in mehreren Körben lagerten Kartoffeln, Kohlköpfe und Zwiebeln.
Das Duftgemisch löste ein flaues Gefühl in Liv aus. Sie spürte, wie sich ihr Mund mit Speichel füllte. Sie schluckte und hoffte, dass das Knurren ihres Magens nicht zu hören war. Noch nie hatte sie eine solche Menge hochwertiger Lebensmittel in einem Privathaushalt gesehen. Wenn Mutter solch eine Speisekammer hätte, dachte sie und stellte sich vor, wie die Sorge aus deren Gesicht schwinden und einem zufriedenen Ausdruck Platz machen würde, wenn sie ihren Kindern jeden Tag eine kräftige, wohlschmeckende Mahlzeit zubereiten könnte, ohne mit den Zutaten geizen zu müssen.
»Wie du siehst, haben wir viele Vorräte und müssen wenig zukaufen. Frischen Fisch holen wir auf dem Markt, andere Dinge wie Salz, Zucker, Kaffee und dergleichen beim Krämer. Du kommst an seinem Laden vorbei, wenn du Elias in die Schule bringst und abholst. Das wird nämlich auch zu deinen Aufgaben gehören. Zumindest so lange, bis der Junge beweist, dass wir ihm wieder trauen können. Er hat letztens ein paar Mal die Schule geschwänzt oder auf dem Weg getrödelt.«
»In welche Klasse geht er denn?«, fragte Liv.
»Nach den Osterferien kommt er in die dritte. Anfang Mai wird er neun.« Ingrid Treske sah Liv forschend an. »Du traust dir doch zu, dich um ihn zu kümmern?«
»Aber natürlich, es ist mir eine Freude«, sagte Liv rasch.
»Elias ist ein schwieriges Kind. Leider. Eine rechte Prüfung hat der Herr uns mit ihm auferlegt.« Frau Treske schüttelte mit bekümmerter Miene den Kopf.
Liv dachte an Pfarrer Nylund. Nach einem Besuch vor Ostern in Stavanger bei seinem alten Studienkollegen Oddvar Treske hatte er Liv erzählt, dass dessen Frau unverhofft noch einmal Mutter geworden war. Um sich ganz dem Neugeborenen widmen zu können, suchte sie ein Dienstmädchen, das ihr im Haushalt zur Hand ging. Der Pfarrer hatte kurz innegehalten. »Ich habe den Eindruck, dass die gute Frau allgemein rasch an ihre Grenzen stößt«, hatte er mit gesenkter Stimme hinzugefügt. »Vor allem aber braucht sie jemanden, der ein Auge auf den Sohn hat. Sie scheint mir ein wenig überfordert mit seiner Erziehung. Und da du so viele jüngere Geschwister hast, denke ich, dass du wie geschaffen für diese Aufgabe bist.«
Entferntes Weinen war zu hören.
»Die Kleine«, rief Frau Treske und hastete zur Tür. »Ich denke, das Nötigste weißt du nun. In ungefähr einer Stunde kommt die Köchin. Könntest du bitte als Erstes Feuerholz aus dem Schuppen holen, Wasser aufsetzen und die kochen«, sie zeigte auf eine große Schüssel, in der sich ein Berg Kartoffeln türmte. »Frau Bryne wird heute einen Vorrat an lompe zubereiten.«
Beim Gedanken an einen warmen Kartoffelfladen rumorte es erneut in Livs Magen. Wie lange würde sie wohl noch aushalten müssen bis zu ihrer ersten Mahlzeit an diesem Tag? Sie getraute sich nicht zu fragen. Frau Treske hatte die Küche bereits verlassen, kehrte aber noch einmal zurück.
»Das hätte ich fast vergessen«, sagte sie. »Du bist nach dem langen Weg gewiss hungrig. Du kannst dir gern von dem Brot und eine Tasse Kaffee nehmen.« Sie nickte zu dem Tisch neben dem Geschirrschrank hin und verschwand.
Neben einem Brett mit einem Brotlaib stand ein Stövchen mit einer schlichten Kanne aus braunem Ton, wie er im Teglverk Graveren in Livs Heimatort Sandnes verwendet wurde. Sie schnitt sich eine dicke Scheibe von dem Roggenbrot ab. Nur mit Mühe widerstand sie dem Drang, sie in sich hineinzuschlingen. Den ersten Bissen kaute sie langsam mit geschlossenen Augen und genoss den leicht säuerlichen Geschmack, in dem sie einen Hauch Kümmel ausmachte. Bevor sie erneut abbiss, holte sie sich einen Becher aus dem Schrank. Dabei fiel ihr Blick auf eine Dose, deren Deckel sie vorsichtig anhob. Sie war bis an den Rand mit goldgelben Kandisbrocken gefüllt. Ob sie davon nehmen durfte, ohne zu fragen? Verstohlen sah sie sich um, klaubte zwei Stücke heraus, schenkte sich Kaffee ein und ließ den Zucker in die dampfende Flüssigkeit plumpsen. Nachdem er sich unter Rühren aufgelöst hatte, probierte Liv einen Schluck. Ihr wurde schwindelig. Es war echter Bohnenkaffee, stark und aromatisch. Nicht wie das bittere Gebräu, das ihre Mutter aus getrockneten Löwenzahnwurzeln herstellte. Liv lehnte sich gegen den Tisch und spürte der Wärme nach, die sich in ihrem Bauch ausbreitete.
Die Aussicht, von nun an täglich satt zu werden, war beglückend und erfüllte sie mit tiefer Dankbarkeit. Liv verzehrte ihr Brot und wischte die bange Frage beiseite, wie sie mit Oddvar Treske auskommen würde. Sie durfte sich eben nichts zuschulden kommen lassen und musste versuchen, bei der Arbeit stets ihr Bestes zu geben. Und vielleicht täuschte sie sich ja auch in ihm, und die harte Bestrafung des Jungen war eine Ausnahme gewesen, die Reaktion auf ein besonders schweres Vergehen. Liv befahl der Stimme in sich, die daran zweifelte, zu schweigen, schnappte sich den leeren Korb neben dem Herd und ging hinaus, um Holz zu holen.
4
Schlesien, April 1905 – Karoline
Die Standuhr in der Eingangshalle schlug eben zur vollen Stunde, als Karoline pünktlich um sieben Uhr abends die breite Treppe hinunterschritt, die die beiden Flügel von Schloss Katzbach voneinander trennte. Mithilfe von Agnes, ihrer Zofe, hatte sie sich in ein stark tailliertes Seidenkleid mit Glockenrock und kurzer Schleppe gezwängt, dessen königsblaue Farbe gut mit ihren dunklen Augen harmonierte. Das Korsett verlieh ihr von der Seite gesehen eine S-förmige Silhouette, indem es den Bauch verschwinden ließ, die Brust betonte und die Hüften nach hinten drückte. Ihre zusammengepressten Lungen waren nur zu flacher Atmung imstande, was durch die leicht nach vorn gebeugte Haltung noch verstärkt wurde. Der Ausschnitt gewährte einen tiefen Blick in ihr Dekolleté – einem der wenigen Teile ihres Körpers, der sie mit Stolz erfüllte. Auf ihrem Kopf türmte sich eine Steckfrisur, die Agnes in einer aufwendigen Prozedur toupiert, mit falschen Haarteilen aufgefüllt und mittels einer Brennschere mit Löckchen über Stirn und Ohren versehen hatte. Zu guter Letzt hatte Karoline ein wenig Puder und ein dezentes Parfum aufgelegt, eine dreireihige Perlenkette um ihren Hals geschlungen und schwarze Satin-Handschuhe übergestreift, die bis zu den Ellenbogen reichten.
Vor der Tür des Speisezimmers hielt sie inne. Die bevorstehende Begegnung mit Moritz versetzte sie in Aufregung. An Weihnachten hatte sie ihn das letzte Mal gesehen – flüchtig bei den Gottesdiensten und den zahllosen Verwandten- und Bekanntenbesuchen, die man sich zwischen den Jahren abzustatten pflegte. Vergeblich hatte sie wieder einmal darauf gewartet, dass er sie in ihren Gemächern aufsuchen würde, das Bedürfnis verspürte, sich mit ihr auszutauschen oder ihr körperlich nahe zu sein. Auch während der mehrgängigen Festessen, die für Karoline zu einem einzigen endlosen Gelage verschmolzen, hatte Moritz nur selten das Wort an sie gerichtet.
Die stundenlange Sitzerei unter lauter Menschen, denen sie bestenfalls gleichgültig war, wenn sie nicht dem Beispiel ihrer Schwiegermutter folgten und sie ihre Verachtung offen spüren ließen, wurde so zur doppelten Qual – seelisch und körperlich. Eingequetscht in ihr Schnürmieder war sie kaum in der Lage gewesen, mehr als ein paar Häppchen von den Suppen und Salaten, den Braten, den Fisch-, Wild- und Geflügelgerichten, den Kartoffel- und Semmelklößen, den Kraut- und Gemüsebeilagen oder den sahnigen Cremes, Mohntorten, Käsekuchen, Früchtebroten, Mandelmakrönchen und anderen Leckereien zu sich zu nehmen, unter denen sich die Tische im wahrsten Sinne des Wortes bogen. Es verlangte Karoline jedes Mal viel Selbstbeherrschung ab, diese Feierlichkeiten mit Würde durchzustehen und nicht dem Drang nachzugeben, aufzuspringen, den Stuhl wegzuschleudern, ihr Glas auf dem Boden zu zerschmettern und in der anschließenden Stille ihrem Mann und seiner überheblichen Sippschaft vor all diesen Von und Zus die Meinung ins Gesicht zu schleudern.
Der einzige Mensch, der Karoline aufrichtige Zuneigung entgegenbrachte, war ausgerechnet der Bruder ihrer Schwiegermutter. Zu ihrem Bedauern bekam sie ihn selten zu sehen. Nach einem Reitunfall war Freiherr Waldemar von Dyhrenfurth seit 1895 an seinen Rollstuhl gefesselt und verließ sein Schloss in der Nähe von Liegnitz nur noch selten. Dort lebte er inmitten seiner Gemäldesammlung, die ganz den Werken von Landschaftsmalern aus Skandinavien gewidmet war. Vor seinem Unfall war er einmal im Jahr in den hohen Norden gefahren, um neue Bilder zu erwerben und seine Kontakte mit einigen Künstlern, die er im Laufe der Zeit näher kennengelernt hatte, zu pflegen. An die Stelle des persönlichen Austauschs war nun eine rege Korrespondenz getreten.