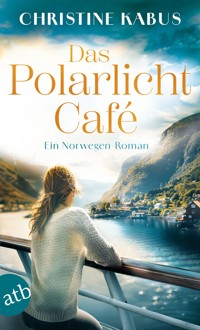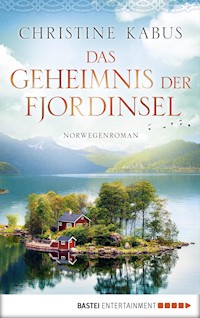
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei außergewöhnliche Frauen und ein folgenschweres Vermächtnis ...
Ostfriesland, 1980. Für die junge Rike bricht nach dem Tod ihres geliebten Großvaters eine Welt zusammen. Gleichzeitig erfährt sie, dass ihre Großmutter nicht vor langer Zeit gestorben ist - wie sie angenommen hatte -, sondern eines Tages plötzlich verschwand. Warum hat sie ihre Familie damals so überstürzt verlassen? Eine erste Spur führt Rike nach Norwegen, auf eine kleine Insel im Oslofjord, wo sie auf ein Geheimnis stößt, das zurückreicht in die Zwanzigerjahre - in die Zeit der Prohibition und die gefährliche Welt der Schmuggler ...
Der neue große Norwegenroman der Erfolgsautorin: atmosphärisch, emotional und fesselnd erzählt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
An ihrem dreißigsten Geburtstag bekommt Jana den Schlüssel zum Ferienhaus der Familie überreicht. Das kleine Haus im Oslofjord spielte in der Vergangenheit ihrer Vorfahren eine besondere Rolle. Ihre Mutter Rike begann hier die Suche nach ihren norwegischen Wurzeln und ihrer verschollenen Großmutter Johanne. Warum hatte diese ihre deutsche Familie Mitte der Fünfzigerjahre so plötzlich verlassen? Die Antwort liegt in einem Geheimnis, das zurückreicht in die Zwanzigerjahre – in die Zeit der Prohibition und die gefährliche Welt der Schmuggler ...
Über die Autorin
Christine Kabus, 1964 in Würzburg geboren, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte als Dramaturgin und Lektorin bei verschiedenen Film- und Theaterproduktionen, bevor sie sich 2003 als Drehbuchautorin selbstständig machte. Schon als Kind zog sie der hohe Norden, den sie zunächst durch die Bücher von Astrid Lindgren und Selma Lagerlöf kennenlernte, in seinen Bann. Vor allem die ursprüngliche, mythische Landschaft Norwegens beflügelte ihre Phantasie. Sie begann, die Sprache zu lernen und sich intensiv mit der Geschichte Norwegens zu beschäftigen. Ihr erster Roman IM LAND DER WEITEN FJORDE ist eine Hommage an dieses faszinierende Land.
CHRISTINE KABUS
DASGEHEIMNIS DERFJORDINSEL
NORWEGENROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Titelillustration: © Geir Olav Lyngfjell / shutterstock.com; Andrew Mayovskyy / shutterstock.com; Pakhnyushchy / shutterstock.com
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7242-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Stefan
in Liebe
Hvis man ikke kenner fortiden, forstår man ikke nåtiden,
og er lite egnet til å forme fremtiden.
Wer die Vergangenheit nicht kennt, versteht auch die Gegenwart nicht und ist kaum in der Lage, die Zukunft zu gestalten.
Personen
1926 – HORTEN, NORWEGEN
Familie Rev
Olof und Borghild – Eltern
Johanne, Dagny, Finn – ihre Kinder
Ingvald Lundalm – Angestellter in Revs Weinhandlung
Wichtige Nebenfiguren:
Sven Gravdal – Schmuggler
Leif – sein Chauffeur
Rettmann – Chef der Polizei von Horten
Nygren – junger Polizist
Ludvigsen – Bankdirektor
Fräulein Solstad – seine Sekretärin
1980 – PETKUM, OSTFRIESLAND
Familie Meiners
Fiete (Friedrich) – ehemaliger Kapitän und Lotse
Rike (Frederike) – seine Enkelin
Beate – seine Tochter, Rikes Mutter
Familie Olthoff
Eilert – Schlepperkapitän, Rikes Chef; Freund und Nachbar von Fiete
Swantje – seine Frau
Lieske – ihre Tochter
Auf der Reise in Norwegen
Bjørn Kravik – Student
Knut, Marit und Linda – seine Freunde
Persson – Bootsverleiher in Holmestrand
Prolog
Das Tuckern des Bootsmotors durchschnitt die Stille der Nacht. Der Wind, der tagsüber die Wasseroberfläche des Fjords gekräuselt und kleine Wellen an die Ufer und die ihnen vorgelagerten Inseln und Schären getrieben hatte, war zu einem kaum wahrnehmbaren Hauch abgeflaut. Im Westen kündigte ein dunkelroter Streifen am Horizont den Untergang der Sonne an, die wenige Stunden später bereits wieder aufgehen würde. Der Mann am Steuer umrundete die Spitze einer lang gezogenen Insel und hielt auf ein rundes Eiland zu, das hinter dieser im Sund lag. Er schaute zurück zum Hafen von Holmestrand, den er eine halbe Stunde zuvor verlassen hatte. Vereinzelt blinkten Lichter aus dem Städtchen herüber. Beim Anblick der langen weißen Spur, die das Kielwasser seines Bootes weithin sichtbar hinterließ, zog sich sein Magen zusammen. Wenn jetzt ein Polizeischiff auftauchte, hätte er keine Chance, unbemerkt zu entkommen. Im nächsten Moment atmete er aus und entspannte sich. Es gab keinen Grund zur Beunruhigung. Das war vorbei. Der Schreck war ein Reflex aus einem anderen Leben, das er ein für alle Mal hinter sich gelassen hatte.
Mittlerweile hatte er das Inselchen erreicht, das von Kiefern und Birken bewachsen war. Er drosselte den Motor, ließ das Boot in den Schatten der Bäume gleiten und spähte zum Ufer. Zwischen den dunklen Felsen entdeckte er den schmalen Sandstreifen, an dem er anlanden konnte. Eine Minute später sprang er ins seichte Wasser, zog das Boot an Land und lief in das Wäldchen. Der schmale Pfad war zugewuchert. Auch die Lichtung, in deren Mitte das kleine Holzhaus stand, war kaum noch auszumachen. Der Boden war mit niedrigem Buschwerk, Blaubeersträuchern und Erdbeerpflanzen bedeckt, aus denen hüfthohe Baumschösslinge und lange Grashalme ragten. Der Mann bahnte sich seinen Weg. Leises Rascheln im Unterholz verriet ihm, dass er eine Maus oder ein anderes kleines Tier aufgescheucht hatte. Ein paar Schritte vor dem Haus, dessen Fensterläden geschlossen waren, hielt er inne. Wie lange es wohl schon in seinem Dornröschenschlaf lag? Im Restlicht bemerkte er die abblätternde Farbe an den Wänden, die halb im Boden eingesunkene Steinstufe vor der Tür, die Moosschicht auf dem Brennholzstapel an der Seitenwand und das zerbrochene Brett in der Sitzfläche der Bank unterm Fenster. Er griff sich in den Hemdkragen und zog ein Lederband mit einem Schlüssel hervor, den er in das Schloss steckte und umdrehte. Mit einem Knarzen schwang die Tür auf. Aus dem Inneren drang ein Geruchsgemisch aus erkalteter Asche, stockigem Stroh und Harz. Er knöpfte eine rechteckige Taschenlampe aus schwarz lackiertem Blech von seinem Gürtel ab, legte den seitlichen Schalter um und betrat im Schein des Lichtkegels die Hütte.
Ohne sich umzusehen, begab er sich zu einem niedrigen Schrank, der an einer Wand neben einem gusseisernen Ofen stand. Er rückte ihn beiseite, kniete sich auf den Boden, hob eine lose Diele an und leuchtete in die geräumige Vertiefung, die sich darunter befand. Neben einigen Metallkanistern und mehreren leeren Flaschenkisten lag ein flaches Kästchen. Er holte es heraus und öffnete es. Die Schrift auf dem Umschlag, der darin lag, ließ sein Herz schneller schlagen. Er riss das Kuvert auf, entfaltete den Briefbogen und überflog die Zeilen, die sie ihm geschrieben hatte. Seine Miene versteinerte. Er war zu spät. Sie würde nicht mehr kommen.
Mein Geliebter!
Lange habe ich es nicht wahrhaben wollen, habe den Leuten nicht geglaubt, die fest behaupteten, Du wärest im Fjord ertrunken. Ich war mir so sicher, dass sie unrecht hatten und Du lebtest. Drei Jahre bin ich einmal im Monat hierhergefahren – voller Hoffnung, endlich eine Nachricht von Dir vorzufinden und Dich wieder in meine Arme schließen zu können. Doch nach so langer Zeit des Wartens muss ich wohl einsehen, dass ich mich getäuscht habe. Es tut so weh! Ich werde fortgehen, hier hält mich nichts mehr. Leb wohl, mein Einziger! Du wirst für immer in meinem Herzen sein.
1
Emden, Ostfriesland, Frühling 1980 – Rike
Der dritte und letzte Tag von Rikes Schicht auf der Greetje ließ sich ruhig an. Der Schlepper lag neben seinem Schwesternschiff, der Hans, an der Pier im Außenhafen von Emden, während die Crew auf den nächsten Auftrag vom Einteiler wartete. Ein frischer Wind trieb die Regenwolken auseinander, die über Nacht für Niederschlag gesorgt hatten, und ließ den Wimpel mit den Farben der Reederei und die Deutschlandfahne an den Wanten über dem Steuerhaus flattern. Ein paar Möwen kreisten über einem vorbeituckernden Fischkutter, der von seinem frühmorgendlichen Fang zurückkehrte. In der Nesserlander Schleuse, die zum Binnenhafen führte, lag ein Schüttgutfrachter, und gegenüber auf dem Borkumkai warteten bereits einige Autos und Passagiere auf die Fähre, die sie zur gleichnamigen Insel transportieren würde.
Auf der Greetje nutzte die Mannschaft die Liegezeit für Reparaturen, Reinigungsarbeiten und andere Erledigungen. Nach dem Frühstück in der winzigen Messe brachte Kapitän Eilert Olthoff, ein ergrauter Mittsechziger, das Logbuch auf den neuesten Stand und aktualisierte auf der Seekarte den Verlauf der Fahrtrinne, die sich nach der letzten Vollmond-Tide verschoben hatte. Schiffsmechaniker Marten überprüfte derweil im Maschinenraum die Leitungen und Sicherungen, und Rike, mit zwanzig Jahren das jüngste Besatzungsmitglied, werkelte achtern auf dem Deck. Nachdem sie einige Rostflecke an der Seitenwand abgeschliffen und anschließend mit Farbe übermalt hatte, war sie nun dabei, die Seilwinde einzufetten.
Zum Schutz gegen die Morgenkühle hatte sie über ihren Overall einen der dunkelblauen Pullover gezogen, die Eilerts Frau Swantje regelmäßig für die kleine Mannschaft des Schleppers strickte. Von ihr war auch die rot-blau geringelte Mütze, unter die Rike ihre dunklen Locken gestopft hatte. Ihre Füße steckten in klobigen Halbschuhen, deren Spitzen mit Stahl verstärkt waren, und ihre Hände in Arbeitshandschuhen, deren Bund Swantje mit einem Gummizug versehen hatte, damit sie ihr nicht herunterrutschten. Auch die Hosenbeine und Ärmel von Rikes Overall hatte sie gekürzt und dabei gebrummt: »Wann kapieren die endlich, dass nicht nur Mannsbilder solche Klamotten brauchen?«
»Ich bin halt nicht sehr groß geraten«, hatte Rike geantwortet.
»Darum geht’s nicht. Es ist einfach nicht in Ordnung, dass es keine Frauengrößen gibt. Bei unserem Ausrüster hier in Emden hab ich jedenfalls noch keine entdecken können.«
Rike hatte mit den Schultern gezuckt und die Bemerkung, dass das ihr geringstes Problem war, für sich behalten. Als Frau einen seemännischen Beruf zu ergreifen – abgesehen von Tätigkeiten in der Verwaltung oder im Service – war ungewöhnlich, um nicht zu sagen verrückt. Zwar hatte die Bundesregierung im Jahr zuvor bei der Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Kopenhagen ein Übereinkommen unterzeichnet, das sich die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zum Ziel gesetzt hatte. Rike hatte jedoch wenig Hoffnung, dass die geplante Aufhebung der Benachteiligung von Mädchen und Frauen in der beruflichen Bildung und auf dem Arbeitsmarkt rasch umgesetzt werden konnte. Zumindest nicht in Sparten, die so fest in Männerhand waren wie die Seefahrt. Was ihren Entschluss keineswegs ins Wanken gebracht hatte. Von klein auf hatte sie auf die Frage, was sie denn einmal werden wollte, stets nur eine Antwort gegeben: Schlepperkapitänin. Hatte dieser Berufswunsch aus dem Munde eines kleinen Mädchens noch für Belustigung gesorgt, war er mit den Jahren auf zunehmendes Unverständnis gestoßen. Rikes Großvater wurde immer öfter aufgefordert, endlich »ein ernstes Wort« mit seiner Enkelin zu reden, ihr die Flausen auszutreiben und sie zur Vernunft zu bringen.
»Elk een noh sien Möög – Jeder, wie er mag«, war alles, was Opa Fiete den Mahnern entgegnete, bevor er das Thema wechselte. Die Unkenrufe, Rike sei den beruflichen Anforderungen rein körperlich nicht gewachsen, würde darüber hinaus niemals als Befehlshaberin respektiert werden und müsse daher kläglich scheitern, ließ er unkommentiert verhallen. Es scherte ihn auch nicht, als verantwortungsloser Dieskopp beschimpft zu werden, der in verblendeter Sturheit oder Ignoranz das bedauernswerte Mädchen ins Verderben rennen ließ. Für ihn zählte nur das, was Rike glücklich machte. Sein bester Freund Eilert und dessen Frau Swantje standen ebenfalls unverrückbar an ihrer Seite und ermutigten sie, ihren eigenen Weg zu gehen. Rikes Mutter Beate hieß ihre Wahl zwar nicht gut, machte jedoch keine Anstalten, sich einzumischen. So wie sie es seit der Geburt ihrer Tochter gehalten hatte.
Nach der mittleren Reife hatte Rike drei Jahre lang die Seefahrtsschule in Leer besucht und das Patent zum Nautischen Wachoffizier erworben. Seit einem Jahr fuhr sie nun auf der Greetje als Matrose in Dreitagesschichten und absolvierte unter Eilerts Aufsicht die Weiterbildung zum Schiffsführer. Ihr Traum, eines Tages das Ruder des Schleppers zu übernehmen und sich ihren alten Berufswunsch zu erfüllen, war in greifbare Nähe gerückt. Der Hafen von Emden war von jeher ihr zweites Zuhause gewesen. Wenn sie nach der Schule die Hausaufgaben erledigt hatte, verbrachte sie ihre Nachmittage am liebsten in der Lotsenstation, wo ihr Großvater angestellt war, oder auf dem Schleppschiff von Onkel Eilert, wie sie ihn genannt hatte, bevor er ihr Chef wurde.
Ein Klingeln riss Rike aus ihren Gedanken. Sie hob den Kopf und sah zum Steuerhaus, wo sich Eilert den Hörer des Telefons ans Ohr hielt und ihr mit der anderen Hand zuwinkte. Rasch stand sie auf, verstaute das Schmierfett und den Lappen in einer Kiste und ging zum Kapitän, der aus der Brücke getreten war. Gleichzeitig stieß Marten zu ihnen. Er war Ende dreißig und überragte Rike um fast einen halben Meter. Jedes Mal, wenn er sich in einem Türrahmen oder an einer der niedrigen Decken an Bord der Greetje den Kopf stieß, fragte sich Rike, warum ausgerechnet dieser Hüne einen Beruf gewählt hatte, der ihn die meiste Zeit zu einer gebückten Haltung zwang. Marten ertrug es mit der gleichen Gelassenheit, mit der er Regengüsse, hohen Seegang und anderes Ungemach über sich ergehen ließ.
»Ein Job?«, fragte er.
Er sprach den Anfangsbuchstaben nicht englisch aus, sondern wie in Jonas oder Jod.
Eilert nickte. »Autofrachter aus Antwerpen. Wir sollen ihn querab vom Eiffelturm in Empfang nehmen und zum Verladeport bringen. Die Greetje übernimmt die Vorleine. Die Hans das Achterschiff zum Abbremsen.«
»Denn man to!« Marten nickte ihnen zu und kehrte in den Maschinenraum zurück.
Rike löste das Tau, mit dem die Greetje am Poller festgemacht war. Das Deck begann zu vibrieren. Marten hatte die Dieselmotoren angeworfen, die die beiden Voith-Schneider-Propeller antrieben und eine Leistung von gut 2400 PS hatten. Auch nach all den Jahren jagte das satte Wummern der Maschinen Rike einen wohligen Schauer über den Rücken. Allein dafür liebte sie den Schlepper, dieses gedrungene Kraftpaket, und hätte ihn um nichts in der Welt gegen einen imposanten Frachter oder Passagierdampfer tauschen wollen. Eine Einstellung, die sie mit dem Kapitän teilte.
»Ja, ja, meine Greetje! Klein, aber oho!«, pflegte Eilert nach kniffligen Aufträgen zu sagen.
Und als sich wieder einmal ein Matrose von einem anderen Schiff über die kleine Frau an Bord des Schleppers lustig machte und hinüberrief: »Passt auf, dass euch die Lüttje nicht durchs Speigatt flutscht«, hatte der Kapitän Rike auf die Schulter geklopft und gesagt: »Hör gar nicht hin. Du und die Greetje, ihr passt gut zusammen. Nicht sehr groß, aber bärenstark, nicht unterzukriegen und immer bereit, die schwierigsten Herausforderungen anzunehmen.«
Eilert steckte den Kopf aus dem Steuerhaus und schrie gegen den Wind: »Komm mal her!«
Rike lief zu ihm.
»Dein Platz«, brummte Eilert, trat vom Steuerstand zurück und beugte sich zum Rufrohr, durch das er Befehle in den Maschinenraum geben konnte.
»Marten, an die Winde!«
Rike sah ihn verständnislos an. Warum sollte Marten ihre Aufgabe übernehmen?
»Worauf wartest du? Wir müssen los«, sagte Eilert.
»Du meinst, ich soll …?«
Eilert nickte. »Bist so weit.«
Rike schluckte. Wochenlang hatte sie diesem Augenblick entgegengefiebert, in dem sie zum ersten Mal das Ruder bei einem großen Manöver übernehmen durfte. Jetzt, wo es soweit war, bekam sie Muffensausen. Bangemachen gilt nicht, dachte sie, streifte die Handschuhe ab und stellte sich in die Nische am Rand des Kommandopults vor das Steuerrad. Sie drehte es nach Backbord und schob gleichzeitig die beiden Fahrthebel in Vorausstellung. Im Nu löste sich die Greetje von der Anlegestelle und fuhr aus dem Hafen auf die Ems, dicht gefolgt von der Hans.
Nach einer Weile sah Rike rechter Hand die dreibeinige, rot-weiß gestrichene Stahlkonstruktion des Campener Leuchtfeuers, das mit knapp fünfundsechzig Metern Deutschlands höchster Leuchtturm war. Da er nicht nur zur selben Zeit errichtet worden war wie der Eiffelturm in Paris, sondern auch dessen Bauweise aus genieteten Eisenteilen hatte, wurde er von den Einheimischen Eiffelturm genannt.
Kurz darauf tauchte in der Ferne der Autotransporter auf und wuchs im Näherkommen zu einem hellgrünen Gebirge an. Ein Lotsenboot ging längsseits. Rike beobachtete, wie der Stromlotse von Bord ging, während der Hafenlotse zustieg, der das folgende Manöver von der Brücke des Seeschiffs aus dirigieren würde.
Rike steuerte den Schlepper bis auf wenige Meter direkt vor den Bug des Frachters, passte ihr Tempo dem seinen an und fuhr rückwärts zur Fahrtrichtung, um ihn im Blick zu behalten. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Das Manöver war riskant. Kam sie dem Ungetüm zu nahe, war die Greetje reif für die Schrottpresse. Beim Herstellen der Schleppverbindung konnte ein Fehler die schlimmsten Folgen haben. War der Frachter noch zu schnell, überrollte er den Schlepper einfach. Es war unmöglich, die Tausenden Tonnen, die da in Bewegung waren, rechtzeitig zu stoppen.
Rike kämpfte kurz gegen ein flaues Gefühl in der Magengegend. Sie atmete tief durch und brachte den Schlepper noch näher an den Frachter heran, von dem kurz darauf ein Matrose eine Schmeißleine herunterwarf, die Marten auffing und ein kräftiges Seil, die sogenannte Jagerleine, daran knotete. Diese war so stark, dass mit ihr vom Seeschiff aus der Draht, ein zentnerschweres Tau aus Stahl, mittels einer Winde an Bord gezogen werden konnte – die dünne Wurfleine wäre unter dem Gewicht gerissen. Als der Jager an Bord war, löste Marten die Wurfleine und verband den Aufholer mit dem Schleppdraht. Er hob die Arme, kreuzte sie und gab so dem Matrosen das Zeichen, dass er ihn einholen konnte. Kurz darauf signalisierte er Rike, dass die Schleppverbindung hergestellt war.
»Greetje vorn fest!«, rief Rike in den Lautsprecher der Funkanlage, über die sie mit dem Lotsen auf dem Autotransporter kommunizierte.
Auch die Hans hatte mittlerweile ihre Position eingenommen und hing am Heck des Frachters – in gebührendem Abstand, um nicht in dessen Schraubenwasser zu geraten. Zu dritt ging es nun weiter Richtung Autoverladekai, den sie nach einer Viertelstunde erreichten. Rike drosselte das Tempo auf drei Knoten. Der Lotse gab den Befehl zum Aufstoppen. Marten zog mit der Winde den Schleppdraht tight und gab Rike das Signal, mit dem Bremsen zu beginnen. Rike spürte den Ruck, als die Trosse zwischen der Greetje und dem Frachter straff gespannt war. Die Maschine des Schleppers brüllte auf, als er seine gesamte Zugkraft einsetzte. Das Rütteln und Zittern erinnerte Rike an einen wütenden Terrier, der mit aller Kraft an seiner Leine zerrte und vor Anstrengung am ganzen Körper bebte.
»Greetje halbe«, bellte die Stimme des Lotsen aus dem Lautsprecher.
»Greetje halbe«, bestätigte Rike und gab halbe Kraft voraus.
»Die Hans halbe Backbord«, kommandierte der Lotse.
Die Richtungsangaben – steuerbord und backbord – machten die Lotsen stets aus der Sicht des geschleppten Schiffes, um Verwechslungen beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren auszuschließen.
Mit vereinten Kräften begannen die beiden Schlepper, die sich neben dem Frachter wie zwei Heringe neben einem Blauwal ausnahmen, diesen zu wenden. Zum Abschluss »nagelten« ihn die beiden Schlepper an die Pier, wo ihn die Festmacher an Land mit Leinen an den Pollern vertäuten. Nach einer Stunde war das Manöver abgeschlossen, der Lotse entließ die Schlepper, und das Frachtschiff öffnete die Ladeklappen, durch die nun knapp sechshundert Autos über Rampen ins Innere gefahren würden.
Rike steuerte die Greetje zurück in den Hafen. Ihr Nacken schmerzte. Erst jetzt merkte sie, wie sehr sie ihre Muskeln angespannt hatte. Verstohlen schielte sie zu Eilert. War er zufrieden mit ihr? Seine Miene war ausdruckslos. Bevor sie ihn fragen konnte, holte er seinen Tabakbeutel aus der Brusttasche und machte sich gemächlich daran, seine Pfeife zu stopfen. Rike unterdrückte ein Seufzen. Eilert bei dieser Zeremonie zu stören war keine gute Idee. Sie sah wieder nach vorn und lenkte den Schlepper in die Fahrrinne, die von der Ems in den Außenhafen führte.
»Dat gung man good!«, nuschelte Eilert, nachdem er die Pfeife in den Mund gesteckt hatte.
Rike sah ihn überrascht an. Er nickte ihr zu, entzündete ein Streichholz und paffte die Pfeife an. Sie spürte, wie sich ihre Mundwinkel zu einem breiten Lächeln verzogen. Ein höheres Lob gab es aus Eilerts Mund nicht. Sie hatte ihre Sache also tatsächlich gut gemacht. Das würzige Aroma des Pfeifenrauchs stieg ihr in die Nase und beschwor das Gesicht ihres Großvaters herauf, der den gleichen Tabak verwendete. Sie schaute auf ihre Armbanduhr. Noch sechs Stunden bis zum Ende ihrer Schicht. Noch sechs lange Stunden, bevor sie Opa Fiete von ihrem Erfolg berichten konnte. Sie hielt auf die Anlegestelle der Schlepper zu und stutzte.
»Ist das auf der Pier nicht Swantje?«
Eilert folgte ihrem Blick und runzelte beim Anblick seiner Frau die Stirn. Swantje saß in sich zusammengesunken auf einem Poller und hielt ein Taschentuch an die Augen gepresst. Als sie den Schlepper bemerkte, stand sie wankend auf. Im Näherkommen sah Rike, dass sie kreidebleich war. Ihre kinnlangen Haare standen zu allen Seiten ab, als hätte sie sie gerauft.
Rikes Herz zog sich zusammen und begann im nächsten Moment wild zu schlagen. Etwas Furchtbares musste geschehen sein.
2
Horten, Norwegen, Juni 1926 – Johanne
»Das soll dein Vater entscheiden.«
Johanne zog die Brauen hoch und sah ihre Mutter ungläubig an, die ihr gegenüber auf der Terrasse hinter dem Haus an einem runden Tisch saß. Die Frage, ob die Aufforderung ernst gemeint war, schluckte sie jedoch hinunter. Selbst schuld, schalt sie sich. Es hat keinen Sinn, Mutter in die Planung einzubeziehen und Entschlüsse von ihr zu erwarten. Selbst bei so belanglosen Dingen wie der Auswahl des Blumenschmucks für die Festtafel. Es war ein Fehler, zu glauben, es würde ihr Freude machen. Sie fühlt sich dadurch nur unter Druck gesetzt.
Johanne ließ ihre Augen kurz auf der Gestalt in dem Korbsessel ruhen, der im Schatten einer weiß-gelb gestreiften Markise stand, die zum Schutz vor der Sonne heruntergekurbelt worden war. Borghild Rev trug ein helles Hauskleid, dessen weicher Stoff ihre nach wie vor schlanke Figur umfloss. Das zu einem Dutt hochgesteckte Haar war voll und glänzend. Den weißen Strähnen, die sich in die zimtbraune Pracht geschlichen hatten, rückte sie mit einem Sud aus gekochten Walnussblättern zu Leibe. Die Hände waren sorgfältig manikürt, und ihre Haut war dank der täglichen Behandlung mit Kaffeesatz-Peelings und Quark-Honig-Gesichtsmasken rosig und straff. Borghild Rev legte auch mit ihren knapp fünfzig Jahren noch großen Wert auf ihr Äußeres, dessen Instandhaltung und Pflege sie ihrem Ehemann und ihrer Position als geachtetes Mitglied in der Kirchengemeinde, diversen wohltätigen Vereinen und der gehobenen Gesellschaft von Horten schuldig zu sein glaubte.
»Ich denke, rote Pfingstrosen, weiße Hortensien und rosa Bartnelken sind eine gute Wahl«, sagte Johanne und stand auf. »Ich muss jetzt los.«
Ihre Mutter ließ den Stickrahmen in ihren Schoß sinken und sah fragend zu ihrer Tochter auf. »Wohin musst du denn schon wieder? Du bist immer so ruhelos. Das macht mich ganz nervös. Überdies ziemt es sich nicht für eine Dame.«
Johanne beschloss, die Bemerkung zu überhören. »Ich habe gleich eine Anprobe beim Schneider. Anschließend will ich noch die Menükarten bei der Druckerei abholen, das Konfekt bestellen, das Telegramm an Finn aufgeben und bei …«
»Ich wusste nicht, dass noch so viel zu erledigen ist«, fiel ihr Borghild Rev ins Wort. In ihrer Stimme schwang ein Hauch Panik mit. »Wie sollen wir das nur alles schaffen? Willst du nicht doch deinen Vater …«
Johanne schüttelte den Kopf. »Er hat genug zu tun. Mit solchen Dingen möchte ich ihn nun wirklich nicht behelligen.«
»Aber er könnte jemanden einstellen, der dir zur Hand geht. Ich begreife nicht, warum er sich dagegen sträubt. Es war ein Fehler, nicht alles Personal zu behalten. Nur weil Dagny und Finn weg sind. Das rächt sich jetzt.«
»Mir macht es Freude, mich selbst um diese Dinge zu kümmern«, sagte Johanne.
Ihre Mutter runzelte die Stirn und öffnete den Mund. Johanne beugte sich rasch zu ihr und küsste sie auf den Scheitel. Ein zarter Veilchenduft stieg ihr in die Nase.
»Mamma, sei ganz beruhigt. Ich schaffe das! Bei Dagnys Hochzeit hat doch auch alles ganz wunderbar geklappt.«
Bevor Borghild Rev antworten und weitere Bedenken äußern konnte, nickte Johanne ihr zu und verließ die Veranda durch die Glastür, die in den Salon des Hauses führte. Ihr Vater hatte es im ersten Jahr seiner Ehe in der Vestre Braarudgata erbauen lassen und war mit seiner Frau kurz vor Johannes Geburt 1903 eingezogen. Auch deren Geschwister Dagny und Finn hatten dort das Licht der Welt erblickt.
Wie die meisten Häuser der Straße, die sich auf halber Höhe eines Hangs nordwestlich des Zentrums von Horten erstreckte, war es aus Holz gebaut. Die beiden mit Paneelen verkleideten Stockwerke ruhten auf einem gemauerten Sockel. Rechter Hand führte ein mit Granitplatten gepflasterter Weg vom Gehsteig durch einen Vorgarten zum Eingang an der Schmalseite und weiter zum großen Garten hinter dem Haus. Die der Straße zugewandte Längsfront wurde in der Mitte von einem Balkon mit weit vorkragendem Giebeldach dominiert – dem Lieblingsplatz von Johanne. Schon als Kind hatte sie sich gern dorthin zurückgezogen, um ungestört zu lesen oder ihren Gedanken nachzuhängen, während sie ihren Blick über die Bucht mit dem Flottenhafen, die drei Inseln Løvøya, Mellomøya und Østøya an ihrem Ausgang und den dahinterliegenden Oslofjord schweifen ließ.
Johanne eilte durch den Salon, in dessen Mitte ein handgeknüpfter Orientteppich lag. Die Sofas und Sessel, die neben einem großen Kachelofen um einen niedrigen Tisch gruppiert waren, hatten gedrechselte Beine und waren mit hellem Seidensamt bezogen. An den Wänden standen ein kleiner Sekretär sowie ein breiter Vitrinenschrank, hinter dessen polierten Scheiben die mundgeblasenen und geschliffenen Gläser und Karaffen funkelten, die Olof Rev im Lauf der Zeit seiner Sammlung mit Trinkgefäßen aus aller Herren Länder einverleibt hatte.
Im Flur blieb Johanne kurz vor dem Garderobenspiegel stehen und setzte sich einen schlichten Strohhut mit schmaler Krempe auf die dunkelblonden Haare, die sie zu Zöpfen geflochten und kranzförmig um den Kopf gelegt hatte. Das Taubenblau ihres wadenlangen Kleides harmonierte gut mit ihren grauen Augen, die unter geraden Brauen lagen. Johanne prüfte den Sitz ihrer Seidenstrümpfe, griff nach ihrer Handtasche, die auf der Kommode neben dem Kleiderständer lag, und trat aus dem Haus.
Ein wolkenloser Himmel spannte sich weit über ihr. Der Wind, den sie hinterm Haus kaum wahrgenommen hatte, wehte vom Fjord den herben Geruch nach Jod und Tang herüber. Zügig lief sie hinunter zur Storgata, der Hauptstraße von Horten, dem König Håkon 1907 das Stadtrecht verliehen hatte. Dieser Tage hatte das einstige Fischerdorf fast elftausend Einwohner.
Johanne überquerte die Storgata und bog eine Kreuzung weiter in die Langgata ein, in der Schneidermeister Holt sein Atelier hatte. Schon von Weitem erkannte sie ihre Schwester, die, in den Anblick des Schaufensters vertieft, auf sie wartete. Über ihre kinnlangen Haare, die Dagny in weiche Wellen über die Ohren zu frisieren pflegte, hatte sie einen eng anliegenden Cloche-Hut gestülpt, der bis zu den zu feinen Bögen gezupften Augenbrauen reichte. Ihre schmale Silhouette war wie gemacht für die vorherrschende Mode, die eine knabenhafte Figur verlangte. An diesem Vormittag hatte Dagny ein Hemdkleid mit einem runden Bubikragen gewählt, das ihr bis zu den Knien reichte und sie weit jünger als ihre einundzwanzig Jahre wirken ließ. Johanne beschleunigte ihre Schritte und stellte sich neben sie.
»Da bist du ja endlich!« Dagny umarmte ihre Schwester. »Ich habe wundervolle Neuigkeiten.«
»Sag bloß … Erling hat die Stelle bekommen?«
Dagny nickte. »Er hat mich vor einer Stunde angerufen. Nächsten Monat kann er anfangen. Er sieht sich schon nach einer passenden Wohnung für uns um.«
»Dir kann es wohl gar nicht schnell genug gehen«, sagte Johanne mit mildem Spott.
»Stimmt, ich kann es kaum erwarten. Hier fällt mir buchstäblich die Decke auf den Kopf. Einen weiteren Winter in diesem Kaff würde ich nicht überstehen! Ich würde jämmerlich eingehen wie eine Primel!«, rief Dagny und schüttelte sich.
Johannes Mundwinkel zuckten. Dagnys Hang zu theatralischen Übertreibungen amüsierte sie. Das Leben ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester glich einem Wildbach, der ungestüm in seinem kurvigen Bett rauschte, sich über Felskanten stürzte und kaum jemals ruhig dahinfloss. Einige Monate zuvor hatte Dagny den Marineoffizier Erling Borre geheiratet, der im Hauptquartier der norwegischen Flotte auf der nördlich des Stadtzentrums gelegenen Halbinsel stationiert war. Die beiden bewohnten eines der schmucken Häuschen am Ufer von Karljohansvern, die den gehobenen Rängen und ihren Familien zur Verfügung standen, während die Mannschaftsgrade in mehrstöckigen Kasernen untergebracht waren. Erling bekleidete nach seiner Ausbildung an der Marineschule und einem Ingenieurstudium einen verantwortungsvollen Posten in der U-Boot-Werft. Zur Überraschung seiner Vorgesetzten und Kameraden hatte er sich nun in der Hauptstadt an der ehrwürdigen Militärakademie als Lehrer beworben. In Norwegens ältester Lehranstalt wurde die Elite des Heeres unterrichtet.
Johanne hegte den Verdacht, dass Erling nicht aus beruflichem Ehrgeiz seine Heimatstadt verlassen wollte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er seine Stellung in der Werft wohl nicht aufgegeben. Es war das kulturelle und gesellschaftliche Leben von Oslo, das ihn zu diesem Schritt bewogen hatte. Nicht um seiner selbst willen, sondern um seiner acht Jahre jüngeren Frau einen Gefallen zu erweisen. Dagnys Unternehmungslust waren in Horten enge Grenzen gesetzt. Erling hatte offensichtlich erkannt, dass er ihr einiges an Unterhaltung und Abwechslung bieten musste, um sie bei Laune zu halten, nachdem er ihr Herz mit einer stürmischen Werbung rasch erobert hatte. Ihr Vater war mit seinem Rat, sich eine längere Bedenkzeit zu nehmen und nicht Hals über Kopf zu heiraten, abgeblitzt. Weinend hatte Dagny ihm vorgeworfen, sich ihrem Glück in den Weg stellen zu wollen, und erklärt, ihre Liebe zu Erling sei unsterblich und jeder Tag ohne ihn eine unerträgliche Qual. Olof Rev hatte auf ein Machtwort verzichtet – wohl wissend, dass er damit nicht nur nichts erreichen, sondern im Gegenteil weitere impulsive Ausbrüche provozieren würde. Er hatte Johanne seine Befürchtung anvertraut, Dagny sei noch zu unreif für den Schritt in die Ehe, und damit ihren eigenen Eindruck bestätigt. »Nun, es hat keinen Sinn, sie vor sich selbst beschützen zu wollen«, hatte er schließlich geseufzt, tief durchgeatmet und Johannes Hand gedrückt. »Zum Glück hat mich das Schicksal mit einer Tochter beschenkt, auf deren Besonnenheit und Vernunft ich mich verlassen kann.«
Dagny war zweifellos nach wie vor in ihren schneidigen Offizier verliebt. Doch selbst die heißeste Leidenschaft konnte erkalten und im Alltagstrott versumpfen. Erling würde gut daran tun, seinem sommerfugl – seinem Schmetterling – ein abwechslungsreiches Blumenbeet zu bieten, wo Dagny von Blüte zu Blüte flattern konnte und nicht Gefahr lief, des Immergleichen überdrüssig zu werden. Johanne wunderte es nicht, dass für ihre Schwester das Dasein als Hausfrau rasch den Reiz des Neuen verloren hatte. Nachdem sie ihr Heim mit Hingabe nach ihrem Geschmack eingerichtet und einige Einladungen gegeben hatte, um es Freunden und Verwandten zu präsentieren, begann Dagny, sich zu langweilen. Die Hoffnung ihrer Mutter, ihre ungestüme Tochter würde im Ehestand zur Ruhe kommen, hatte sich nicht erfüllt. Ihr Ansinnen, Dagny solle ihrem Leben durch Kinder Sinn und Inhalt geben, wies diese von sich. Eben erst volljährig geworden, wollte sie sich diese Verantwortung noch nicht aufbürden. Dazu war ihrer Ansicht nach später Zeit genug. Jetzt wollte sie erst einmal in vollen Zügen ihre Freiheit genießen, etwas von der Welt sehen und sich vergnügen.
Dagny sah Johanne forschend an. »Zieht es dich denn nicht auch fort von hier? Sehnst du dich nie nach einem aufregenderen Leben?«
Johanne erwiderte ihren Blick. »Darüber hab ich nie nachgedacht. Hm … nein, eigentlich nicht. Ich fühle mich wohl so, wie es jetzt ist.«
Dagny rümpfte die Nase, zuckte mit den Schultern und sprang die beiden Stufen zur Ladentür hoch.
»Aber ich freue mich sehr für dich«, fuhr Johanne fort. »Auch wenn ich dich vermissen werde.«
»Du musst uns eben recht oft besuchen. Oslo ist ja nicht aus der Welt.«
Johanne nickte und folgte ihrer Schwester in die Schneiderei, wo ihnen Herr Holt mit einem beflissenen Lächeln entgegenkam und sie ins Hinterzimmer führte. Während sie sich hinter einem Paravent bis auf die Unterwäsche und die Strümpfe entkleidete, dachte Johanne über Dagnys Frage nach. Sie hatte tatsächlich noch nie den Wunsch verspürt, Horten den Rücken zu kehren und an einem anderen Ort zu leben. Ihre Heimatstadt mochte klein sein und wenig Zerstreuung bieten, doch die Lage am Fjord, umrahmt von fruchtbaren Wiesen, bewaldeten Hügeln und Seen, machte diesen Mangel in Johannes Augen wett. Die Möglichkeit, direkt von ihrem Haus aus stundenlange Spaziergänge zu unternehmen oder sich im Sommer an einem der Strände aufzuhalten, mochte sie nicht missen. Die bevorstehende Veränderung ihres Lebens würde überdies für ausreichend Abwechslung sorgen.
Bei der Vorstellung, sich in wenigen Tagen von Fräulein Rev in Frau Falkensten zu verwandeln, kribbelte es in Johannes Magen. Wie mag es sich anfühlen, einem eigenen Hausstand vorzustehen, fragte sie sich. Nach eigenem Gutdünken schalten und walten zu können. Nicht länger die behütete Tochter zu sein, sondern eine Ehefrau. Und vielleicht bald auch Mutter? Hoffentlich will Rolf auch viele Kinder, dachte sie. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich will mindestens drei.
Dagny lugte um die Ecke des Wandschirms und hielt ihr das Unterkleid aus elfenbeinfarbenem Kreppstoff hin. Johanne schlüpfte hinein, hielt die Arme hoch und ließ sich von ihrer Schwester das gleichfarbige Hochzeitsgewand aus durchscheinendem Tüll überstreifen. Es hatte einen mit Perlen verzierten V-Ausschnitt und war an Saum und Ärmeln mit Blüten bestickt. Nachdem Johanne die Druckknöpfe an der Seite geschlossen hatte, trat sie hinter dem Paravent hervor und stellte sich vor den Spiegel in der Mitte des Zimmers. Dagny ging mit prüfendem Blick um sie herum. Der Schneidermeister kam herein, schnalzte mit der Zunge und deutete eine Verbeugung an.
»Ihr Verlobter darf sich sehr glücklich schätzen, Fräulein Rev. So eine hübsche Braut sieht man nicht alle Tage.«
Das sagt er vermutlich zu jeder Frau, die sich von ihm ihr Hochzeitskleid schneidern lässt, schoss es Johanne durch den Kopf. Gleichzeitig fühlte sie sich von dem Kompliment geschmeichelt und lächelte ihrem Spiegelbild zu. Sie spürte ihr Herz schneller schlagen und sah, wie sich ihre Wangen röteten. Nur noch eine knappe Woche, dann schreite ich durch den Mittelgang der Garnisonskirche, dachte sie. Sie glaubte, die festliche Orgelmusik zu hören, und sah Rolf in einem maßgeschneiderten Anzug am Altar stehen, die Augen in feierlichem Ernst auf sie geheftet und … und später dann, nach dem Gottesdienst, dem Festmahl und den Reden würden sie in den Zug nach Oslo steigen und von dort mit dem Schiff nach Kopenhagen fahren, der ersten Station ihrer Flitterwochenrundreise durch Dänemark und Schweden. In der Kabine des Dampfers würden sie beide zum ersten Mal ganz allein und ungestört sein. Das Kribbeln in ihrem Bauch kehrte zurück. Wie wird sie wohl sein, unsere Hochzeitsnacht?
»Den Rock dürfen Sie aber gern noch eine Handbreit kürzen, Herr Holt«, drang Dagnys Stimme in ihre Fantasie. Sie beugte sich zu Johanne und flüsterte: »Sonst sieht man ja gar nichts von deinen hübschen Beinen.«
Johanne kicherte.
»Ich werde es gleich abstecken«, sagte der Schneidermeister. »Zuvor möchten Sie sich vielleicht aber erst noch einen Eindruck vom gesamten Ensemble …« Er öffnete eine längliche Schachtel und entnahm ihr eine Haube und eine lange Schleppe, die aus demselben Schleiergewebe wie das Oberkleid gefertigt waren.
»Sie erlauben.« Er setzte Johanne die Haube auf den Kopf, die mit Seidenröschen verziert war, befestigte den Schleier an den dafür vorgesehenen Häkchen und drapierte ihn über ihre Schultern und in gekonntem Schwung um ihre Füße.
»Die Seidenschuhe müssen Sie sich dazudenken. Ich erwarte sie morgen mit einer Lieferung aus Oslo.«
Die Türglocke ertönte. Herr Holt machte eine entschuldigende Geste und verschwand in den Verkaufsraum. Johanne begutachtete sich mit angehaltenem Atem.
»Du siehst wirklich ganz bezaubernd aus«, sagte Dagny. »Wenn du dich jetzt noch dazu entschließen könntest, die Haare endlich kürzer …«
Johanne schüttelte den Kopf. »Nein, das würde mir Rolf nie verzeihen. Er ist ganz vernarrt in meine Zöpfe.«
Vor ihrem inneren Auge tauchte das Büro im Hotel Falkensten von Rolfs Familie auf, in dem sie drei Tage zuvor die Speisefolge des Festmenüs mit ihrem Bräutigam und seiner Mutter besprochen hatte. Als Letztere kurz weggegangen war, um einem Zimmermädchen eine Anweisung zu geben, hatte Rolf die Gelegenheit genutzt und Johanne an sich gezogen. Während er sie küsste, hatte er eine Hand über ihren Zopf gleiten lassen und geflüstert: »Ich kann es kaum erwarten, dein Haar zu lösen und dich nur damit bedeckt vor mir zu sehen.«
Die Erinnerung trieb Johanne erneut die Röte ins Gesicht.
»Und als brave Ehefrau in spe würdest du natürlich nie etwas tun, was deinem Göttergatten missfällt«, stichelte Dagny weiter.
Johanne fuhr zusammen und wedelte mit gespielter Empörung mit dem Zeigefinger. »Nur weil du immer deinen Kopf durchsetzt, muss das nicht für jeden der Weg zum Glück sein. Was schadet es, ab und zu anderen einen Gefallen zu tun oder eine Freude zu bereiten?«
Dagnys Miene verfinsterte sich. »Bla, bla, bla! Ich kann’s nicht mehr hören! Johanne, die Selbstlose, die immer das Wohl der anderen im Sinn hat«, zischte sie und verdrehte die Augen. »Und ich bin mal wieder die Egoistin, die nur an sich selbst denkt.«
»Aber das hab ich doch gar nicht gesa…«
»Gesagt vielleicht nicht. Aber gedacht«, fiel Dagny ihr ins Wort. »So wie Vater. Der hält mich auch für oberflächlich und eigensüchtig.«
»Das ist ungerecht!«, rief Johanne. »Außerdem weißt du genau, dass es nicht stimmt.«
»So, weiß ich das? Warum kriege ich dann immer zu hören, dass ich mir ein Beispiel an dir nehmen soll? Und wann ich endlich so vernünftig und uneigennützig werde wie du?« Dagny funkelte sie an. »Ich hab’s so satt! Es liegt mir eben nicht, mich ständig einzuschleimen.«
Johanne schluckte. Der Angriff ihrer Schwester hatte sie überrumpelt. Die Freude an dem hübschen Kleid und auf die Hochzeit war verflogen.
Die Rückkehr des Schneidermeisters enthob sie einer Antwort. Dagny setzte sich auf einen Stuhl und blätterte in einem Modejournal. Johanne nahm die Haube mit der Schleppe ab und stellte sich auf einen Schemel. Am liebsten hätte sie sich wieder umgezogen und die Schneiderei verlassen. Es kostete sie Überwindung, still zu stehen, während Herr Holt den Saum des Brautkleides absteckte. Verstohlen schaute sie zu Dagny, die einen Schmollmund machte und ihrem Blick auswich.
Hat sie recht, fragte sich Johanne. Bin ich wirklich so?
3
Emden, Ostfriesland, Frühling 1980 – Rike
Kaum hatte die Greetje am Schlepperanleger festgemacht, stieg Swantje an Bord.
Ihr Mann lief ihr entgegen. »Ist was mit Lieske?«, rief er und fasste sie an den Schultern.
Während Rike die Motoren ausschaltete, beobachtete sie die beiden und Marten, der zu ihnen getreten war, durch das Fenster des Führerhauses. Swantje schüttelte den Kopf. Gott sei Dank, dachte Rike und atmete erleichtert aus. Die einzige Tochter von Eilert und Swantje hatte von Geburt an eine zarte Gesundheit, die ihren Eltern immer wieder Anlass zur Sorge gab. Für sie selbst war die zwölf Jahre ältere Lieske wie eine große Schwester, zu der sie mit Bewunderung aufblickte. Nicht nur, weil sie bereits im zarten Alter von siebzehn Jahren die Räucherstube übernommen hatte, die Swantjes Familie seit Generationen neben ihrem Haupterwerb, dem Fischfang, betrieb. Rike war vor allem beeindruckt von Lieskes heiterer Gelassenheit, die sie selbst dann nicht einbüßte, wenn sie wieder einmal zu einer längeren Bettruhe gezwungen war. Außerdem imponierten ihr Lieskes klarer Blick auf die Menschen und ihr feines Gespür für Stimmungen. In ihr hatte Rike eine verständnisvolle Freundin, die ihr – ohne jemals aufdringlich zu sein – stets zuhörte, ihre Kümmernisse ernst nahm und auf ihrem Weg ins Erwachsenendasein »Frauenfragen« beantwortete, die sie nicht mit ihrem Großvater besprechen wollte. Ohne diesen und Lieske hätte sie in den vergangenen Jahren ihre Mutter gewiss stärker vermisst.
Swantje sagte etwas, das Rike nicht verstehen konnte. Sie sah, wie Marten die Lippen zusammenpresste und Eilert bleich wurde. Alle drei drehten sich zu ihr. Rike begann zu zittern. Ihre Beine setzten sich wie von selbst in Bewegung und trugen sie aus dem Steuerhaus hinunter aufs Deck. Swantje war mit drei Schritten bei ihr und nahm sie in die Arme. Noch bevor sie zu sprechen anfing, wusste Rike, dass Opa Fiete etwas zugestoßen war. Wie aus weiter Ferne hörte sie Swantjes Stimme.
»… zusammengebrochen. Zum Glück hab ich gerade draußen Wäsche aufgehängt und gleich den Notarzt gerufen. Der hat ihn sofort ins Krankenhaus gefahren.«
Vor Rikes geistigem Auge tauchte die aufrechte Gestalt ihres Großvaters auf, wie er seinem allmorgendlichen Ritual folgend in den Garten hinterm Haus ging und sich ein frisch gelegtes Ei aus dem Hühnerstall holte. Sie glaubte, das »Moin, moin, all mien Kükeltjes« zu vernehmen, mit dem er seine ostfriesischen Möwen – sechs Hennen mit silbergrauer Flockung und einen weißen Gockel mit schwarzen Schwanzfedern – nach der Nacht begrüßte und in ihren eingezäunten Auslauf entließ. Den Namen verdankte diese alte Hühnerrasse der Daunenzeichnung der Küken, die an die von jungen Möwen erinnerte. Rike sah Opa Fiete auf dem Rückweg zur Terrassentür einen prüfenden Blick auf die Setzlinge im Salatbeet und die Knospen des Apfelbaums werfen und hörte ihn die Melodie eines Seemannsliedes summen. Es gelang ihr jedoch nicht, ein Bild zu beschwören, in dem er sich ans Herz griff, zusammensackte, auf dem Rasen lag und nicht imstande war, aus eigener Kraft wieder aufzustehen.
»Er ist auf der Intensivstation«, antwortete Swantje auf Eilerts Frage, der sich nach dem Zustand seines alten Freundes erkundigt hatte. »Er hatte einen schweren Herzinfarkt. Als ich zu euch aufgebrochen bin, war er noch nicht wieder bei Bewusstsein. Und vielleicht wird er es auch nie …«
»Nein!«, fiel Rike ihr ins Wort, befreite sich aus Swantjes Armen und ballte die Fäuste. »Opa ist kerngesund! Es war sicher nur ein kleiner Schwächeanfall.«
Sie mied Swantjes Blick. Sie wollte den Schmerz und das Mitleid darin nicht sehen, wollte nicht wahrhaben, was sie tief in ihrem Inneren wusste.
Eilert nickte seiner Frau zu. »Fahrt zu ihm. Ich komme so schnell wie möglich nach.«
»Aber meine Schicht ist noch nicht zu Ende«, sagte Rike.
Eilert legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Geh, er braucht dich jetzt.«
Rike folgte Swantje zu deren orangefarbenem VW-Käfer, den sie an der Hafenstraße geparkt hatte, und setzte sich wortlos auf den Beifahrersitz. Dabei wiederholte sie im Stillen unablässig: Bitte, lass es nicht wahr sein! Bitte, lieber Gott!, und presste ihre Hände fest ineinander. Ohne etwas wahrzunehmen, schaute sie aus dem Fenster. Erst als Swantje die Nesserlander Straße nicht an der Kreuzung Am Tonnenhof verließ, um auf die Petkumer Straße zu gelangen, erwachte Rike aus ihrer Erstarrung. Die Frage, wohin sie fuhren, blieb ihr in der Kehle stecken. Natürlich, zum Klinikum, gab sie sich selbst die Antwort. Sie spürte, wie ihre Hände feucht wurden. Beim Anblick des mehrstöckigen Backsteinbaus, den sie wenige Minuten später erreichten, stöhnte sie auf.
Swantje, die ihr Schweigen bis dahin nicht unterbrochen hatte, legte kurz ihre Hand auf Rikes Oberschenkel. Sie räusperte sich. »Weißt du, wo deine Mutter ist?«, fragte sie heiser.
»Nicht genau«, entgegnete Rike. »Warum willst du das …« Sie hielt inne. So schlimm also stand es! Sie schluckte. »Irgendwo in der Südsee«, fuhr sie fort. »Vor einer Woche hat sie angerufen. Da war sie gerade im Hafen von Puerto Rico.«
Ihre Mutter Beate arbeitete seit einiger Zeit für die britische Cunard Line als Rezeptionistin auf einem Kreuzfahrtschiff, das überwiegend in der Karibik unterwegs war.
»Wir sollten sie so rasch wie möglich informieren«, sagte Swantje.
Sie lenkte den Wagen auf den Besucherparkplatz des Krankenhauses, das nach dem Krieg nördlich des Zentrums im Stadtteil Barenburg errichtet worden war.
»Am besten rufe ich gleich mal in Borkum an«, fuhr Swantje fort, nachdem sie ausgestiegen waren und zum Haupteingang liefen.
Rike nickte. Auf der Insel befand sich eine Küstenfunkstelle, die der Vermittlung von Funktelegrammen und -gesprächen zwischen Schiffen und den Fernmeldenetzen an Land diente.
Im Krankenhaus begaben sie sich direkt zur Intensivstation. Eine Schwester teilte ihnen mit, dass der Patient das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt hatte, und bot an, Rike zu seinem Zimmer zu führen. Swantje wollte später zu ihr stoßen – nach dem Telefonat mit seiner Tochter Beate. Wie würde diese wohl auf die Nachricht vom besorgniserregenden Zustand ihres Vaters reagieren? Rike wusste keine Antwort darauf. Das Verhältnis der beiden war eines der ungelösten Rätsel, die ihre Mutter ihr aufgab. Sie wusste, dass Opa Fiete sich mehr Kontakt zu seiner Tochter gewünscht hätte, sich aber damit abgefunden hatte, sie so selten zu sehen. »Dafür hat sie mir dich geschenkt«, hatte er einmal gesagt, als Rike ihn tröstete, weil Beate kurzfristig einen Besuch abgesagt hatte.
Sie folgte der Krankenschwester und saß kurz darauf am Bett ihres Großvaters. Im ersten Augenblick war sie überzeugt, sich im falschen Zimmer zu befinden. Diese eingefallenen Wangen, die durchsichtig wirkende Haut und der fahle Teint waren ihr fremd, hatten nichts mit dem freundlichen, rotwangigen Gesicht gemein, mit dem Opa Fiete sie drei Tage zuvor verabschiedet hatte. Vorsichtig griff sie nach seiner Hand, die neben seinem Körper ruhte. Zu ihrer Erleichterung war sie warm. Das Fremdheitsgefühl verflüchtigte sich ein wenig, als sie die vertrauten Schwielen auf der Innenfläche spürte. Sie versuchte, das Piepen des EKG-Geräts auszublenden und nicht auf den Monitor der Herzkreislaufüberwachungseinheit zu schauen, auf dem Zahlen und Kurven blinkten. Wenigstens wird er nicht künstlich beatmet, dachte sie. Das ist doch gewiss ein gutes Zeichen. Rike streichelte die Hand ihres Großvaters und beschwor ihn stumm, seine Kräfte zu sammeln, gegen das lauernde Nichts anzukämpfen und sie nicht zu verlassen.
Nach einer Weile begannen seine Lider zu flattern. Er öffnete die Augen einen Spaltbreit, fixierte Rike und verzog den Mund zu einem Lächeln. Sie beugte sich näher zu ihm. Bevor sie etwas sagen konnte, flüsterte er: »Johanne!« Es klang überrascht. Und sehr glücklich.
Rike runzelte die Stirn. »Nein, ich bin es. Rike. Deine Enkelin.«
Verwirrt blinzelte er. Ein Schatten flog über sein Gesicht. Er schloss die Augen.
»Opa!«, flüsterte Rike. »Bitte bleib bei mir.«
Ihre Kehle verengte sich. Sie spürte, wie er ihre Hand drückte. Einen Atemzug später veränderte sich das Geräusch des EKGs. Die in regelmäßigen Abständen aufeinanderfolgenden Töne kamen ins Stolpern und wurden schließlich von einem lang anhaltenden Piepsen abgelöst.
»Nein!« Rike sprang auf, rannte zur Tür und rief um Hilfe. Sofort eilte eine Krankenschwester herbei, dicht gefolgt von einem Arzt. Sie drängten Rike beiseite und machten sich am Bett zu schaffen. Sie versuchte, zwischen ihnen hindurch einen Blick auf ihren Großvater zu erhaschen, und trat näher.
»Komm, Liebes. Hier stehen wir nur im Weg.« Unbemerkt von ihr war Swantje hereingekommen. Sie fasste Rike am Arm und zog sie aus dem Raum.
»Was geschieht mit ihm?«, schluchzte Rike. »Gerade eben ist er aufgewacht. Und jetzt …« Ihre Stimme brach.
Swantje drückte sie auf einen der Stühle, die an der Wand im Gang festgeschraubt waren. Ihr Bericht vom Telefonat mit Beate rauschte an Rikes Ohren vorbei. Sie hatte ihre Augen auf die Tür geheftet, hinter der ihr Großvater lag, und zerrte und verdrehte ihre Mütze, die sie sich vom Kopf gezogen hatte, mit beiden Händen. Eilerts Eintreffen registrierte sie nur am Rande, ebenso die Frage, ob sie etwas zu trinken wolle. Sie schüttelte stumm den Kopf und starrte weiter auf die Tür. Endlich wurde sie geöffnet, und der Arzt kam heraus. Der Ausdruck des Bedauerns auf seinem Gesicht traf Rike wie ein Schlag in den Bauch. Sie krümmte sich zusammen und legte die Arme um ihren Kopf. Sie wollte nichts mehr sehen und hören. Ich halte das nicht aus, schrie es in ihr. Das darf nicht sein! Nicht Opa Fiete!
4
Horten, Norwegen, Juni 1926 – Johanne
Nach der Anprobe des Hochzeitskleides geleitete Schneidermeister Holt die Schwestern zum Ausgang und verabschiedete sich mit einer Verbeugung. Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, wandte sich Johanne an Dagny.
»Du, wegen vorhin … ich wollte dich wirklich nicht zurechtweisen und …«
»Ach, ist schon vergeben und vergessen«, rief Dagny und warf einen Blick auf ihre Armbanduhr.
Johanne kämpfte kurz mit sich. Einerseits war sie erleichtert, dass der Streit beigelegt und Dagnys finstere Laune verflogen war. Sie hatte im Augenblick genug andere Dinge im Kopf, um die sie sich kümmern musste. Andererseits blieb ein schaler Nachgeschmack. Dagnys Art, Konflikte und Unstimmigkeiten zu übergehen oder herunterzuspielen, irritierte sie nicht zum ersten Mal. Sie kam sich bei solchen Gelegenheiten so vor, als befände sie sich auf schwankendem Moorgrund, der jederzeit nachgeben oder unvermutet Dinge zutage fördern konnte, die sie selbst längst vergessen hatte, die sich für ihre Schwester jedoch wie eben geschehen anfühlten. Ihre Versuche, strittige Punkte zu klären und so ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, stießen zu ihrem Leidwesen bei Dagny auf wenig Gegenliebe. Für diese waren derartige Vorstöße nur ein weiterer Beweis für Johannes Pedanterie, während sie sich selbst dem Motto verschrieben hatte: Man muss auch mal alle fünfe gerade sein lassen. Manchmal beneidete Johanne ihre Schwester insgeheim um diese Haltung, die es ihr erlaubte, sich unbekümmert dem Jetzt hinzugeben. Gleichzeitig fragte sie sich, wie Dagny mit Situationen umgehen würde, die sich nicht mit einem Lächeln wegwischen ließen. Zum Beispiel mit einer handfesten Ehekrise oder einer Meinungsverschiedenheit, die an ihren innersten Überzeugungen und Werten rüttelte.
»Hast du Lust auf ein Picknick?«, fragte Dagny. »Ich bin vorhin zufällig Ellen über den Weg gelaufen. Sie trifft sich über Mittag mit ein paar Freunden im Lystlunden Park und hat mich eingeladen, mit von der Partie zu sein. Sie hat gewiss nichts dagegen, wenn du mitkommst.«
Johanne zog die Stirn kraus. »Welche Ellen?«
»Ellen Knudsen.«
Johanne sah Dagny ratlos an.
»Na, die Tochter von Doktor Knudsen.«
»Dem Garnisonsarzt?«
Dagny nickte.
»Ich wusste gar nicht, dass du mit ihr befreundet bist«, sagte Johanne, die sich nur vage an Ellen Knudsen erinnerte, ein junges Mädchen, das in der Schule fünf oder sechs Klassen unter ihr gewesen war.
»Du weißt so einiges nicht«, murmelte Dagny und fuhr lauter fort: »Sie geht auch oft zu den Filmvorführungen im Lichtspielhaus, da haben wir uns kennengelernt.« Sie lief los. »Also, was ist, kommst du mit?«
»Warte!«, rief Johanne und hielt sie am Ärmel fest. »Wir wollten doch bei Vater im Kontor vorbeischauen.«
Dagny zuckte mit den Schultern. »Das können wir auch ein anderes Mal, oder?«
Johanne zog die Augenbrauen hoch. »Aber du hast doch gestern selbst …«
Dagny schob die Unterlippe vor. Johanne verstummte und verbiss sich die Bemerkung, dass diese Idee von Dagny gekommen war. Als sie Johanne am Tag zuvor bei einem Telefonat angeboten hatte, sie zur Anprobe des Brautkleids zu begleiten, hatte sie vorgeschlagen, ihn zu einem Imbiss abzuholen, und zerknirscht zugegeben: »Ich habe Vater schon viel zu lange vertröstet.« Johanne hatte bereitwillig zugestimmt, wusste sie doch, wie sehr ihr Vater sich über die seltenen Gelegenheiten freute, »seine beiden Mädchen« einmal ganz für sich zu haben.
Dagny hakte sich bei ihr unter. »Vater versteht das sicher. Bei dem herrlichen Wetter muss man einfach raus.«
Johanne verzichtete auf den Hinweis, dass sie auch mit ihrem Vater die Mittagspause im Freien verbringen konnten. Es hatte keinen Sinn, Dagny ein schlechtes Gewissen zu machen und sie zu zwingen, ihre Pläne zu ändern. Es würde nur zu neuerlichem Schmollen führen. »Ein anderes Mal komm ich gern mit«, sagte sie und löste sich von Dagny. »Ich muss heute noch so viel erledigen und …«
Dagny öffnete den Mund zu einer Erwiderung. Bevor sie weiter in sie dringen konnte, fuhr Johanne rasch fort: »Aber ich wünsche dir viel Spaß und werde Vater Grüße von dir ausrichten.«
»Oh ja, unbedingt!«, sagte Dagny. Auf ihrem Gesicht machte sich Erleichterung breit. »Ich begleite dich noch ein Stück.« Sie wandte sich zum Gehen. Dabei wäre sie um ein Haar mit einem Herrn zusammengestoßen, der eben zusammen mit einer Frau aus dem Haus neben der Schneiderei kam. Der Mittvierziger mit Schnauzbart, steifem Hemdkragen und gebügeltem Einstecktüchlein in der Brusttasche seiner Anzugjacke musterte sie mit finsterer Miene. Auch der Gesichtsausdruck seiner Begleiterin, deren rundliche Figur von einem hellblauen Cape umhüllt wurde, verschloss sich beim Anblick der beiden Schwestern.
Johanne seufzte innerlich. Dass sie ausgerechnet jetzt auf die Trulsens treffen mussten! Seit sie denken konnte, begegnete das Ehepaar ihrer Familie mit unverhohlener Abneigung und hatte einst ihren beiden Söhnen, die die gleiche Schule wie Dagny und Johanne besucht hatten, strikt den Umgang mit der Rev’schen Brut untersagt. Als Kind hatte Johanne sehr unter dieser – für sie unbegreiflichen – Ächtung gelitten. Die Erklärung ihres Vaters, Herr Trulsen sei nicht mit seinem Beruf einverstanden, war da wenig hilfreich gewesen. Was war verkehrt daran, Wein, Champagner, Sherry und Madeira aus Frankreich, Spanien und Portugal sowie schottischen Whisky oder italienischen Grappa zu verkaufen? Warum war das weniger ehrbar als der Handel mit Pelzen, den Herr Trulsen betrieb? In den Augen der kleinen Johanne war Letzteres sehr viel verdammenswerter, mussten doch unschuldige Tiere ihr Leben lassen, das sie zuvor oft unter grausamen Bedingungen in engen Käfigen gefristet hatten.
Erst später wurde ihr klar, dass die Wein- und Spirituosenhandlung ihres Vaters in den Augen von Herrn Trulsen nichts weniger war als das Einfallstor zur Hölle. Als Vorsitzender des örtlichen Abstinenzlerverbandes hatte er sich den Kampf gegen den Alkoholismus auf die Fahnen geschrieben und plädierte für eine absolute Verbannung »geistiger Getränke« jeder Art. Als Ende des Weltkrieges ein striktes Verbot eingeführt worden war, sahen sich er und seine Mitstreiter der Erfüllung ihres Traums von einem »trockenen« Norwegen sehr nahe. Lediglich Dünnbier und leichte Tafelweine durften verkauft und ausgeschenkt werden.
Die Forderung der Abstinenzbewegung, auch die Einfuhr und den Verkauf von Wein unter kommunale Verantwortung zu stellen, wurde nicht erfüllt. Zu groß war das Risiko, es sich mit Handelspartnern wie Spanien, Italien und Frankreich zu verscherzen, den Hauptabnehmern von Norwegens wichtigstem Exportgut, dem Fisch. Denn diese waren zugleich die Hauptlieferanten von Südweinen und hochprozentigen Spirituosen. Als eine Art Kompromiss wurde die Errichtung eines Monopolverkaufs unter staatlicher Kontrolle beschlossen. Die Geburtsstunde des Vinmonopolet schlug am 30. November 1922. Auch Johannes Vater hatte damals eine Lizenz erworben.
»Guten Tag, Frau Trulsen, guten Tag, Herr Trulsen«, sagte Dagny und setzte ein beflissenes Lächeln auf.
Der Pelzhändler rang sich eine knappe Erwiderung ab und ging an ihr vorbei.
»Ich hoffe, Ihr rheumatisches Leiden hat sich gebessert«, fuhr Dagny an seine Frau gewandt fort.
Johanne bemerkte, wie diese zusammenzuckte und blass wurde.
»Sie müssen mich verwechseln, ich habe keine derartigen Beschwerden«, stieß Frau Trulsen hervor. Dabei warf sie Dagny einen Blick zu, in dem etwas Beschwörendes lag, als wolle sie sie zum Schweigen bringen.
Ihr Mann blieb stehen, zog die Brauen zusammen und öffnete den Mund. Bevor er etwas sagen konnte, legte sie ihre Hand auf seinen Unterarm und zog ihn weiter. »Komm, sonst verspäten wir uns noch.«
Johanne, die den kurzen Wortwechsel stumm verfolgt hatte, sah ihre Schwester fragend an. Dagny grinste, hakte sich erneut bei ihr unter und setzte sich in Bewegung.
»Was sollte das? Warum fragst du Frau Trulsen nach ihrem Befinden? Und woher weißt du überhaupt, dass sie Rheuma hat?«
»Ich hab so meine Quellen. Wobei ich dich beruhigen kann: Die gute Frau ist kerngesund.«
»Das hat sie ja auch gesagt. Aber …«
»Aber dennoch lässt sie sich regelmäßig etwas zum Einreiben ihrer angeblich schmerzenden Gelenke verschreiben«, fiel Dagny ihr ins Wort. »Du verstehst schon. Hochprozentiges zur besseren Durchblutung.« Sie zwinkerte, hob ein imaginäres Glas an die Lippen und machte eine schluckende Bewegung.
Johanne verengte die Augen. »Du meinst, sie …«
»… zwitschert ganz gern mal einen«, beendete Dagny ihren Satz.
Johanne schüttelte den Kopf. »Das ist nicht dein Ernst!«
Dass ausgerechnet Frau Trulsen eine Vorliebe für Branntwein hatte, konnte sie kaum glauben. Die Gattin des Pelzhändlers engagierte sich mindestens ebenso stark im Temperenzlerverein wie ihr Mann. Regelmäßig organisierte sie Informationsveranstaltungen für Frauen, bei denen Vorträge zu Themen wie »Die Zerstörung des Familienglücks durch Alkohol« oder »Das Übel bei der Wurzel packen« gehalten wurden.
»Oh doch!«, sagte Dagny. »Es ist ihr kleines, schmutziges Geheimnis. Ihr Mann weiß natürlich nichts davon.«
»Aber du schon.«
Dagny kicherte. »Ellen hat’s mir erzählt. Anscheinend ist Frau Trulsen auf der Suche nach einem Arzt, der ihr ein Rezept für ihre Hausmedizin ausstellt, bei ihrem Vater abgeblitzt. Doktor Knudsen ist sehr korrekt und nicht bereit, gegen Krankheiten, die er auch nach eingehender Untersuchung nicht feststellen kann, etwas zu verschreiben. Schon gar nicht, wenn die Patienten auf alkoholhaltiger Arznei bestehen.«
Mittlerweile hatten sie die Ecke zur Falsensgata erreicht, wo sich ihre Wege trennten.
Dagny küsste Johanne auf die Wange. »Ich muss mich sputen. Wir sehen uns ja bald!«
Johanne schaute ihr kurz nach, wie sie die Langgata weiter hinunter Richtung Kanal lief, an dessen Ufer der Park angelegt war, bevor sie selbst um die Ecke bog, um zur Storgata und dem Geschäft ihres Vaters zu gelangen. Die Enthüllung über Frau Trulsens heimliches Laster beschäftigte sie noch, als sie die Hauptstraße ihres Heimatstädtchens Richtung Süden hinaufging. Rechts und links der Fahrbahn verliefen mit Steinplatten belegte Gehsteige, die von ein- und zweistöckigen Häusern gesäumt wurden. In vielen von ihnen waren Geschäfte, Werkstätten, Büros und Praxen untergebracht, die mit Aushängeschildern, Schaufensterauslagen und Werbetafeln um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden und Klienten warben. Das schöne Wetter hatte viele Angestellte, Ladeninhaber und Anwohner in ihrer Mittagspause ins Freie gelockt. Johanne sah einige Handwerksburschen auf den Stufen eines Hauseingangs vespern, eine Matrone mit Spitzenhaube saß dösend auf einem Stuhl, den sie vor die Wand ihres Hauses gestellt hatte, zwei junge Frauen schoben – angeregt miteinander plaudernd – Kinderwagen, und das Verdeck einer vorüberfahrenden Autodroschke war zurückgeschlagen. Kurz vor der Kreuzung Storgata und Thranesgata wurde Johanne von einer Gruppe Schulkinder überholt, die auf dem Heimweg von der in der Nähe liegenden Mittelschule lachend und sich gegenseitig neckend an ihr vorbeirannten.
Wenige Schritte später überquerte sie die Straße und erreichte das einstöckige Haus, in dessen Erdgeschoss sich Revs Vinhandel befand. Im oberen Geschoss hatte sich Johannes Vater sein Büro eingerichtet sowie einen Raum zur Aufbewahrung besonders edler und wertvoller Tropfen. Zwei weitere Zimmer bewohnte Ingvald Lundalm, sein langjähriger Angestellter. An der rechten Seite öffnete sich ein Torbogen zum Hinterhof, wo ein ehemaliger Stall als Garage für den Lieferwagen diente und eine Bodenklappe zum Keller eingelassen war, in dem Flaschen und Fässer lagerten. Außerdem gab es dort eine weitere Tür zum Geschäft und zur Stiege in den ersten Stock. Die Hausfassade zur Straße hin war hellgelb gestrichen. Zwei Schaufenster rahmten die Eingangstür ein, über der ein großes Blechschild angebracht war. Darauf saß neben dem Schriftzug Revs Vinhandel ein Fuchs in Frack und Zylinder und hielt ein Weinglas hoch.
Johanne stellte sich vor eine der großen Glasscheiben, beschattete ihre Augen und spähte ins Innere. Der Laden war menschenleer – bis auf Ingvald Lundalm, einen ergrauten, hageren Mann um die fünfzig, der hinter dem Verkaufstresen saß und in eine Zeitung vertieft war. Ihren Vater vermutete Johanne oben im Büro. Als sie sich vom Fenster wegdrehte, bemerkte sie einige Meter weiter die Straße hinauf ein großes, rot-schwarz lackiertes Automobil, das am gegenüberliegenden Gehsteig parkte. Auf der Kühlerhaube war ein silberner Vogel montiert. Ein Adler? Johanne rief sich das Bilderalbum ihres jüngeren Bruders ins Gedächtnis, der die Embleme der verschiedenen Automarken sammelte. Er hätte ihr auf Anhieb den Hersteller nennen können. Sie hatte den auffälligen Wagen noch nie zuvor gesehen. In Horten waren knapp achtzig Kraftfahrzeuge registriert. Die meisten waren einfache Modelle von Ford, Dodge oder Opel, besser situierte Bürger wie Ärzte, Kaufleute, Anwälte und Ingenieure leisteten sich kostspieligere Exemplare von Herstellern wie Buick, Overland oder Benz. Mit dieser luxuriösen Limousine konnten sie jedoch nicht mithalten. Sogar einen eigenen Chauffeur hatte der Besitzer eingestellt. Jedenfalls hielt Johanne den Burschen in Lederjoppe, Handschuhen und Schiebermütze, der lässig an der Fahrertür lehnte und eine Zigarette rauchte, für den Fahrer.
Während sie sich noch fragte, wer sein Herr sein mochte, trat ein etwa vierzigjähriger Mann aus dem Torbogen. Er trug einen maßgeschneiderten Zweireiher aus dunkelgrauem Wollstoff, eine silberfarbene Krawatte und einen Filzhut. Als er diesen grüßend vor ihr lüftete, schrak sie leicht zusammen. Sie kannte dieses Gesicht – wenn auch nicht mit glatt rasierten Wangen und sorgfältig getrimmtem Schnurrbärtchen. Das letzte Mal hatte sie Sven Gravdal einige Jahre zuvor mit rot unterlaufenen Augen, Bartstoppeln und in einem fadenscheinigen, ausgebeulten Mantel gesehen, als er nach dem Gottesdienst am ersten Weihnachtstag vor der Garnisonskirche randaliert hatte. Sturzbetrunken hatte er die Gemeindemitglieder angepöbelt, dem Pfarrer eine leere Schnapsflasche vor die Füße geworfen und sich mit Fausthieben gegen die beiden Wachtmeister zur Wehr gesetzt, die ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Noch lange, nachdem sie ihm Handschellen angelegt und ihn vom Kirchplatz gezerrt hatten, waren die wilden Flüche und Verwünschungen zu hören gewesen, mit denen Gravdal sie bedachte. Den Kommentaren der Kirchenbesucher nach zu schließen, hatte er sich selbst in diese desolate Lage hineinmanövriert. Er galt als arbeitsscheu und frönte dem Glücksspiel. Als seine Eltern 1918 an der Spanischen Grippe gestorben waren, hatte er ihren Bauernhof verkauft und das Geld verzockt.
Offenbar hat sich das Blatt für ihn mittlerweile gewendet, überlegte Johanne. Ob ihm die Glücksfee hold gewesen war? Anders als durch einen hohen Spielgewinn konnte er es in der kurzen Zeit doch kaum zu so großem Wohlstand gebracht haben. Entgegen ihrer Erwartung lief er nicht weiter. Er blieb stehen und fixierte sie mit leicht zusammengekniffenen Augen.
»Ah! Das Fräulein Rev! Meine Verehrung!«
Johanne spürte, wie sich die Härchen auf ihren Unterarmen aufrichteten. In der Stimme von Sven Gravdal lag ein einschmeichelnder und zugleich lauernder Unterton. Sie versteifte sich und erwiderte seinen Gruß mit einem knappen Nicken.