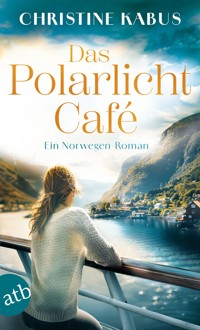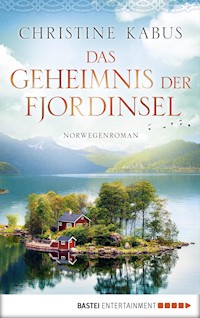9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Estland-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Frauen vom Birkenhof.
Schleswig-Holstein, 1977: Die Liebe zwischen Gesine und dem Pferdetrainer Grigori endet jäh, als er plötzlich spurlos verschwindet. Doch eines Tages stößt Gesine auf Hinweise über seinen Verbleib, die sie nicht nur tief in die Vergangenheit ihrer Familie, sondern auch in die Abgründe europäischer Geschichte führen.
Estland,1938: Charlotte verliebt sich Hals über Kopf in den jungen Esten Lennart. Doch ihre Eltern würden diese Verbindung niemals billigen, und so halten sie ihre Beziehung geheim. Als Charlotte ein Kind von Lennart erwartet, brechen die Wirren des Zweiten Weltkriegs über sie herein, und die Liebenden werden getrennt.
Historisch fundiert und hochemotional erzählt: eine große Saga um die Geheimnisse einer Familie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 733
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Die Frauen vom Birkenhof.
Schleswig-Holstein, 1977: Die Liebe zwischen Gesine und dem Pferdetrainer Grigori endet jäh, als er plötzlich spurlos verschwindet. Doch eines Tages stößt Gesine auf Hinweise über seinen Verbleib, die sie nicht nur tief in die Vergangenheit ihrer Familie, sondern auch in die Abgründe europäischer Geschichte führen.
Estland,1938: Charlotte verliebt sich Hals über Kopf in den jungen Esten Lennart. Doch ihre Eltern würden diese Verbindung niemals billigen, und so halten sie ihre Beziehung geheim. Als Charlotte ein Kind von Lennart erwartet, brechen die Wirren des Zweiten Weltkriegs über sie herein, und die Liebenden werden getrennt.
Historisch fundiert und hochemotional erzählt: eine große Saga um die Geheimnisse einer Familie
Über Christine Kabus
Christine Kabus, 1964 in Würzburg geboren und in Freiburg aufgewachsen, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte zunächst einige Jahre als Dramaturgin und Lektorin bei verschiedenen Film- und Theaterproduktionen, bevor sie sich 2003 als Drehbuchautorin selbstständig machte. 2013 wurde ihr erster Roman veröffentlicht.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christine Kabus
Die Zeit der Birken
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Epilog
Aiteh! – Danke!
Quellenverzeichnis
Impressum
Für Sabine
minu hingesulane
De düüstern Morgen geevt de hellsten Daag.
Die dunklen Morgen bringen die hellsten Tage.
Prolog
Maarja schreckte aus dem Schlaf hoch. Hatte die Kleine geschrien? Sie richtete sich auf und lauschte. Von der Wiege, die am Fußende ihres Bettes stand, war kein Laut zu hören. Durch das geöffnete Fenster drang das feine Sausen des Windes in den Nadeln der Kiefern, die das Schulhaus umgaben. Maarja sank in die Kissen zurück und schloss die Augen.
»Atwarite dweri!«, brüllte eine tiefe Stimme, gefolgt von einem lauten Schlag.
Maarja erstarrte. Der Albtraum wurde wahr. Sie waren gekommen, um sie zu holen. Seitdem die Gerüchte kursierten, dass es auf dem Festland vor zwei Wochen Verschleppungen gegeben hatte, betete Maarja jeden Abend darum, dass sie und die Ihren verschont bleiben würden. Die Hoffnung war mit jedem Tag gewachsen – und erwies sich nun als trügerisch.
Die Kleine begann zu wimmern. Maarja sprang aus dem Bett und lief barfuß aus dem Zimmer. Durch das Fenster über dem Eingang drang ein fahler Schein, der den Flur in diffuses Dämmerlicht tauchte. Erneut ertönten Gehämmer und die Aufforderung auf Russisch, die Tür zu öffnen. Maarja unterdrückte den Impuls, sich in einen Winkel zu verkriechen. Es würde nichts nützen. Sie würden die Tür eintreten und das Haus durchsuchen. Kein Versteck war vor ihnen sicher. Dann lieber in Würde dem Schicksal die Stirn bieten. Sie zog sich eine der Jacken, die an der Garderobe hingen, über ihr Nachthemd, drückte die Klinke herunter und sah sich zwei Uniformierten gegenüber. Ein Blick auf ihre blauen Mützen mit rotem Rand und einem goldenen Stern über der Krempe bestätigte ihren Verdacht. Es waren Offiziere des NKWD, der sowjetischen Geheimpolizei. Der jüngere der beiden ließ das Gewehr, mit dessen Kolben er gegen die Tür geschlagen hatte, sinken.
Der ältere leuchtete Maarja mit einer Taschenlampe ins Gesicht. »Maarja Landa?«
Sie nickte.
Er richtete den Lichtkegel auf ein Klemmbrett. »Gdje twoj brat?«, fragte er, schob Maarja beiseite und trat in den Flur.
»Mein Bruder ist nicht hier«, antwortete Maarja auf Russisch.
Das Weinen der Kleinen lenkte sie ab. Sie drängte sich an dem Offizier vorbei, rannte in ihr Zimmer, hob das Kind aus der Wiege und drückte es an sich.
»Du hast eine Stunde zum Packen.« Der jüngere Russe stand auf der Schwelle. »Nur einen Koffer.«
Maarja starrte ihn benommen an. Draußen hörte sie den älteren durch den Gang poltern und nacheinander die Türen des Schulzimmers, der Küche, der Poststelle und der anderen Räume aufreißen. Der junge Offizier machte eine auffordernde Handbewegung und verschwand auf den Flur.
Wie von selbst setzten sich Maarjas Beine in Bewegung. Ihre Hände wussten, was zu tun war. Sie legte die Kleine, die sich beruhigt hatte, in die Wiege zurück, wuchtete einen großen Lederkoffer vom Schrank und warf ihn aufs Bett. Sie musste nicht nachdenken, was sie einpacken sollte. Unzählige Male hatte sie sich auf diesen Moment vorbereitet und im Kopf eine Liste angefertigt von den Dingen, die sie auf ihrer Reise ins Ungewisse benötigen würde. Während sie den Koffer mit Kleidungsstücken, Windeln, Toilettenartikeln, Nähzeug, einem Verbandskasten, der Schachtel mit den Fotografien und der Blechdose mit ihrem Schmuck füllte, wanderten ihre Gedanken zu ihrem Bruder. Ob er bereits die finnische Küste erreicht hatte? Wie lange brauchte man in einem Fischkutter, um die rund neunzig Kilometer zum Städtchen Hanko zu bewältigen? Zum Glück war die See ruhig und die Sicht dank der hellen Sommernacht gut. Bitte, lieber Gott, lass ihn in Sicherheit sein, flehte sie stumm, als sie sich mit zitternden Händen anzog und die Kleine in eine Decke wickelte. Mit dem Kind auf dem Arm und dem Koffer in der anderen Hand trat sie schließlich aus dem Haus.
In einigen Metern Entfernung entdeckte sie einen Lastwagen, auf dessen offener Ladefläche rund ein Dutzend Menschen saß. In der Zwischenzeit hatten die beiden Russen das Haus durchsucht und es unverrichteter Dinge wieder verlassen. Der ältere fluchte laut, hielt Maarja drohend seine Faust vors Gesicht und stieß sie in Richtung Lastwagen, von dem sich ihr mehrere Hände entgegenstreckten und sie nach oben zogen. Kurz darauf rumpelten sie auf der Schotterstraße Richtung Osten. Die Tränen in Maarjas Augen verschleierten den letzten Blick auf das rote Holzhaus, bevor es hinter den Kiefern verschwand.
»Wenigstens haben sie deinen Vater nicht gekriegt«, flüsterte Maarja, hielt das Kind fest im Arm und sog den süßen Duft des warmen Körpers ein. Unter dem lauten Dröhnen des Motors begann sie, leise zu singen:
»Viire takka tulevad ka unetuuled monusad.
Kui katab tuuletiivake, siis suiguteleb silmake.«
Vom Horizont kommen Winde voll Schlaf.
Wenn ihre Flügel dich bedecken, wirst du einschlafen.
Schleswig-Holstein, September 1977
– 1 –
Frühmorgens, kurz nach sechs, steckte Gesine den Kopf aus ihrem Zimmer und spähte in den dunklen Flur. Kein Lichtschimmer drang unter den Türen zu den Schlafgemächern ihrer Eltern hervor, kein Laut störte die Stille. Gesine griff nach ihren Reitstiefeln und schlich auf Strümpfen zur Treppe. Ein Knacken ließ sie zusammenfahren. Sie blieb stehen und lauschte mit angehaltenem Atem. Es rührte sich nichts. Rasch huschte sie die Stufen hinunter ins Erdgeschoss und prallte um ein Haar mit Anneke zusammen, die gerade aus der Küche kam.
Die Haushälterin, eine zierliche Mittvierzigerin mit dunkelblonder Pagenfrisur, machte erschrocken einen Schritt rückwärts und hielt mit Mühe das Tablett gerade, auf dem Marmeladengläser, Butterdose, Brotkorb und Teller mit Aufschnitt und Käse ins Rutschen geraten waren und leise schepperten. »Nu man sachte, mien Krüselwind!«
»Psst!« Gesine legte einen Finger auf den Mund und schielte zur Treppe. »Tschuldige«, murmelte sie. »Wollte dich nicht erschrecken.« Sie beugte sich zu Anneke hinunter, die sie um einen Kopf überragte, gab ihr einen Kuss auf die Wange und stibitzte gleichzeitig eines der frisch gebackenen Hörnchen, die in einem Korb auf dem Tablett verführerisch dufteten. Sie hielt es mit den Zähnen fest, während sie ihre Stiefel anzog und anschließend zu einer schmalen Tür neben der Küche ging, dem ehemaligen Dienstboteneingang.
»Wo willst du denn hin?«, fragte Anneke. »Hast du nicht Hausarrest?«
Gesine machte eine abwinkende Handbewegung. »Bis zum Frühstück bin ich längst zurück«, antwortete sie. »Du hältst doch dicht, oder?«
Anneke zog die Augenbrauen zusammen.
»Bitte!« Gesine schaute sie flehentlich an.
»Natürlich. Aber komm ja nicht zu spät. Deine Mutter wird sonst …«
Gesine warf ihr eine Kusshand zu und verließ das Haus, ohne Annekes Bedenken zu Ende anzuhören. Der weitläufige Hofplatz lag noch im Schatten. Er wurde von mehreren Gebäuden eingerahmt: Am östlichen Ende stand das ursprünglich im barocken Stil erbaute Herrenhaus, das Ende des 18.Jahrhunderts klassizistisch überformt worden war. Der zweigeschossige verputzte und hellgelb angestrichene Backsteinbau hatte neun Achsen und ein Mansarddach. An der Hofseite ragte ein übergiebelter, dreiachsiger Risalit hervor, in dessen Mitte sich das Eingangsportal befand, zu dem eine breite Treppe führte. Gesine verharrte ein paar Atemzüge lang auf dem oberen Absatz und sog die kühle Morgenluft ein, die vom süßen Duft der Goldruten erfüllt war, die in dichten Stauden auf dem Rondell in der Mitte des Hofplatzes wuchsen. Leises Summen verriet ihr, dass die gelben Rispenblüten bereits von Bienen umschwärmt wurden. Eine Amsel, die zwischen den Stängeln nach Regenwürmern suchte, flog mit einem aufgeregten Tixen davon, als Gesine die Stufen hinuntersprang. Rechts und links des Herrenhauses hatten einst eine reetgedeckte Scheune und das Kavaliershaus für die Bediensteten sowie weitere einstöckige Wirtschaftsgebäude gestanden. Nachdem sie Ende des 19.Jahrhunderts einem Feuer zum Opfer gefallen waren, hatte Gesines Urgroßvater an ihrer Stelle großzügige Stallungen errichten lassen, um seiner Pferdezucht den nötigen Raum zu verschaffen.
Anneke hat ja recht, meldete sich eine leise Stimme in Gesine, während sie zum Stall lief. Mama rastet aus, wenn sie merkt, dass ich ihr Verbot missachte. Sie schob die Unterlippe vor. Es war so ungerecht. Wenn es nach ihrer Mutter gegangen wäre, hätte Gesine die gesamten Sommerferien damit verbracht, für die Schule zu büffeln und sich aufs Abitur vorzubereiten, das sie im kommenden Frühjahr ablegen würde. In den ersten Wochen hatte sie die mütterliche Aufforderung, mindestens drei Stunden täglich zu lernen, weitgehend ignoriert – unterstützt von ihrem Vater Carl-Gustav, der der Meinung war, »das Kind« solle sich erholen, möglichst viel Zeit an der frischen Luft verbringen und den Sommer genießen. Außerdem hielt er es für unnötig, dass sich Gesine bereits zu diesem frühen Zeitpunkt auf die Prüfungen vorbereitete.
Nachdem ihre Appelle an die Vernunft ihrer Tochter unbeachtet verhallten, war Henriette von Pletten schließlich vor vier Tagen – eine Woche vor Schulbeginn – der Kragen geplatzt. In ihren Augen ließen Gesines schulische Leistungen zu wünschen übrig. Von einer guten, geschweige denn hervorragenden Abiturnote war sie weit entfernt. Sie würde es nicht zulassen, dass sich ihre einzige Tochter aus purer Faulheit ihre Zukunft verbaute. Außerdem war sie nicht länger gewillt, sich von ihr auf der Nase herumtanzen zu lassen. Es war höchste Zeit, ihren ungestümen Wildfang an die Kandare zu nehmen und zur Ordnung zu rufen. Die letzten Ferientage sollte Gesine über ihren Büchern verbringen. Und da sie anders nicht dazu zu bewegen war, bekam sie Hausarrest. Zumindest so lange, bis Henriette von Pletten mit ihren Lernfortschritten zufrieden sein würde. Also nie, erkannte ihre Tochter, und setzte alles daran, das mütterliche Verbot auszuhebeln.
Gesine legte den Kopf in den Nacken. Der Himmel wölbte sich wolkenlos über ihr. Hinter den Bäumen des Parks, der sich auf der Rückseite des Wohnhauses Richtung Ostsee ausdehnte, kündete ein heller Streifen vom Aufgang der Sonne. Es versprach, ein herrlicher Tag zu werden. Gesine streckte dem Fenster im ersten Stock, das zu den Zimmern ihrer Mutter gehörte, die Zunge heraus und schlüpfte in den Stall. Es war einfach unmenschlich, sie im Haus einzusperren! Noch dazu bei so wunderbarem Wetter!
Gesine eilte zur Box von Cara, ihrer Holsteiner Stute. Das dunkelbraune Pferd begrüßte sie mit einem Schnauben und ließ sich bereitwillig aufzäumen. Gesine führte Cara hinaus, schwang sich in den Sattel und dirigierte sie zum alten Torhaus, das den Hof nach außen abschloss. Blickfang war der Glockenturm mit seinem an eine Pickelhaube erinnernden Dach über dem Torbogen, an dessen Frontseite ein Relief mit dem Familienwappen prangte: ein Pferd, das sich über drei stilisierten Wasserwellen aufbäumte.
Auf der von alten Eichen gesäumten Allee, die zum Gestüt führte, ließ Gesine die Stute antraben und bog nach etwa fünfzig Metern auf einen Feldweg Richtung Küste ab. Das Anwesen ihrer Familie lag im Kirchensprengel Gundelsby – mitten in Angeln, dem Gebiet zwischen der Flensburger Förde und dem Ostseefjord Schlei. Eine von einstigen Gletschern geprägte hügelige Landschaft mit kleinen Wäldern und Feldern, die mit den typischen Wallhecken voneinander getrennt waren. Diese »Knicks« waren teilweise uralte, von Haselsträuchern, Schlehenbüschen und anderen Gehölzen bewachsene, breite Erd- oder Steinwälle und stammten häufig noch von den Angeln, die bis ins 5.Jahrhundert hier gelebt hatten, bevor sie nach Britannien ausgewandert waren.
Gesine sah ihren Großvater Paul vor sich, der die verschiedenen Ausgrabungen in der Region mit großem Interesse verfolgte. Von klein auf hatte Gesine ihn auf seinen »Streifzügen in die Vergangenheit« begleitet. Besonders aufregend und gruselig hatte sie das Thorsberger Moor in der Nähe von Süderbrarup gefunden. Im 3. und 4.Jahrhundert nach Christus hatten sich verschiedene Stämme in der Gegend erbitterte Kämpfe geliefert. Die Sieger hatten Waffen und Ausrüstung der Unterlegenen im heiligen Moor geopfert – als Dank an ihren obersten Gott Thor. Opa Paul hatte die Welt der Germanen und Wikinger so anschaulich geschildert, dass sie sich damals bei der Erkundung der alten Opferstätte an seine Hand geklammert hatte – halb hoffend, halb fürchtend, dem Geist eines alten Kriegers zu begegnen.
Das ungeduldige Schnauben ihrer Stute riss Gesine aus ihren Gedanken. Sie hatten mittlerweile den Strand erreicht, den sie gewöhnlich für einen Galopp nutzten. Gesine beugte sich vor. »Auf geht’s!«, rief sie und klopfte Cara den Hals.
Die Stute wieherte, beschleunigte ihre Gangart und sauste auf dem feuchten Sand an der Wasserlinie entlang. Gesine jauchzte auf und gab sich ganz der Geschwindigkeit und den kraftvollen Bewegungen des Pferdes hin. Die Welt bestand nur noch aus dem Trommeln der Hufe, dem Geräusch der Brandung, dem Glitzern der Sonnenreflexe auf den Wellen, dem kühlen Wind, der ihre Haare zauste, und dem Glücksgefühl, das sie erfüllte und alles andere für den Augenblick verdrängte.
Eine Stunde später hastete Gesine durch die große Eingangshalle ihres Elternhauses. Aus einer Ecke schoss ein braunes Bündel auf sie zu und sprang bellend an ihr hoch.
»Anton, sei leise«, flüsterte Gesine.
Der Rauhaardackel wedelte mit dem Schwanz und warf sich auf den Rücken, um sich am Bauch kraulen zu lassen.
Gesine bückte sich und streichelte ihn kurz. »Ich hab jetzt leider keine Zeit«, sagte sie und richtete sich wieder auf.
Anton sah sie vorwurfsvoll an und trollte sich in Richtung Küche, während Gesine zum Speisezimmer lief. Vor der Tür hielt sie inne und lauschte den erregten Stimmen, die dumpf nach draußen drangen. Sie verdrehte die Augen. Streit schon am frühen Morgen.
»… so nicht weiter!«, hörte sie ihre Mutter sagen. »Sie ist ungehorsam und aufmüpfig. Das lasse ich mir nicht bieten!«
»Sei doch nicht so streng, meine Liebe«, antwortete der sonore Bariton des Grafen.
Gesine presste ihre Lippen aufeinander. Kein Zweifel, es ging wieder einmal um sie. Vielleicht hätte ich doch auf Anneke hören und nicht ausreiten sollen, dachte sie.
»Auch dir kann es doch nicht gleichgültig sein, dass sie ihre Zukunft aufs Spiel setzt«, fuhr ihre Mutter fort.
»Nun übertreibst du aber«, sagte ihr Mann. »Gesine wird schon nicht durchfallen. Und ich finde …«
»Schon nicht durchfallen?«, unterbrach ihn seine Frau empört. »Du willst mir nicht ernsthaft sagen, dass du dich damit zufriedengibst?«
»Sie wird sich sicher noch berappeln und …«, wandte der Graf ein.
»Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss«, fiel ihm Henriette von Pletten ins Wort.
Ganz genau, pflichtete Gesine ihr in Gedanken bei. Das ist doch sehr vernünftig. Wozu soll man sich unnötig schinden?
»Wir hatten eine klare Abmachung. Aber das Fräulein setzt sich einfach darüber hinweg. Das lasse ich mir nicht länger gefallen!«, wetterte ihre Mutter.
Bevor der Graf antworten konnte, holte Gesine tief Luft, stieß die Tür auf und trat über die Schwelle. Das Speisezimmer war mit Biedermeiermöbeln aus Kirschholz ausgestattet und hatte dank der hellen Tapeten und der beiden zum Park zeigenden Fenster eine freundliche Atmosphäre. Ein Vitrinenschrank nahm eine Schmalseite ein, an der gegenüberliegenden Wand befand sich eine Anrichte. Der ausziehbare ovale Tisch konnte zwölf Personen Platz bieten, war gewöhnlich jedoch zusammengeschoben und von vier Stühlen umgeben, die übrigen standen an der Längsseite des Zimmers rechts und links neben der Tür. Gesines Vater, Carl-Gustav von Pletten, saß in Cordhosen, hellblauem Hemd und dunkelblauer Jacke am Kopfende des Tisches, seine neun Jahre jüngere Frau Henriette stand ihm in einem schmal geschnittenen beigen Hosenanzug und dunkelgrüner Schleifenbluse gegenüber. Sie hatte die Hände um die Lehne ihres Stuhls gelegt, die Knöchel traten weiß hervor – das einzige Anzeichen für ihre Anspannung.
Die Gräfin war eine mittelgroße Frau von siebenunddreißig Jahren. Sie trug ihre schwarzen Haare in einem kurzen Stufenschnitt, was ihre markanten Gesichtszüge mit den geraden Brauen und der schmalen Nase unterstrich. Von ihr hatte Gesine bis auf die braungrünen Augen wenig Äußerliches geerbt. Mit dem schulterlangen Lockenschopf, den geschwungenen Augenbrauen und dem breiten Mund kam sie nach ihrem Vater, von dem sie auch die hochgewachsene, muskulöse Figur hatte.
»Guten Morgen«, sagte Gesine betont fröhlich und setzte sich auf ihren Platz mit Blick auf die Fenster.
Ihre Mutter fixierte sie mit gerunzelter Stirn und öffnete den Mund.
»Ich weiß, dass ich Hausarrest habe«, fuhr Gesine rasch fort. »Aber Cara muss bewegt werden. Das sagst du selbst immer. Deshalb bin ich extra früh aufgestanden, um nachher genug Zeit zum Lernen zu haben.« Sie schielte zu ihrer Mutter und fragte sich, ob sie damit durchkommen würde.
»Siehst du, Henriette, unsere Tochter ist durchaus verantwortungsbewusst«, sagte Carl-Gustav und zwinkerte Gesine kaum merklich zu. »Und nun setz dich bitte und lass uns frühstücken. Die Eier werden sonst kalt.« Er deutete auf eine Platte, auf der sich Rühreier mit Schinken und angebratenen Pilzen türmten. »Das kannst du doch gar nicht leiden.«
Seine Frau kam seiner Aufforderung nach kurzem Zögern nach. Carl-Gustav reichte ihr die Eier und schenkte sich Kaffee ein. Gesine schüttete Cornflakes und Milch in eine Schale, wich dem Blick ihrer Mutter aus, der nach wie vor auf ihr ruhte, und wendete sich an ihren Vater.
»Paps, ich weiß noch gar nicht, wie gestern das Bewerbungsgespräch mit dem Bereiter gelaufen ist.«
»Stimmt, das wollte ich dich auch fragen«, murmelte Henriette von Pletten und sah ihren Mann gespannt an.
Gesine beglückwünschte sich insgeheim. Sie hatte das richtige Thema gewählt und fürs Erste die Aufmerksamkeit ihrer Mutter von sich abgelenkt. Abgesehen davon wollte sie tatsächlich wissen, ob ihr Vater endlich erfolgreich gewesen war. Schon seit Wochen war er auf der Suche nach einem Nachfolger für seinen ehemaligen Bereiter, der mit knapp siebzig Jahren den Ruhestand angetreten hatte und zu seiner Tochter und ihrer Familie nach Süddeutschland gezogen war. Am Tag zuvor war Gesines Vater zu einem Pferdehof bei Husum gefahren. Dort suchte ein Reitlehrer nach neuen Herausforderungen und hatte sich auf die vakante Stelle auf Gestüt Pletten beworben. Um sich ein Bild von dessen Arbeitsweise zu verschaffen, hatte Carl-Gustav die siebzig Kilometer zur Nordsee zurückgelegt und war erst wieder zu Hause eingetroffen, als Gesine bereits im Bett lag.
Er setzte seine Tasse ab. »Den Weg hätte ich mir sparen können.« Er verzog den Mund.
Gesine zog erstaunt die Brauen hoch.
Auch ihre Mutter sah ihn überrascht an. »Wieso das?«, fragte sie. »Ich dachte, er hat die besten Referenzen?«
»Auf dem Papier vielleicht«, knurrte ihr Mann. »Der Kerl hat sich als arroganter Schnösel entpuppt. Vor allem aber ist er ein ganz unverhohlener Freund aller erdenklichen Hilfsmittel, um die Pferde – ich zitiere wörtlich – schnellstmöglich in Form zu bringen und ihnen klarzumachen, wer der Herr ist.« Er schüttelte den Kopf. »So jemanden kann ich hier nicht gebrauchen.«
»Nein, wirklich nicht!«, rief Gesine.
Ihre Mutter zog die Stirn kraus und öffnete den Mund.
»Ich weiß, was du denkst, meine Liebe«, sagte Carl-Gustav. »Und ich gebe ja zu, dass der Einsatz von Gerte, Sporen oder auch Hilfszügeln in gewissen Situationen beim Training durchaus sinnvoll sein kann. Aber wenn du diesen Kerl gesehen hättest, würdest du mir zustimmen. Ich wage zu bezweifeln, dass er viel von Pferden versteht.«
Seine Frau zuckte mit den Schultern. »Deine Entscheidung.« Sie drehte sich zu Gesine. »Apropos Training. Wie kommst du mit Cara voran?«
»Äh, ich …«, stammelte Gesine.
»Hast du nicht gesagt, dass du sie vorhin bewegt hast?«
»Hab ich ja auch.«
»Lass mich raten«, zischte ihre Mutter. »Ihr seid wieder einmal ohne Sinn und Verstand herumgestreunt und über den Strand galoppiert.«
Gesine richtete sich auf. »Was ist denn so verkehrt daran? Es tut Cara gut, sich auszutoben und …«
»Schweig!« Henriette von Pletten funkelte ihre Tochter wütend an. »Du weißt sehr gut, dass sie noch viel zu lernen hat. Sie hat hervorragende Anlagen. Aber ohne Ausbildung wird sie nie Preise gewinnen.«
»Ich pfeif auf deine Preise!« Gesine pfefferte ihren Löffel in die Schüssel mit den Cornflakes. Milch spritzte über den Rand. »Ich hab keine Lust auf dämliche Wettkämpfe. Und Cara kann ganz sicher auch dar…«
»Cara wird eine Zuchtstute«, fiel ihr ihre Mutter ins Wort. »Der Wert ihrer Fohlen steigt, wenn sie Turniere erfolgreich bestreitet.«
»Dir geht’s nur ums Geld!«, rief Gesine. »Aber es gibt auch …«
»Es geht vor allem um deine Zukunft!« Henriette von Pletten funkelte sie an. »Du hast offensichtlich nicht die Absicht, dich für dein Abitur ins Zeug zu legen. Dann mach wenigstens etwas aus deinem Talent als Reiterin. Du könntest es weit bringen und eine Karriere als Dressur…«
Gesine schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Sieh’s doch endlich ein! Ich will das nicht!«, schrie sie.
»Und was willst du dann? Rumlungern und dich treiben lassen?«
»Bitte, beruhigt euch«, sagte Carl-Gustav und hob beschwichtigend die Hände. »Es hat doch keinen Sinn, darüber zu streiten. Wenn Gesine keine Lust …«
»Ja, nimm du sie immer nur in Schutz!«, fauchte seine Frau. »Bestärke sie noch in ihrer Verweigerungshaltung. Du wirst schon sehen, wohin das führt. Und dann sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt!«
»Mein Gott, jetzt langt’s aber!« Gesine sprang auf. »Du tust ja gerade so, als würde ich unter der Brücke enden. Nur weil ich nicht so von Ehrgeiz zerfressen bin wie du.«
»Was erlaubst du dir?« Henriette von Pletten erhob sich ebenfalls. »Da! Das sind die Früchte deiner Nachgiebigkeit!«, warf sie ihrem Mann vor.
»Lass Paps aus dem Spiel!«, schrie Gesine. »Immer hackst du auf ihm rum. Dabei kann er rein gar nichts für mein Verhalten. Ich allein …«
»Wie du meinst«, sagte ihre Mutter mit eisiger Stimme. »Jedenfalls werden jetzt andere Saiten aufgezogen.«
»Nur zu! Wirst schon sehen, was du davon hast«, rief Gesine, stürmte aus dem Zimmer und warf die Tür hinter sich zu.
In der Halle blieb sie stehen und stützte sich mit beiden Händen auf der Kommode ab, die unter einem großen Spiegel neben der Garderobe stand. Das Hochgefühl, ihrer Mutter Paroli geboten zu haben, verflüchtigte sich. Ihre Knie begannen zu zittern. Was für eine Strafe würde sie erwarten?
Das Klacken von Absätzen auf dem Parkett im Speisezimmer schreckte Gesine auf. Sie stieß sich von der Kommode ab, lief zur Eingangstür, öffnete sie einen Spaltbreit und schlüpfte hinaus. Wie von selbst schlugen ihre Füße den Weg zu dem Ort ein, den sie von klein auf in Situationen wie diesen aufsuchte.
»Gesine! Bleib gefälligst hier!«
Gedämpft drang der Ruf ihrer Mutter zu ihr nach draußen. Der Zorn in ihrer Stimme verstärkte Gesines Fluchtimpuls. Sie fühlte sich einer Fortführung ihrer Auseinandersetzung nicht gewachsen. Nicht in diesem Moment. So schnell sie konnte, rannte sie über den Hof zum Torhaus und hinauf zu den Zimmern, die Opa Paul seit dem Tod seiner Frau Greta vor zwölf Jahren bewohnte. Zu dieser Zeit hatte er die Leitung des Gestüts in die Hände seines Sohnes Carl-Gustav gegeben und sich fortan ganz der Erkundung der Vor- und Frühgeschichte seiner Heimat verschrieben.
Bereits beim Betreten des Gebäudes entspannte sich Gesine. Der vertraute Geruch nach Pfeifenrauch, Bohnerwachs und frisch gehackten Holzscheiten, die im Vorraum neben der Treppe gestapelt waren, hatte etwas Tröstliches. Sie fand ihren Großvater in seinem Studierstübchen, das er sich im Turm über dem Torbogen eingerichtet hatte. Von dort hatte er sowohl einen Blick auf die Zufahrtsallee als auch auf den Innenhof. Wenn er nicht tief in seinen Büchern oder Fachzeitschriften versunken war, neue Funde katalogisierte oder gar selbst über die Ausgrabungen und historischen Begebenheiten schrieb, saß er gern am Fenster und beobachtete das Treiben auf dem Gestüt.
Gesine konnte nicht nachvollziehen, warum ihre Mutter ihren Schwiegervater für senil hielt und glaubte, er würde sich nicht mehr für Dinge und Personen interessieren, die jünger als zweitausend Jahre waren. Opa Paul war vielleicht ein wenig sonderlich und häufig in seine Gedanken versponnen, er bekam aber durchaus noch genau mit, was um ihn herum geschah. Da er es jedoch vermied, sich in fremde Angelegenheiten einzumischen, mochte der Eindruck entstehen, er nähme keinen Anteil daran. Gesine vermutete, dass er sich aus gutem Grund diese Zurückhaltung auferlegte. Von Anneke wusste sie von heftigen Auseinandersetzungen, die in den Jahren vor seinem Rückzug aus der Gutsverwaltung häufig zwischen ihm und seiner Schwiegertochter eskaliert waren.
»Ah, Gesine, komm herein.«
Opa Paul, der wie gewöhnlich eine Kniebundhose und ein weißes Hemd mit Stehkragen trug, nickte seiner Enkelin, die den Kopf zur Tür hineingesteckt und vorsichtig an den Rahmen geklopft hatte, freundlich zu und winkte sie zu sich. Er stand vor einem Tisch, den eine Flurkarte bedeckte, die er sich vom Katasteramt besorgt hatte. An vielen Stellen steckten farbige Wimpelchen, die Ausgrabungsstellen oder Fundorte interessanter prähistorischer Gegenstände markierten.
»Wobei störe ich dich denn gerade?«, fragte Gesine und stellte sich neben ihn.
»Ich bereite den Vortrag vor, den ich bei der Herbsttagung des Heimatvereins halten werde.« Er sah Gesine über den Rand seiner Lesebrille an. »Was bedrückt dich, mien Deern?« Er kniff die Augen leicht zusammen. »Bist du mal wieder mit deiner Mutter aneinandergeraten?«
»Nie kann ich es ihr recht machen«, brach es aus Gesine heraus. Sie fuhr sich mit einer Hand durch die braunen Locken. »Ständig nörgelt sie an mir rum. Heute war’s besonders schlimm.«
»Sie beruhigt sich schon wieder, du wirst se…«
Gesine schüttelte heftig den Kopf. »Sie hat gedroht, dass sie nun andere Saiten aufziehen wird.«
»Was hast du denn angestellt?« Opa Paul nahm seine Brille ab und sah seiner Enkelin in die Augen.
»Nix Besonderes. Hab ihr halt widersprochen.« Gesine verschränkte die Arme vor der Brust.
»Und was meint deine Mutter mit anderen Saiten?«
»Keine Ahnung. Aber ich fürchte, sie will mich nach Louisenlund schicken.« Gesine ließ die Schultern hängen.
Mehrfach hatte ihre Mutter bei vergangenen Streitigkeiten damit gedroht, Gesine ins Internat in der Nähe von Eckernförde zu stecken. Die Privatschule Louisenlund galt als elitär – erst in diesem Jahr hatte die Tochter von Herzog Friedrich zu Schleswig-Holstein dort ihr Abschlussexamen gemacht. Allerdings hatte die Schule auch den Ruf, dass dort diejenigen, die auf normalen Gymnasien scheiterten, noch eine Chance aufs Abitur bekamen, sofern ihre Eltern das nötige Geld dafür aufbringen konnten.
Opa Paul sog scharf die Luft ein, verkniff sich jedoch die Bemerkung, die ihm zweifellos auf der Zunge lag.
»Ja, ich weiß. Ich hätte sie nicht provozieren dürfen«, grummelte Gesine. »Aber sie bringt mich einfach zur Weißglut mit ihrem Ehrgeiz. Wieso kann sie mich nicht in Ruhe lassen?«
Ihr Großvater fasste sie am Ellenbogen und führte sie zu dem kleinen Sofa, das in einer Ecke stand. Die ledernen Sitzpolster waren vom jahrelangen Gebrauch blankgerieben und verformt. Bereits als Kind hatte Gesine dort mit ihrem Opa gesessen und sich von ihm vorlesen lassen oder seinen Geschichten gelauscht, die sie in die Welt der alten Germanen entführten. In letzter Zeit diente das Sofa immer öfter als Zufluchtsort, auf dem sich Gesine ihren Kummer von der Seele redete.
»Sie macht sich eben Sorgen um dich«, sagte Opa Paul, nachdem sie Platz genommen hatten.
»Aber warum? Ich werde das Abi schon nicht vergeigen.«
»Natürlich nicht. Aber deine Mutter will wohl nicht, dass du unter deinen Möglichkeiten …«
»Ja, ja, schon klar. Sie will nur mein Bestes.« Gesine schnaubte. »Aber für mich ist eben was anderes das Beste. Ich will mal den Hof übernehmen und Pferde züchten. Aber das ist Mama nicht ambitioniert genug.«
»Vergiss nicht, dass sie sich selbst sehr wohlgefühlt hat in Louisenlund.«
»Ich bin aber nicht sie!«, rief Gesine. »Wann kapiert sie das endlich?«
»Ist ja gut.« Opa Paul tätschelte Gesines Oberschenkel. »Wir alle neigen dazu, von uns auf andere zu schließen.«
Gesine zuckte die Achseln. »Schön für sie. Aber sie war in einer vollkommen anderen Situation als ich. Ihre Großmutter muss ja eine echte Schreckschraube gewesen sein. Da war alles besser, als weiter unter ihrer Fuchtel zu stehen.«
Opa Paul schmunzelte. »So wie du deine Lage beschreibst, klingt das allerdings ähnlich.«
Gesine musste grinsen. »Stimmt. Mama führt sich manchmal echt schreckschraubig auf. Aber ich habe ja noch so viele liebe Menschen um mich herum.« Sie schlang ihre Arme um ihren Großvater und drückte einen Kuss auf seine Wange, die leicht nach Rasierseife duftete. »Ich will hier nicht weg! Ich würde eingehen wie eine Primel.«
»So weit wird es schon nicht kommen«, sagte Opa Paul. »Schließlich ist es nicht so einfach möglich, die Schule kurz vor dem Abschluss zu wechseln.«
»Da kennst du Mama aber schlecht!«, rief Gesine. »Sie hat neulich erst irgendwelche Beziehungen angedeutet, die sie spielen lassen könnte, und gemeint, dass es immer Mittel und Wege gäbe.«
»Verstehe.« Opa Paul kratzte sich am Kinn. »Was sagt dein Vater denn dazu? Der hat doch auch ein Wörtchen mitzureden, nicht wahr?«
»Paps würde mich nie aufs Internat schicken. Schon gar nicht gegen meinen Willen«, antwortete Gesine. »Aber wenn Mama sich mal was in den Kopf setzt, hat Paps kaum eine Chance.«
»Dann solltest du wohl besser versuchen, dich mit deiner Mutter zu vertragen.« Opa Paul sah sie eindringlich an. »Du bist doch ein kluges Mädchen. Gib ihr das Gefühl, dass du ihre Sorgen ernst nimmst und dich in der Schule bemühen wirst. Dann lenkt sie bestimmt ein.«
Gesine schob die Unterlippe vor.
Opa Paul fasste sie unters Kinn. »Gib dir einen Ruck. Mir zuliebe. Ich würde dich sehr vermissen, wenn du auf dieses Internat gehen müsstest.«
Gesine schluckte und atmete tief durch. »Du hast recht. Ich werde mich bei ihr entschuldigen. Auch wenn ich eigentlich gar nicht einsehe, warum.« Sie stand auf. »Auf nach Canossa!«, sagte sie mit einem schiefen Lächeln.
»Viel Glück!« Opa Paul erhob sich ebenfalls und strich ihr über den Kopf.
Auf dem Weg ins Herrenhaus kramte Gesine ein blau-rot-weißes Päckchen mit Bazooka Bubble Gums aus ihrer Hosentasche und schob sich eines der rosaroten Stücke in den Mund. Das Kauen half ihr, die Nervosität in den Griff zu bekommen, mit der sie dem Gespräch mit ihrer Mutter entgegensah. Dabei standen ausgerechnet diese Kaugummis auf der langen Liste von Dingen, die Henriette ein Dorn im Auge waren – und nicht zuletzt aus diesem Grund die Begehrlichkeit von Gesine weckten, auch wenn sie zuweilen feststellte, dass sie ihr gar nicht sonderlich gut gefielen (Plateauschuhe) oder schmeckten (zum Beispiel Kaba – Der Plantagentrunk, den sie als Kind dennoch gern gehabt hätte wegen der Sammelpunkte auf den Packungen, für die man Pappfiguren von Walt Disney wie Micky Maus, Donald Duck oder aus dem Dschungelbuchfilm erhielt).
Ihre Eltern waren nicht mehr im Speisesaal. Aus dem Büro ihres Vaters hörte sie dessen Stimme im Gespräch mit Stallmeister Wittke, der sich dort zur allmorgendlichen Tagesbesprechung eingefunden hatte. Gesine sprang – zwei Stufen auf einmal nehmend – hinauf in den ersten Stock, wo sie ihre Mutter vermutete. Henriette von Pletten pflegte nach dem Frühstück in ihren beiden Zimmern, die am Ende des Flurs lagen, Zeitung zu lesen, Briefe zu schreiben und anderen Papierkram zu erledigen. Die Tür zum Salon stand offen.
Gesine nahm den Kaugummi heraus. »Mama, bist du da?«, rief sie, trat ein und sah sich um. Der Raum war leer. Ein Klappsekretär mit zahlreichen Schubladen stand rechts neben dem Fenster, links davon ein Lehnstuhl zum Lesen. Ein mit hellem Samt bezogenes Sofa und zwei dazu passende Sesselchen luden in einer Ecke neben der Tür zum gemütlichen Zusammensitzen ein. Ein großes Regal an der gegenüberliegenden Wand beherbergte Dutzende von Pokalen und anderen Siegestrophäen, die Henriette von Pletten in ihrer Zeit als Springreiterin bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen hatte, bevor ihrer Turnierkarriere durch eine Rückenverletzung ein jähes Ende bereitet worden war. Gesine lief über den handgeknüpften Perserteppich hinüber zum Schlafgemach, dessen Fenster zum Park hinausging, und warf einen Blick hinein. Auch dieses war menschenleer. Gesine steckte den rosa Klumpen wieder in den Mund und machte eine große Blase, die mit einem Knall zerplatzte. Sie kehrte um und wollte auf den Flur zurück, als ein Motorengeräusch sie ablenkte.
Sie schaute durch das Fenster und sah, wie der blaue VW-Bus vom Hansenhof soeben vor dem Haus zum Stehen kam. Einen Atemzug später stieg Ulrike aus, eine ihrer Cousinen zweiten oder dritten Grades – so genau konnte sich Gesine die Verwandtschaftsgrade der ferneren Familienangehörigen nicht merken.
Während sich Gesine fragte, was Ulrike an einem gewöhnlichen Werktag hergeführt haben mochte, stieg auf der Beifahrerseite ein Mann mit blonden, kurzgeschorenen Haaren aus, der eine kleine Segelstofftasche bei sich hatte. Sein Anblick irritierte sie. Er war jung – höchstens zwei, drei Jahre älter als sie selbst – und sah zugleich wie aus der Zeit gefallen aus. Das lag an seiner Kleidung, wurde ihr nach einem Augenblick klar. Mit seinen weiten Hosen, den klobigen Schnürschuhen und der gerade geschnittenen Jacke aus dickem Stoff erinnerte er Gesine an die Männer auf den gerahmten Fotografien aus den Fünfzigerjahren, die Handwerker und Bauern beim Schmieden oder der Feldarbeit abbildeten und im Dorfkrug an der Wand hinter dem Stammtisch aufgehängt waren. Hatte sich der Unbekannte im Jahrzehnt verirrt?
Gesine öffnete das Fenster, lehnte sich hinaus und wollte ihre Cousine durch einen Zuruf auf sich aufmerksam machen. Im selben Moment streckte Ulrike eine Hand durch das heruntergekurbelte Seitenfenster und drückte auf die Hupe. Das Signal lockte Anneke herbei, die auf dem Treppenabsatz vor der Eingangstür erschien, gefolgt von Anton, der die Stufen hinuntersprang und die Ankömmlinge kläffend umkreiste.
»Hallo, Anneke!«, rief Ulrike. »Ist der Graf da? Ich möchte ihm jemanden vorstellen.« Sie bückte sich kurz zu dem Dackel und streichelte ihn.
Anneke nickte, wischte ihre bemehlten Hände an der Schürze ab und winkte die beiden Besucher ins Haus.
Gesines Neugier war nun endgültig geweckt. Wer war dieser fremde junge Mann, und warum hatte Ulrike ihn hergebracht? Sie schloss das Fenster, eilte aus dem Salon und wollte eben die Treppe hinunterspringen, als ihr jemand auf die Schulter tippte. Sie fuhr herum und stand ihrer Mutter gegenüber. Vor Schreck schluckte sie den Kaugummi hinunter.
»Wo warst du? Ich habe in deinem Zimmer auf dich gewartet.«
Die Schärfe in ihrer Stimme jagte Gesine einen Schauer über den Rücken. »Und ich habe in deinen Zimmern nach dir gesucht«, antwortete sie, um einen ruhigen Ton bemüht. »Ich wollte mich bei dir entschuldigen«, schob sie schnell nach. »Ich hätte nicht einfach abhauen dürfen.«
Ihre Mutter runzelte die Stirn und öffnete den Mund.
»Gnädige Frau!« Von ihnen unbemerkt, war Anneke die Treppe hinaufgestiegen und stand auf dem Absatz. »Der Graf bittet Sie zu sich ins Arbeitszimmer.«
»Danke, Anneke. Ich komme sofort.« Henriette von Pletten drehte sich zu Gesine. »Wir sprechen später. Du gehst jetzt auf dein Zimmer und lernst.« Sie hielt ihr ein Blatt Papier hin.
»Was ist das?«, fragte Gesine.
»Der Trainingsplan für Cara. Bis zu den Jugendmeisterschaften gibt es noch viel zu tun.«
Gesine unterdrückte den Impuls, zu widersprechen, biss sich auf die Lippe und folgte dem Befehl. Sie konnte es nicht riskieren, ihre Mutter noch weiter gegen sich aufzubringen. Sosehr es sie auch juckte, an der Zimmertür zum Büro ihres Vaters zu lauschen und zu erfahren, was es mit Ulrikes überraschendem Besuch und dem jungen Mann auf sich hatte.
Estland – September/Oktober 1938
– 2 –
»Guck mal, Charly! Wir sind in der Zeitung!«
Charlotte von Lilienfeld sah von ihrem Schulheft auf, in das sie eben ein Rezept für Preiselbeermarmelade eintrug, und schaute ihre Freundin Zilly fragend an. Die beiden Neunzehnjährigen hatten sich nach dem Mittagessen zum Lesen und Lernen in den großen Saal zurückgezogen und saßen sich an einem der Tischchen gegenüber, die vor der Fensterfront aufgestellt waren. Die weißen Gardinen vor den geöffneten Balkontüren bauschten sich im Luftzug, der den erdigen Geruch eines umgegrabenen Beetes vom Gemüsegarten gemeinsam mit dem Duft frisch gewaschener Wäsche vom Hof hereinwehte.
»Was meinst du mit wir?«, fragte Charlotte.
Cecilie von Weitershagen, die ihre hellen Haare wie ihr Idol Katherine Hepburn mit Seitenscheitel und einer leichten Dauerwelle trug, schob Charlotte die »Deutsche Zeitung« vom Dienstag hin und tippte auf die linke Spalte mit der Rubrik »Kurze Nachrichten«. Charlotte beugte sich darüber und las:
Wie aus informierten Quellen verlautet, ist die Erkrankung des Marschalls Göring auf die Überanstrengungen der letzten Tage zurückzuführen. Vor allem hat ihm das viele Stehen geschadet.
Sie hob die Brauen, die sich über ihren hellbraunen Augen wölbten. »Was hat denn der Göring mit uns …«
»Weiter unten«, fiel ihr Zilly ins Wort. »Beim Tagesspiegel.«
»Sag das doch gleich«, brummte Charlotte und fand unter der Mitteilung, dass der Preis für Exportbutter gestiegen war, einen Bericht über das zweite Deutsche Jugendsportfest, an dem sie am vergangenen Wochenende in der Hauptstadt Tallinn teilgenommen hatten. Charlotte überflog die Ergebnisse der Männerstaffelläufe. »Ah, hier«, murmelte sie und las laut vor: »Die Staffel der Frauen viermal fünfundsiebzig Meter wurde von dem Team des Stift Finn gewonnen.«
Charlotte lächelte. Sie hatte wieder den Applaus der Zuschauer im Ohr, spürte wieder die Mischung aus Erschöpfung und Hochgefühl, mit der sie ihre Mitläuferinnen nach dem Wettkampf umarmt hatte, und den Stolz, ihre Schule würdig vertreten zu haben.
»Das schneide ich aus und klebe es in mein Tagebuch«, sagte Zilly. »Zusammen mit dem Foto, das Fräulein Lüders von uns gemacht hat.«
»Hoffentlich ist es was geworden.« Charlotte verzog den Mund. »Denk nur an das Bild von der Feier zu Johanni.«
»Hör mir auf!«, rief Zilly. »Auf dem sehen wir alle aus wie kopflose Schattenmonster, die ums Feuer tanzen.« Sie grinste. »Aber als Erinnerung werde ich es trotzdem behalten.«
»Ich auch.« Charlotte berührte die runde Silberbrosche an ihrem Blusenkragen. Im vorigen Herbst hatte sie das Schmuckstück mit den drei Eichenblättern von einer Absolventin überreicht bekommen. In wenigen Tagen war es nun an ihr und ihren Klassenkameradinnen, solche Broschen als Zeichen der Verbundenheit mit Stift Finn, dessen alter Eichenwald mit den Blättern als Wahrzeichen gewürdigt wurde, an die Schülerinnen des nächsten Jahrgangs zu verteilen. Die Priorin, Constance, Edle von Rennenkampff, würde die Neuen mit salbungsvollem Ernst ermahnen, die Nadeln – wie ein Student sein Farbband – als Träger »hochstehenden baltischen Kulturgutes« in Ehren zu halten.
»Manchmal kann ich es kaum glauben, dass unser Jahr hier schon fast vorbei ist«, sagte Charlotte leise.
»Gott sei Dank«, antwortete Zilly. »Ich kann es kaum erwarten, endlich an die Akademie zu gehen.« Sie griff nach dem Lehrbuch der praktischen Physik von Friedrich Kohlrausch. »Und deshalb muss ich wohl oder übel noch ein bisschen pauken.« Sie setzte eine gespielt strenge Miene auf und hob einen Zeigefinger. »Fräulein von Weitershagen! Das Abschlusszeugnis muss man sich verdienen! Auch Ihnen stünde es gut an, sich ein wenig mehr zu bemühen. Sie wollen Ihrer Klasse doch keine Schande machen, oder?«
Charlotte kicherte. Zillys Talent, andere Menschen nachzuahmen, war unübertroffen. Sie sah die Lehrerin, die sie in den Naturwissenschaften unterrichtete, förmlich vor sich.
»Warum werden wir mit diesem Unsinn gequält?« Zilly schlug sich dramatisch mit der Hand gegen die Stirn. »Diese Formeln wollen einfach nicht in meinen Kopf.«
Charlotte zuckte kaum merklich mit den Schultern. Sie selbst fand Physik eines der spannendsten Fächer. Es faszinierte sie, dass die Naturgesetze immer und überall galten und vermeintlich alltägliche Phänomene bei genauer Untersuchung spektakuläre Aspekte enthüllten. So hatte sie sich erst kürzlich beim Blick aus einem regennassen Fenster gefragt, warum an sich transparentes Wasser die Durchsicht trübte. Sie hatte die Regentropfen aus der Nähe betrachtet und verblüfft festgestellt, dass diese keineswegs den ihrer Position entsprechenden Ausschnitt aus der hinter dem Fenster liegenden Gegend darboten, sondern jeder Tropfen ein umgekehrtes Bild der gesamten Gegend zeigte.
»Wenn du willst, frag ich dich nachher ab«, sagte sie.
»Du bist ein Schatz«, rief Zilly und schlug das Buch auf.
Charlotte strich sich eine dunkelbraune Strähne, die sich aus ihrem geflochtenen Zopf gelöst hatte, aus der Stirn und unterdrückte ein Seufzen. Der Gedanke an den bevorstehenden Abschied stimmte sie wehmütig – das hätte sie noch zwölf Monate zuvor nie für möglich gehalten. Im Gegenteil, wie wütend sie gewesen war, als ihre Eltern sie hierhergeschickt hatten! Sie sollte in guter Familientradition eine Ausbildung an der »Wirtschaftlichen Frauenschule Stift Finn« absolvieren – ein Ansinnen, das Charlotte empört hatte. Sie verspürte keinerlei Bedürfnis, ihr Dasein als Hausmütterchen zu fristen, und haderte mit ihrem Schicksal, oder besser gesagt mit ihren Eltern. Nicht zum ersten Mal hatte sie sich gewünscht, ein Mann zu sein. Warum durfte sie nicht Abitur machen und studieren wie ihr älterer Bruder Johann? Sie lebten schließlich mitten im 20.Jahrhundert.
Ihre Einwände waren unbeachtet verhallt. Fundiertes hauswirtschaftliches Wissen war in den Augen ihrer Eltern unverzichtbar für eine junge Dame ihres Standes. Zwar war ihr Vater als jüngerer Spross eines Rittergutbesitzers ohne Aussicht auf das väterliche Erbe seinerzeit gezwungen gewesen, einen »Brotberuf« zu ergreifen. Er hatte Medizin studiert und sich als Arzt in dem beliebten Seeheilbad Haapsalu niedergelassen. Seinem Selbstverständnis, nach wie vor zur baltischen Oberschicht zu gehören, tat das jedoch keinen Abbruch. Als diese mit der Unabhängigkeit Estlands viele ihrer Privilegien und vor allem Ländereien und Gutshöfe verlor, erwies sich sein Werdegang sogar als Vorteil. Clemens von Lilienfeld war von den Bodenreformen nicht betroffen und weiterhin in der Lage, sich und den Seinen mit seiner Praxis ein gutes Auskommen zu sichern.
Von Groll erfüllt war Charlotte in den Zug nach Rakvere, dem früheren Wesenberg, gestiegen, in dessen Nähe sich Stift Finn befand. In dem einstigen Gutshaus war Ende des 18.Jahrhunderts auf Geheiß des letzten Besitzers ein Pensionat für adelige junge Damen aus verarmten Familien eingerichtet worden, das später ausgebaut und zu einer Schulanstalt umgewandelt wurde.
Charlotte hatte sich dort anfangs wie ein Sträfling gefühlt – was nicht zuletzt an dem straffen Plan lag, der das Leben der Maiden bestimmte. Unter der Woche begannen die Tage um sechs Uhr mit einer kurzen Andacht und dem Frühstück, gefolgt von Lehrstunden in Hauswirtschaft, in denen Kochen, Backen, Kleintierhaltung, Gartenbau und andere praktische Fähigkeiten vermittelt wurden. Nach dem Mittagessen herrschte bis drei Uhr eine Ruhezeit, der sich bis zum frühen Abend Unterrichtseinheiten in Physik, Chemie, Pflanzenkunde, Nahrungsmittellehre, Gesundheitspflege, Seelenkunde, Pädagogik, Personalführung sowie Bürgerkunde, Deutsch und Rechnungswesen anschlossen. Daneben wurde Wert auf regelmäßige Leibesertüchtigung, Chorgesang und Ausflüge gelegt, ebenso auf Gesellschaftsabende, bei denen geladene Gäste oder Schülerinnen Vorträge und Referate hielten.
Charlottes Unmut war binnen weniger Wochen verflogen. Zu ihrer eigenen Überraschung hatte sie schnell Fuß gefasst und das Leben in der Gemeinschaft zu schätzen gelernt. Es war eine ungewohnte Erfahrung. Nachdem sie die Volksschule ihres Heimatstädtchens Haapsalu absolviert hatte, war sie zu Hause unterrichtet worden. In Stift Finn entzog sie sich nicht nur das erste Mal der Aufsicht ihrer Eltern, sondern war vor allem in eine große Schar Gleichaltriger eingebunden, deren Gesellschaft sie anregend und beglückend fand – allen voran die von Cecilie von Weitershagen.
Charlotte war fasziniert vom Selbstbewusstsein und der scharfen Beobachtungsgabe ihrer neuen Freundin, die selten ein Blatt vor den Mund nahm und sich ungern vorschreiben ließ, was sie zu denken und zu glauben hatte. Sie träumte von einer Karriere als Schauspielerin, begeisterte sich für alles, was aus den Vereinigten Staaten kam, und war fest entschlossen, eines Tages dorthin auszuwandern. Ähnlich wie Charlotte war jedoch auch Zilly, die ihren Taufnamen verabscheute, gezwungen, sich vorerst dem Willen ihrer Eltern zu beugen und die Ausbildung auf Stift Finn zu absolvieren. Sie sah es als notwendiges Übel und kleinen Umweg, der sie nicht von ihrem Herzenswunsch ablenken würde. Charlotte beneidete ihre Freundin um diese Zielstrebigkeit. Sie selbst hatte nur verschwommene Vorstellungen von ihrer Zukunft. Sie gestand sich ein, dass das ein weiterer Grund war, warum sie dem Ende ihrer Pensionatszeit mit einem mulmigen Gefühl entgegensah.
»Was schaust du denn so traurig?«
Zillys Frage riss Charlotte aus ihren Gedanken. Sie hatte nicht bemerkt, dass ihre Freundin ihre Lektüre unterbrochen hatte und sie aufmerksam musterte.
»Es ist nichts«, antwortete sie und lächelte verlegen. »Ich … ach Zilly, ich werde das alles hier so schrecklich vermissen!«, platzte sie heraus. »Und vor allem dich!«
»Ich dich doch auch, Charly!«, rief Zilly, sprang auf und zog Charlotte in ihre Arme. »Aber wir sehen uns ja zum Glück bald wieder.«
»Hoffentlich.« Charlotte löste sich von Zilly. »Es macht mich ganz nervös, dass meine Eltern noch nicht geantwortet haben. Das kann doch nur ein schlechtes Zeichen sein!«
»Sei nicht so pessimistisch!« Zilly sah ihr in die Augen. »Was sollten sie dagegen haben, wenn du dich weiterbilden und auf eigenen Beinen stehen willst?«
Charlotte hob die Schultern, verzichtete jedoch auf eine Antwort. Ihr fielen viele Gründe ein, warum ihre Eltern mit ihren Plänen nicht einverstanden sein könnten. Als Zilly ihr zwei Wochen zuvor vorgeschlagen hatte, sie nach Tallinn zu begleiten und sich dort nach einer geeigneten Ausbildung umzusehen, war Charlotte noch voller Zuversicht gewesen. Beflügelt von der Begeisterung, mit der Zilly ihr gemeinsames Leben in der Hauptstadt ausmalte, hatte Charlotte nach Hause geschrieben und für ihr Anliegen geworben. Ein wichtiges Argument war dabei, dass sie kein Geld für Miete und Unterhalt benötigen würde. Zilly hatte ihr versichert, dass ihre Eltern sie gern bei sich aufnehmen würden. Nach dem Auszug ihrer beiden älteren Schwestern, die geheiratet hatten, war genug Platz. Charlottes Eltern würden ihre Tochter also in guter Obhut wissen. In ihrem Brief hatte sie die angesehene Position von Zillys Vater hervorgehoben. Baron Weitershagen war ein leitender Angestellter im Bankhaus Scheel, der größten Privatbank Estlands, die sich auf die Finanzierung von Großindustrie und Handel konzentrierte und an vielen bedeutenden Unternehmen beteiligt war. Außerdem war er Mitglied im Deutschen Kulturrat, der die Interessen der deutschen Minderheit vertrat. Unter seinem Dach zu wohnen, war eine Ehre und konnte unmöglich das Missfallen ihrer Eltern wecken.
Dass Frau von Weitershagen Sängerin am Estonia Theater war, wo sie unter ihrem Mädchennamen auftrat, hatte Charlotte dagegen nicht erwähnt. Ihrer Mutter verdankte Zilly die künstlerische Ader und die Unterstützung ihres Traums, an der neu eröffneten Schauspielschule am Konservatorium Tallinn zu studieren. Charlotte war überzeugt, dass ihre Eltern diese Haltung nicht billigen und befürchten würden, ihre eigene Tochter könnte sich von solchen »Flausen« anstecken lassen. Charlotte hatte noch keine genaue Vorstellung, welchen Beruf sie einmal ergreifen wollte. Es gab so viele verlockende Möglichkeiten. Um ihre Eltern auf ihre Seite zu ziehen, war es ratsam, etwas »Solides« vorzuschlagen. In ihrem Brief hatte sie daher Tätigkeiten als Modistin, Buchhalterin oder Erzieherin erwähnt. Wenn sie erst einmal das grundsätzliche Einverständnis hatte, würde ihr schon etwas einfallen. Die lange Funkstille aus Haapsalu verunsicherte Charlotte. Es sah ihren Eltern nicht ähnlich, ihre Briefe nicht umgehend zu beantworten.
»Wenn sie es dir verbieten wollten, hätten sie sich sofort gemeldet.«
Zillys Bemerkung riss Charlotte aus ihren Überlegungen. Sie setzte sich aufrecht. »Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen.« Sie lächelte. »Hoffen wir also das Beste.«
»Hier steckt ihr!« Auf der Türschwelle stand ein sommersprossiges Mädchen und schaute sie vorwurfsvoll an. »Schon vergessen? Wir wollten uns doch um zwei bei Ursula und Liese treffen und überlegen, was wir Tjilk und der Priorin zum Abschied schenken könnten.«
»Tschuldige, Ilse«, rief Zilly. »Gerade wollten wir uns auf den Weg machen.« Sie schnappte sich das Physikbuch, hakte sich bei Charlotte unter und folgte Ilse, die ihnen – etwas Unverständliches grummelnd – voraus zum Trakt mit den sogenannten Maidenzimmern ging, in denen die Schülerinnen wohnten.
Hatte sich Charlotte anfangs noch gemeinsam mit Zilly darüber lustig gemacht, dass sie und ihre Klassenkameradinnen als Maiden bezeichnet wurden, war sie mittlerweile stolz, eine solche zu sein. Das altmodisch anmutende Wort setzte sich aus den Anfangsbuchstaben der Tugenden zusammen, die sich die Schülerinnen auf die Fahne geschrieben hatten: Mut, Ausdauer, Idealismus und Demut.
Mit der Demut hatte Charlotte so ihre Schwierigkeiten, mit den anderen Eigenschaften konnte sie sich jedoch voll und ganz identifizieren, nicht zuletzt, weil sie ihr täglich von Elisabeth Tiling vorgelebt wurden. Charlotte war nicht allein mit ihrer Bewunderung für die Direktorin von Stift Finn, die von ihren Schülerinnen liebevoll Tjilk genannt wurde – das estnische Wort für Tropfen. Selbst Zilly, die sich gern über den Anspruch der Schulleitung mokierte, »die Mütter kommender baltischer Geschlechter« auszubilden und »die Trägerinnen baltischer Tradition und jahrhundertealten Erbguts« auf ihre Verantwortung vorzubereiten, machte aus ihrer Verehrung für die Schulleiterin keinen Hehl.
Eine knappe Stunde später eilten Charlotte und Zilly in das Zimmer, das sie sich mit zwei anderen Mädchen teilten, und holten die Hefte und Bücher, die sie für den Nachmittagsunterricht benötigten.
»Das Warten hat ein Ende«, rief Zilly und hielt Charlotte einen Brief hin, der zusammen mit anderen Postsendungen auf einer Kommode lag.
Charlotte erkannte die zierliche Schrift ihrer Mutter auf dem Umschlag. Mit klopfendem Herzen nahm sie ihn entgegen und drehte ihn unschlüssig in ihren Händen.
»Los, worauf wartest du?« Zilly sah sie auffordernd an.
Charlotte holte tief Luft, riss das Kuvert auf und überflog das kurze Schreiben.
Hapsal, 10.September1938
Liebe Charlotte,
bitte entschuldige, dass Du so lange auf Antwort warten musstest. Der Grund dafür ist leider ein trauriger: Deine Tante Luise ist von uns gegangen. Ich hatte Dir ja schon in früheren Briefen von ihrer schweren Erkrankung geschrieben, der sie nun erlegen ist.
Mein Bruder ist untröstlich, und ich mache mir Sorgen, wie er diesen Verlust verkraften wird. Er würde es nie zugeben, aber ich fürchte, dass er mit dem Haushalt allein nicht gut zurechtkommt. Er lehnt es bislang kategorisch ab, eine Wirtschafterin einzustellen. Wenn ich hier nicht unabkömmlich wäre, würde ich selbst für ein paar Wochen zu ihm fahren und ihm zur Hand gehen. Doch daran ist gar nicht zu denken. Ich werde nicht lockerlassen und nach einer soliden Haushälterin für meinen Bruder suchen. Das wird allerdings seine Zeit brauchen.
Dein Vater und ich haben daher beschlossen, Dich nach Dagö zu schicken. Von einer Verwandten wird sich Julius helfenlassen – und wer wäre geeigneter als eine frisch gebackene Absolventin von Stift Finn? Auf diese Weise kannst Du Deine Kenntnisse und Fertigkeiten direkt unter Beweis stellen. Du hast ja geschrieben, dass Du auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung bist. Ich gehe also davon aus, dass Du diese Aufgabe gern übernehmen wirst, zumal Du Dich immer gut mit Deinem Onkel verstanden hast.
Alles Weitere besprechen wir, wenn Du nach Deinem Examen nach Hause kommst.
Bis bald, herzliche Grüße von Deiner Mutter.
Charlotte stöhnte auf.
»Was ist los?«, fragte Zilly.
»Lies selbst.« Charlotte gab Zilly den Brief, ließ sich auf die Kante ihres Bettes sinken und beobachtete ihre Freundin beim Lesen. Dieselbe Enttäuschung, die sie verspürte, machte sich nun auch in Zillys Gesicht breit.
Mit einem Hupen verließ das Motorboot den neuen Hafen von Haapsalu und fuhr auf die Ostsee hinaus. Charlotte stand an einer Seitenreling und winkte ein letztes Mal der kleiner werdenden Gestalt ihrer Mutter zu, die am Kai stand, sich mit einer Hand den Hut festhielt und mit der anderen ein Taschentuch schwenkte. Nun geht’s also in die Verbannung, dachte Charlotte und rümpfte die Nase. Seit sie den Brief ihrer Mutter erhalten hatte, haderte sie mit dem Beschluss ihrer Eltern, sie zu Onkel Julius zu schicken. Sie hatte sich nicht getraut, offen dagegen zu protestieren – weder schriftlich noch im direkten Gespräch zu Hause, wo sie nach der Abschlussprüfung ein paar Tage verbracht hatte. Selbstsüchtig seinem eigenen Willen zu folgen – nichts anderes war in den Augen ihrer Eltern Charlottes Wunsch, in Tallinn eine Ausbildung zu machen –, kam in einer solchen Situation nicht infrage. Es war schlichtweg ihre Pflicht, einem Familienmitglied zu helfen und die eigenen Interessen hintanzustellen. Zur Wut auf die Selbstverständlichkeit, mit der über sie verfügt wurde, kam die Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden.
»Gib dir Mühe, mein Kind, und mach uns keine Schande«, hallte die Stimme ihrer Mutter nach. Noch auf den letzten Metern auf dem Weg zur Anlegestelle hatte Irmengard von Lilienfeld ihrer Tochter mit Ermahnungen, Ratschlägen und Verhaltensregeln in den Ohren gelegen – was Charlottes Nervosität ins schier Unerträgliche gesteigert hatte. Im Vergleich zu der bevorstehenden Aufgabe erschienen ihr im Nachhinein die Examina in Stift Finn harmlos. Dort hatte sie gewusst, was auf sie zukam, konnte sich in Ruhe darauf vorbereiten und fand Halt in der Gemeinschaft ihrer Mitschülerinnen. Nun würde sie weitgehend auf sich selbst gestellt sein.
Bei ihren früheren Aufenthalten auf Gut Birkenhof hatte Charlotte der Führung des Haushalts wenig Beachtung geschenkt. Alles funktionierte reibungslos. Dabei hatte Tante Luise immer das Herz des Hauses gebildet. Sie war für den Tagesablauf zuständig gewesen, hatte der Köchin und dem Dienstmädchen Anweisungen gegeben, Einnahmen und Ausgaben überwacht und selbst tüchtig zugepackt. Vor allem der weitläufige Gemüse- und Obstgarten hatte ihrer Obhut unterstanden und sie viel Arbeit gekostet. Die Zeiten, in denen herrschaftliche Anwesen von einer Schar dienstbarer Geister versorgt wurden, gehörten für die meisten deutschen Adligen auf dem Baltikum der Vergangenheit an – spätestens nachdem ein Großteil ihrer Ländereien und Güter mit der Unabhängigkeit des estnischen Staats enteignet wurden. Und nun würde sie – wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum – in die Rolle der Gutsherrin schlüpfen und die Verantwortung für den Haushalt tragen. Anstatt mit Zilly die Hauptstadt unsicher zu machen, ins Kino und in Tanzcafés zu gehen, Theatervorstellungen zu besuchen und neue, aufregende Kontakte zu knüpfen. Wo sich Zilly wohl gerade herumtreibt?, fragte sich Charlotte, während sie in die schäumende Bugwelle starrte. Was gäbe ich nicht darum, jetzt bei ihr zu sein!
Mit einem Seufzen richtete sie sich auf und stellte sich an die Reling am Bug des kleinen Dampfers. Der Wind, der bereits an Land kräftig geblasen hatte, wurde durch die Fahrt verstärkt und zerrte an dem Tuch, das sich Charlotte um den Kopf gebunden hatte. Sie zog den Knoten fester und hielt ihr Gesicht in die Sonne, die durch die dahinjagenden Wolken blitzte. Sie leckte sich mit der Zunge über die Lippen und schmeckte der metallischen Note des Salzes nach. Über ihr balancierten Möwen im Wind, ließen sich zurückfallen, machten kehrt und trotzten scheinbar mühelos den Böen. Charlotte versuchte sich vorzustellen, wie es sich anfühlen mochte, so frei durch die Luft zu schweben. Wenn ich fliegen könnte, würde ich längst nicht mehr auf diesem Schiff stehen, sondern wäre auf dem Weg nach Tallinn. Sie senkte den Blick und bemerkte einen dunklen Streifen im Westen, der inmitten des Blaus des Himmels und des Graugrüns der Ostsee den Horizont begrenzte: Hiiumaa. Allmählich wurde die Insel größer, die einst von den Schweden Dagö, Taginsel, genannt worden war. Charlotte beschattete ihre Augen und ließ sie über die Wipfel der Bäume wandern. Wenn sie früher mit ihrer Familie nach Hiiumaa gefahren war, hatten sie und ihr Bruder einen Wettstreit daraus gemacht, wer als Erster den Kirchturm von Pühalepa entdeckte, der in früheren Jahrhunderten den Schiffern als Seezeichen zur Orientierung gedient hatte. Er lag nur einige Kilometer vom Hafenort Heltermaa entfernt, der ersten Station des Motorboots.
Charlottes Herz schlug schneller. Nicht aus Nervosität. Überrascht stellte sie fest, dass sie von der Vorfreude auf dieses Fleckchen Erde übermannt wurde, dem sie ihre schönsten Sommererinnerungen verdankte. Als Kind hatte sie den Hof ihres Onkels samt seinem Park mit den alten Birken sowie die angrenzenden Weiden und Wälder als riesigen Spielplatz gesehen, auf dem sie und ihr Bruder gemeinsam mit den Kindern anderer Urlauber sowie der benachbarten Bauern- und Fischerfamilien die Sommerferien verbrachten. Das Landleben war ihr als eine endlose Kette unbeschwerter Tage in Erinnerung geblieben, die den Geschmack von selbstgepflückten Beeren und frisch gegrilltem Fisch innehatten, nach Meer, Kiefernharz und Wacholder rochen und vom Gezirpe der Grillen sowie dem Rauschen der Brandung erfüllt waren. Sie hatte Onkel Julius und seine Frau darum beneidet, das ganze Jahr über in diesem Paradies leben zu dürfen.
Erst beim Anblick der Insel wurde ihr bewusst, wie sehr sie sie vermisst hatte. Seit ihr Bruder Johann und sie »aus dem Gröbsten« heraus waren, wie ihre Mutter es nannte, hatten die Eltern in den vergangenen fünf Jahren die Ferien gern in Orten verbracht, in denen kulturell und gesellschaftlich mehr geboten wurde als auf dem Birkenhof. Höhepunkte waren dabei bislang ihre Reisen nach Paris, London und Kopenhagen, eine Kreuzfahrt im Mittelmeer mit Landaufenthalten in Griechenland, Ägypten und der Türkei sowie nach Johanns Abitur eine Bildungsreise auf Goethes Spuren nach Italien gewesen. Irmengard von Lilienfeld hatte es sich auf ihre Fahne geschrieben, ihren Sprösslingen die Wiege der europäischen Philosophie und Kunst zu zeigen und ein tieferes Verständnis für die Wurzeln der abendländischen Kultur zu erzeugen. Charlotte hatte diese Urlaube genossen, begeistert die fremdartigen Landschaften und Städte erkundet und die ungewohnten Gerüche, Farben, Lichtstimmungen, Speisen und Sprachen mit allen Sinnen in sich aufgesogen. Die vertraute Küstenlinie von Hiiumaa rührte jedoch etwas in ihr an, das tiefer ging als die Faszination dieser Fernreisen.
Nach einem kurzen Halt im Hafen von Heltermaa ging es entlang der Ostküste weiter in eine Art Binnenmeer – umrahmt von den Inseln Saaremaa, Hiiumaa und Muhu. Das Schiff fuhr an dicht begrünten, kleinen Eilanden und felsigen Schären vorbei, die teilweise nur ein paar Handbreit aus dem flachen Wasser ragten. Die Fahrrinne war schmal und an keiner Stelle tiefer als fünf Meter. Schließlich umrundeten sie die Insel Kassari, die durch zwei Dämme mit Hiiumaa verbunden war, und erreichten kurz darauf Charlottes Ziel, den Hafen von Orjaku.
Nikolaus II. hatte einst große Pläne für das damalige Fischerdörfchen gehabt, von denen noch zwei lange Molen und eine Landungsbrücke zeugten. Orjaku sollte als Versorgungshafen für seine Ostseeflotte dienen und die Bucht entsprechend ausgebaggert und befestigt werden. Der Weltkrieg und die Revolution hatten dem letzten Zaren jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Bauarbeiten unterbrochen. Dieser Tage wurde der Hafen für den Transport von Holz nach Tallinn genutzt sowie für den Personenverkehr.
Charlotte griff nach ihrer Reisetasche und verließ mit zwei weiteren Passagieren das Schiff. Ihren Schrankkoffer hatte sie bereits zwei Tage zuvor aufgegeben und hoffte, dass er mittlerweile wohlbehalten auf dem Birkenhof eingetroffen war. Sie sah sich suchend um. Ihr Onkel hatte telegraphiert, dass er eine Kutsche zum Hafen schicken würde. Abgesehen von einem Postboten auf einem Fahrrad und einem mit Strohballen beladenen Karren, vor den zwei Ochsen gespannt waren, konnte sie jedoch kein Fahrzeug entdecken. Sie zuckte mit den Schultern und machte sich auf der ungepflasterten Straße auf den Weg zum Birkenhof, der sich ungefähr fünf Kilometer von Orjaku entfernt am Ufer der Käina-Bucht befand. Im Grunde handelte es sich um einen Küstensee, dessen Schilfgürtel und rund zwei Dutzend Inselchen Rohrdommeln, Odinshühnchen, Kormoranen, Schwänen, Säbelschnäblern und weiteren unzähligen Vogelarten Plätze zum Nisten und Brüten boten. Im Herbst und im Frühling machten außerdem riesige Schwärme von Kranichen, Bläss- und Graugänsen, Reihern und anderen Zugvögeln auf ihren langen Flügen gen Süden oder auf dem Rückweg in nördlichere Gefilde in der Bucht Rast. In den warmen Flachwasserzonen taten sie sich an den reichlich gedeihenden Algen, Muscheln und Krebsen gütlich, bevor sie ihre Reise fortsetzten.
Charlottes Beine schritten wie von selbst weit aus, die Melodie ihres Lieblingsliedes »Geh aus, mein Herz, und suche Freud« lag ihr unwillkürlich auf den Lippen, während sich ihre Augen nicht sattsehen konnten an dem weiten Himmel und den Wolkengebilden, die der Wind in Sekundenschnelle verformte, ineinanderschob und wieder in Fetzen riss. Vergessen waren die Wut auf ihre Eltern und die Angst, zu versagen. In diesem Augenblick zählte nur das Glück, in der vertrauten Umgebung zu sein.
»Kissel? Bist du das?«
Die Stimme in ihrem Rücken schreckte Charlotte aus ihrer Versunkenheit. Sie drehte sich um und sah einen Einspänner, der von einem kräftigen Fuchs mit weißer Blässe gezogen wurde. Auf dem Kutschbock saß ein junger Mann, der das Pferd mit einem leisen »Brrr« zum Stehen brachte.
»Lennart!«, rief sie und starrte ihn überrascht an. »Was machst du denn hier?«
Seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, war er in die Höhe geschossen, ansonsten hatte er sich kaum verändert: Die blonden Haare, die sich von keiner Bürste bändigen ließen, die Sommersprossen auf Nase und Stirn und die graublauen Augen, in denen rasch ein belustigtes Fünkchen aufglomm.
»Dich abholen«, antwortete er. »Oder sollte ich besser Sie sagen? Du siehst so … äh, erwachsen aus.«