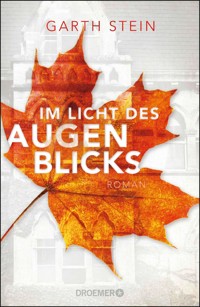
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman "Im Licht des Augenblicks" von Garth Stein erzählt eine poetische, atmosphärische und tiefgründige Familiengeschichte aus dem Nordwesten der USA. Der 14-jährige Trevor besucht mit seinem Vater das heruntergekommene Familien-Anwesen in der Nähe von Seattle, in dem sein Großvater und seine Tante wohnen. Trevor stöbert durch längst verlassene Zimmer, in Geheimgänge hinter Tapetentüren, immer auf der Suche nach Antworten, vor denen die Erwachsenen zurückscheuen: Warum verletzt man immer wieder die, die man am meisten liebt? Wie kann man Schuld wiedergutmachen? Wie schwer wiegt ein Geheimnis, das man anderen vorenthalten hat? Seit Generationen scheint ein Fluch auf Trevors Familie zu lasten. Doch nun macht sich der gewitzte Trevor auf, die Wahrheit zu entdecken und auszusprechen. "Ich habe "Im Licht des Augenblicks" verschlungen. Ein großes, wunderbares, Generationen umspannendes Epos, das im Nordwesten der USA spielt. Garth Stein hat uns erneut einen einzigartigen, gefühlvollen Erzähler für die Ewigkeit geschenkt, der uns in eine Geschichte voller Geheimnisse und Sehnsüchte mitnimmt." (Maria Semple, Autorin von "Wo steckst du, Bernadette?")
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Garth Stein
Im Licht des Augenblicks
Knaur e-books
Über dieses Buch
Der 14-jährige Trevor besucht mit seinem Vater das heruntergekommene Familien-Anwesen in der Nähe von Seattle, in dem sein Großvater und seine Tante wohnen. Trevor stöbert durch längst verlassene Zimmer, in Geheimgänge hinter Tapetentüren, immer auf der Suche nach Antworten, vor denen die Erwachsenen zurückscheuen: Warum verletzt man immer wieder die, die man am meisten liebt? Wie kann man Schuld wiedergutmachen? Wie schwer wiegt ein Geheimnis, das man anderen vorenthalten hat? Seit Generationen scheint ein Fluch auf Trevors Familie zu lasten. Doch nun macht sich der gewitzte Trevor auf, die Wahrheit zu entdecken und auszusprechen.
Inhaltsübersicht
Für meinen toten Vater
Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind,
wir sehen sie, wie wir sind.
Anaïs Nin
Prolog Der Fluch
In meiner Jugend im ländlichen Connecticut hieß es, der Name Riddell habe bei den Leuten im Nordwesten Gewicht. Mein Ururgroßvater väterlicherseits sei ein bedeutender Mann gewesen, erklärte mir meine Mutter. Elijah Riddell hatte in der Holzindustrie ein gewaltiges Vermögen angehäuft, das allerdings von seinen Nachfolgern wieder verloren wurde. Meine Vorfahren hatten das Gesicht Amerikas verändert, im eigentlichen Wortsinn verändert, mit Äxten, Baumsägen und Dieselschleppern, um die Gefallenen zu bergen, mit Fabriken, um die Leichen zu verarbeiten und ihre Asche zu zerstreuen. So hatten sie für uns alle einen Platz in der Geschichte frei geschlagen, und auf diesem Platz, so hieß es, laste ein Fluch.
Meine Mutter ist in Cornwall geboren, eine englische Bauerntochter, die etwas aus sich gemacht hat, indem sie ihrer Leidenschaft für das geschriebene Wort folgte, am Ende sogar eine Dissertation verfasste und damit einen Doktorhut der Harvard-Universität in Vergleichender Literaturwissenschaft erlangte. Damit war sie die Erste in ihrer Familie mit einem höheren Abschluss. Nur fing sie mit ihrer Brillanz nie etwas Beachtenswertes an, trug ihr Wissen allerdings wie einen Saatbeutel mit sich und verteilte es auf ihrer Meinung nach fruchtbarem Grund, fütterte mich als Kind bereits mit literarischen Zitaten und machte mich zu einem begierigen Leser. Schon vor meinem vierzehnten Geburtstag kannte ich die Geschichte des Alten Seemanns, die der Dichter und Philosoph Samuel Taylor Coleridge erzählt und die auch als Sinnbild für die Geschichte meiner Familie gelten kann.
Der Fluch. Wer etwas so Schönes wie den hilfreichen Albatros erschießt, der ihm den Weg aus den gefährlichen arktischen Gewässern weist, wird dafür bestraft. Verflucht. Meine Mutter erklärte mir das, und mein Vater nickte dazu. »Der Schütze und seine Familie werden dafür bestraft«, sagte sie, »bis die Schuld beglichen ist.«
Die Schuld meiner Familie ist beglichen, mehr als das. Mutter hat immer schon an die reinigende Kraft der Katastrophe geglaubt, sieht das Geschehene als einen Schlusspunkt und geht heute Morgen lieber spazieren, als bei uns zu bleiben und zuzuhören, wie ich alles noch einmal erzähle. Ich bin da jedoch anderer Meinung: Es gibt keine Geschichte mit einem sauberen Ende, sosehr wir es auch hoffen mögen. Geschichten entwickeln sich weiter, wozu auch gehört, dass man sie immer wieder aufs Neue erzählt. Legenden werden durch ihre Interpretationen geprägt, Interpretationen durch die Zeit. Und so erzähle ich jetzt meine Geschichte, wie der alte Seemann seine erzählte: Er stand am Rand des Hochzeitsfestes, griff nach einem vorbeikommenden Handgelenk und lähmte sein Opfer mit seinem Blick. Ich stehe mit meiner Familie am Rand dieses unsterblichen Waldes.
Ich erzähle diese Geschichte, weil ich es muss.
Es begann vor etwas über zwanzig Jahren, noch bevor die Technologie unsere Welt veränderte und der Terrorismus Furcht in die Herzen unserer Bürger grub. Bevor Jungen in Trenchcoats überall in diesem schönen Land Klassen voller unschuldiger Kinder heimsuchten und mordeten. Bevor die Ozeane dick vor Ölschlamm wurden und Bill Gates sich anschickte, die Welt zu Tode zu lieben, bevor Orkane so heftig wurden, dass sie ganze Städte ins Wanken brachten, bevor problematische Kinder (um die Profite der Pharmaindustrie in die Höhe zu treiben) bis zur Besinnungslosigkeit mit Pillen vollgestopft und uns allen genetisch modifizierte Nahrungsmittel aufgezwungen wurden, ohne dass uns die Problematik bewusst gewesen wäre. Bevor das Marihuana-Rauchen bei Schwulenhochzeiten aus der Mode kam, Schwule überhaupt, äh, zu ganz normalen Leuten wurden und Gras zu einer simplen weiteren Steuerquelle. Was noch vor einem anderen berühmten Bill war, dem mit dem Nachnamen Clinton, der wegen der Auswahl seiner Zigarren Berühmtheit erlangte. Das alles scheint Ewigkeiten her. Keine Smartphones. Kein On-Demand. Nicht mal ein iPad war in Sicht.
So lange ist es her. Ja. Meine Geschichte beginnt im Jahr 1990.
An einem heißen Julitag in Seattle fährt ein erbsengrüner Mietwagen vom Flughafen Seattle/Tacoma in nördlicher Richtung die Interstate 5 hinauf. Ringsum in den Hügeln, hinter Brücken und Gewässern, liegen Wohnviertel versteckt, und der Fahrer und sein Beifahrer, Vater und Sohn, reden nicht miteinander. Der Junge ist fast vierzehn und unglücklich. Unglücklich, weil er das Haus seiner Kindheit verlassen muss und zu dieser Fahrt gezwungen wird. Unglücklich, weil seine Mutter nicht bei ihm ist. Unglücklich, dass da sein Vater sitzt. Also sagt er nichts. Konzentriert lauscht er der Musik von Pink Floyd’s The Wall über die Kopfhörer seines Walkmans.
Sein Vater sieht immer wieder nervös zu ihm hinüber. Sein ganzes Sehnen scheint darauf gerichtet, von dem Jungen anerkannt zu werden, doch der bleibt stur. Als sie sich dem Süden der Stadt nähern, hebt der Junge den Blick und sieht die Space Needle, das allgegenwärtige, merkwürdige Wahrzeichen Seattles. Die Belanglosigkeit des Monuments lässt ihn zusammenzucken. Wer um alles in der Welt konnte so etwas bauen, und was für eine Stadt würde darauf Wert legen? Er senkt den Blick auf seine Schuhe, die ihm weit interessanter vorkommen.
Er sieht die Stadt nicht, durch die sie fahren. Sie überqueren eine hohe Brücke.
»Willst du dich nicht mal umsehen?«, fragt der Vater endlich verzweifelt, klopft dem Jungen auf die Schulter und deutet auf die Pracht Seattles ringsum.
Der Junge hebt den Kopf und sieht sich um. Brücken, Seen, ausdruckslose Gebäude, Funktürme, Wasserflugzeuge, Berge, Bäume. Er kennt das Bild.
»Nein«, sagt er und kehrt zu seiner Musik zurück. Die Stimmen singen ihm zu: Reiß die Mauer ein. Reiß die Mauer ein.
Und so beginnt meine Geschichte.
1 Der North Estate
Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als wir den Freeway an der nördlichen Stadtgrenze verließen und in die typische amerikanische Vorstadtwelt eintauchten. Ein Laden für Klempnerbedarf, Las Margaritas, ein mexikanisches Restaurant, Cliffs Kartenkasino, Genes IGA-Lebensmittel, eine ARCO-Tankstelle, ein Stoffgeschäft. Es war schlimmer, als ich es mir hätte vorstellen können. Wir überquerten eine öde Avenue an einer Kreuzung mit viel zu vielen Autos, die auf Grün warteten, um nach links abzubiegen. Aber dann verengte sich die Straße auf zwei statt vier Fahrspuren, Bäume lehnten sich über die Fahrbahn und verdeckten den Himmel, und als mein Vater schließlich in eine noch kleinere Straße und eine Zufahrt bog, schaltete ich den Walkman aus. Wir kamen zu einem Wachhäuschen mit einer Schranke. Mein Vater kurbelte sein Fenster herunter, die Tür des hölzernen Häuschens öffnete sich, und ein uniformierter Wärter trat heraus. Er war alt und gebrechlich und sah nicht aus, als könnte er einen Angriff stoppen, sollte jemand den North Estate erobern wollen, für dessen Verteidigung er offensichtlich bezahlt wurde.
»Zu wem wollen Sie?«, fragte er gutgelaunt.
»Nach Hause«, sagte Vater. »Ich kehre nach Hause zurück.«
Der alte Mann legte den Kopf leicht schief, doch dann begriff er. »Der Teufel soll mich holen. Jones Riddell.«
»Val«, sagte mein Vater, »ich kann nicht glauben, dass Sie hier immer noch Dienst tun.«
»Vor ein paar Jahren wollten sie mich in Rente schicken, aber ich kann nicht den ganzen Tag allein sein, und da haben sie mich wieder eingestellt.«
Die beiden Männer verstummten, und ich weiß noch, wie ich den fast überwältigenden Drang verspürte, mit der für mich so offensichtlichen Frage herauszuplatzen: Aber wenn Sie den ganzen Tag da in dem Wachhäuschen hocken, sind Sie dann nicht allein?
»Wie lange ist es her, Jones? Lange.«
»Dreiundzwanzig Jahre.«
»Dreiundzwanzig Jahre. Ihre Mutter war eine tolle Frau.«
»Das war sie.«
»Eine echte Tragödie.«
Val nickte und klopfte aufs Autodach. Er zog die Hose ein Stück höher, streckte sich, ging zur alten Holzschranke hinüber und drückte auf das Gegengewicht. Das Ding hob sich und gab den Weg frei. Als wir an ihm vorbeirollten, winkte Val und rief: »Willkommen daheim.«
Was für eine Tragödie? Über den Tod meiner Großmutter wurde nicht gesprochen. Ich hatte oft nach ihr gefragt, ohne Erfolg. Mein Vater wollte nicht über sie reden. Ich war überzeugt, dass er es nie tun würde.
Wir ließen die Schranke hinter uns, und die Welt veränderte sich, als wären wir in einen mittelalterlichen Wald teleportiert worden. Wir schlängelten uns durch Schluchten und kamen an Einfahrten zu fernen, kaum erkennbaren Häusern vorbei, die hinter zahllosen Bäumen versteckt lagen. Immergrünen Bäumen: Zedern und Fichten, Tannen und Kiefern. Sommergrünen Bäumen: Eichen und Birken, Ahorn und den für den Nordwesten typischen Erdbeerbäumen mit ihrer roten, sich pellenden Rinde. Tiefer und tiefer fuhren wir in den Wald, die Zufahrten wurden weniger und herrschaftlicher, Tore blockierten den Zugang, Natursteinmauern führten an der Straße entlang. Ich hatte das Gefühl, wir bewegten uns immer weiter in der Zeit zurück. Die sich windende Straße verwandelte sich in einen pockennarbigen, mit Schlaglöchern durchsetzten Schotterweg, der unter unseren Reifen knirschte, als ginge es über die brüchigen Knochen von lauter Toten. Wir erreichten das Ende der Straße. Seitlich lag ein kaputtes Eisentor, das schon vor langer Zeit aus seinen Angeln gehoben worden war, und ich wusste, wir hatten unser Ziel erreicht. Es ging hier sonst nirgends mehr hin.
Wir fuhren auf das Anwesen und folgten einem sich windenden Weg hinunter in eine kühle Schlucht, bevor es steil nach oben auf eine Anhöhe mit einer Lichtung auf einem Steilufer ging. Der Blick weitete sich hinaus auf den Puget Sound. Mein Vater hielt auf der Zufahrt, und ich war sprachlos. Nicht aus Protest, nein. Der Anblick des Hauses überwältigte mich: Riddell House.
Mein Vater hatte mir davon erzählt, von dem Ort, an dem sein Vater geboren war und an dem die Familie damals schon seit zwei Generationen wohnte. Vaters Urgroßvater hatte Riddell House vor einem Jahrhundert errichtet. Die Beschreibung meines Vaters war vage und oberflächlich geblieben, eigentlich hatte er nur die Nachteile und Probleme aufgezählt, die es mit dem Haus gab. Es verfalle langsam, hatte er mir erklärt, und sei praktisch dem Untergang geweiht. Wir fahren hin, um es von seinem Elend zu befreien, wir reißen es ab, verkaufen das Land und sind damit fertig. Aber das war offenbar nicht die ganze Wahrheit, Riddell House war weit mehr, als ich aus seinen Worten hatte schließen können. Ich hatte einen baufälligen alten Schuppen erwartet, der kaum eines Blickes würdig war, doch was ich da sah, war ganz sicher kein Schuppen.
Mein Vater stieg aus dem Auto. Ich folgte ihm und trat an den Rand der Zufahrt. Hinter einer großen, vertrockneten Wiese ragte ein massiges Gebäude aus Balken, Ziegeln und Steinen auf, gekrönt von einem Dach aus schweren Zedernschindeln mit grünen Kupferrinnen und Fallrohren. Rund ums Erdgeschoss und die erste Etage des dreistöckigen Hauses verliefen eine Veranda und ein Balkon. Die Zufahrt führte in einem ebenmäßigen Rund zu ein paar prächtigen Eingangsstufen und mündete dann wieder in sich selbst. Ein schmaler Weg zweigte von ihr ab und verschwand hinter dem Haus. Auf den ersten Blick zählte ich ein Dutzend Kamine, wobei ich sicher war, dass es noch mehr gab. Die Zahl der Fenster schätzte ich auf hundert, nahm mir aber nicht die Zeit, genauer nachzuzählen. Aus unserer Perspektive wirkte das Haus gedrungen, als kauerte es sich auf den Boden. Die Säulen, die es einfassten und einen großen Teil der Außenwände ausmachten, waren massige Baumstämme. Stämme uralter, riesiger Bäume, von ihren Ästen befreit, aber immer noch in ihre Rinde gekleidet. Jeder einzelne ein Prachtexemplar. Am Giebel standen gleich drei nebeneinander, der größte meiner Schätzung nach sicher fünfzehn Meter hoch. Ein Regiment stummer, mächtiger Riesen.
Riddell House.
Ich holte tief Luft und roch Meerestiere, Seegras und Schlamm. Es war wie bei Ebbe in Mystic, Connecticut, wohin ich früher oft mit meinen Eltern für einen Tag gefahren war. Venusmuscheln, Krabben und Tang. Es ging ein kräftiger Wind, und ich kämpfte mit dem flatternden Papiernest meiner Pommes frites. Mein Vater lächelte meiner Mutter zärtlich zu und beugte sich vor, um ihr einen Kuss zu geben. Mutter erwiderte seinen Kuss, und ich bekam endlich eine meiner Pommes frites zu fassen. Es war die beste der Welt.
Die Dinge, an die wir uns erinnern.
Nach Westen hin dehnte sich der Puget Sound zwischen uns, den Bäumen und der Halbinsel Kitsap dahinter aus, wo sich der blaue Gebirgszug mit seinen zerklüfteten Gipfeln erhob.
»Die erste Zielvorgabe ist damit erfüllt«, sagte mein Vater, »Riddell House lokalisiert und identifiziert.«
Mein Verhältnis zu meinem Vater war damals nicht unbedingt schlimm, aber doch ziemlich oberflächlich und fußte weniger auf den Dingen, wie sie waren, sondern eher auf Phantasien. Wir gingen nicht einfach einkaufen oder säuberten den Rinnstein, sondern »fuhren Einsätze«. Wir benutzten Codewörter, arbeiteten »verdeckt« und starteten »Kommandounternehmen«. Einer seiner Standardsätze war: »Wir befinden uns in der Akquisitions- und Entwicklungsphase.« Als müsste alles mit einer Kriegslist angegangen und in Ironie gehüllt werden. Wir wickelten alles in eine schützende Schicht Befangenheit, was aller Aufrichtigkeit und Offenheit den Garaus machte. Wir gingen Eier kaufen, aber nicht wirklich, nein, wir nahmen das »Projekt Ovum« in Angriff, was verschiedene, die nationale Sicherheit betreffende Missionen notwendig machte. Als kleiner Junge hatte ich das toll gefunden, als fast Vierzehnjähriger aber nicht mehr. Weil ich zu begreifen begann, dass es für meinen Vater kein Spiel war. So lebte er sein Leben.
Ich reckte mich und dehnte den Rücken. Es war gut, aus dem Auto herauszukommen und in der heißen Sonne zu stehen. Eine Brise strich über die Wiese und drückte die langen Halme mit unsichtbarer Hand in meine Richtung, umwirbelte mich und kühlte meinen Nacken.
»Ich verstehe das nicht«, sagte ich. »Das Haus sieht doch gut aus. Warum wollen wir es abreißen?«
Mein Vater sah mich einen Moment lang an.
»Es ist morsch und faul«, sagte er nur und schob mich zurück zum Auto.
Wir fuhren die letzten Meter über die gekieste Zufahrt, wie eine graue Narbe schnitt sie durch das verdorrte Grün. Als wir zum Stehen kamen, wurden wir für einen Moment von einer Staubwolke verschluckt, ließen sie abziehen, stiegen aus und betrachteten den monumentalen Bau vor uns. So aus der Nähe hob er sich bis in den Himmel und blendete alles andere aus. Er strahlte eine ungeheure Kraft aus, die Baumstämme der Außenwände waren wirklich immens. Vielleicht waren es der lange Flug und die Autofahrt, vielleicht auch das Gefühl, zum ersten Mal seit Beginn unserer Reise wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, auf jeden Fall wurde ich von einer Gefühlsaufwallung erfasst, der ich kaum zu widerstehen vermochte. Ich brach zwar nicht in Tränen aus, wurde aber von dem Gefühl erfüllt, das ihnen normalerweise vorangeht, und wunderte mich. Ich fragte mich, was mich so anrührte. Es war wie eine Inspiration.
»Es ist morsch«, wiederholte mein Vater.
Warum behauptete er das so beharrlich? Ich sah ihn an. Er schüttelte mitleidig den Kopf, und ich wandte mich wieder dem Haus zu und versuchte, es mit seinen Augen zu sehen: Das Ziegelfundament war brüchig, der Mörtel zwischen den Steinen hier und da weggebrochen, Löcher gaben den Blick auf das Dunkel im Inneren frei. Die Blumenbeete waren verwahrlost, Efeu wucherte an den Baumstämmen hoch und krallte sich mit seinen blassen Tentakeln ins Holz. Wir stiegen die Stufen hinauf, und ich sah, wie verzogen die Verandadielen waren. Die Fenster bestanden aus kleinen, welligen, unebenen Scheiben. Viele waren gesprungen, einige herausgebrochen und durch Sperrholz ersetzt. Mein Vater klopfte gegen einen der Stämme und zog die Brauen zusammen, so hohl klang das Holz. Ich hörte es auch. Es klang wie tot.
Als er an den Fugen kratzte, rieselte trockener Mörtel heraus, wurde zu Staub und löste sich auf. In langen, zackigen Streifen blätterte die Farbe von den Fenstern, und wir bemerkten die Lücken zwischen Rahmen und Schindeln. Riddell House verfiel tatsächlich.
»Würde es einer Überprüfung standhalten?«, fragte ich.
»Du meinst durch jemanden, der nicht im Koma liegt?«, antwortete mein Vater.
Er klopfte an die Tür, drückte die Klinke, klopfte noch einmal. Nichts.
»Ich habe Serena gesagt, wann wir kommen würden.«
Er tastete über den Türrahmen und hatte plötzlich einen Schlüssel in der Hand.
»Einige Dinge ändern sich nie«, sagte er und schob den Schlüssel ins Schloss. Die Tür öffnete sich.
Ich weiß noch, wie ich mich von dem Haus ins Innere gezogen fühlte, als wir die Eingangshalle betraten. Sie glich einer Zeitkapsel, die vor kurzem erst aus einem Riesengletscher geschmolzen war. Ein unberührtes Stück Welt aus dem Seattle der Jahrhundertwende. Ein Museum. Ein staubiges, verblichenes, mottenzerfressenes Museum.
Es war eine Welt des Verfalls, durchsetzt mit schwerer, zäher Luft, die wie unsichtbarer Nebel durch die Räume trieb, wobei das Innere des Hauses aus sorgsam bearbeitetem Holz bestand, im Gegensatz zu der groben Fassade. Dunkel, mit Einlegearbeiten, eng gemasert und schokoladenfarben. Überall lagen Orientteppiche, und ich sah eine Standuhr, die auf Viertel nach sechs stehengeblieben war. Die Eingangshalle öffnete sich hoch ins Licht. Ein Flur gegenüber der Eingangstür führte in die Finsternis, eine breite Treppe hinauf auf einen Balkon. Ich trat in das Zimmer zu meiner Rechten und sah mich um. Die Möbel waren nobel und dick gepolstert, Teppiche, Wände und Decke dunkel und düster. Eiserne Löwen mit ausgefahrenen Klauen bewachten einen großen Kamin, darüber hing ein sicher zweieinhalb Meter großes Gemälde. Es zeigte einen gutgekleideten Mann mit einem Stock und wildem, silbernem Haar, der mir direkt in die Augen sah und seine Hand mit einer so aggressiven Willkommensgeste entgegenreckte, dass ich zurückzuckte.
»Dein Ururgroßvater«, sagte mein Vater. Er stand direkt hinter mir. »Elijah Riddell.«
»Warum hat er ein Bild von sich in seinem eigenen Haus aufgehängt?«, fragte ich.
»Reiche Leute machen das so.«
»Reiche Leute sind komisch.«
»Vielleicht ist sie in der Küche«, sagte mein Vater und ging in den hinteren Teil des Hauses.
Ich wollte bleiben und die Zimmer erkunden, doch das alles war schon etwas unheimlich. Fast kam es mir vor, als lebte und atmete das Haus, was so verstörend war, dass ich meinem Vater folgte.
Wir kamen an einem Esszimmer mit einem wohl acht Meter langen, von Dutzenden Stühlen umstandenen Tisch vorbei, dann an einem düsteren Raum mit Büchern vom Boden bis zur Decke und Buntglasfenstern. Die Küche selbst schien mir auf den ersten Blick größer als unser ganzes Haus in Connecticut. Auf der einen Seite gab es einen Kochbereich mit einem großen Schlachtertisch, dessen Platte vom jahrzehntelangen Schneiden und Hacken abgenutzt war, einem Brotofen und einem riesigen gusseisernen Herd unter einer großen kupfernen Abzugshaube. Gegenüber vom Herd stand ein langer Holztisch mit einer bunten Sammlung Stühle und einer Art Wohnecke mit ein paar Sesseln, einem kleinen Sofa und einem neuen Fernseher auf einem alten Rolltisch. Ein Stück seitlich von Ofen und Herd befand sich ein riesiger Kamin mit langen Haken, die früher, wie mein Vater erklärte, für große Kessel zum Kochen von Eintöpfen benutzt worden seien. Er deutete auf die Grillhalterungen für Lammhälften und große Rinderstücke.
»Um die Einsatzkommandos zu füttern?«, fragte ich, doch er überging meine Bemerkung.
»Das Haus stammt aus einer Zeit, als es hier noch keinen Strom gab«, sagte mein Vater. »Auch kein Gas. Als Elijah es hier errichten ließ, gab es ringsum nur Wildnis, und alles im Haus wurde mit Kohle befeuert. Ich zeig es dir unten im Keller. Das ist schon faszinierend. Irgendwann dann haben sie ein hochmodernes System installiert, mit dessen Hilfe sie aus Kalziumkarbid und Wasser Azetylen zum Betreiben eines Generators herstellten …«
»Woher weißt du das alles?«, fragte ich.
»Als Kind fand ich es toll. Ich kann dir die Anlage zeigen. Auf jeden Fall hatten sie vor allen anderen Strom. Lange bevor der North Estate mit der Stadt verbunden war und es städtischen Strom und Gas gab.«
»Ist dafür unser Erbe draufgegangen? Für die Entwicklung einer modernen Stromerzeugung?«
»Weißt du«, sagte er, »irgendwann wirst du begreifen, dass du als Klugscheißer nicht unbedingt klug, sondern eher ein Scheißer bist.«
»Super«, sagte ich. »Hast du das aus einem Glückskeks?«
»Wahrscheinlich.«
Zum ersten Mal auf unserer albernen Reise musste ich lächeln, einerseits wegen des Witzes, andererseits wegen meines Vaters.
Ich meine, er sah schon lächerlich aus. Wie Shaggy aus Scooby-Doo. Er trug die alten Khaki-Shorts, die er immer trug, ein weißes T-Shirt und Bootsschuhe. Und so verreiste er auch! Ins Flugzeug war er so gestiegen und quer übers Land geflogen! Wenn meine Großmutter und mein Großvater, die Eltern meiner Mutter aus England, uns besuchten, putzten sie sich für den Flug heraus, Großmutter mit ihren Perlen und einem schicken Kleid. Ich hatte Großvater einmal gefragt, warum sie das machten, und er meinte: »Wenn wir abstürzen und sterben, dann, bitte schön, in unseren besten Sachen.« Also das nenne ich Respekt vor dem System.
Jones Riddell, mein Vater, hatte einen drahtigen grauen, viel zu langen Bart, und vor allem das Gestrüpp auf der Oberlippe machte meine Mutter wahnsinnig, aber sie sagte nichts dazu. Sie drängte ihn nie, sich zu ändern. Wobei ich annahm, dass sie ihm das, was sie so verabscheute, nur ließ, damit sie ihn nicht mögen musste. Sein Haar war zu lang, sein Gesicht zu braun, und er wurde ganz faltig, weil er so viel in der Sonne auf seinen Booten arbeitete. Mutter hatte längst aufgegeben, ihn an seine Sonnencreme zu erinnern. Ich brauchte nur hinaus auf die Straße zu gehen und die Zeitung hereinzuholen, schon musste ich mich eincremen, mein Vater nicht. Sie hatte ihn längst abgeschrieben.
Jetzt standen wir in der Küche des offenbar verlassenen Hauses und wussten nicht recht, was tun. Ich warf einen Blick aus dem nach Norden gehenden Erkerfenster und sah eine Frau auf einem Rad. Wie aus einem alten Film entsprungen, saß sie auf ihrem Großmutterfahrrad mit zwei Körben voller überquellender Einkaufstüten. Die Frau wirkte jugendlich und schlank und trug ein langes, kokett um die hohen Stiefel wehendes Kleid, das sich wunderbarerweise nicht in der Kette verfing. Ihr kastanienbraunes Haar wurde von einem Band über dem Nacken zusammengehalten, und sie hielt das Gesicht leicht zum Himmel erhoben, als wollte sie die Sonne grüßen. Ich zeigte auf sie, und da bemerkte auch Vater sie.
»Da ist sie ja«, sagte er, während sie die Zufahrt heraufkam. Sie sah unser Auto vor dem Haus stehen, wandte den Blick zum Erkerfenster und musste uns drinnen gesehen haben, denn sie lächelte und winkte. Sie fuhr ums Haus herum, verschwand aus unserem Blickfeld und betrat Sekunden später die Küche. Ihre Wangen waren gerötet, und sie war außer Atem, lächelte mit leuchtenden Augen und hielt den Blick fest auf meinen Vater gerichtet. Eine Hand legte sie in den Nacken, die andere auf die Hüfte. Ihr ärmelloses Kleid ließ ihre schön geformten Arme sehen und legte sich eng um ihre Taille, wie ich es bisher nur bei Frauen in Filmen und im Fernsehen gesehen hatte.
Ich war ziemlich angetan von ihr. Als mein Vater gesagt hatte, jetzt würde ich endlich meine Tante kennenlernen, die sich um meinen Großvater kümmerte, hatte ich angenommen, sie würde Mom-Jeans tragen, wabblige Arme, faltige Ellbogen und ein Doppelkinn haben. Dass sie nett und so wäre, hatte ich mir schon vorgestellt, aber auch irgendwie alt und mit einer Frisur wie eine Lady, die in einen Salon geht, starr fixiert, so dass sich eine Woche nichts bewegt. Dass meine Tante so ein Feger war, hätte ich nie gedacht.
»Bruder Jones«, sagte sie und ließ die Worte auf der Zunge zergehen. Mich würdigte sie keines Blickes. »Du bist gekommen, um uns zu retten.«
Mein Vater schien leicht verunsichert.
»Serena«, sagte er und versuchte, sich zu fassen. »Du siehst, äh …«
»Ich sehe was?«, erwiderte Serena verschmitzt.
»Du siehst erwachsen aus.«
»Oh, bitte. Das kann nicht alles sein!«
»Wunderschön siehst du aus.«
»Schon besser«, sagte sie lächelnd.
Sie trat zu meinem Vater und umarmte ihn auf eine Weise, die mir unangenehm war. Was Umarmungen anging, dachte ich in Boxkategorien. Da wird geklammert und gleich wieder losgelassen. Normalerweise lassen die Boxer selber los, und wenn sie zu lange damit warten, trennt der Schiedsrichter sie. In diesem Fall, begriff ich, würde ich den Schiedsrichter geben müssen, denn die Umarmung dauerte schon viel zu lange, und so räusperte ich mich laut und vernehmlich. Als Serena meinen Vater losließ, sagte sie: »Diesen schrecklichen Bart solltest du dir wirklich abrasieren«, was ich nicht nur witzig fand, weil es stimmte, sondern weil es wie bei einem Boxer war, der seinem Gegner eins verpasste, kaum dass der Schiedsrichter die beiden getrennt hatte. Das ist nicht erlaubt, sondern man muss warten, bis er den Kampf wieder freigibt.
»Und du musst Trevor sein«, sagte sie, fuhr zu mir herum und verschlang mich mit ihren Augen. Anders konnte man es nicht ausdrücken. Ich war wie gelähmt.
»Gib Tante Serena einen Kuss«, sagte mein Vater.
Serena lächelte über meine Verlegenheit. Ich konnte den Blick nicht von der Vertiefung über dem Schlüsselbein wenden.
»Die Hand reicht fürs Erste auch«, sagte Serena und streckte ihre aus. »Die Küsse können wir uns für später aufbewahren.«
»Ich nehme einen«, krächzte ich, und sie lachte, beugte sich vor und berührte meine Wange mit ihren Lippen. Ein angenehmer Duft stieg mir in die Nase, ein frischer Zitrushauch.
»Bist du süß«, sagte sie.
»Ja, Ma’am«, sagte ich.
»Ich bin keine Ma’am und hoffe auch, nie eine zu werden. Ich bin Tante Serena, wenn du es förmlich magst, obwohl mir das eigentlich nicht so gefällt. Sag einfach Serena.«
»Ja, einfach Serena«, sagte ich und entlockte ihr damit ein Grinsen.
»Frechdachs«, sagte sie und musterte mich sorgfältig von oben bis unten, als stünde ich auf einem Verkaufsregal bei Macy’s. »Er hat deine Augen, Jones. Nicht die Farbe, die muss von Rachel sein, aber die Form. Er ist eindeutig ein Riddell.«
»Eindeutig ein Riddell«, stimmte mein Vater ihr zu.
»Aber ich denke nur an mich! Ihr müsst am Verhungern sein. Ich bin zwar selbst noch nicht geflogen, aber im Film sieht man immer, wie schlecht das Essen da ist. Ich mache euch was. Habt ihr zu Mittag gegessen? Einen kleinen Imbiss, dass ihr bis zum Abendessen durchhaltet.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, lief sie hinaus.
»Hilf ihr«, sagte mein Vater, und so folgte ich ihr und half ihr mit den Einkaufstüten.
Serena machte uns Sandwiches, denn wir hatten nichts zu Mittag gehabt. Im Kühlschrank wartete ein frisch gebackener Truthahn. Hinterher brachte uns Serena nach oben und zeigte uns unsere Zimmer, die an den entgegengesetzten Enden eines langen Flurs lagen.
»Ich dachte, du würdest etwas für dich sein wollen«, sagte sie, als sie mich den Gang hinunterführte, nachdem wir meinen Vater in sein Zimmer vorn im Haus gebracht hatten. »Hinten ist es auch kühler. Deinen Vater habe ich in seinem alten Zimmer untergebracht, weil es ihm vertraut ist. Aber dort ist es am Nachmittag immer ziemlich heiß, und wir haben keine Klimaanlage. Ich denke, du bist hinten glücklicher.«
In meinem Zimmer stand nichts als ein Bett, eine Kommode, ein sich hin- und herbewegender Ventilator, ein kleiner Schreibtisch und ein Schaukelstuhl. Es gab keinen Teppich, kein Bild an der Wand.
»Dein Vater hat erzählt, dass du einmal Schriftsteller werden willst«, sagte sie. »Das ist ein herrlicher Beruf. Ich habe Schriftsteller schon immer bewundert. Deshalb habe ich dir auch den kleinen Schreibtisch hierhergestellt. Brauchst du Papier und Stifte?«
»Ich habe meine Notizbücher.«
»Oh, wie schön«, sagte sie mit einem befriedigten Lächeln. »Es ist ein bisschen rustikal hier, aber sehr friedlich. Fühl dich wie zu Hause. Ich weiß, du bist müde nach der Reise, deshalb lass ich dich jetzt ein Schläfchen machen. Abendessen gibt es um sieben, unten in der Küche. Da lernst du Großvater Samuel kennen. Ist das nicht was?«
»Hast du einen Job?«, fragte ich.
Meine Frage schien sie zu überraschen, und es war mir peinlich, dass ich mehr über sie erfahren wollte.
»Natürlich habe ich einen Job. Einer muss schließlich das Essen auf den Tisch bringen, und Daddy tut es ganz sicher nicht.«
»Was machst du?«
»Ich arbeite für einen Immobilienentwickler, was für einen jungen Mann wie dich bestimmt ganz schön langweilig klingt. Für einen Schriftsteller! Versunken in der Welt der Literatur! Nun, es ist wichtig, dass wir alle unsere Ziele haben, wenn auch einige etwas bescheidener als andere sein mögen.«
Damit ließ sie mich wie versprochen allein. Aber ich legte mich nicht hin, nach einem Mittagsschlaf fühlte ich mich immer widerlich. Im Übrigen wollte ich über Serena nachdenken. Welcher Erwachsene war noch nie mit einem Flugzeug geflogen? Meine Familie war praktisch arm (nun, mittlerweile waren wir wirklich arm, aber davor waren wir nur praktisch arm gewesen), trotzdem war ich schon oft geflogen.
Ich packte meine Sachen in die Kommode und wanderte eine Weile im Kreis herum, denn es war heiß, und ich war müde. Am Ende legte ich mich doch aufs Bett, verschränkte die Hände hinter dem Kopf, starrte an die Decke und lauschte dem Sirren des Ventilators, der sich abwechselnd zur einen, dann zur anderen Seite neigte.
Ich musste einen Moment lang eingeschlafen sein, weil mich der Klang einer Stimme hochschrecken ließ, wenigstens dachte ich das. Hatte da mein Vater gerufen? Im Zimmer war niemand, und aus dem Haus rundum war auch nichts zu hören. Ich stand auf, ging zur Tür und sah den Flur hinunter. Nichts. Ein leichter Schauder durchfuhr mich. Der Luftzug vom Ventilator strich mir über den Nacken, und ich zitterte. Ich hätte schwören können, dass jemand meinen Namen gerufen hatte.
Als ich die Tür wieder schloss und zum Bett zurückkehrte, hörte ich ein leises Knarzen, irgendwo tief im Gebälk des Hauses, als riefe es nach mir.
2 Auf Wiedersehen, New Haven
Als wir im Juli 1990 in Riddell House ankamen, waren es noch zwei Tage bis zu meinem vierzehnten Geburtstag, trotzdem erinnere ich mich, dass ich damals genau Bescheid zu wissen glaubte. Ich kannte den Stand der Dinge. Meine Eltern waren pleite. Sie hatten Insolvenz angemeldet und ihr Haus in Connecticut verloren. Vorher hatte mein Vater schon sein Geschäft schließen müssen, was mit ein Grund für die Insolvenz gewesen war, und eine Katastrophe, die mächtige Spannungen zwischen Mutter und ihm auslöste. Ich wusste, dass Mutter meinen Vater und mich verlassen und sich zu ihrer Familie in England geflüchtet hatte, und mein Vater brachte mich in dieses bizarre Haus in Seattle, damit ich meine Vergangenheit, meine »Geschichte«, kennenlernte. Ich war noch nie in Riddell House gewesen, kannte weder meinen Großvater noch meine Tante, und mein Vater wollte, dass sich das änderte. Wenn du ein Huhn bist, zeigt dir dein Hahnenvater irgendwann ein Ei und sagt: »Daher kommst du.« Das verstand ich.
Mutters Englandreise und unser Flug nach Seattle waren mehr als nur ein getrennter Sommerurlaub, sie waren der Beginn einer probeweisen Trennung. Weil es seit einer Weile schon schwierig zwischen meinen Eltern war. Wenn zwei Menschen sich eine bestimmte Zeitlang streiten, höhlen sie sich gegenseitig die Seele aus und klappen zusammen. Selbst wenn sie sich einmal sehr geliebt haben. Selbst wenn sie es immer noch tun.
Es gab genug Scheidungskinder in der Schule in Connecticut. Ich hatte es miterlebt. Sie gaben mit doppelten Weihnachtsbescherungen an. Doppelten Geschenken. Doppelter Liebe. Aber ich sah es in ihren Augen, schon als Kind. Sie blufften. Hot Wheels funktionieren nur eine Zeitlang, bis sich die Achsen verbiegen und die Dinger nicht mehr geradeaus fahren. Ferngesteuerte Autos sind nur so lange toll, bis du den Controller nicht mehr findest.
Es war eine finstere Zeit in unserem Leben, als die Bank die Zwangsversteigerung unseres Hauses erwirkte und es unter den Hammer kam. Sie nahmen mich mit zur Auktion, meine Eltern müssen gedacht haben, dass es eine Erfahrung fürs Leben sei, die sie mir nicht vorenthalten wollten, aber ich weiß nicht so recht, ob es eine gute Idee war. Es ging zu wie bei der Versteigerung eines Bildes oder eines Oldtimers im Fernsehen. Es war also ziemlich langweilig. Ein Mann nannte einen Preis, ein anderer gab ihm ein paar Unterlagen, und er schlug mit dem Hammer vor sich auf den Tisch: Unser Haus gehörte jetzt einer Firma in Alabama.
Ich fühlte mich im Stich gelassen. Ist das eine Untertreibung? Ich hatte gedacht, mein Vater würde uns retten. Ich hatte gedacht, wir wären gekommen, damit er alle mit einem letzten Gebot für unser Haus ausstechen konnte. Dass er die Hand heben, der Auktionator auf ihn zeigen, in die Runde blicken und nach einem höheren Gebot verlangen würde, aber seins blieb das höchste, und unser Leben kehrte in seine alten Bahnen zurück.
Er rettete uns nicht. Wir verließen den Ort des Geschehens wie alle anderen, die Hände in leeren Taschen vergraben.
Es war sehr warm, eine altmodische Hitzewelle wie so oft im Juli, als wir in unser Motel beim Flughafen von New Haven kamen. Das Motel war in Ordnung, es war sauber, hatte einen großen Parkplatz und einen Pool mit einem hohen Eisenzaun drum herum. Ich war immer schon ein Einzelkind gewesen und kannte die Regeln, zog meine Badehose an und ging zum Pool, der so schlecht nicht war, obwohl ein paar deutsche Touristenkinder mit einem Tennisball ein komisches Spiel spielten: Sie waren zu dritt und ließen den tropfnassen Ball wie eine Rakete hin- und herfliegen und auf dem Wasser auftitschen. Und zwar so heftig, dass ich Angst hatte, der Ball würde mir die Zähne ausschlagen. Ich mochte den Pool, fühlte mich wegen des herumfliegenden Balls aber unsicher, und so stieg ich wieder aus dem Wasser, wickelte mich in die Extra-Handtücher, die ich vom Handtuchwagen genommen hatte, und legte mich auf die Kunststoffliege neben meinen Eltern, die mitten in einem so intensiven Gespräch waren, dass sie mich nicht bemerkten.
»Sieh dir unser Leben an«, sagte meine Mutter zu meinem Vater. »Alles ist weg, und du bist nur noch verbittert und wütend.«
Mein Vater sagte nichts.
»Ich war geduldig, Jones«, fuhr meine Mutter fort, »das war ich wirklich. Ich habe versucht, dir zu helfen, doch du musst dir auch selbst helfen. Ich liebe dich, Jones, und werde dich auf eine bestimmte Art immer lieben. Aber du musst verstehen: Der Augenblick wurde zur Krise hingelenkt.«
Es folgte ein langes Schweigen. Ich lag in meinen Handtüchern vergraben, und sie haben mich wohl nicht wahrgenommen. Sie wussten nicht, dass ich ihnen zuhörte. So kam ich meist an meine Informationen: indem ich Gesprächen lauschte, die nicht für mich gedacht waren.
»Ich fühle mich wie ein Esel, wenn du mit Gedichtzeilen argumentierst«, sagte mein Vater endlich. »Von wem war das? Wieder mal Coleridge?«
»Eliot.«
Meine Mutter schüttelte traurig den Kopf.
»Ich weiß, du bist damit noch nicht fertig«, sagte sie. »Du hast es mir zwar immer wieder versichert, doch es stimmt nicht. Du trägst es mit dir herum, wohin du auch gehst.«
»Es ist schwierig«, sagte er.
»Nein. Ein Atom zu spalten, ist schwierig. Du kommst nicht darum herum, dich deiner Vergangenheit zu stellen. Ich habe schon zugestimmt, dass du Trevor mitnimmst. Bring ihn an den Ort, an dem du aufgewachsen bist, nach Riddell House. Zeige ihm, wer du bist, und zeige ihm, warum du so bist, wie du bist. Und vielleicht findest du dich dort ja auch selbst wieder …«
»Und dann?«
»Dann sind wir eher in der Lage zu sehen, wo wir stehen.«
Er nickte, sah sie aber nicht an, und sie hielt ihren Blick so lange auf ihn gerichtet, bis er ihn erwiderte.
»Ich hoffe, du weißt, was du tust«, sagte er, als sie aufstand, um zu gehen.
Er streckte die Hand nach ihr aus. Sie zögerte einen Moment und streckte dann auch ihre aus, aber nur so weit, dass sich ihre Fingerspitzen berührten. Sie nickte noch einmal, wandte sich ab und ging. Mein Vater blieb noch ein paar Minuten, dann stand er auch auf. Als er am Pool vorbeikam, warf eines der deutschen Kinder den Tennisball übers Wasser. Er prallte gegen einen Liegestuhl, traf meinen Vater an der Brust und blieb vor seinen Füßen liegen. Er verharrte einen Moment, nahm den Ball schließlich und warf ihn, so fest er konnte, fester, als ich je einen Menschen einen Ball hatte werfen sehen, über den Parkplatz.
Der Ball stieg hoch in die Luft, flog über die Autos, schlug gegen das Balkongeländer des Motels und landete im Gebüsch.
Später, als ich mit meiner Mutter im Motelzimmer war und mein Vater gerade duschte, bat ich sie, mit uns nach Riddell House zu kommen.
»Oh, Trevor«, sagte sie. »Du hast einfach nicht die Lebenserfahrung, um zu verstehen, worum es hier geht.«
Vielleicht war es so. Ich weiß noch, dass ich das in dem Moment dachte. Aber ich verstand zwei Dinge: Erstens hatte mein Vater irgendwann etwas falsch gemacht, und meine Mutter hatte aufgehört, ihn zu lieben, und zweitens: Ich konnte ihn wieder zu sich bringen. Ich glaubte, wenn ich alles richtig machte, hatte ich ihn bis zum Ende des Sommers so weit, dass ich ihn meiner Mutter als normalen, liebenden Menschen präsentieren konnte. So, wie er gewesen war, als sie sich kennenlernten.
Und dann? Nun, dann musste sie wissen, was ihr Herz ihr sagte. Ein Kind kann nicht alles.
3 Es gibt Essen
Ich mochte Riddell House nicht. Es schien ständig zu knarzen, zu ächzen oder zu seufzen, als wäre es ein lebendes Wesen. Wie ein alter Baum, der sich im Wind wiegte und beschwerte, herumgestoßen zu werden.
Ich schlich die Treppe hinunter. Ich wollte meinen Vater nicht stören, der womöglich noch schlief, und ging auf die vordere Veranda. Es war fürchterlich heiß, die Sonne erdrückte das Haus mit ihren Strahlen, und im grellen Nachmittagsdunst konnte ich kaum etwas erkennen. Deshalb bemerkte ich ihn erst, als er etwas sagte.
»Wer bist du?«
Ich erschrak zu Tode, hob die Hand über die Augen und blinzelte in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Dort saß ein alter Mann in einem Schaukelstuhl, neben sich auf einem kleinen Tischchen ein Tablett mit ein paar Gläsern und einem Krug mit Limonade, wie ich annahm. Der alte Mann hatte eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Elijah Riddell auf dem Bild vorn im Salon. Er hatte strähniges weißes Haar, ein müdes Gesicht, große Ohren und eine große Nase. Einen Moment lang dachte ich, es sei Elijah Riddell, doch das war unmöglich. Die Logik und der gesunde Menschenverstand (sowie der Umstand, dass ich mich in keinem Horrorfilm befand) sagten mir, dass das Großvater Samuel war.
Der Mann, den ich für Großvater Samuel hielt, machte ein gequältes Gesicht und veränderte seine Sitzposition. Er wischte sich mit einem Taschentuch über die Stirn. Ihm musste unangenehm warm sein, denn er trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt, und die Sonne liebt nun mal besonders schwarze Sachen.
»Wer bist du?«, fragte der Mann noch einmal.
»Ich bin Trevor, und du bist Samuel, oder? Mein Großvater.«
»So wird es wohl sein.«
»Ich bin der Sohn deines Sohnes. Jones Riddell. Sein Sohn. Schön, dich kennenzulernen.«
Ich machte ein paar Schritte auf ihn zu und sah, was auf seinem T-Shirt stand: Gott war mein Copilot … Aber wir sind in den Bergen abgestürzt, und ich musste ihn essen.
»Das ist witzig«, sagte ich.
»Was?«
»Dein T-Shirt. Was da draufsteht.«
»Weißt du, warum wir ihn Jones genannt haben?«
»So hieß seine Mutter, bevor sie geheiratet hat«, sagte ich ein bisschen verwirrt angesichts seines Gedankensprungs, aber ich kannte die Geschichte und wollte mich beweisen. »Deine Frau, Isobel Jones. Und weil es ungewöhnlich war. Die Leute erinnern sich an Ungewöhnliches, und sie wollte, dass sie sich an ihn erinnerten.«
»Hast du sie gekannt?«, fragte Opa Samuel.
»Nein, ich bin erst vierzehn, ich meine, übermorgen. Sie ist gestorben, bevor ich auf die Welt kam.«
»Sie hat ihn so geliebt, mehr als alles auf der Welt«, sagte er, nachdem er tief in Gedanken mit dem Mund einige Worte geformt hatte. »Wobei, ich glaube, er hat sie sogar noch mehr geliebt.«
Damit verfiel er in das Schweigen alter Leute. Käute Gedanken wieder. Was schon immer eines meiner Lieblingsworte gewesen war: wiederkäuen. Ziegen und Kühe sind Wiederkäuer. Sie zerkauen ihr Futter, schlucken es, würgen es wieder hoch, kauen noch ein bisschen darauf herum, schlucken es, würgen es hoch, und so weiter. Wenn du viel nachgrübelst, schluckst du deine Gedanken und würgst sie wieder hoch, um weiter darauf herumzukauen. Ich mag das Bild auch heute noch.
»Ich möchte auch so ein T-Shirt«, sagte ich schließlich.
Opa Samuel sah auf sein Hemd und zog es hoch, als wollte er lesen, was darauf stand, ließ es wieder los und zuckte mit den Schultern.
»Serena kauft meine Sachen.«
»Kann ich ein Glas Limonade haben?«
Er dachte lange über meine Frage nach und goss dann ein Glas voll. Als er es mir gab, stellte ich fest, dass er nicht mehr alle Finger an seiner linken Hand hatte. Der Zeigefinger fehlte ganz und der Mittelfinger zur Hälfte.
Ich setzte mich neben ihn, und wir sagten nichts mehr. Wir käuten wieder. Es war ganz schön zennig, wie in »Zen«, meine ich. Die Sonne brannte auf uns nieder. Wir tranken unsere Limonade, bis die Gläser leer waren, schenkten nach und brieten noch etwas mehr in der Hitze. Und eine Minute lang dachte ich, wenn ich jetzt zu Hause wäre, das heißt, wenn meine Eltern noch ein Haus hätten, in dem ich zu Hause sein könnte, würde ich wahrscheinlich Baseball gucken oder ein Buch lesen, mir die Zeit vertreiben, aber sicher nicht wiederkäuen. Und mir kam der Gedanke, dass ich womöglich gerade neben dem weisesten Mann des Planeten saß. Mein Großvater bombardierte mich nicht mit Fragen, um dann wie die meisten Erwachsenen überhaupt nicht zuzuhören, wenn ich antwortete. Er unterhielt mich auch nicht mit netten Anekdoten. Es war ihm egal, ob ich meine Zeit sinnvoll verbrachte oder nicht. Er sagte mir nicht, dass ich mich mit Sonnencreme einreiben sollte. Wir saßen einfach nur zusammen. Fast eine Stunde taten wir nichts anderes. Bis Serena aus der großen, zweiflügeligen Eingangstür von Riddell House auf die Veranda trat.
Ich war überrascht, dass ich sie nicht hatte kommen hören. Das Haus knarzte so sehr, da hätte ich sie doch hören müssen. Ich senkte den Blick und stellte fest, dass sie ihre Stiefel ausgezogen hatte, was mein Rätsel teilweise löste: Barfußgehen ist so viel leiser. Ich wollte wieder wegsehen, konnte es aber nicht. Ihre Füße waren vollkommen. Die sanfte Wölbung ihres Spanns und ihre Zehen: wundervoll. Die azurblau lackierten Nägel: hypnotisierend. Ich gab mir alle Mühe, sie nicht anzustarren, doch es gelang mir offenbar nicht, denn sie lächelte und sagte: »Ich laufe im Haus immer au naturel herum, das ist besser für die Haltung.«
»Klar«, sagte ich, denn ich war fast vierzehn und hatte einen Ständer, und so was sagen Vierzehnjährige dann.
»Es ist Zeit, sich die Hände fürs Abendessen zu waschen. Wie ich sehe, hast du deinen Großvater kennengelernt. Daddy, warst du nett zu Trevor?«
»Ich habe ihm Limonade gegeben«, sagte Opa Samuel.
»Hast du das? Das war nett von dir.«
»Er mag mein T-Shirt.«
»Hmmm. Es ist ein wenig pietätlos, oder? Gott und Kannibalismus in einem Atemzug?«
»Ich weiß nicht, ob es Kannibalismus ist«, sagte ich und hoffte, Serena mit meinem Scharfsinn zu beeindrucken. »Dafür müsste es dieselbe Spezies sein. Also wäre, einen Gott zu essen, im eigentlichen Wortsinn kein Kannibalismus. Ich meine, wenn einer da wäre, den man essen könnte.«
»Bist du clever! Clever Trevor.«
»Einfach Serena«, sagte ich, ohne nachzudenken.
»Ist schon okay, mach dich nur über mich lustig. Und nicht so verschämt. Sag’s lauter.«
»Einfach Serena«, sagte ich.
»Ha!«, rief Großvater Samuel und schlug sich laut und vernehmlich auf den Schenkel. »Einfach Serena!«, bellte er, legte den Kopf in den Nacken und lachte und lachte.
»Wie schön, dass du dich mit deinem Großvater so gut auf meine Kosten amüsierst«, sagte sie, und als sich Opa Samuel wieder beruhigt hatte: »Und jetzt wascht euch die Hände, Jungs.«
Opa Samuel ging ins Haus, und als ich ihm folgen wollte, zog Serena die Tür ein Stück zu, so dass ich stehen bleiben musste.
»Ich weiß, ihr von der Ostküste haltet nicht viel von uns im Westen«, sagte sie betont nett. »Ihr denkt, wir sind nicht die Hellsten.«
»Nein, das denke ich nicht …«
»Oh, doch, du auch«, sagte sie. »Und es stört mich nicht. Der Provinzialismus hat nicht nur seine Nachteile. Aber sei darauf gefasst, dass wir unkultivierten Westler manchmal ein wenig grob sind. Wenn du dich also mal verletzt fühlen solltest, nun, ich entschuldige mich schon im Voraus dafür. Ich habe es sicher nicht so gemeint.«
Sie sah mich auf eine Weise an, die mir etwas Angst machte.
»Es tut mir leid, Tante Serena«, sagte ich ehrlich zerknirscht. »Ich wollte dir nicht weh tun.«
»Das hast du nicht, junger Trevor.« Sie strahlte mich an und drückte mich an sich, so dass ich ihren Zitrusduft wieder riechen konnte. »Du hast mir absolut nicht weh getan.«
Serena. Blaue Zehen, Zitrusduft und Katzenaugen.
Auf dem Tisch stand eine Riesenmenge Essen, ganz sicher mehr, als vier Personen hinunterbringen konnten. Es gab frisch gebackenes Brot, das die Küche mit einem feuchtwarmen Hefegeruch erfüllte, Backhähnchen, Wassermelone, Blatt- und Kartoffelsalat, gedünstete Maiskolben, Zuckerschoten und Limonade mit Rosmarinzweigen, eine von Serenas Spezialitäten.
»Wow«, sagte ich.
»Ich habe nur schnell etwas zusammengestellt.«
Opa Samuel setzte sich, und Serena holte ein Medizinfläschchen aus dem Schrank.
»Könntest du schnell nach oben laufen und deinen Vater holen?«, bat sie mich, nahm zwei Pillen heraus und legte sie vor Opa Samuel hin. »Ich habe ihm gesagt, dass das Essen fertig ist, aber er scheint nicht ganz nachzukommen.«
»Nimm deine Medizin«, hörte ich sie im Hinausgehen sagen.
Ich lief nach oben, klopfte kurz an und trat ein. Vater saß vorgebeugt auf dem Rand seines Betts und hielt das Gesicht in den Händen vergraben. Er hatte seine sauberen Khaki-Shorts angezogen und trug dazu seine Bootsschuhe, denn die trug er immer, außer er hatte den einzigen Anzug an, den er besaß, dann waren es einfache schwarze Slipper. Aber ich sah, dass er ein frisches, maßgeschneidertes Hemd trug. Meine Mutter musste es ihm eingepackt haben, weil mein Vater ein Schlunz war und nicht wusste, was ein gebügelter Ärmel war oder wozu der gut sein mochte. Als er den Kopf hob, tat ich so, als würde ich erschreckt zurückfahren. Mein Vater hatte sich den Bart abrasiert. Einfach so. Serena hatte einen Kommentar dazu abgegeben, und prompt hatte mein Vater sich rasiert. Was meine Theorie untermauerte, dass meine Mutter ihm den Bart gelassen hatte, damit sie sich körperlich abgestoßen fühlen konnte, ihm sein Bart aber eigentlich egal gewesen war und er ihn sich problemlos abrasiert hätte, hätte sie nur etwas gesagt. Mein Vater hatte keine Ahnung, wie sehr er selbst an seinem Debakel schuld war.
Ohne seinen Bart sah er um Jahre jünger aus: Wangen, Stirn und Ohren waren gebräunt, die freigelegte Haut jedoch blass, was einen leichten Waschbäreneffekt hatte. Wie er so dasaß in seinem gestärkten weißen Hemd und mit dem gekämmten, vom Duschen nassen Haar, sah er aus wie ein Kind. Irgendwie tat er mir leid. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich gekommen, um ihn an einen Tisch mit lauter Erwachsenen zu holen.
Ich versuchte, einen Witz zu machen, und sagte: »Noch ein paar letzte Worte?«, und er fing buchstäblich an zu zittern.
Er stand auf, holte tief Luft, legte den Arm um meine Schultern und ging mit mir hinaus in den Flur.
»Versprich mir, beim Essen viele Witze zu machen«, sagte er. »Ich habe das Gefühl, mir wird schlecht.«
Ich hatte keine Ahnung, wie das Verhältnis zwischen meinem Vater und meinem Großvater war, den es bis dahin in meinem Leben nicht gegeben hatte. Als wäre er tot gewesen. Kaum jemand sprach über ihn. Mit ihm sowieso keiner. Es gab kein einziges Foto von ihm, oder von sonst jemandem aus Vaters Familie, was das anging. Ich hatte mich nie darüber gewundert, schließlich war auch mein Vater mir ein Rätsel. Wir unternahmen in jenen Tagen kaum etwas zusammen, und wenn doch einmal, redeten wir nur wenig. Manchmal fing er an, mir etwas aus seiner Kindheit zu erzählen, brach jedoch jedes Mal mitten in der Geschichte ab. Als hätte er eine Tür hinter diesem Teil seines Lebens geschlossen, die er nicht wieder öffnen wollte.
Ich half ihm hinunter in die Küche (und dachte auf der Treppe ernsthaft, seine Beine würden ihm den Dienst versagen, wenn ich ihn nicht hielte). Serena und Opa Samuel hoben den Blick, als wir hereinkamen.
»Oh, das sieht gut aus!«, rief Serena fröhlich. »Ich wusste doch, dass unter dem zauseligen Durcheinander ein Gesicht versteckt war. Daddy? Sieh, wer da ist. Bruder Jones!«
Opa Samuel und mein Vater sahen sich vorsichtig an.
»Hallo, Dad«, sagte mein Vater.
»Hallo, Sohn«, erwiderte Opa Samuel mit einem flüchtigen Nicken und senkte den Blick auch schon wieder.
»Ich liebe diese herzlichen, schwindelerregenden Wiedersehen!«, sagte Serena fröhlich. »Versucht bitte, nicht zu rührselig zu werden, Jungs. Wir haben noch reichlich Zeit zum Reden! Setz dich, Jones. Setz dich zu uns.«
Wir nahmen unsere Plätze ein, das Essen wurde herumgereicht, und keiner sagte ein Wort. Es wurde gestikuliert, gelächelt, genickt, alles äußerst höflich. Gekaut, geschluckt, getrunken. Der Mund mit der Serviette betupft. Im Übrigen herrschte tiefe Stille, nur der Ventilator summte.
Endlich beugte sich Opa Samuel zu mir und flüsterte: »Gib mir bitte ein Stück Wassermelone.« Ich reichte ihm den Teller.
»Dickie hat angerufen, um zu sagen, dass er aufgehalten wurde«, verkündete Serena plötzlich und zeigte auf ein unbenutztes Gedeck, das mir zwar aufgefallen war, nach dem ich aber nicht hatte fragen wollen.
»Wer ist Dickie?«, wollte mein Vater wissen.
»Mein Freund, Dummkopf«, sagte Serena. »Wie, denkst du, soll ich die einsamen Nächte hier überleben?«
»Ich wusste nicht, dass du einen Freund hast. Ist es was Ernstes?«
»In meinem Alter, Bruder Jones, ist jede Beziehung ernst.«
»Wie alt bist du jetzt?«, kam es von Opa Samuel, als ich gerade dachte, dass er der Unterhaltung nicht folgte.
»Das fragt man eine Dame nicht, Daddy. Aber da du dich offenbar nicht an meine Ankunft in dieser Welt erinnerst, will ich es dir sagen. Ich bin fünf Jahre jünger als Bruder Jones, und der ist neununddreißig. Reicht das, Daddy?«
»Ich kann rechnen«, sagte Opa Samuel gereizt.
»Du musst mehr als nur Wassermelone essen.«
Ich sah auf Opa Samuels Teller, auf dem sich die Wassermelonenstückchen türmten.
»Aber ich liebe Wassermelone!«, rief Opa.
Ich hatte Schwierigkeiten, nicht laut loszulachen. Opa war wie eine Figur aus einem Comic. Große Hände, großer Kopf, sein Haar überall, und als er »ich liebe« rief, warf er die Arme in die Höhe – und ich konnte nicht anders, als auf seine Fingerstümpfe zu starren.
»Seht ihr?«, sagte Serena zu meinem Vater und mir. »Damit muss ich mich jeden Tag herumschlagen. Mal ist er hier, dann wieder nicht. Er muss alles aufschreiben, um sich daran zu erinnern, und selbst dann …«
»Ich liebe Wassermelone!«, rief Opa und setzte seinen Protest fort.
Serena blickte uns an und verzog verzweifelt das Gesicht.
»Nimm auch etwas Hähnchen«, sagte sie.
»Ich mag kein Hähnchen«, jammerte er. »Da sind Sehnen drin.«
»Alle Tiere haben Sehnen, Daddy«, sagte Serena. »Sehnen und Bänder. Sehnen und Innereien. Fasern und Bindegewebe. Knochen gehören auch zum Bindegewebe, wusstest du das, Trevor? Ich wette, das hast du längst in Biologie gelernt. Wir sehen die Knochen immer als das Stahlgerüst unseres Körpers, dabei sind es nachgiebige, biegsame Organe, die neben dem strukturellen Halt noch wichtige andere Funktionen erfüllen, zum Beispiel die Produktion der roten und weißen Blutkörperchen.«
Wir verstummten. Serenas Stegreifvortrag über unsere Knochen machte uns sprachlos. Und vielleicht ging es ja genau darum, vielleicht war das ihre Art, mit Opa Samuels Beschwerden umzugehen.
»Und genau wie Knochen flexibel sein müssen«, fuhr sie fort, »müssen auch wir uns in unseren Beziehungen zueinander flexibel zeigen, um in Harmonie zu leben. Wir müssen anerkennen, dass Beziehungen dynamischer Natur sind, sich ständig verändern und manchmal ein Ende finden. Das hast du am eigenen Leibe erfahren, nicht wahr, Bruder Jones, bei deiner Trennung von Rachel?«
»Wir haben uns nicht getrennt«, sagte er.
»Nein? Was dann? Sie ist in England, und du bist hier. Das sieht mir sehr nach einer Trennung aus.«
»Ich meine, gesetzlich sind wir nicht getrennt«, sagte mein Vater und warf mir einen Blick zu.
»Gesetze werden gemacht, um die Wirtschaft zu regulieren, Bruder Jones«, sagte Serena, »keine Herzensangelegenheiten. Gesetzlich oder nicht, du bist von deiner Frau getrennt, oder täusche ich mich da?«
»Aber sie kommen wieder zusammen«, platzte es aus mir heraus, worauf Serena mich ansah.
»Sie machen nur eine Pause«, sagte ich. »Es ist nicht für immer.«
»Wie ich sagte, Beziehungen sind dynamische Gebilde«, erwiderte sie mit einem Achselzucken, als hätte ich den Beweis für ihre Behauptung geliefert. »Bitte, nimm etwas Hähnchen, Daddy. Du brauchst dein Protein.«
»Ich mag kein Hähnchen …«
»Du musst doch etwas essen.«
»Spukt es in diesem Haus?«, fragte ich, um das Thema Sehnen zu beenden.
Serena aß einen Moment lang weiter, bevor sie antwortete: »Hast du Angst vor Gespenstern?«
»Nein.«
Sie nahm noch etwas Kartoffelsalat und zeigte auf die Platte mit den Hähnchenstücken.
»Hähnchen«, sagte sie zu Opa Samuel.
»Sehnen«, sagte er und schob die Lippen vor.
»Warum fragst du nach Gespenstern, mein Neffe?«
»Weil ich etwas gehört habe. Ich glaube, ich habe eine Stimme gehört.«
»Ein Haus wie dieses spricht mit dir«, sagte Serena. »Es hat dir viel zu sagen.«
»Was zum Beispiel?«
»Riddell House ist fast hundert Jahre alt.« Serena zuckte mit den Achseln und steckte sich einen Bissen in den Mund. »Denk an all die Leute, die über diese Böden gegangen sind. Die Dielen kennen sie alle, ich nicht. Dein Großvater hört nachts oben im Ballsaal jemanden tanzen. Aber er leidet an Demenz, also glaubt ihm keiner.«
»Es spukt hier also tatsächlich?«
»Es kommt darauf an, was du darunter verstehst.«
»Serena, bitte hör auf«, sagte mein Vater.
»Ben ist nervös«, murmelte Opa Samuel. Er stand auf, ging zum Telefontisch, nahm einen Stift und schrieb bedächtig etwas auf einen Klebezettel.
»Was macht er da?«, flüsterte ich Serena zu. »Und wer ist Ben?«
»Er kann sich an nichts erinnern, deshalb schreibt er alles auf Klebezettel. Es ist Unsinn, nichts davon ergibt einen Sinn. Sie sagen, in den späten Phasen von Alzheimer gleicht das Gehirn einem nassen Schwamm. Stellt euch das mal einen Moment lang vor.«
»Das ist wichtig«, rief Opa Samuel und blickte zur Decke. Dann schrieb er seine Notiz zu Ende und kam zurück an den Tisch.
»Wo waren wir?«, fragte Serena und verdrehte die Augen. »O ja, ob es spukt. Jones, hast du Trevor den Vortrag noch nicht gehalten?«
»Was für einen Vortrag?«, fragte ich.
»Den Vortrag über das Sein und die Stadien des Bewusstseins. Dein Vater und ich, wir haben ihn als Kinder jeden Abend zu hören bekommen. Unablässig hat unsere Mutter uns damit belemmert. Ich meine, es gibt so viel, von dem wir keine Ahnung haben, wie können wir da annehmen, überhaupt etwas zu wissen? Daddy, ich muss wirklich darauf bestehen, dass du jetzt etwas Hähnchen isst.«
Serena spießte ein Stück auf ihre Gabel und legte es Opa Samuel auf den Teller. Er zuckte zurück und schob das Fleisch zur Seite, so dass es auf dem Tisch landete.
»Gibt es eine Entität in diesem Haus?«, fragte ich.
»Was meinst du mit ›Entität‹?«, sagte Serena. »Wir müssen die richtigen Begrifflichkeiten verwenden. Worte können verwirren, wenn wir uns nicht auf eine Definition geeinigt haben.«
»Hör schon auf, Serena«, sagte mein Vater. »Ernsthaft. Du machst ihm Angst.«
»Ich denke, Trevor weiß mehr, als du ihm zugestehst. Und er hat danach gefragt.«
Serena stand auf und nahm eine Streichholzschachtel von der Anrichte neben dem großen, altmodischen Herd. Sie ließ die Schachtel vor mir auf den Tisch fallen und setzte sich wieder.
»Es gibt alle möglichen Verstecke in diesem Haus«, sagte sie. »Als Riddell House gebaut wurde, gab es eine Menge furchteinflößender Dinge. Nicht die Indianer. Die Ureinwohner im Nordwesten waren ein gutmütiges Völkchen, das mit den eigenen Leuten wie mit den Weißen Handel trieb. Aber es gab Banditen und Diebe, die es auf die Reichen abgesehen hatten, die Familienmitglieder entführten und manchmal Lösegeld erpressten. Wenigstens glaubte Elijah das, wobei er dafür bekannt war, niemanden zu mögen, und so sollte das Ganze mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Jedenfalls wurden in dieses Haus Geheimgänge und Verstecke eingebaut, damit Elijah sich sicher fühlte. Man nennt sie ›Priesterlöcher‹, der Begriff stammt aus der Reformation in England, als die Katholiken ihre Priester vor den Protestanten versteckten. Weißt du, was sie gemacht haben, wenn sie einen Priester hinter den Mauern entdeckten?«
»Was?«
»Aufgehängt haben sie ihn, oder bei lebendigem Leib verbrannt. Jemanden aufzuhängen, ist schon ein nettes Spektakel, aber nichts gegen den Geruch von verbranntem Fleisch in der Luft, nachdem sie einen oder zwei Priester aus ihren Verstecken geholt hatten. Das kannst du dir sicher vorstellen.«
»Serena!«, schimpfte mein Vater.
»Es gibt in Riddell House eine geheime Treppe«, fuhr Serena ohne Pause fort. »Wo, weiß ich nicht. Es ist ein Geheimnis, nicht wahr, Jones? Eins zwischen dir und Mutter? Ich war zu jung, um eingeweiht zu werden. Es gibt eine versteckte Treppe, und wenn du sie findest und ein Streichholz anreißt, wirst du im aufflammenden Licht eine Erscheinung sehen. Den Geist von Riddell House. Aber darüber sollten wir nicht sprechen, es regt Daddy auf. Daddy findet Gespräche über Geister verstörend. Kannst du dich noch an den Abend erinnern, als Daddy mit der Axt auf die Treppe losgegangen ist, Bruder Jones?«
»Ich hätte nicht herkommen sollen«, murmelte er verzweifelt.
»Vielleicht nicht«, sagte Serena. »Aber jetzt bist du da, und du hast es dir vorher überlegt und bist nicht einfach durch die Dielen gebrochen, um dich plötzlich in Riddell House wiederzufinden. Du bist in ein Flugzeug gestiegen, hast dein Gepäck eingecheckt, ein Auto gemietet … Daddy, leg den Hähnchenschenkel zurück auf deinen Teller und iss ihn. Iss ihn ganz auf, einschließlich der Sehnen, oder du wirst schwächer, fällst und brichst dir die Hüfte. Und Untersuchungen zeigen, wenn erst die Mobilität eingeschränkt ist, sinkt auch die Lebenserwartung.«
»Ich mag kein Hähnchen!«, rief Opa. »Ich mag kein Hähnchen! Ich mag kein Hähnchen! Ich mag kein Hähnchen!«
Serena legte ruhig Gabel und Messer auf ihren Teller.
»Das ist heute ein sehr wichtiges Essen«, sagte sie. »Bruder Jones ist zurückgekommen und hat seinen Sohn mitgebracht. Wenn du dich nicht benehmen kannst, wirst du dich entschuldigen müssen.«
Sie schlug keinen scharfen Tonfall an, aber ihre Stimme klang unmissverständlich.
»Ich mag kein Hähnchen«, wiederholte Opa Samuel kleinlaut ein letztes Mal.
»Dann iss Gemüse. Nimm einen Maiskolben, Salat und ein paar Erbsen.«
Opa Samuel betrachtete das Essen auf dem Tisch, sein Blick sprang von Schüssel zu Schüssel. Die Aufgabe schien ihn zu überwältigen.
»Darf ich jetzt gehen?«, fragte er.
»Du hast noch kein Wort zu Jones gesagt.«
Opa Samuel bewegte den Unterkiefer hin und her und rieb sich die Stummel der fehlenden Finger. »In der Nacht«, sagte er, »wenn du aufmerksam lauschst, kannst du sie tanzen hören.«
»Das reicht jetzt, Daddy«, sagte Serena schroff. »Du weißt, du musst auf deinen Blutdruck achten.«
»Du kannst ihre Schritte hören«, flüsterte Opa Samuel.
»Daddy!«
Er hielt inne. Serena blitzte ihn an, und er traute sich nicht weiterzureden.
»Wen kannst du tanzen hören?«, fragte mein Vater.





























