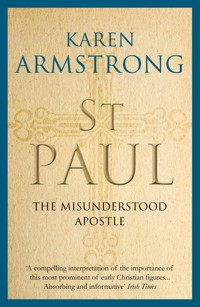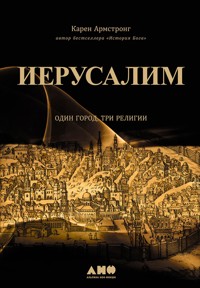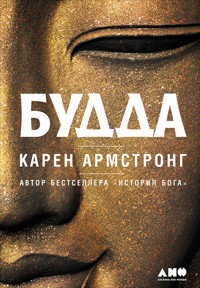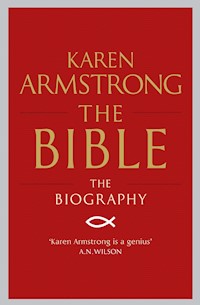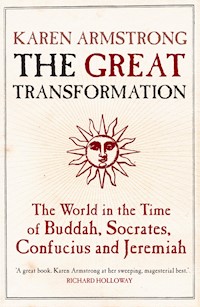14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pattloch eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
In ihrem neuen Buch "Im Namen Gottes" nimmt die Autorin erstmals die Geschichte und Gegenwart von Judentum, Christentum und Islam in Bezug auf religiöse Gewalt in den Blick. Karen Armstrong geht den Ursachen dieser Gewalt auf den Grund. Das Ergebnis ihrer Untersuchung: Jahrtausendelang waren Politik und Religion ineinander verwoben. Die Trennung von Politik und Religion in der Neuzeit konnte die Gewalt nicht eindämmen. Mit ihrer Analyse schafft Karen Armstrong die Grundlagen für das Verständnis der aktuellen internationalen Konflikte, die von politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Interessen beherrscht sind. »Geistreich, informativ und nachdenklich: Karen Armstrong versteht es, komplexe Zusammenhänge einfach darzustellen, aber sie vereinfacht nicht.« New York Times Book Review
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 981
Ähnliche
Karen Armstrong
Im Namen Gottes
Religion und Gewalt
Aus dem Englischen von Ulrike Strerath-Bolz
Knaur e-books
Über dieses Buch
In der westlichen Kultur geht man heute selbstverständlich davon aus, dass Religion zwangsläufig mit Gewalt einhergeht«, stellt Karen Armstrong am Anfang ihrer groß angelegten Untersuchung fest. In drei Themenkreisen hinterfragt sie dieses Selbstverständnis. Ihr Blick reicht von den frühen Hochkulturen in Indien, China und Israel über den Einfluss der Religion auf die mittelalterlichen Großreiche des christlichen und des islamischen Kulturkreises bis hin zu den Konflikten der neuzeitlichen Nationalstaaten und den religiösen Verwerfungen der Gegenwart.
Dabei kommt sie zu überraschenden Ergebnissen: Der Siegeszug des säkularen Staates hat keineswegs mehr Frieden und Gerechtigkeit mit sich gebracht. Vielmehr hat das Ausmaß an Gewalt zugenommen, wie gerade die großen Kriege des 20. Jahrhunderts zeigen. Bis heute versteckt sich eine machtpolitisch und ideologisch motivierte Politik hinter der Maske religiöser Überzeugungen.
Inhaltsübersicht
Hinweis
Die Bibelzitate sind, soweit nicht anders angegeben, der Übersetzung »Hoffnung für alle« entnommen; Copyright © 1983, 1996, 2002 by Biblica Inc. TM. Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Verlags. Alle weiteren Rechte weltweit vorbehalten.
Für Jane Garrett
Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann.
…
Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen! Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde.
Genesis 4,2.8–10
Einleitung
Im alten Israel brachte der Hohepriester jedes Jahr zum Versöhnungsfest Jom Kippur zwei Ziegen in den Jerusalemer Tempel. Eine opferte er, um die Sünden der Gemeinschaft zu sühnen; der zweiten legte er die Hände auf, übertrug sämtliche Missetaten des Volkes auf ihr Haupt und brachte das sündenbeladene Tier dann aus der Stadt. Die Schande wurde buchstäblich an einen anderen Ort gejagt. Auf diese Weise, so erklärte Mose, sorgte er dafür, »dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage« (Levitikus 16,22; ML 1984[1]). In einer klassischen Untersuchung zum Thema Religion und Gewalt vertritt René Girard die These, das Sündenbock-Ritual habe Rivalitäten innerhalb der Gemeinschaft aufgelöst.[2] Und ich füge hinzu, die moderne Gesellschaft hat in ähnlicher Weise den Glauben zum Sündenbock gemacht.
In der westlichen Kultur geht man heute selbstverständlich davon aus, dass Religion zwangsläufig mit Gewalt einhergeht. Der Befund scheint offensichtlich. Wo auch immer ich über Religion spreche, bekomme ich zu hören, wie grausam und aggressiv Religion sei. Und es ist geradezu unheimlich, dass immer wieder das Gleiche dazu gesagt wird: »Bei allen großen Kriegen der Menschheitsgeschichte war die Religion die Ursache.« Wie ein Mantra wird dieser Satz von amerikanischen Kommentatoren und Psychiatern, Londoner Taxifahrern und Oxford-Absolventen rezitiert. Dabei ist die Behauptung seltsam genug: Es liegt auf der Hand, dass die beiden Weltkriege keine religiösen Ursachen hatten. In allen Diskussionen über die Gründe für kriegerische Handlungen bestätigen Militärhistoriker, dass eine Vielzahl ineinander verschränkter gesellschaftlicher, materieller und ideologischer Faktoren Gewalt begründen; einer der wichtigsten ist der Kampf um knappe Ressourcen. Auch Experten für die Themen politische Gewalt und Terrorismus erklären, dass Greueltaten aus verschiedenen, sehr komplexen Gründen begangen werden.[3] Und doch ist das aggressive Image des religiösen Glaubens in unserem säkularen Bewusstsein so unauslöschlich verankert, dass wir die gewalttätigen Sünden des 20. Jahrhunderts routinemäßig auf den Schultern der »Religion« abladen und sie in die politische Wildnis hinausjagen.
Selbst diejenigen, die zugeben, dass Religion nicht für alle Gewalt und jeden Krieg der Menschheit verantwortlich ist, halten ihren grundlegend kriegerischen Charakter für eine Selbstverständlichkeit. Sie vertreten den Standpunkt, gerade der »Monotheismus« sei besonders intolerant, und jeglicher Kompromiss werde unmöglich, sobald Menschen glauben, dass »Gott« auf ihrer Seite stehe. Und dann führen sie die Kreuzzüge, die Inquisition und die Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts an. Außerdem sprechen sie von der Flut des religiös begründeten Terrorismus, um nachzuweisen, dass der Islam besonders aggressiv sei. Wenn ich die Gewaltlosigkeit des Buddhismus anspreche, erwidern sie, der Buddhismus sei eine säkulare Philosophie und keine Religion. Und damit kommen wir zum Kern des Problems. Der Buddhismus ist sicher keine Religion in dem Sinne, wie der Begriff im Westen seit dem 17./18. Jahrhundert verstanden wird. Aber unsere moderne westliche Vorstellung von »Religion« ist auch eigenwillig und exzentrisch. Keine andere kulturelle Tradition kennt etwas Entsprechendes, und selbst europäische Christen hätten sie in der Zeit vor der Moderne als eng und fremd beschrieben. Tatsächlich verkompliziert diese Vorstellung jeden Versuch, die Neigung der Religion zur Gewalt zur Sprache zu bringen.
Und noch komplizierter werden die Dinge, wenn man bedenkt, dass eine Tatsache im wissenschaftlichen Bereich seit etwa fünfzig Jahren Gemeingut ist: nämlich die Erkenntnis, dass es keine allgemein gültige Definition von Religion gibt.[4] Im Westen verstehen wir »Religion« als zusammenhängendes System aus verpflichtenden Glaubenssätzen, Institutionen und Ritualen, das sich um einen übernatürlichen Gott dreht und dessen Praxis seinem Wesen nach in den privaten Bereich fällt und hermetisch von allen »säkularen« Aktivitäten abgegrenzt ist. Aber wenn wir in anderen Sprachen die Wörter betrachten, die wir als »Religion« übersetzen würden, dann beziehen sie sich fast alle auf etwas Größeres, Unbestimmteres und Umfassenderes. Das arabische din bezeichnet eine ganze Lebensweise. Das Sanskript-Wort dharma beschreibt ebenfalls »ein umfassendes, eigentlich nicht übersetzbares Konzept, das Recht, Gesetz, Moral und gesellschaftliches Leben umfasst«.[5] Das Oxford Classical Dictionary erklärt mit großer Klarheit: »Kein Wort im Griechischen oder Lateinischen entspricht ganz dem englischen Wort ›religion‹ oder ›religious‹.«[6] Die Vorstellung von Religion als einer privaten und zugleich auf einem festen System beruhenden Praxis war dem klassischen Griechenland, Japan, Ägypten, Mesopotamien, dem Iran, China oder Indien vollkommen fremd.[7] Und auch die hebräische Bibel kennt keine abstrakte Vorstellung von Religion. Die talmudischen Rabbis hätten unmöglich mit einem einzelnen Wort oder auch nur einer Formulierung ausdrücken können, was sie unter Glauben verstehen, denn der Talmud war ausdrücklich darauf angelegt, die Gesamtheit des menschlichen Lebens in den Bereich des Heiligen zu rücken.[8]
Die Ursprünge des lateinischen Wortes religio liegen im Dunkeln. Dahinter stand ursprünglich kein objektiver Sachverhalt, sondern eine eher unscharfe Konnotation im Sinne von »Verpflichtung« und »Tabu«: Wenn man sagte, die Einhaltung einer kultischen Regel, ein Familienbesitz oder ein Eid sei religio für einen bestimmten Menschen, dann stand dahinter ein »Obliegen«, eine Verpflichtung.[9] Bei den frühchristlichen Theologen nahm das Wort dann eine wichtige neue Bedeutung an: Es bezeichnete eine Haltung der Verehrung gegenüber Gott und der Ganzheit des Universums. Für den hl. Augustinus (um 354–430 u.Z.) war religio weder ein System von Ritualen und Doktrinen noch eine historisch institutionalisierte Tradition, sondern zum einen die persönliche Begegnung mit der Transzendenz, die wir Gott nennen, zum anderen eine Bindung zwischen uns und dem Göttlichen und untereinander.[10] Im mittelalterlichen Europa bezog sich religio vor allem auf das monastische Leben und unterschied den Mönch vom »säkularen« Priester, der in der Welt (saeculum) lebte und arbeitete.[11]
Die einzige Glaubenstradition, die zur westlichen Vorstellung von Religion als etwas Festgeschriebenem und zugleich Privatem passt, ist die protestantische Ausprägung des Christentums, und sie ist, wie alle Religion in diesem Sinne, ein Ergebnis der frühen Neuzeit. Zu dieser Zeit hatten Europäer und Amerikaner begonnen, Religion und Politik voneinander zu trennen, weil sie – nicht unbedingt zutreffend – annahmen, der theologische Zank der Reformation trage die Alleinschuld am Dreißigjährigen Krieg. Die Überzeugung, Religion müsse rigoros aus dem politischen Leben herausgehalten werden, wurde zum Gründungsmythos des souveränen Nationalstaats.[12] Die Philosophen und Staatsmänner, die diesem Dogma den Weg bereiteten, glaubten, sie würden damit zu jenem besseren Zustand zurückkehren, der noch nicht davon geprägt war, dass ehrgeizige katholische Geistliche zwei ganz und gar getrennte Bereiche miteinander vermischten.
Tatsächlich war die säkulare Ideologie eine ebenso radikale Innovation wie die Marktwirtschaft, die der Westen zur gleichen Zeit entwickelte. Nicht-Westlern, die diesen Modernisierungsprozess nicht durchlaufen hatten, blieben beide Innovationen fremd und sogar unbegreiflich. Die Gewohnheit, Religion und Politik voneinander zu trennen, ist heute im Westen so fest verankert, dass es uns schwerfällt, wahrzunehmen, wie sehr die beiden Bereiche in der Vergangenheit eins waren. Es ging nie nur darum, dass der Staat die Religion »benutzte«: Die beiden Bereiche waren untrennbar ineinander verwoben. Eine Grenzziehung wäre ungefähr so schwierig gewesen wie der Versuch, den Gin aus einem Cocktail zu entfernen.
In der vormodernen Welt durchdrang die Religion alle Aspekte des Lebens. Ich werde in diesem Buch zeigen, dass eine ganze Reihe von Aktivitäten, die man heute für profan hält, als zutiefst heilig galten: Waldrodung, Jagd, Fußballspiele, Würfelspiele, Astronomie, Landwirtschaft, Staatsgründungen, Kriegszüge, Stadtplanung, Handel, das Trinken alkoholischer Getränke und vor allem der Krieg. Die frühen Völker hätten nicht sagen können, wo die »Religion« endet und die »Politik« beginnt. Und das nicht etwa, weil sie zu dumm gewesen wären, den Unterschied zwischen beiden zu erkennen, sondern weil sie all ihrem Tun einen letztgültigen Sinn geben wollten. Wir Menschen sind sinnsuchende Geschöpfe, und anders als Tiere verzweifeln wir schnell, wenn wir keinen Sinn in unserem Leben erkennen. Wir finden die Aussicht auf unser unvermeidliches Ende nur schwer erträglich. Wir reagieren verstört auf Naturkatastrophen und menschliche Grausamkeit und sind uns unserer körperlichen und seelischen Zerbrechlichkeit schmerzlich bewusst. Wir finden es erstaunlich, dass wir überhaupt hier sind, und möchten wissen, warum wir hier sind. Und wir haben die große Fähigkeit zu staunen. Die Philosophen der Antike waren wie verzaubert von der Ordnung des Kosmos, sie bewunderten die geheimnisvolle Kraft, die die Himmelskörper auf ihrer Bahn und die Meere auf der Erde hielt, jene Kraft, die auch dafür sorgte, dass die Natur nach der winterlichen Bedrängnis wieder zum Leben erwachte. Und sie wünschten sich, an dieser reicheren, dauerhafteren Existenz teilzuhaben.
Diese Sehnsucht drückten sie in dem aus, was wir heute als ewige Weisheitstradition bezeichnen, weil sie auf irgendeine Weise in den meisten vormodernen Kulturen vorhanden war.[13] Jeder Mensch, jedes Ding und jede Erfahrung wurde als Abbild, als Schattenbild einer Wirklichkeit angesehen, die stärker und dauerhafter war als jegliche Alltagserfahrung, den Menschen aber nur in visionären Augenblicken oder Träumen kurz zuteilwurde. Indem sie im Ritual die vermeintlichen Gesten und Handlungen ihrer himmlischen Gegenstücke – Götter, Ahnen oder Kulturheroen – nachahmten, fühlten sich die vormodernen Menschen als Teil einer größeren Dimension.
Wir Menschen neigen von Natur aus zu Archetypen und Mustern.[14] Ständig streben wir danach, die Natur zu verbessern und uns einem Ideal anzunähern, das das Alltägliche übersteigt. Selbst unser heutiger Kult um »Prominente« kann als Ausdruck unserer Verehrung für »übermenschliche« Vorbilder und unserer Sehnsucht nach einer vergleichbaren Stellung verstanden werden. Indem wir uns mit einer außergewöhnlichen Wirklichkeit verbinden, befriedigen wir ein wesentliches Bedürfnis. Es berührt uns im Inneren und hebt uns für einen Augenblick über uns selbst hinaus, so dass wir unser Menschsein intensiver erfahren und das Empfinden haben, wir kämen in Kontakt mit den tieferen Strömen des Lebens. Wenn wir diese Erfahrung in einer Kirche oder einem Tempel nicht mehr finden, suchen wir sie in der Kunst, bei einem Konzert, in Sex und Drogen – oder im Krieg. Was diese letztgenannte Möglichkeit mit all den anderen zu tun hat, ist auf den ersten Blick vielleicht nicht klar, aber tatsächlich ist »Kampf« einer der ältesten Auslöser ekstatischer Erfahrungen. Um zu verstehen, warum das so ist, werfen wir einen kurzen Blick auf die Entwicklung unseres Gehirns.
Jeder von uns hat nicht nur ein Gehirn, sondern drei, und deren Zusammenwirken geschieht nicht immer reibungslos. In den tiefsten Tiefen unserer Gehirnmasse gibt es das »alte Gehirn«, das wir von den Reptilien geerbt haben, die sich vor etwa 500 Millionen Jahren aus dem Urschlamm herausgekämpft haben. Sie waren nur aufs Überleben aus, kannten überhaupt keine altruistischen Impulse und waren nur durch Mechanismen motiviert, die sie dazu brachten, zu fressen, zu fliehen (wenn nötig) und sich fortzupflanzen. Diejenigen, die am besten dafür ausgestattet waren, gnadenlos um Futter zu kämpfen, jede Bedrohung abzuwehren, ein Revier zu verteidigen und sich in Sicherheit zu bringen, gaben ihre Gene weiter, so dass diese egoistischen Impulse zwangsläufig stärker wurden.[15] Aber nachdem irgendwann die Säugetiere aufgetaucht waren, vor etwa 120 Millionen Jahren, entwickelten sie, was die Neurowissenschaft das »limbische System« nennt.[16] Es bildete sich rund um das »Reptiliengehirn« und sorgte für alle möglichen neuen Verhaltensweisen – darunter die Brutpflege und das Schließen von Bündnissen mit ihresgleichen –, die im Überlebenskampf von unschätzbarem Wert waren. Und so entstanden zum ersten Mal empfindsame Wesen mit der Fähigkeit, zu lieben und sich um andere Geschöpfe zu kümmern.[17]
Das limbisch bedingte Verhalten war zwar nie so stark wie die egoistischen Triebe, die immer noch aus unserem Reptilien-Kern aufstiegen, aber wir Menschen haben inzwischen doch eine stabile Neigung zur Empathie für andere Geschöpfe und eine besondere Bindung an unsere Mitmenschen entwickelt. Der chinesische Philosoph Mencius (371–288 v.u.Z.) war der Erste, der behauptete, kein Mensch sei ganz ohne solche Gefühle. Wenn ein Mann ein Kind sieht, das auf einem Brunnenrand balanciert und in Gefahr ist hineinzufallen, dann spürt er die Gefahr körperlich und wird aus einem Reflex heraus, ohne an sich selbst zu denken, einen Satz nach vorn machen und zupacken, um das Kind zu retten. Ein Mensch, der an einer solchen Szene ohne jegliches Gefühl von fürsorglicher Verantwortung vorübergeht – mit dem stimmt etwas nicht. Den meisten Menschen, so Mencius, sind diese Gefühle angeboren, jedoch bis zu einem gewissen Grad dem persönlichen Willen unterworfen. Man könne diese Keime des Wohlwollens ebenso zertrampeln, wie man sich verstümmeln oder körperlich deformieren könne. Andererseits erreichten sie eine ganz eigene Kraft und Dynamik, wenn man sie kultivierte.[18]
Wir können Mencius aber nicht richtig verstehen, ohne uns mit dem dritten Teil unseres Gehirns zu beschäftigen. Vor etwa zwanzigtausend Jahren, im Paläolithikum, entwickelten die Menschen ein »neues Gehirn«, den sogenannten Neocortex, in dem die Kräfte des Verstandes und der Selbstwahrnehmung angesiedelt sind, die uns in die Lage versetzen, uns den instinktiven, primitiven Leidenschaften zu entziehen. Durch diese Entwicklung wurden die Menschen im Prinzip zu dem, was sie heute sind, den widerstreitenden Impulsen ihrer drei verschiedenen Gehirnareale unterworfen. Die Männer der Altsteinzeit waren geübt im Töten. Vor der Erfindung der Landwirtschaft waren die Menschen abhängig davon, Tiere zu schlachten, und sie benutzten ihre großen Gehirne, um eine Technologie zu entwickeln, die es ihnen erlaubte, Geschöpfe zu töten, die viel größer und kräftiger waren als sie selbst. Durchaus denkbar ist jedoch, dass ihre Fähigkeit zum Mitgefühl ihnen das Töten nicht unbedingt einfach machte. Das könnten wir jedenfalls vermuten, wenn wir heutige Jägergesellschaften betrachten. Anthropologen beobachten, dass die Angehörigen dieser Völker nur mit großer Besorgnis Tiere töten, die sie eigentlich als Freunde und Beschützer ansehen, und dass sie versuchen, diese Besorgnis durch Reinigungsrituale abzumildern. In der Kalahari-Wüste, wo Holz sehr selten ist, haben die Buschmänner nur leichte Waffen, die gerade einmal die Haut des Tieres ritzen. Deshalb versehen sie ihre Pfeile mit einem Gift, das das Tier tötet – allerdings sehr langsam. In einer geradezu unbeschreiblichen Solidarität bleibt der Jäger bei seinem sterbenden Opfer, klagt mit ihm und nimmt symbolisch an seinem Todeskampf teil. Andere Völker kostümieren sich als Tiere oder streichen das Blut und die Exkremente des Opfers auf Höhlenwände, um das Tier an die Unterwelt zurückzugeben, aus der es gekommen ist.[19]
Die altsteinzeitlichen Jäger hatten möglicherweise ähnliche Vorstellungen.[20] Die Höhlenmalereien in Nordspanien und Südwestfrankreich gehören zu den frühesten erhaltenen Dokumenten unserer Spezies. Diese ausgemalten Höhlen hatten ziemlich sicher eine zeremonielle Funktion; Kunst und Ritual waren also von Anfang an nicht voneinander zu trennen. Unser Neocortex lässt uns die Tragik und Verwirrung unserer Existenz intensiv spüren, und sowohl in der Kunst als auch in einigen Erscheinungsformen der Religion finden wir Möglichkeiten, uns zu lockern und die weicheren, limbischen Emotionen zum Vorschein kommen zu lassen. Die Fresken und Ritzungen in der Höhle von Lascaux in der Dordogne, die ältesten 17000 Jahre alt, rufen selbst heute noch Staunen hervor. In ihren numinosen Tierdarstellungen haben die Künstler den grundlegenden Zwiespalt der Jäger eingefangen. Sosehr ihnen auch daran gelegen war, für Nahrung zu sorgen: Ihre Wildheit wurde gemildert durch ein respektvolles Mitgefühl für die Tiere, die sie töten mussten und deren Blut und Fett sie mit ihren Farben vermischten. Rituale und Kunst halfen den Jägern, ihr Mitgefühl und ihre Verehrung (religio) für die Mitgeschöpfe zum Ausdruck zu bringen – so wie Mencius es später beschreiben sollte – und mit der Notwendigkeit des Tötens ins Reine zu kommen.
In Lascaux gibt es keine Darstellungen von Rentieren, obwohl diese Tiere in der Ernährung dieser Jäger eine große Rolle spielten.[21] Aber ganz in der Nähe, in Montastruc, fand man eine kleine Skulptur, die um 11000 v.u.Z. aus dem Stoßzahn eines Mammuts geschnitzt worden war, also ungefähr zu der Zeit, als die Höhlenmalereien in Lascaux entstanden sind. Diese Skulptur wird heute im British Museum aufbewahrt, und sie zeigt zwei schwimmende Rentiere.[22] Der Künstler muss seine Beutetiere ganz genau beobachtet haben, wie sie auf dem Weg zu neuen Weiden Seen und Flüsse durchschwammen und sich damit besonders verletzlich machten. Er empfand durchaus Zärtlichkeit für seine Opfer, denn er gibt den Schmerz in ihren Gesichtern ohne jede Sentimentalität wieder. Neil MacGregor, der Direktor des British Museum, erklärt dazu, die anatomische Genauigkeit dieser Skulptur zeige, »dass sie sicher nicht nur mit dem Wissen eines Jägers, sondern auch mit der Einsicht eines Schlachters« angefertigt worden sei, also eines Menschen, »der seine Tiere nicht nur angeschaut, sondern auch aufgeschnitten hat«.[23] Rowan Williams, der frühere Erzbischof von Canterbury, spricht außerdem sehr einsichtsvoll von der »riesigen, phantasievollen Großzügigkeit« dieser Steinzeitkünstler: »In der Kunst dieser Epoche sehen wir Menschen, die den Versuch unternehmen, ganz und gar in den Strom des Lebens einzutauchen, so dass sie an allem Tierleben teilhaben, das sie umgibt … und das ist tatsächlich ein sehr religiöser Impuls.«[24]
Von allem Anbeginn an bestand also eine der Hauptbeschäftigungen sowohl der Religion als auch der Kunst darin, einen Gemeinschaftssinn zu entwickeln: im Hinblick auf die Natur, die Tierwelt und die Mitmenschen.
Wir können unsere Vergangenheit als Jäger und Sammler, die längste Epoche der Menschheitsgeschichte, niemals leugnen. Alles, was wir als zutiefst menschlich ansehen – Gehirn, Körper, Gesicht, Sprache, Emotionen und Gedanken –, trägt den Stempel dieses Erbes.[25] Einige Rituale und Mythen, die unsere prähistorischen Vorfahren entwickelten, überlebten bis in die religiösen Systeme späterer Schriftkulturen hinein. So bewahrte das Tieropfer, wichtigster Ritus nahezu aller antiken Kulturen, die prähistorischen Jägerzeremonien und die Ehrerbietung für das Tier, das für die Gemeinschaft sein Leben gab.[26] Die frühesten Formen von Religion wurzelten in der Anerkennung der tragischen Tatsache, dass alles Leben von der Zerstörung anderer Geschöpfe abhängig ist. Und ihre Rituale wurden entwickelt, um den Menschen ihren Umgang mit diesem unauflöslichen Dilemma zu erleichtern. Trotz ihres ehrlichen Respekts, ihrer Ehrerbietung und sogar Zuneigung für ihre Opfer betrieben die frühen Jäger das Töten durchaus mit Leidenschaft. Jahrtausende des Kampfes gegen große, aggressive Tiere führten dazu, dass die Jägergruppen verschworene Einheiten bildeten, die Keimzelle unserer modernen Armeen. Sie waren bereit, alles für das Gemeinwohl zu riskieren und ihre Kameraden vor Gefahr zu bewahren.[27] Und es gab noch ein zusätzliches widerstreitendes Gefühl, das integriert werden musste: Vermutlich liebten sie die Aufregung und Intensität der Jagd.
Hier kommt das limbische System wieder ins Spiel. Die Aussicht aufs Töten erregt unser Mitgefühl, aber während wir dann tatsächlich jagen, verfolgen und kämpfen, werden diese Emotionen vom Serotonin weggespült, und dieser Neurotransmitter ist für das ekstatische Gefühl verantwortlich, das wir auch mit bestimmten Formen religiöser Erfahrungen in Verbindung bringen. So konnte es geschehen, dass diese Gewalthandlungen als natürliche religiöse Aktivitäten wahrgenommen wurden, so bizarr uns das mit unserem heutigen Verständnis von Religion auch vorkommen mag. Die Menschen, vor allem die Männer, empfanden eine starke Bindung an ihre Mitkrieger, ein berauschendes Gefühl des Altruismus und der Lebendigkeit, wenn sie ihr Leben für andere riskierten. Und diese Reaktion auf Gewalt ist immer noch Teil unserer menschlichen Natur. Chris Hedges, Kriegsberichterstatter der New York Times, hat den Krieg sehr zutreffend als eine »sinnstiftende Kraft« beschrieben:
Krieg macht die Welt verständlich, er legt uns ein Schwarz-Weiß-Bild vor: Sie und wir. Er setzt das Denken außer Kraft, vor allem das selbstkritische Denken. Alles verneigt sich vor der übergeordneten Anstrengung. Wir sind eins. Die meisten von uns akzeptieren den Krieg bereitwillig, solange wir ihn in ein Glaubenssystem integrieren können, das das zwangsläufige Leiden als notwendig im Interesse eines höheren Guts darstellt. Denn Menschen sind nicht nur auf der Suche nach Glück, sondern nach Sinn. Und tragischerweise ist der Krieg manchmal die mächtigste Form der Sinnstiftung in der menschlichen Gesellschaft.[28]
Es ist auch vorstellbar, dass Krieger sich im Einklang mit den elementarsten, unerbittlichsten Kräften der Existenz fühlen – Leben und Tod –, wenn sie den aggressiven Impulsen ihrer tiefsten Gehirnschichten freien Lauf lassen. Oder anders gesagt: Krieg ist eine Gelegenheit, sich der Rücksichtslosigkeit unseres Reptiliengehirns zu ergeben, einem der stärksten menschlichen Triebe, ohne von den selbstkritischen Bemerkungen des Neocortex gestört zu werden.
Deshalb erlebt der Krieger im Kampf die ekstatische Selbstbestätigung, die andere Menschen im Ritual finden, manchmal mit krankhaften Auswirkungen. Psychiater, die Kriegsveteranen mit posttraumatischen Störungen behandeln, haben festgestellt, dass manche Soldaten bei der Zerstörung anderer Menschen eine Selbstbestätigung erleben, die fast schon erotische Ausmaße annimmt.[29] Danach jedoch, wenn sie darum kämpfen, ihre Gefühle von Mitleid und Rücksichtslosigkeit wieder zu entwirren, stellen diese PTSD-Kranken fest, dass sie nicht mehr stimmig als Menschen funktionieren können. Ein Vietnam-Veteran hat ein Foto beschrieben, auf dem er zwei abgeschlagene Köpfe an den Haaren hochhielt. Der Krieg, so sagte er, war die »Hölle«, ein Ort, an dem »jede Verrücktheit normal« und »alles außer Kontrolle« war. Aber er schloss mit den Worten:
Das Schlimmste, was ich über mich selbst sagen kann, ist: Solange ich dabei war, habe ich mich sehr lebendig gefühlt. Ich fand es wunderbar, so wie man einen Adrenalinstoß liebt, seine Freunde oder enge Kumpel. Es ist vollkommen irreal und doch das Realste, was je passiert ist … Und vielleicht ist das Schlimmste für mich jetzt, dass ich im Frieden lebe, ohne jede Möglichkeit, einen derartigen Rausch zu erleben. Ich hasse alles, was mit diesem Rausch zusammenhing, aber den Rausch selbst, den habe ich geliebt.[30]
»Erst wenn wir uns mitten in einem Konflikt befinden, wird die weitgehende Flachheit und Fadheit unseres Lebens deutlich«, erklärt Chris Hedges. »Unsere Gespräche und das meiste, was durch den Äther zu uns gelangt, werden von Nichtigkeiten beherrscht. Der Krieg dagegen ist ein verführerisches Elixier. Er gibt uns Entschlossenheit, einen Grund für unser Tun. Er gestattet uns sogar, edel zu sein.«[31] Eines der vielen, ineinander verschränkten Motive für Menschen, in den Krieg zu ziehen, ist seit jeher die Langeweile und Sinnlosigkeit der normalen alltäglichen Existenz. Derselbe Hunger nach intensivem Leben bringt andere dazu, Mönche und Asketen zu werden.
Solange der Kampf andauert, fühlt sich der Krieger möglicherweise mit dem Kosmos verbunden, aber hinterher kann er die inneren Widersprüche nicht mehr auflösen. Das Tabu gegen das Töten innerhalb unserer eigenen Art ist einigermaßen unumstritten – ein Trick der Evolution, der das Überleben der Spezies gesichert hat.[32] Trotzdem kämpfen wir. Aber um uns selbst dazu zu bringen, hüllen wir unser Tun in eine – oft genug religiöse – Mythologie, die uns von unserem Feind distanziert. Wir übertreiben die Unterschiedlichkeit auf Gebieten wie ethnische Abstammung, Religion und Ideologie. Wir entwickeln Narrative, um uns selbst davon zu überzeugen, dass der Kampf nicht wirklich menschlich ist, sondern ein Monster, das Gegenteil von Ordnung und Güte. Heute sagen wir uns vielleicht, dass wir für Gott und Vaterland kämpfen oder dass ein bestimmter Krieg »gerecht« oder »rechtmäßig« sei. Aber diese Ermutigung greift nicht immer. Während des Zweiten Weltkriegs hat eine Gruppe von Historikern unter der Leitung von US-Brigadegeneral S. L. A. Marshall Tausende von Soldaten aus mehr als vierhundert Infanterie-Kompanien befragt, die die Kämpfe in Europa und im Pazifik aus eigener Anschauung erlebt hatten. Die Ergebnisse waren verblüffend: Nur 15 bis 20 Prozent der Infanteristen sahen sich in der Lage, direkt auf den Feind zu schießen, alle anderen versuchten es zu vermeiden oder entwickelten komplexe Methoden, danebenzuschießen oder ihre Waffen nachzuladen, um ihr Verhalten zu verbergen.[33]
Es fällt uns schwer, unserer Natur zu entkommen. Um als Soldaten zu funktionieren, müssen Rekruten eine zermürbende Initiation durchlaufen, während der sie lernen, ihre Emotionen zu unterdrücken, nicht viel anders als Mönche oder Yogis im Übrigen. Die Kulturhistorikerin Joanna Bourke erklärt den Vorgang so:
Individuen mussten gebrochen werden, um anschließend zu effizienten Kämpfern aufgerichtet zu werden. Die grundlegenden Methoden umfassten Entpersonalisierung, Uniformen, Mangel an Privatsphäre, erzwungene Sozialkontakte, enge Zeitpläne, Schlafmangel, Desorientierung, gefolgt von Reorganisationsriten nach militärischen Kriterien, willkürliche Regeln und strenge Strafen. Die Methoden der Brutalisierung ähnelten denen totalitärer Regime, wenn Männern beigebracht wurde, Gefangene zu foltern.[34]
Wir könnten also sagen: Der Soldat muss genauso inhuman werden wie der »Feind«, den er in seinem Kopf erschaffen hat. Tatsächlich werden wir noch feststellen, dass in einigen Kulturen, selbst – oder gerade – in solchen, die den Krieg verherrlichen, das Bild des Kriegers ein Stück weit verdorben, schmutzig und angstbesetzt ist. Er ist gleichzeitig eine heroische Gestalt und ein notwendiges Übel, das gefürchtet und ausgesondert wird.
Unsere Beziehung zum Krieg ist also vielleicht deshalb so komplex, weil er eine relativ neue Entwicklung darstellt. Die Jäger und Sammler konnten sich die organisierte Gewalt, die wir Krieg nennen, nicht leisten, weil dazu große Armeen, eine kontinuierliche Führung und ökonomische Ressourcen nötig sind, die ihnen bei weitem nicht zur Verfügung standen.[35] Archäologen haben Massengräber aus dieser Epoche gefunden, die zwar auf eine Art Massaker hindeuten,[36] aber es gibt wenig Hinweise darauf, dass die frühen Menschen regelmäßig gegeneinander kämpften.[37] Das menschliche Leben änderte sich allerdings von Grund auf um etwa 9000 v.u.Z., als die ersten Bauern im Vorderen Orient lernten, wie man wildes Getreide anbaut und lagert. Sie brachten Ernten ein, die wesentlich größere Bevölkerungsgruppen ernähren konnten, und bald produzierten sie sogar mehr Nahrungsmittel, als sie selbst brauchten.[38] In der Folge wuchs die Bevölkerung in einem solch hohen Maß, dass in einigen Regionen eine Rückkehr zum Leben als Jäger und Sammler unmöglich wurde. Zwischen etwa 8500 v.u.Z. und dem ersten Jahrhundert u.Z. – also in einer bemerkenswert kurzen Zeit, wenn man die vier Millionen Jahre der Menschheitsgeschichte zum Maßstab nimmt – vollzog der größte Teil der Menschheit überall auf der Erde und relativ unabhängig voneinander den Übergang zum Ackerbau. Mit dem Ackerbau kam die Zivilisation – und mit der Zivilisation der Krieg.
In unseren Industriegesellschaften blicken wir oft mit einer gewissen Nostalgie auf dieses Agrarzeitalter zurück und stellen uns vor, die Menschen hätten damals gesünder gelebt, erdverbundener und in Harmonie mit der Natur. Aber in der Anfangsphase war der Übergang zur Landwirtschaft eine traumatische Erfahrung. Die frühen Siedlungen waren starken Produktivitätsschwankungen ausgesetzt, die eine ganze Bevölkerung auslöschen konnten, und ihre Mythologie beschreibt den verzweifelten Kampf der ersten Bauern gegen Unfruchtbarkeit, Dürre und Hungersnot.[39] Zum ersten Mal im Leben der Menschheit war schwere körperliche Arbeit die Regel. Skelettfunde zeigen, dass die pflanzliche Ernährung Menschen hervorbrachte, die einen Kopf kleiner waren als die fleischessenden Jäger. Sie neigten zu Blutarmut, Infektionskrankheiten, fauligen Zähnen und Knochenanomalien.[40] Die Erde wurde als Muttergottheit verehrt, ihre Fruchtbarkeit als Offenbarung erlebt. In Mesopotamien wurde sie Ishtar genannt, in Griechenland Demeter, in Ägypten trug sie den Namen Isis und in Syrien hieß sie Anat. Allerdings war sie kein tröstendes Wesen, sondern extrem gewalttätig. Mutter Erde verstümmelte regelmäßig und gleichermaßen Gefährten und Feinde – so wie das Getreide zu Mehl vermahlen und die Trauben zu einem einheitlichen Brei zerstoßen wurden. Landwirtschaftliche Gerätschaften wurden als Waffen dargestellt, die die Erde verwundeten, so dass die Felder zu Blutäckern wurden. Wenn Anat den Gott der Unfruchtbarkeit tötete, einen Gott mit Namen Mot, dann zerschnitt sie ihn mit einer rituellen Sichel in zwei Teile, strich ihn durch ein Sieb, zermahlte ihn in einer Mühle und verstreute sein zerstückeltes blutiges Fleisch auf den Feldern. Nachdem sie die Feinde Baals – des lebenspendenden Regengottes – niedergemetzelt hatte, schmückte sie sich mit roter Farbe und Henna, machte sich eine Kette aus den Händen und Köpfen ihrer Opfer und watete durch knietiefes Blut zum Siegesbankett.[41]
Diese gewalttätigen Mythen spiegeln die politischen Realitäten des Lebens in der Agrargesellschaft. Zu Beginn des 9. Jahrtausends v.u.Z. hatte die Siedlung in der Oase von Jericho im Jordantal dreitausend Einwohner – eine Zahl, die vor der Entwicklung der Landwirtschaft undenkbar gewesen wäre. Aber Jericho war eine Festung mit einer massiven Mauer, deren Bau Zehntausende von Arbeitsstunden erfordert haben muss.[42] In dieser trockenen Region müssen die reich gefüllten Vorratsspeicher der Stadt Jericho wie ein Magnet auf hungrige Nomaden gewirkt haben. So schuf die intensivierte Landwirtschaft Bedingungen, die alle Bewohner dieser wohlhabenden Kolonie in Gefahr bringen und ihr Nutzland in einen Blutacker verwandeln konnten. Jericho jedoch war etwas Besonderes: ein Wegweiser in die Zukunft. Die nächsten fünftausend Jahre wurde der Krieg noch nicht zum Problem, aber er war bereits eine Möglichkeit, und zu Beginn dieser Phase war organisierte Gewalt nicht mit Religion verknüpft, sondern mit organisiertem Diebstahl.[43]
Aber die Landwirtschaft brachte noch eine andere Art von Aggression hervor: eine institutionelle oder strukturelle Gewalt, die Menschen innerhalb der Gesellschaft in ein derartiges Elend und solche Unterdrückung zwingt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihr Los zu verbessern. Diese systemische Unterdrückung ist als vielleicht »subtilste Form der Gewalt«[44] beschrieben worden. Nach Aussage des Weltrats der Kirchen ist sie dort vorherrschend, wo
Ressourcen und Macht ungleich verteilt und in den Händen einiger weniger konzentriert sind, die sie nicht dazu nutzen, die mögliche Selbstverwirklichung aller Mitglieder einer Gesellschaft zu erreichen, sondern Teile davon zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse heranziehen oder dazu, andere Gesellschaften oder die unterprivilegierten Mitglieder der eigenen Gesellschaft zu beherrschen, zu unterdrücken und zu kontrollieren.[45]
Die Entwicklung einer agrarischen Zivilisation ließ diese systemische Gewalt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte entstehen.
Die altsteinzeitlichen Gemeinschaften waren vermutlich egalitär, weil die Jäger und Sammler es sich gar nicht leisten konnten, eine privilegierte Klasse zu unterstützen, die an den Härten und Gefahren der Jagd nicht teilhatte.[46] Weil diese kleinen Gemeinschaften nahe am Subsistenzniveau lebten und keinen wirtschaftlichen Überfluss produzierten, war eine ungleiche Verteilung des Wohlstands unmöglich. Der Stamm konnte nur überleben, wenn alle Nahrungsmittel geteilt wurden. Herrschaft durch Zwang war kaum praktikabel, weil alle körperlich fähigen Männer über genau dieselben Waffen und Kampfmöglichkeiten verfügten. Anthropologen haben festgestellt, dass moderne Jäger-und-Sammler-Gesellschaften klassenlos sind und dass ihre Wirtschaft durch »eine Art Kommunismus«[47] charakterisiert ist. Sie schätzen Fertigkeiten und Eigenschaften wie Großzügigkeit, Freundlichkeit und Ausgeglichenheit, die der gesamten Gemeinschaft nützen.[48] Aber in Gesellschaften, die mehr produzieren, als sie brauchen, kann eine kleine Gruppe genau diesen Überschuss nutzen, um sich selbst zu bereichern, ein Gewaltmonopol zu errichten und den Rest der Bevölkerung zu beherrschen.
Wie wir im ersten Teil dieses Buches sehen werden, war diese systembedingte Gewalt ein Merkmal sämtlicher Agrargesellschaften. In den großen Reichen des Nahen Ostens, Chinas, Indiens und Europas, die von der Landwirtschaft abhängig waren, beraubte eine kleine Elite – nicht mehr als zwei Prozent der Bevölkerung – mit Hilfe weniger Steigbügelhalter die Bevölkerung systematisch ihrer Ernten, um die eigene aristokratische Lebensweise abzusichern. Historiker argumentieren allerdings, dass die Menschen ohne diese Ungerechtigkeit vielleicht nie über das Subsistenzniveau hinausgekommen wären, weil nur so eine privilegierte Klasse entstehen konnte, die die Zeit und die Mittel hatte, um jene Künste und Wissenschaften zu entwickeln, die ihrerseits Fortschritt möglich machten.[49] Alle vormodernen Zivilisationen übernahmen dieses Unterdrückungssystem, als gäbe es keine Alternative. Das hatte unvermeidliche Auswirkungen auf die Religion, die alles menschliche Tun durchdrang, selbst den Aufbau und die Verwaltung von Staaten. Wir werden in der Tat noch sehen, dass die Politik der vormodernen Zeit von der Religion gar nicht zu trennen war. Und wenn eine herrschende Elite eine ethische Tradition übernahm – Buddhismus, Christentum oder Islam –, dann übernahm in der Regel auch der Klerus die jeweilige Ideologie und unterstützte damit die strukturelle staatliche Gewalt.[50]
In Teil eins und zwei werden wir dieses Dilemma untersuchen. Krieg war eine notwendige Voraussetzung des Agrarstaats, er wurde durch Zwang ins Leben gerufen und durch militärische Aggression am Leben erhalten. Wenn das Land und die Bauern, die es bewirtschafteten, die Hauptquelle allen Wohlstands waren, dann konnte ein agrarisches Königreich seine Einnahmen nur durch Gebietseroberungen steigern. Das Mittel des Krieges war deshalb unverzichtbar für jede Agrargesellschaft. Die herrschende Klasse musste ihre Kontrolle über die Bauerndörfer erhalten, das nutzbare Land gegen Angreifer verteidigen, noch mehr Land erobern und jedes Anzeichen von Ungehorsam rücksichtslos unterdrücken. Eine Schlüsselfigur in unserer Betrachtung dieser Geschichte ist der indische Kaiser Ashoka (268–223 v.u.Z.). Entsetzt über das Leid, das seine Armee über eine aufständische Stadt gebracht hatte, forderte er unermüdlich eine Ethik des Mitgefühls und der Toleranz, konnte aber seine Armee am Ende doch nicht auflösen. Kein Staat kann ohne seine Soldaten überleben. Und sobald die Staaten wuchsen und die Erfahrung von Krieg zu einem Menschenleben fest dazugehörte, schien eine noch größere Streitmacht, die militärische Macht eines Reiches, oft die einzige Möglichkeit zu sein, den Frieden zu bewahren.
Militärische Macht ist für den Aufstieg von Staaten und letztlich großen Reichen so wichtig, dass die Historiker den Militarismus für eine wichtige Phase der Zivilisation halten. Ohne disziplinierte, gehorsame und gesetzestreue Armeen, so sagen sie, wäre die menschliche Gesellschaft vermutlich auf einem primitiven Niveau mit sich endlos bekriegenden Horden verblieben.[51] Aber wie unser innerer Konflikt zwischen gewalttätigen und mitfühlenden Impulsen, so blieb auch der Widerspruch zwischen friedlichen Zielen und gewalttätigen Mitteln aufs Ganze gesehen ungelöst. Ashokas Dilemma ist das Dilemma der gesamten Zivilisation. Und auch die Religion geriet in dieses Tauziehen hinein. Da alle Staatsideologie der vormodernen Staaten religiös durchtränkt war, nahm der Krieg unvermeidlich sakrale Züge an. Tatsächlich hat jede größere Glaubenstradition die politische Gemeinschaft geprägt, in der sie entstanden ist. Keine Glaubenstradition ist zur »Weltreligion« geworden ohne die Förderung durch ein militärisch mächtiges Reich, und jede von ihnen hat eine imperiale Ideologie entwickelt.[52] Aber bis zu welchem Grad hat die Religion zur staatlichen Gewalt beigetragen, mit der sie so untrennbar verbunden war? Wie groß ist der Anteil an der Geschichte der menschlichen Gewalt, den wir der Religion selbst zuschreiben können? Die Antwort ist nicht so einfach, wie ein Großteil unseres öffentlichen Diskurses vermuten lässt.
Unsere heutige Welt ist in einem gefährlichen Maße polarisiert, und dies zu einer Zeit, da die Menschheit politisch, wirtschaftlich und elektronisch stärker vernetzt ist als je zuvor. Wenn wir die Herausforderung unserer Zeit bestehen und eine globale Gesellschaft errichten wollen, in der alle Völker in Frieden und gegenseitigem Respekt leben können, dann kommen wir nicht umhin, die Dinge sorgfältig zu betrachten. Vereinfachte Annahmen über den Charakter der Religion oder ihre Rolle in der Welt können wir uns nicht leisten. Was der amerikanische Wissenschaftler William T. Cavanaugh als »Mythos von der religiösen Gewalt«[53] bezeichnet, hat den Menschen im Westen in der frühen Phase der Modernisierung gute Dienste geleistet, aber in unserem globalen Dorf brauchen wir nuanciertere Sichtweisen, um unsere missliche Lage besser zu verstehen.
Dieses Buch konzentriert sich weitgehend auf die abrahamitischen Traditionen des Judentums, des Christentums und des Islam, weil sie im Moment im Rampenlicht stehen. Aber nachdem es eine sehr weit verbreitete Überzeugung gibt, dass der Monotheismus, also der Glaube an einen einzigen Gott, besonders stark zu Gewalt und Intoleranz neige, werde ich im ersten Teil meiner Ausführungen Vergleiche heranziehen. Am Beispiel der Traditionen, die den abrahamitischen Glaubensrichtungen vorangingen, werden wir nicht nur sehen, wie unabdingbar militärische Gewalt und Religion für den vormodernen Staat waren, sondern auch, dass es immer Menschen gab, die unter dem Dilemma der notwendigen Gewalt gelitten und »religiöse« Mittel gegen aggressive Impulse und mitfühlendere Zielsetzungen gefordert haben.
Es würde mehr als ein Leben brauchen, um alle Fälle religiös formulierter Gewalt zu analysieren, aber wir werden einige der wichtigsten in der langen Geschichte der abrahamitischen Religionen erforschen, darunter den heiligen Krieg Josuas, den Ruf zum Dschihad, die Kreuzzüge, die Inquisition und die europäischen Religionskriege. Es wird sich zeigen, dass die Menschen der Vormoderne in religiösen Begriffen dachten, wenn sie sich politisch betätigten, und dass ihr Glaube die Suche nach Sinn in dieser Welt in einer Weise prägte, die uns heute fremd geworden ist. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Ein Werbeslogan der Post in Großbritannien lautet: »The weather does a lot of different things and so does the Post Office.« So ist es auch mit der Religion. In der Geschichte der Religionen war der Kampf um Frieden genauso wichtig wie der heilige Krieg. Religiöse Menschen haben alle möglichen genialen Methoden entwickelt, um mit dem aggressiven Machismo des Reptiliengehirns zurechtzukommen, um Gewalt zu umgehen und respektvolle, lebensfördernde Gemeinschaften aufzubauen. Aber ähnlich wie Ashoka, der sich gegen den systemischen Militarismus des Staates stellte, konnten sie die Gesellschaften, in denen sie lebten, nicht von Grund auf verändern. Im besten Fall gelang es ihnen, einen Weg aufzuzeigen, um freundlichere, mitfühlendere Formen des Zusammenlebens für die Menschen zu entwickeln.
Wenn wir uns im dritten Teil des Buchs der Moderne widmen, werden wir natürlich die Welle der Gewalt während der achtziger Jahre untersuchen, die religiös begründet war und später in der Schreckenstat des 11. September 2001 ihren Höhepunkt fand. Wir werden aber auch den Siegeszug des Säkularismus betrachten, der trotz all seiner vielfältigen Vorteile nicht immer eine friedliche Alternative zur religiösen Staatsideologie angeboten hat. Denn die Philosophien der frühen Neuzeit, die den Versuch unternahmen, Europa nach dem Dreißigjährigen Krieg zu befrieden, offenbarten ihrerseits ausgesprochen rücksichtslose Züge, vor allem wenn sie sich mit den dunklen Seiten der säkularen Moderne beschäftigten, einer Epoche, die sie als eher befremdend denn als stärkend und befreiend erlebten. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass der Säkularismus die Religion nicht abschaffte, sondern Ersatzreligionen schuf. Unser Verlangen nach einem letzten Sinn ist so tief in uns angelegt, dass unsere säkularen Institutionen, vor allem der Nationalstaat, fast zwangsläufig eine »religiöse« Aura annehmen – auch wenn es ihnen weniger als den Religionen der Antike gelingt, Menschen bei der Auseinandersetzung mit den grausamsten Realitäten der menschlichen Existenz, auf die es keine einfachen Antworten gibt, behilflich zu sein.
Doch der Säkularismus ist bei weitem nicht das Ende der Geschichte. In einigen Gesellschaften, die versucht haben, einen Weg in die Moderne zu finden, hat er lediglich die Religion beschädigt und die Seelen von Menschen verletzt, die nicht darauf vorbereitet waren, aus Lebens- und Denkweisen herausgerissen zu werden, die ihnen immer eine Stütze gewesen waren.
So leckt der Sündenbock in der Wüste seine Wunden und kehrt mit all seinem schwelenden Groll zurück in die Stadt, aus der er vertrieben wurde.
Teil 1
Anfänge
1
Bauern und Hirten
Gilgamesch, der legendäre fünfte König von Uruk, galt als der »stärkste der Männer, riesig, schön, strahlend, vollkommen«[54]. Es heißt, er habe alles gesehen, sei bis zu den Enden der Erde gereist, habe die Unterwelt besucht und große Weisheit erlangt. Im frühen dritten Jahrtausend v.u.Z. war Uruk, das im heutigen Südirak lag, der größte Stadtstaat im Staatenbund von Sumer, der ersten Zivilisation der Welt. Der Dichter Sin-leqi, der seine Version von Gilgameschs bemerkenswertem Leben um 1200 v.u.Z. aufschrieb, platzte noch vor Stolz über die Tempel, Paläste, Gärten und Läden der Stadt. Aber er beginnt und beendet sein Epos mit einer überschwenglichen Beschreibung der großartigen, sechs Meilen langen Stadtmauer, die Gilgamesch für sein Volk wiedererrichtet hatte. »Geht auf der Mauer von Uruk!«, drängt Sin-leqi seine Leser voller Begeisterung. »Folgt ihrem Weg rund um die Stadt, betrachtet ihre mächtigen Fundamente, untersucht die Ziegel und wie meisterhaft sie gebaut ist.«[55] Diese phantastische Stadtbefestigung zeigte, dass der Krieg im Leben der Menschen schon gegenwärtig geworden war – allerdings nicht als Ergebnis einer zwangsläufigen Entwicklung. Hunderte von Jahren hatte Sumer keinerlei Notwendigkeit gesehen, seine Städte vor Angriffen von außen zu schützen. Gilgamesch jedoch, der vermutlich um 2750 v.u.Z. regierte, war eine neue Art sumerischer König: »Ein wilder Stier von einem Mann, ein unbesiegter Führer, Held der vordersten Schlachtreihe, geliebt von seinen Soldaten. Festung nannten sie ihn, Beschützer des Volkes, rasende Flut, die alle Verteidigungslinien zerstört.«[56]
Trotz seiner Leidenschaft für Uruk musste Sin-leqi zugeben, dass die Zivilisation auch unschöne Seiten hatte. Die Dichter hatten schon kurz nach Gilgameschs Tod damit begonnen, seine Geschichte zu erzählen, weil es eine archetypische Geschichte ist, eine der ersten schriftlichen Aufzeichnungen vom »Weg des Helden«.[57] Aber diese Geschichte ringt auch mit der unausweichlichen strukturellen Gewalt des zivilisierten Lebens. Denn das Volk von Uruk – unterdrückt, verarmt und elend – bat die Götter, es vor Gilgameschs Tyrannei zu retten:
Die Stadt ist sein Besitz, er stolziert
hindurch, voll Arroganz, den Kopf erhoben,
trampelt ihre Bürger nieder wie ein wilder Stier.
Er ist der König, er tut, was ihm gefällt.
Verfolgt die jungen Männer von Uruk ohne Urteil.
Gilgamesch lässt keinen Sohn frei zu seinem Vater gehen.[58]
Diese jungen Männer wurden wohl für die Arbeitstrupps zwangsverpflichtet, die die Stadtmauer errichteten.[59] Das Leben in der Stadt wäre nicht möglich gewesen ohne die skrupellose Ausbeutung der großen Bevölkerungsmehrheit. Gilgamesch und der sumerische Adel lebten in bis dahin unbekanntem Prunk, aber für die bäuerlichen Massen brachte ihre Herrschaft nichts als Elend und Unterdrückung.
Die Sumerer waren wohl das erste Volk, das die Ernteüberschüsse der Gemeinschaft privatisierte und eine privilegierte herrschende Klasse hervorbrachte. Das war nur mit Gewalt möglich. Um 5000 v.u.Z. waren die ersten wagemutigen Siedler in die fruchtbare Ebene zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat gezogen.[60] Der Boden dort war jedoch zu trocken für den Ackerbau, so dass sie ein Bewässerungssystem entwickelten, um das Schmelzwasser von den Bergen, das die Ebene jedes Jahr überflutete, zu kontrollieren und zu verteilen. Das war eine außerordentliche Leistung. In einer gemeinsamen Anstrengung mussten Kanäle und Deiche geplant, entworfen und erhalten werden, und das Wasser musste gerecht zwischen den wetteifernden Gemeinschaften aufgeteilt werden. Das neue System fing vermutlich klein an, führte aber bald zu einem dramatischen Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion und damit zu seiner Bevölkerungsexplosion.[61] Um 3500 zählte das Volk der Sumerer eine halbe Million Seelen – eine bis dahin undenkbare Zahl. Nun wurde eine starke Führung unabdingbar, aber bis heute ist nicht klar, was diese einfachen Bauern zu Stadtbewohnern machte. Vermutlich war es eine ganze Reihe von miteinander verbundenen, sich gegenseitig verstärkenden Faktoren: das Bevölkerungswachstum, eine bisher ungekannte Fruchtbarkeit der Landwirtschaft und die intensive Arbeit an der Bewässerung – ganz zu schweigen von schlichtem menschlichem Ehrgeiz – trugen zur Herausbildung einer neuen Gesellschaftsform bei.[62]
Was wir sicher wissen, ist nur dies: Um 3000 v.u.Z. gab es zwölf Städte in der Ebene von Mesopotamien, die alle von den Ernten der Bauern in dieser Region lebten. Diese Bauern betrieben Subsistenzwirtschaft. Jedes Dorf musste seine gesamte Ernte in der Stadt abliefern, der es diente; Beamte sorgten dafür, dass die Bauern einen Teil davon zum Leben bekamen, der Rest wurde in den Tempeln der Stadt für den Adel gelagert. Auf diese Weise sicherten sich einige wenige große Familien mit Hilfe ihrer Gefolgsleute – Bürokraten, Soldaten, Kaufleute und Hausdiener – die Hälfte bis zwei Drittel des Ertrags.[63] Diesen Überschuss nutzten sie, um ein ganz anderes Leben zu führen, frei für vielfältige Beschäftigungen, die Muße und Wohlstand voraussetzten. Im Gegenzug sorgten sie für das Bewässerungssystem und ein gewisses Maß an Recht und Ordnung. Alle vormodernen Staaten fürchteten die Anarchie: Eine einzige Missernte durch Dürre oder soziale Unruhen konnte Tausende von Menschen das Leben kosten, und so war für die Elite klar, dass das System der gesamten Bevölkerung nützte.
Die Bauern freilich, die man um die Früchte ihrer Arbeit brachte, waren kaum mehr als Sklaven: Sie pflügten, ernteten, gruben Bewässerungskanäle, wurden unterdrückt und lebten im Elend. Die harte Arbeit auf den Feldern saugte ihnen das Mark aus den Knochen. Wenn ihre Aufseher nicht zufrieden waren, schossen sie den Bauern die Zugtiere lahm oder fällten ihre Olivenbäume.[64] Hier und da sind bruchstückhafte Aufzeichnungen über die Not der Bauern erhalten: »Der Arme ist tot besser dran als lebendig«, klagt einer von ihnen.[65] »Ich bin ein Vollbluthengst«, beschwert sich ein anderer, »aber man hat mich zum Maultier gemacht, und ich muss den Karren ziehen, mit Kraut und Stoppeln beladen.«[66]
Sumer hatte ein System struktureller Gewalt entwickelt, wie es in jedem Agrarstaat bis in die Moderne hinein vorherrschen sollte, also bis zu dem Zeitpunkt, da die Landwirtschaft als wirtschaftliche Grundlage der Zivilisation an Bedeutung verlor.[67] Symbol der rigiden sumerischen Hierarchie waren die Zikkurats: riesige stufenförmige Tempeltürme, die zum Markenzeichen der Zivilisation in Mesopotamien wurden. Auch die sumerische Gesellschaft bestand aus nach oben zunehmend kleiner werdenden sozialen Schichten, die in eine adelige Spitze mündeten und jedem Individuum seinen unverrückbaren Platz zuwiesen.[68] Historiker argumentieren freilich, ohne diese grausame Ordnung, die der großen Mehrheit der Bevölkerung Gewalt antat, hätten die Menschen niemals die Künste und Wissenschaften entwickelt, die Fortschritt erst möglich machen. Die Zivilisation selbst brauchte eine freigestellte Schicht von Menschen, die sie kultivierte, und so bauten die besten Errungenschaften der Menschheit jahrtausendelang auf dem Rücken ausgebeuteter Bauern auf. Es ist kein Zufall, dass die Sumerer die Schrift erfanden, um sie als Mittel der sozialen Kontrolle einzusetzen.
Welche Rolle spielte aber die Religion in dieser schändlichen Unterdrückung? Alle politischen Gemeinschaften entwickeln Ideologien, die ihre Institutionen mit der natürlichen Ordnung begründen, wie sie sie wahrnehmen.[69] Die Sumerer wussten, wie empfindlich ihr bahnbrechendes städtisches Experiment war. Ihre Gebäude aus Lehmziegeln brauchten ständige Pflege; Euphrat und Tigris traten oft über die Ufer und vernichteten die Ernten; Wolkenbrüche verwandelten den Boden in Schlamm, und schreckliche Stürme zerstörten Besitz und töteten das Vieh. Aber die Angehörigen des Adels hatten begonnen, die Gestirne zu beobachten, und dabei wiederkehrende Muster in den Bewegungen der Himmelskörper entdeckt. Sie staunten darüber, wie die verschiedenen Elemente der natürlichen Welt zusammenwirkten, um ein stabiles Universum zu erhalten, und sie vermuteten, der Kosmos selbst müsse eine Art Staat sein, in dem jedes Ding seine feste Aufgabe hatte. Wenn sie nun ihre Städte nach dieser himmlischen Ordnung einrichteten, so dachten sie, dann stünde ihr Gesellschaftsexperiment in Einklang mit der Welt und würde deshalb gedeihen und die Zeit überdauern.[70]
Der kosmische Staat, so glaubten sie, wurde von Göttern regiert, die untrennbar mit den Naturkräften verbunden waren, sich ihrem Charakter nach also vollkommen von dem Gott unterschieden, den Juden, Christen und Muslime heute verehren. Diese Gottheiten konnten keine Ereignisse beeinflussen, sondern waren an dieselben Gesetze gebunden wie die Menschen, Tiere und Pflanzen. Es gab auch keinen großen existenziellen Abstand zwischen Mensch und Gott – Gilgamesch war beispielsweise zu einem Drittel menschlich und zu zwei Dritteln göttlich.[71] Die Anunnaki, die höheren Götter, entsprachen in ihrem vollkommenen und wirkungsvollsten Selbst den Adeligen – von den Menschen unterschieden sie sich lediglich durch ihre Unsterblichkeit. Die Sumerer stellten sich vor, dass diese Götter mit Stadtplanung, Bewässerung und Regierung ebenso beschäftigt waren wie sie selbst. Anu, der Himmelsgott, regierte diesen archetypischen Staat von seinem himmlischen Palast aus, aber seine Gegenwart machte sich auch in jeder irdischen Autorität bemerkbar. Enlil, der Herr des Sturms, offenbarte sich nicht nur in den verheerenden Gewittern Mesopotamiens, sondern auch in jeder Art menschlicher Macht und Gewalt. Er war Anus oberster Ratgeber im Rat der Götter (dessen Abbild die sumerische Ratsversammlung war) – Enki, der den Menschen die Kunst der Zivilisation gebracht hatte, war eine Art Landwirtschaftsminister.
Jeder Staat – selbst unsere heutigen säkularen Nationalstaaten – beruht auf einem Mythos, der den besonderen Charakter und die Aufgabe des Staates bestimmt. Das Wort »Mythos« hat in der Moderne jedoch an Kraft verloren und wird heute so verstanden, als bezeichnete es etwas Unwahres, nie Geschehenes. In der vormodernen Welt jedoch war die Mythologie Ausdruck einer zeitlosen, nicht so sehr einer historischen Wirklichkeit und stellte die Blaupause für das Handeln in der Gegenwart zur Verfügung.[72] In Bezug auf diese frühe geschichtliche Phase, aus der uns nur spärliche archäologische und historische Aufzeichnungen überliefert sind, ist die schriftlich bewahrte Mythologie unser einziger Zugang zum Denken der Sumerer. Für diese Pioniere der Zivilisation war der Mythos eines kosmischen Staates eine Übung in politischer Wissenschaft. Die Sumerer wussten, dass ihre gegliederte Gesellschaft in erschreckender Weise von der egalitären Norm abwich, die seit unvordenklichen Zeiten galt, aber sie waren auch überzeugt davon, dass sie in irgendeiner Weise in der Natur der Dinge aufgehoben war und dass selbst die Götter an sie gebunden waren. Lange bevor Menschen überhaupt existiert hatten, so sagten sie, hatten Götter in den Städten Mesopotamiens gelebt, die Felder bewirtschaftet und das Bewässerungssystem betrieben.[73] Nach der großen Flut hatten sie sich von der Erde in den Himmel zurückgezogen und die sumerische Aristokratie dazu bestimmt, an ihrer Stelle die Städte zu regieren. Diese herrschende Schicht war ihren göttlichen Herren rechenschaftspflichtig, und sie hatte keine andere Wahl, als zu gehorchen.
Die politischen Einrichtungen der Sumerer folgten der ewigen Philosophie und ahmten die Einrichtungen ihrer Götter nach. Auf diese Weise, so glaubten sie, versetzten sie ihre fragilen Städte in die Lage, an der Kraft des Göttlichen teilzuhaben. Jede Stadt besaß ihre eigene Schutzgottheit und war im persönlichen Besitz des jeweiligen Gottes.[74] Der herrschende Gott lebte, repräsentiert durch eine lebensgroße Statue, im Haupttempel, umgeben von seiner Familie und einem ganzen Hofstaat mit göttlichen Bediensteten und Sklaven, die ebenfalls durch Standbilder dargestellt wurden und in einer Reihe von Räumen im Tempel lebten. Mit ausgefeilten Ritualen wurden die Götter ernährt, gekleidet und unterhalten, und jeder Tempel unterhielt riesige Flächen Ackerland und große Viehherden in ihrem Namen. Jeder Mensch in dem Stadtstaat, so untergeordnet seine Tätigkeit auch sein mochte, stand im Dienst der Götter. Die Menschen waren mit dem Tempelritus beschäftigt, arbeiteten in ihren Brauereien, Manufakturen und Werkstätten, fegten ihre Schreine, hüteten und schlachteten ihre Tiere, buken ihr Brot und kleideten ihre Statuen. Im mesopotamischen Staat war nichts Säkulares, und an dessen Religion war nichts Persönliches. Es war eine Theokratie, in der jeder – vom höchsten Aristokraten bis zum niedrigsten Handwerker – eine heilige Handlung vollführte.
Die mesopotamische Religion war ihrem Wesen nach gemeinschaftlich ausgerichtet. Männer und Frauen suchten die Begegnung mit dem Heiligen nicht nur in der Stille ihres Herzens, sondern in erster Linie in einer heiligen Gemeinschaft. Die vormoderne Religion existierte nicht als abgegrenzte Institution; sie war eingebettet in die politischen, sozialen und häuslichen Einrichtungen einer Gesellschaft, die sie mit einem alles überwölbenden Sinn versorgte. Ihre Ziele, Sprache und Rituale wurden von diesen weltlichen Überlegungen bestimmt. Indem sie das Muster für die Gesellschaft bereitstellte, war die religiöse Praxis Mesopotamiens wohl das genaue Gegenteil unserer modernen Vorstellung von »Religion« als privatem spirituellem Erlebnis: Sie war ihrem Wesen nach eine politische Beschäftigung, und es gibt auch keine Überlieferungen irgendeiner persönlichen Frömmigkeitspraxis.[75] Die Tempel der Götter waren nicht nur Orte der Verehrung, sondern von größter Bedeutung für die Wirtschaft, weil dort alle Überschüsse aus der Landwirtschaft gelagert wurden. Die Sumerer hatten kein Wort für »Priester«: die Aristokraten, die auch die Verwaltungsbeamten, Dichter und Astronomen der Stadt stellten, dienten dem Kult. Das entsprach ihrem Selbstverständnis, denn für sie war jegliches Tun – auch und gerade politisches Tun – heilig.
Dieses ausgefeilte System war nicht nur einfach eine heuchlerische Rechtfertigung für die strukturelle staatliche Gewalt, sondern in erster Linie ein Versuch, diesem kühnen, höchst problematischen menschlichen Experiment einen Sinn zu geben. Die Stadt war das größte Artefakt der Menschheit: künstlich, verletzlich und abhängig von institutionalisierter gemeinsamer Anstrengung. Zivilisation fordert Opfer, und die Sumerer mussten sich selbst davon überzeugen, dass der Preis, den sie von den Bauern verlangten, notwendig und letztlich die Sache wert war. Indem sie für sich in Anspruch nahmen, dass ihr System der Ungleichheit mit den grundlegenden Gesetzen des Kosmos im Einklang stand, fanden die Sumerer den mythischen Ausdruck für eine unwiderrufliche politische Realität.
Und dahinter schien ein eisernes Gesetz zu stehen, für das es keine Alternative gab. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts u.Z. etablierten sich im Nahen Osten, in Süd- und Ostasien, Nordafrika und Europa Agrargesellschaften, und in jeder einzelnen – sei es in Indien, Russland, der Türkei, der Mongolei, dem Vorderen Orient, in China, Griechenland oder Skandinavien – beutete die Aristokratie die Bauern aus, genauso wie es die Sumerer getan hatten. Ohne diese aristokratische Gewalt hätte man die Bauern niemals dazu zwingen können, einen Überschuss zu erwirtschaften, weil das Bevölkerungswachstum immer mit dem Zuwachs an Produktivität Schritt gehalten hätte. So schrecklich es klingen mag: Indem die Massen dazu gezwungen wurden, auf Subsistenzebene zu leben, hielt die Aristokratie das Bevölkerungswachstum in Schach und machte den Fortschritt der Menschheit erst möglich. Hätte man den Bauern ihre Überschüsse nicht genommen, dann hätte es keine wirtschaftlichen Ressourcen gegeben, um die Techniker, Wissenschaftler, Erfinder, Künstler und Philosophen zu unterstützen, die unsere moderne Zivilisation irgendwann ins Leben riefen.[76] Bereits der amerikanische Trappistenmönch Thomas Merton sagte: Wir alle haben von der strukturellen Gewalt profitiert, die vor mehr als fünftausend Jahren großes Leid über die Mehrheit der Menschen brachte.[77] Und der Philosoph Walter Benjamin stellte fest: »Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.«[78]
Die Herrscher der Agrargesellschaft betrachteten den Staat als ihr Privateigentum und fühlten sich berechtigt, ihn zu ihrer persönlichen Bereicherung auszubeuten. Es gibt keinerlei historische Aufzeichnungen, die darauf hindeuten, dass diese Herrscher irgendeine Verantwortung für ihre Bauern empfanden.[79] Oder wie die Menschen im Gilgamesch-Epos klagten: »Die Stadt ist in seinem Besitz … Er ist der König, er tut, was er will.« Allerdings unterstützte die sumerische Religion diese Ungleichheit nicht ohne Einschränkung. Als die Götter die Klagen hörten, riefen sie Anu zu: »Gilgamesch, so edel und großartig er ist, hat alle Grenzen überschritten. Die Menschen leiden unter seiner Tyrannei … Willst du, dass dein König so regiert? Soll der Hirte seine eigene Herde zerfleischen?«[80] Anu schüttelte den Kopf, konnte das System aber nicht ändern.
Das Erzählgedicht Atrahasis (um 1700 v.u.Z.) ist in der mythischen Periode angesiedelt, in der die Götter noch in Mesopotamien lebten und »an Stelle der Menschen die Arbeit taten«, auf der die Zivilisation beruhte.[81] Der Dichter erklärt, dass die Anunnaki, die Angehörigen der göttlichen Aristokratie, die Igigi, also die niedrigeren Götter, dazu zwangen, eine viel zu große Last zu tragen: Dreitausend Jahre lang pflügten und bebauten sie die Felder und gruben Bewässerungskanäle – sie mussten sogar die Flussbetten von Euphrat und Tigris ausheben. »Tag und Nacht stöhnten sie und beschuldigten sich gegenseitig«, aber die Anunnaki kümmerten sich nicht darum.[82] Schließlich versammelte sich eine zornige Menge vor Enlils Palast: »Jeder Einzelne von uns Göttern hat euch den Krieg erklärt. Wir graben nicht mehr!«, riefen sie. »Die Last ist zu groß, sie bringt uns um!«[83] Enki, der »Landwirtschaftsminister«, stimmte ihnen zu. Das System war grausam und unerträglich, und die Anunnaki hatten kein Recht, die Plage der Igigi zu missachten. »Ihre Arbeit war zu schwer, ihre Mühe zu groß! Jeden Tag hallte die Erde davon wider. Die Warnsignale waren laut genug!«[84] Aber wenn niemand mehr produktiv arbeitete, würde die Zivilisation zusammenbrechen, also befahl Enki der Muttergöttin, Menschen zu erschaffen, die den Platz der Igigi einnehmen sollten.[85] Auch für die Mühen ihrer menschlichen Arbeiter empfanden die Götter keine Verantwortung. Die schuftenden Massen durften ihre privilegierte Existenz nicht stören, und als die Menschen so zahlreich wurden, dass ihr Lärm die göttlichen Herren nicht schlafen ließ, beschlossen die Götter ganz einfach, die Bevölkerung durch eine Seuche zu dezimieren. Drastisch beschreibt der Dichter ihr Leiden:
Ihre Gesichter mit Geschwüren bedeckt, wie Malz,
bleich sahen sie aus,
gingen gebeugt umher,
ihre breiten Schultern zusammengefallen,
ihre aufrechte Haltung zerbrochen.[86]
Aber auch diesmal entging die Grausamkeit der Aristokratie nicht der Kritik: Enki, den der Dichter als »weitsichtig« bezeichnet, setzte seinen Göttergefährten tapferen Widerstand entgegen und erinnerte sie daran, dass ihr Leben von den menschlichen Sklaven abhing.[87] Widerwillig erklärten sich die Anunnaki bereit, sie zu schonen, und zogen sich in die friedliche Stille des Himmels zurück. Dies war der mythische Ausdruck für eine harte soziale Realität: Die Kluft zwischen Adel und Bauern war so groß geworden, dass sie wirklich in unterschiedlichen Welten lebten.
Das Atrahasis war wohl für den öffentlichen Vortrag gedacht, und die Geschichte scheint auch mündlich überliefert worden zu sein.[88] Bruchstücke des Textes aus tausend Jahren sind gefunden worden, die Erzählung scheint also auch weit verbreitet gewesen zu sein.[89] Die Schrift, ursprünglich erfunden, um der strukturellen Gewalt der Sumerer zu dienen, hatte angefangen, auch die Unruhe der nachdenklicheren Mitglieder der herrschenden Klasse aufzuzeichnen. Die konnten zwar auch keine Lösung für das Dilemma der Zivilisation finden, versuchten aber wenigstens, das Problem direkt zu betrachten. Wir werden noch sehen, dass auch andere – Propheten, Weise und Mystiker – ihre Stimme zum Protest erhoben und versuchten, eine gerechtere Form des menschlichen Zusammenlebens zu finden.
Das Gilgamesch-Epos spielt in der Mitte des 3. Jahrtausends, als Sumer militarisiert worden war, und deshalb begreift es kriegerische Gewalt als Zeichen der Zivilisation.[90] Als die Menschen die Götter um Hilfe anflehten, versuchte Anu, ihr Leiden zu lindern, indem er Gilgamesch einen ebenbürtigen Gegner zuführte, mit dem er kämpfen sollte, um so einen Teil seiner überschüssigen Aggressivität abzubauen. Die Muttergöttin erschuf Enkidu, den Urmenschen. Er war riesengroß, behaart und sehr stark, aber er war auch eine sanfte, freundliche Seele, die glücklich mit den pflanzenfressenden Tieren umherwanderte und sie vor Raubtieren schützte. Um jedoch Anus Plan zu erfüllen, musste sich Enkidu vom friedlichen Barbaren in einen aggressiven Zivilisationsmenschen verwandeln. Die Priesterin Shamhat übernahm die Aufgabe, ihn zu unterrichten, und unter ihrer Obhut lernte Enkidu zu denken, Sprache zu verstehen und menschliche Nahrung zu sich zu nehmen. Seine Haare wurden geschnitten, er wurde mit süßem Öl eingerieben, und schließlich »verwandelte er sich in einen Menschen. Er zog Kleidung an und wurde wie ein Krieger.«[91] Der zivilisierte Mann war seinem Wesen nach ein Mann des Krieges, randvoll mit Testosteron. Als Shamhat Gilgameschs militärisches Können erwähnte, wurde Enkidu bleich vor Zorn. »Bringt mich zu Gilgamesch!«, rief er und schlug sich an die Brust. »Ich will es ihm ins Gesicht schreien: Ich bin der Mächtigste! Ich bringe die Welt zum Zittern! Ich bin der Höchste!«[92] Und sobald diese beiden Alpha-Männchen sich zu Gesicht bekamen, begannen sie einen Ringkampf, taumelten durch die Straßen von Uruk, die wirbelnden Gliedmaßen in einer fast erotischen Umarmung verschlungen, bis sie schließlich genug davon hatten, »sich küssten und Freunde wurden«.[93]
Inzwischen hatte die mesopotamische Aristokratie begonnen, ihr Einkommen durch Kriege aufzubessern, und so kündigt Gilgamesch dann auch schon im nächsten Kapitel an, er werde eine Gruppe von fünfzig Männern in den Zedernwald begleiten, den der grausige Drache Humbaba bewacht, um sein kostbares Holz nach Sumer zu bringen. Vermutlich kamen die mesopotamischen Städte durch solche räuberischen Kriegszüge zur Herrschaft über das nördliche Hochland, das reich an Luxusgütern war, wie sie die Adligen liebten.[94] Schon seit längerer Zeit waren ihre Kaufleute nach Afghanistan, ins Industal und in die heutige Türkei ausgezogen, um Holz, seltene und wichtige Metalle sowie Edelsteine und Halbedelsteine mitzubringen.[95] Für einen Aristokraten wie Gilgamesch jedoch war die einzig edle Art, an diese seltenen Rohstoffe heranzukommen, der gewaltsame Raub. In sämtlichen späteren Agrarstaaten unterschied sich die Aristokratie vom Rest der Bevölkerung dadurch, dass sie überleben konnte, ohne zu arbeiten.[96] Der Kulturhistoriker Thorstein Veblen hat erklärt, dass in solchen Gesellschaften »Arbeit … mit Schwäche und Unterwerfung gleichgesetzt wurde«. Arbeit, selbst der Handel, war nicht nur »anrüchig … sondern moralisch unmöglich für einen edlen, freigeborenen Mann«.[97] Und weil der Aristokrat seine Privilegien der gewaltsamen Ausbeutung des landwirtschaftlichen Überschusses verdankte, »wurde das Aneignen von Gütern, sofern es nicht durch Raub erfolgte, als unehrenhaft betrachtet.«[98]
So war für Gilgamesch der organisierte Diebstahl im Zuge eines Krieges nicht nur edel, sondern moralisch. Er unternahm seine Kriegszüge nicht nur um seiner persönlichen Bereicherung willen, sondern im Interesse der Menschheit. »Wir müssen jetzt in den Zedernwald ziehen, wo das wilde Ungeheuer Humbaba lebt«, verkündete er wichtigtuerisch. »Wir müssen ihn töten und das Böse aus der Welt vertreiben.«[99] Für den Krieger ist der Gegner immer ein Ungeheuer, eine Antithese zu allem Guten. Aber wir sehen deutlich, dass der Dichter diesem Kriegszug jede religiöse oder ethische Rechtfertigung versagt. Die Götter waren dagegen. Enlil hatte Humbaba ausdrücklich dazu bestimmt, den Wald gegen derartige Raubzüge zu verteidigen. Gilgameschs Mutter, die Göttin Ninsun, war entsetzt über den Plan und machte zuerst Shamash, dem Sonnengott und Gilgameschs Herrn, Vorwürfe, weil er ihrem Sohn diese widerwärtige Idee in den Kopf gesetzt hatte. Als er jedoch befragt wurde, schien Shamash nichts davon zu wissen.