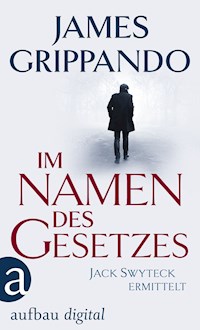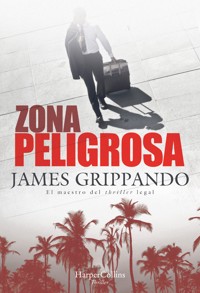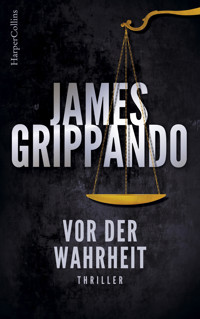9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Anwalt Jack Swyteck ermittelt
- Sprache: Deutsch
Anwalt Jack Swyteck steht vor dem heikelsten Fall seiner Karriere. Er soll nicht nur eine Frau vertreten, die angeblich ihren Mann, einen ranghohen Militäroffizier auf Guantánamo, erschossen hat. Die Frau behauptet außerdem, Jack Swyteck sei der leibliche Vater ihres zehnjährigen Adoptivsohnes. Jack entschließt sich nach langem Ringen dazu, Lindsey zu verteidigen, bereut diese Entscheidung aber schon bald, als er seine Mandantin einer Reihe von Lügen überführt …
Der vierte Fall für Jack Swyteck! Spannend, rasant und äußerst raffiniert.
Der Thriller ist vormals unter dem Titel "Preis der Lüge" erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Anwalt Jack Swyteck steht vor dem heikelsten Fall seiner Karriere. Er soll nicht nur eine Frau vertreten, die angeblich ihren Mann, einen ranghohen Militäroffizier auf Guantánamo, erschossen hat. Die Frau behauptet außerdem, Jack Swyteck sei der leibliche Vater ihres zehnjährigen Adoptivsohnes. Jack entschließt sich nach langem Ringen dazu, Lindsey zu verteidigen, bereut diese Entscheidung aber schon bald, als er seine Mandantin einer Reihe von Lügen überführt …
Der vierte Fall für Jack Swyteck! Spannend, rasant und äußerst raffiniert.
Der Thriller ist vormals unter dem Titel »Preis der Lüge« erschienen.
Über James Grippando
James Grippando ist Autor diverser New York Times-Bestseller. Er arbeitete zwölf Jahre als Strafverteidiger bevor sein erstes Buch »Im Namen des Gesetzes« 1994 veröffentlicht wurde und ist weiterhin als Berater für eine Kanzlei tätig. Er lebt mit seiner Familie im Süden Floridas.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
James Grippando
Preis der Lüge
Roman
Aus dem Englischen von Norbert Möllemann
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Epilog
Danksagungen
Impressum
Für Tiffany – zum zehnten Jahrestag!
1
»Mein Mann wurde ermordet.«
Lindsey Hart sprach mit der teilnahmslosen Stimme einer trauernden jungen Witwe. Es war, als könnte sie noch gar nicht glauben, dass die Worte aus ihrem Mund kamen, dass etwas so Schreckliches tatsächlich geschehen war. »Mit einer Kugel in den Kopf.«
»Das tut mir sehr Leid.« Jack hätte am liebsten noch mehr gesagt, aber er war schon einmal in einer solchen Situation gewesen und wusste, dass es einfach nicht mehr zu sagen gab. Gott hat es so gewollt? Die Zeit heilt alle Wunden? Nichts dergleichen würde ihr etwas nützen, schon gar nicht aus seinem Mund. Zwar kam es vor, dass Menschen sich an einen Fremden wandten, um Trost zu finden, aber wohl kaum, wenn der Fremde ein Strafverteidiger war, der nach Stunden abrechnete.
Jack Swyteck gehörte zu den besten Strafverteidigern, die die Anwaltschaft von Miami zu bieten hatte; er hatte nach dem Studium vier Jahre lang Berufungsprozesse für zum Tode verurteilte Gefängnisinsassen geführt und danach die Seiten gewechselt, um für die Bundesbehörden als Ankläger zu arbeiten. Mittlerweile betrieb er im dritten Jahr seine eigene Kanzlei und hatte sich bereits einen Namen gemacht. Dabei hatte er es bisher noch nicht zu einem wirklich hochkarätigen Prozess vor einem Geschworenengericht gebracht, womit zahlreiche weniger talentierte Anwälte zu Ruhm gekommen waren. Aber für einen Mann, der eine Mordanklage, die Scheidung von einer Exzentrikerin und den ungeklärten Tod seiner Exfreundin überstanden hatte, die nackt in seiner Badewanne aufgefunden worden war, hielt er sich ganz gut.
»Kennt die Polizei den Täter?«, fragte Jack.
»Sie glaubt ihn zu kennen.«
»Und wer ist es demnach?«
»Ich.«
Die logische nächste Frage blieb Jack im Halse stecken, und bevor er dazu kam, das Thema anzusprechen, sagte Lindsey: »Ich war’s nicht.«
»Gibt es Zeugen, die behaupten, Sie wären es gewesen?«
»Nicht, dass ich wüsste. Ich würde auch nichts anderes erwarten, da ich ja unschuldig bin.«
»Wurde die Tatwaffe sichergestellt?«
»Ja. Sie lag auf dem Schlafzimmerboden. Oscar wurde mit seiner eigenen Pistole erschossen.«
»Wo ist es passiert?«
»In unserem Schlafzimmer. Während er schlief.«
»Waren Sie zu Hause?«
»Nein.«
»Woher wissen Sie dann, dass er geschlafen hat?«
Sie zögerte, als hätte sie diese Frage nicht erwartet. »Die Ermittler haben mir gesagt, dass er in seinem Bett lag und es keinerlei Hinweise auf einen Kampf gab, woraus ich geschlossen habe, dass er entweder überrascht wurde oder schlief.«
Jack ließ eine Weile verstreichen, weniger um seine Gedanken zu ordnen, als um einen Eindruck von Lindsey Hart zu gewinnen. Ein paar Jahre jünger als er selbst, wie er vermutete, redegewandt und gefasst. Ihr anthrazitgraues Kostüm stellte eine vorsichtige Abweichung vom traditionellen Trauerschwarz dar, auch wenn sie sich bei der seidenen Bluse und dem seidenen Halstuch etwas Farbe erlaubt hatte. Sie war hübsch – wahrscheinlich erheblich attraktiver, als sie sich gegenwärtig präsentierte, denn Jack vermutete, dass sie in ihrem Kummer ein bisschen zu viel Gewicht verloren hatte und weniger als gewöhnlich auf ihr Äußeres achtete.
Er sagte: »Ich weiß, dass die Vorstellung schmerzhaft für Sie wäre. Aber hat irgendjemand in Erwägung gezogen, dass Ihr Mann sich die tödliche Verletzung selbst beigebracht haben könnte?«
»Oscar hat sich nicht selbst umgebracht. Er hing viel zu sehr am Leben.«
»Das tun die meisten Menschen, die sich das Leben nehmen. Sie verlieren einfach die Perspektive.«
»Seine Waffe war gesichert, als man sie fand. Ziemlich unwahrscheinlich, dass er sich zuerst in den Kopf geschossen und anschließend noch die Pistole gesichert haben soll.«
»Das ist allerdings ein Argument. Obwohl es mir merkwürdig vorkommt, dass jemand Ihren Mann erschießt und sich dann noch die Zeit nimmt, die Waffe wieder zu sichern.«
»Im Zusammenhang mit dem Tod meines Mannes gibt es eine Menge Merkwürdigkeiten. Deswegen brauche ich Sie.«
»Also gut. Lassen Sie uns damit anfangen, was Sie am Tag seines Todes gemacht haben. Wann haben Sie das Haus verlassen?«
»Um halb sechs. Wie jeden Tag. Ich arbeite im Krankenhaus. Meine Schicht beginnt um sechs.«
»Da ist es wahrscheinlich schwer, überzeugend nachzuweisen, dass er noch gelebt hat, als Sie das Haus verlassen haben.«
»Der Gerichtsmediziner hat den Todeszeitpunkt auf irgendwann vor fünf Uhr angesetzt.«
»Haben Sie den Autopsiebericht gelesen?«
»Ja, vor kurzem.«
»Wie lange ist es her, dass Ihr Mann getötet wurde?«
»Gestern waren es zehn Wochen.«
»Haben Sie mit der Polizei gesprochen?«
»Selbstverständlich. Ich wollte mein Möglichstes dazu beitragen, dass der Mörder gefasst wird. Bis mir dämmerte, dass ich zu den Verdächtigen zähle. Da habe ich beschlossen, mir einen Anwalt zu nehmen.«
Jack kratzte sich am Kopf. »Von all dem ist noch nichts zu mir durchgedrungen, und normalerweise bin ich ziemlich gut informiert, was Mordfälle betrifft. Mit wem haben Sie denn gesprochen, mit der Miami City Police oder der Mordkommission von Miami-Dade?«
»Weder noch. Es waren NCIS-Agenten. Naval Criminal Investigative Services. Ermittler der Marine. Das Ganze ist auf der Navy-Basis geschehen.«
»Welcher?«
»Guantánamo.«
»Guantánamo, Kuba?«
»Ja. Mein Mann war Berufsoffizier. Wir haben dort fast sechs Jahre gelebt. Bis zu seinem Tod.«
»Ich wusste nicht einmal, dass dort überhaupt Familienangehörige wohnen. Ich dachte immer, da gibt es nur Soldaten, die ein wachsames Auge auf Castro werfen.«
»O nein. Dort leben und arbeiten mehrere tausend Menschen. Wir haben eigene Schulen und eine eigene Zeitung. Es gibt sogar eine McDonald’s-Filiale.«
Jack dachte über ihre Worte nach. »Ich sage es Ihnen ganz offen: Ich habe absolut keine Erfahrung mit Militärangelegenheiten.«
»Das ist keine reine Militärangelegenheit. Ich bin eine Zivilperson, also muss ich als Zivilistin angeklagt werden, auch wenn mein Mann Offizier war.«
»Verstehe. Aber der Tatort befindet sich auf einer Militärbasis und Sie haben bereits mit den ermittelnden NCIS-Agenten gesprochen. Wer auch immer Sie vertritt, sollte wissen, wie man sich durch das Militärdickicht arbeitet.«
»Das werden Sie schon herausfinden.« Sie nahm einen Ordner aus ihrer Handtasche und legte ihn auf Jacks Schreibtisch. »Das ist der NCIS-Bericht. Ich habe ihn erst vor zwei Tagen erhalten. Werfen Sie einen Blick hinein. Ich nehme an, Sie werden mit mir einer Meinung sein, dass die Sache zum Himmel stinkt.«
Jack ließ den Ordner unberührt vor sich liegen. »Ich will mir nicht die Arbeit vom Hals halten, aber ich kenne in der Stadt mehrere Strafverteidiger, die früher beim Militär waren.«
»Ich will keinen anderen. Ich will den Anwalt haben, der sich mehr als jeder andere dafür einsetzen wird, meine Unschuld zu beweisen. Und dieser Anwalt sind Sie.«
»Danke. Freut mich zu hören, dass mir mein Ruf bis nach Kuba vorauseilt.«
»Es hat nichts mit Ihrem Ruf zu tun, sondern schlichtweg damit, wer Sie sind.«
»Klingt wie ein Kompliment, aber ich fürchte, dass ich die Bedeutung dessen, was Sie mir sagen wollen, nicht wirklich verstehe.«
»Mr Swyteck, jede Minute, die die Ermittler damit verbringen, sich auf mich als mutmaßliche Täterin zu konzentrieren, ist verlorene Zeit. Wenn sie nicht bald jemand auf eine andere Spur bringt, wird der Mörder meines Mannes ungestraft davonkommen. Das wäre eine schreckliche Tragödie.«
»Da kann ich Ihnen gar nicht genug zustimmen.«
»Doch, das können Sie. Glauben Sie mir. Hier geht es nicht einfach darum, dass die Polizei mal wieder den Falschen verdächtigt. Wenn derjenige, der meinen Mann getötet hat, nicht gefasst würde, wäre das eine Tragödie – für Sie.«
»Kenne ich Ihren Mann?«
»Nein. Aber deswegen ist es nicht weniger persönlich. Mein Mann …« Sie holte tief Luft, aber ihre Stimme klang auch beim zweiten Anlauf noch belegt. »Mein Mann war der Vater Ihres Kindes.«
Jack war wie gelähmt vor Verwirrung. »Sagen Sie das noch mal.«
»Ich glaube, Sie haben mich verstanden.«
Jack ließ sich alle Möglichkeiten durch den Kopf gehen, und ihm wurde schnell klar, dass es nur eine Erklärung gab. »Haben Sie Ihren Sohn adoptiert?«
Sie nickte ernst.
»Und Sie behaupten, dass ich der leibliche Vater Ihres Kindes bin?«
»Die Mutter war eine Frau namens Jessie Merrill.«
Jessie, die Frau, mit der er zusammen war, als er sich Hals über Kopf in die Frau verliebt hatte, die er schließlich geheiratet hatte – und von der er später geschieden wurde. Erst nach fünf Jahren Ehe mit Cindy Paige hatte Jack erfahren, dass Jessie, als er sich von ihr getrennt hatte, schwanger gewesen war und das Kind zur Adoption freigegeben hatte.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich leugne nicht, dass Jessie ein Kind hatte und behauptet hat, ich wäre der Vater. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das Recht hatte, in die Adoptionsfamilie einzudringen.«
»Das war sehr rücksichtsvoll«, erwiderte Lindsey immer noch mit belegter Stimme. »Aber meinem Mann und mir war klar, dass unser Sohn vielleicht irgendwann Kontakt zu seinen leiblichen Eltern suchen würde. Vor einigen Jahren haben wir die notwendigen Nachforschungen angestellt.«
»Und Sie sind sich Ihrer Sache völlig sicher.«
»Ich könnte Ihnen den ganzen Papierwust zeigen, aber ich denke nicht, dass das notwendig ist.« Sie griff erneut in ihre Handtasche und zog ein Foto heraus.
»Das ist Brian«, sagte sie.
Ein Augenblick verstrich, während das Foto vor ihm zu schweben schien. Schließlich langte er über den Schreibtisch und fasste es an einer Ecke an, als könnte er sich an der Vergangenheit verbrennen, wenn er zu viel davon berührte. Er ließ seinen Blick auf dem lächelnden Gesicht eines zehnjährigen Jungen ruhen. Er hatte ihn nie zuvor gesehen, aber diese dunklen Augen und die Adlernase kamen ihm bekannt vor.
»Ich bin sein Vater«, sagte er mit einer Stimme wie aus der Ferne, als kämen ihm die Worte unfreiwillig über die Lippen.
»Nein«, erwiderte sie sanft, aber bestimmt. »Sein Vater ist tot. Und wenn Sie mir nicht helfen, seinen Mörder zu finden, besteht die Gefahr, dass seine Mutter für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis wandert.«
Sie sah ihm in die Augen, und Jack suchte nach Worten, die einer Situation entsprachen, auf die sich kein Strafverteidiger der Welt innerlich vorbereiten konnte. »Ich glaube, Sie haben Recht«, sagte er ruhig. »Das ist sehr persönlich.«
2
Jack hielt sich nicht gerade für einen Trinker, aber nach dem aufwühlenden Treffen mit der Adoptivmutter seines Sprösslings – »Sohn« kam ihm zumindest im Moment noch wie eine zu vertrauliche Bezeichnung vor – brauchte er dringend einen Drink. Sein Freund Theo Knight betrieb eine Kneipe namens Sparky’s in der Nähe der Florida Keys, eigentlich zu weit abgelegen für ein Gläschen Trost, aber allein wegen Theo lohnte sich die Fahrt.
»Bourbon«, bestellte Jack beim Barkeeper. Keinen erstklassigen Markenwhiskey zu bestellen war gewagt, aber schon das Betreten einer Kneipe wie das Sparky’s war gefährlich, was bedeutete da ein Risiko mehr?
Das Sparky’s war eine umgebaute Tankstelle, wobei »umgebaut« leicht übertrieben war. Wenn man sich umsah, hätte man schwören können, dass die Jungs von der Tankstelle nur Pause machten und in ihren schmierigen Overalls an der Theke hockten und sich fragten, wo diese fürchterliche Band und die besoffenen Motorradfahrer plötzlich hergekommen waren. Die Kneipe war eine Goldgrube und häufig brechend voll, vor allem, wenn Theo höchstpersönlich bis zum frühen Morgen in sein Saxophon blies. Natürlich hätte sich Theo ein paar Schönheitsreparaturen leisten können, aber offenbar gefiel ihm der Laden so, wie er war. Jack war klar, dass das mit Theos Egotrip zu tun hatte, dass sein alter Kumpel sich jedes Mal ins Fäustchen lachte, wenn sich mal wieder so ein Yuppie mit seiner in Gucci-Klamotten gehüllten Freundin in seinen Schuppen verirrte, in den er normalerweise keinen Fuß setzen würde, nur um sich anzuhören, wie Theo und seine Band in feinster Harlem-Manier drauflosimprovisierten.
Es war noch früh am Abend und die Band hatte ihre Instrumente noch nicht aufgebaut. Theo war allein auf der Bühne. Es kam nicht oft vor, dass er sang oder Klavier spielte, außer wenn seine engsten Freunde da waren. Vom Tresen aus, wo er an einem Bourbon nippte, der ihm die Kehle verbrannte, hörte Jack zu, wie Theo sich die Seele aus dem Leib sang und bekannten Stücken seine eigenen satirischen Texte verpasste. Diesmal hatte er sich »I Can’t Make You Love Me« vorgenommen, Bonnie Raitts Rhythm&Blues-Megahit aus dem Jahre 1991, einen ziemlich deprimierenden Song über eine Frau, die mit ihrem kaltherzigen Liebsten ein letztes Mal ins Bett geht, bevor er sie sitzen lässt. Theo hatte daraus ein Selbstmordlied mit dem schlichten Titel »The Suicide Song« gemacht.
Hab mir die Handgelenke aufgeschlitzt.
Spring aus dem Fenster.
Schieß mir eine Kugel
ins Hirn.
Denn du kannst mich nicht zwingen zu leben,
wenn ich es nicht will …
Das Publikum tobte. Theo enttäuschte die Leute nie. Zumindest nicht, wenn sie betrunken waren.
»Hey, Jacko!« Theo hatte ihn entdeckt und teilte seine Anwesenheit allen Gästen mit, ob es Jack gefiel oder nicht. Theo verließ die kleine Bühne und gesellte sich zu seinem Freund an den Tresen.
»Eine lustige Vorstellung.«
»Findest du Selbstmord lustig?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Falsche Antwort. Alles ist lustig. Solange du das nicht begriffen hast, muss ich dir leider für dieses Gesöff das Doppelte abknöpfen.«
Theo gab dem Barkeeper ein Zeichen, der sofort zwei Drinks brachte. Einen weiteren Bourbon für Jack und ein Mineralwasser für Theo. »Ich muss heute Abend noch spielen«, erklärte Theo, wie um sich für das Wasser zu entschuldigen.
»Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin.«
»Du Heuchler. Glaubst du etwa, ich würde dich nach zehn Jahren immer noch nicht kennen? Jack Swyteck trinkt keinen Rachenputzer, es sei denn, man hat ihn sitzen gelassen oder angeklagt, oder beides zusammen.«
Jack grinste, obwohl es ihn irritierte, dass er so leicht zu durchschauen war.
Theo schaute plötzlich an ihm vorbei und Jack folgte seinem Blick auf die Bühne, wo der Bassist seine Anlage für den Auftritt aufbaute.
Die Leute begannen, näher an die Bühne heranzurücken und sich die besten Plätze zu sichern, und Jack wusste, dass er nicht mehr lange mit der Aufmerksamkeit seines Freundes würde rechnen können. Es war immer dasselbe.
»Und, was ist diesmal passiert?«, fragte Theo.
»Ich sage nur zwei Worte: Jessie Merrill.«
»Wow. Merkwürdig, diesen Namen zu hören, nachdem ich gerade den ›Suicide Song‹ gesungen habe.«
»Sie ist wieder da.«
»Von den Toten auferstanden?«
»Ich meine das nicht wörtlich, du Pfeife.«
Jack klärte ihn in knappen Zügen über Lindsey Hart auf. Theo war zwar kein Jurist, aber wenn Jack sich dazu entschied, Lindseys Fall zu übernehmen, würde Theo garantiert eine Ermittlerrolle übernehmen; er verstieß also nicht gegen die anwaltliche Schweigepflicht, wenn er ihn einweihte. Außerdem musste Jack sich mit irgendjemandem aussprechen, und Theo war einer der wenigen Leute, die die ganze Geschichte mit Jessie Merrill kannten. Zudem war er Jacks einziger Mandant gewesen, der wegen eines Mordes, den er nicht begangen hatte, in der Todeszelle gesessen hatte.
Als Jack geendet hatte, schüttelte Theo grinsend den Kopf. »Für einen Typen, der nur bei jeder zweiten Sonnenfinsternis eine Frau im Bett hat, hast du ein ausgesprochenes Händchen dafür, aus jeder Beziehung das Maximum an Chaos rauszuholen.«
»Vielen Dank auch. Und zur Erinnerung, es passiert nur bei jeder zweiten partiellen Sonnenfinsternis.«
»Du alter Lüstling.« Theo griff sich eine Hand voll Erdnüsse, die er sich einverleibte, während er weiterredete. »Sitzt diese Lindsey tief in der Tinte?«
»Weiß ich noch nicht. Bevor ich herkam, hab ich versucht, den Ermittlungsbericht zu lesen, aber ich hatte den Kopf zu voll.«
»Diese Geschichte mit Jack junior hat dich wohl ziemlich umgehauen, was?«
»Ziemlich? Ich weiß ja schon seit ein paar Jahren von der Adoption. Seit Jessies Tod. Aber ich glaube, ich hab’s erst richtig begriffen, als Lindsey mir das Foto gezeigt hat. Ich habe tatsächlich irgendwo da draußen einen Sohn.«
»Nein, es ist ihr Sohn. Du hattest bloß Sex mit deiner Freundin.«
»So einfach ist das nicht, Theo. Er sieht genauso aus wie ich.«
»Wirklich? Oder siehst du das nur so, weil seine Mutter es sagt und weil du dir aus irgendeinem bescheuerten darwinistischen Grund wünschst, dass es wahr ist?«
»Glaub mir. Die Ähnlichkeit ist frappierend.«
»Hätte ja auch schlimmer kommen können. Wenn er zum Beispiel einem deiner Freunde ähnlich sähe.«
»Kannst du zur Abwechslung mal ernst bleiben?«
»Nein, aber ich kann so tun, als ob.« Theo nippte an seinem Wasser. »Und wie sieht’s aus, wirst du sie verteidigen?«
»Ich weiß noch nicht.«
»Was sagt dir dein Gefühl? Ist sie unschuldig?«
»Welche Rolle würde das spielen? Ich habe eine Menge Mandanten vertreten, die schuldig waren. Selbst dich habe ich für schuldig gehalten, als ich deinen Fall in die Berufung gebracht habe.«
»Aber ich war nicht schuldig.«
»Und selbst wenn du’s gewesen wärst, hätte ich mich genauso für dich ins Zeug gelegt.«
»Vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Fall sich etwas anders darstellt.«
»Du siehst das Dilemma also auch?«
»Ja, außer dass man es da, wo ich herkomme, nicht Dilemma nennt. Bei uns sagt man, du hast dir den Schwanz im Reißverschluss eingeklemmt.«
»Autsch. Aber irgendwie zutreffend.«
»Natürlich trifft es zu. Also gut, deine Mandantin wird beschuldigt, ihren Mann getötet zu haben, und du erklärst dich bereit, sie zu verteidigen. Angenommen, sie ist schuldig, aber es gelingt dir, deinen ganzen Charme spielen zu lassen und die Jury davon zu überzeugen, dass sie es nicht ist. Dann wird sie freigesprochen. Und was hast du davon?«
»Das spielt keine Rolle. Was hat ihr Sohn davon?«
»Dass er mit einer Mörderin leben muss, das hat er davon.«
Jack starrte in sein Whiskeyglas und sagte: »Also nichts, was ein Strafverteidiger mit einem Rest von Ehrgefühl im Leib seinem eigenen Fleisch und Blut antun sollte.«
»Andererseits, wenn du diesen Fall ablehnst … Angenommen, sie ist unschuldig, aber irgendein unfähiger Anwalt vermasselt es – so wie mein Pflichtverteidiger damals –, und sie wird verurteilt. Dann würde der Kleine außer seinem Vater auch noch seine Mutter verlieren, oder zumindest die einzige Mutter und den einzigen Vater, die er jemals hatte. Könntest du damit leben?«
»Ich würde sagen, du hast beide Seiten des Dilemmas voll erfasst.«
»Scheiß auf dein Dilemma. Das sind tausend winzige Metallzähne, die sich in deinen –«
»Ich hab’s kapiert, Theo. Was meinst du also, was ich tun sollte?«
»Ganz einfach. Übernimm den Fall. Und falls du irgendwann feststellst, dass sie schuldig ist, legst du dein Mandat nieder.«
»Das ist riskant. Wenn ein Mordprozess erst in Gang gekommen ist, kann man sein Mandat nicht mehr einfach so niederlegen. Dass man den Angeklagten plötzlich für schuldig hält, wird der Richter nicht als ausreichende Begründung akzeptieren. Wenn das zulässig wäre, würden jeden Tag Anwälte mitten in einem Prozess abspringen.«
»Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dich davon zu überzeugen, dass deine Klientin unschuldig ist, bevor du den Fall übernimmst. Du kannst sie ja fragen, ob sie bereit ist, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen.«
»An diese Tests glaube ich nicht, schon gar nicht bei jemandem, der emotional so fertig ist. Da könnte ich genauso gut eine Münze werfen.«
»Was willst du mir jetzt eigentlich sagen?«
»So wie ich die Sache sehe, könnte die Staatsanwaltschaft schon morgen Anklage erheben. Ich brauche eine schnelle Antwort und wie üblich gibt es mal wieder keine.«
Theo nahm seinem Freund das Glas aus der Hand, stellte es auf den Tresen und schob es weg. »Dann setz deinen Arsch in Bewegung, fahr nach Hause und lies diesen Ermittlungsbericht. Lies ihn so, wie du ihn lesen würdest, wenn dieser Junge irgendein ganz normaler Junge wäre.«
Theos Ton war ernst und er lächelte nicht, aber Jack wusste, dass die Worte von einem Freund kamen. Er stand auf und legte einen Fünfer für die beiden Drinks auf den Tresen.
»Hey«, sagte Theo. »Das war kein Witz.«
»Ich weiß.«
»Ich rede von der Rechnung, du Genie. Bis du diese Art Humor begreifst, zahlst du hier das Doppelte, erinnerst du dich?«
Jack griff ins Portemonnaie und warf einen zweiten Schein auf den Tresen. »Danke für die Lektion«, sagte er grinsend. Aber als er sich seinen Weg durch die lärmende Menge bahnte und dem Ausgang zustrebte, vorbei an belanglosen Gesprächen, fragte er sich, wozu all das gezwungene Gelächter dienen sollte, und sein Lächeln verschwand.
Er wünschte, Theo hätte Recht. Er wünschte, er könnte wirklich alles lustig finden.
3
Am folgenden Nachmittag wurde Jack im fünften Stock des Büros der US-Bundesanwaltschaft im Zentrum von Miami vorstellig. Er hatte fast die ganze Nacht damit zugebracht, die Kopie des NCIS-Ermittlungsberichts durchzuarbeiten, die Lindsey Hart ihm gegeben hatte. Jack hatte noch nie zuvor militärische Ermittlungsakten in der Hand gehabt, aber sie glichen weitgehend den Berichten im zivilen Bereich, wie sie ihm aus seiner jahrelangen Arbeit vertraut waren, allerdings mit einer wesentlichen Ausnahme: Fast auf jeder Seite waren Zeilen – teils ganze Absätze, teils komplette Zeugenaussagen – geschwärzt worden, Stellen, die die militärische Führung offenbar als vertraulich einstufte und als ungeeignet für die Augen von Zivilpersonen.
Jacks erster Gedanke war, dass die NCIS Lindsey Informationen vorenthielt, weil sie des Mordes verdächtigt wurde. Als er jedoch einen Freund bei der Militäranwaltschaft JAG anrief, erfuhr er, dass Angehörige eines getöteten Militärs häufig stark zensierte Ermittlungsberichte erhielten. Selbst wenn der Soldat nicht im Zusammenhang mit Kampfhandlungen ums Leben gekommen war, sondern durch Mord, Selbstmord oder einen Unfall, bekamen die Hinterbliebenen längst nicht immer Gelegenheit zu erfahren, was der Betroffene gerade getan hatte, als der Tod ihn ereilte, mit wem er zuletzt gesprochen oder was er ein paar Stunden, bevor ihm eine 9-mm-Kugel den Hinterkopf zertrümmerte, in sein Tagebuch geschrieben hatte. Sicherlich hatte das Militär in vielen Fällen ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung, besonders an einem Ort wie Guantánamo, der letzten US-Basis auf kommunistischem Boden. Aber Jack war Anwalt und all das machte ihn zutiefst skeptisch.
»Jack, ich wollte am Telefon nicht unhöflich sein. Aber ich habe wirklich absolut nichts mit dem Fall Hart zu tun.«
Gerry Chavetz saß mit hinter dem Kopf verschränkten Händen an seinem Schreibtisch, genauso wie früher, als er noch Jacks Vorgesetzter gewesen war. Damals hatten sie häufig bis spät in die Nacht zusammengesessen und über Gott und die Welt diskutiert, darüber, ob die Miami Dolphins mehr Footballspiele in ihren blauen oder den weißen Trikots gewonnen hatten, oder auch darüber, ob ihr Kronzeuge eher trotz oder wegen des Zeugenschutzprogramms ein toter Mann war. Manchmal vermisste Jack die alten Zeiten, aber auch wenn er geblieben wäre, hätten sich die Dinge geändert. Gerry hatte sich zum stellvertretenden Bundesstaatsanwalt hochgearbeitet, und die Streitgespräche mit ihm wären weitaus weniger lustig, da er mittlerweile über alles informiert war.
»Der Fall wird hier in Miami verhandelt. Habe ich Recht?«, fragte Jack.
Gerry schwieg eisern. Jack bohrte weiter. »Also, es ist kein Geheimnis, dass Lindsey Hart als Zivilperson nicht vor ein Militärgericht gestellt werden kann. Sie stammt aus Miami. Du gefährdest sicher nicht die Sicherheit der Nation, wenn du mir bestätigst, dass der Prozess hier im Southern District of Florida stattfinden wird, falls man sie des Mordes an ihrem Mann anklagt.«
Immer noch keine Reaktion von Gerry.
Ein Lächeln spielte um Jacks Mund. »Nun komm schon, Gerry. Nicht mal damit willst du herausrücken?«
»Lass es mich so ausdrücken: Theoretisch könntest du Recht haben.«
»Gut. Also dann möchte ich dich theoretisch darum bitten, dem zuständigen Staatsanwalt eine Nachricht von mir zukommen zu lassen. Ich habe den NCIS-Bericht gelesen. Zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Die Hälfte ist geschwärzt.«
»Ms Hart kann von Glück reden, überhaupt einen Bericht erhalten zu haben.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Normalerweise dauert es mindestens ein halbes Jahr, bis die Behörde einen Abschlussbericht verfasst. Dieser hier kam sehr schnell. Deine Mandantin sollte froh darüber sein.«
Jack lächelte in sich hinein. Genau wie er gedacht hatte: Der stellvertretende Bundesstaatsanwalt wusste tatsächlich alles. Jack erwiderte: »Offiziell ist sie nicht meine Mandantin. Noch nicht. Wie ich am Telefon gesagt habe, ich ringe noch mit mir, ob ich ihre Verteidigung übernehmen soll.«
»Woher weißt du dann, dass es überhaupt zu einem Verfahren kommen wird?«
»Die NCIS stuft den Tod ihres Ehemanns als Mordfall ein.«
»Ich meinte ein Verfahren gegen sie.«
Jack warf ihm einen fragenden Blick zu. »Willst du mir sagen –«
»Ich sage dir gar nichts. Ich dachte, das hätte ich von vornherein klargestellt.«
»Okay. Es mag wahr oder unwahr sein, aber Ms Hart scheint anzunehmen, dass sie die Hauptverdächtige ist.«
Gerry verzog keine Miene und schwieg.
»Für eine Frau, die von ihrer Unschuld überzeugt ist, bedeutet das eine extreme nervliche Belastung.«
»Alle sind von ihrer Unschuld überzeugt. Deshalb sitze ich auch immer noch auf dieser Seite des Schreibtischs. Ich respektiere dich, Jack, aber ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass ich keinen Schuldigen verteidige.«
Jack rutschte auf die Stuhlkante und sah seinem ehemaligen Chef in die Augen. »Deshalb bin ich hier. Bei diesem Fall sitze ich in der Klemme. Lindsey Hart ist –« Er unterbrach sich, weil er nicht zu viel preisgeben wollte. Gerry war zwar ein alter Kumpel, aber immer noch auf der anderen Seite. »Sagen wir, sie ist die Freundin eines Freundes. Eines sehr engen Freundes. Ich möchte ihr helfen, wenn ich kann. Aber ich möchte mich nicht in diese Sache hineinknien, wenn …«
»Wenn was?«, erwiderte Gerry sarkastisch. »Wenn sie schuldig ist?«
Jack lächelte nicht zurück. Sein Gesichtsausdruck war todernst.
»Komm schon, Jack. Du hast doch nicht allen Ernstes erwartet, dass ich dir in die Augen sehe und sage: ›Du hast Recht, Kumpel. Übernimm den Fall. Die Ermittler haben den falschen Verdächtigen auf dem Kieker.‹ Oder?«
»Vorerst will ich rausfinden, wie ehrlich meine Mandantin mir gegenüber ist. Ich muss eine bestimmte Sache überprüfen. Es hat etwas mit dem Todeszeitpunkt zu tun.«
»Selbst wenn mir die Einzelheiten dieses Falles bekannt wären, was sie nicht sind, könnte ich zu den Ermittlungen nichts sagen.«
»Natürlich könntest du das. Die Frage ist doch nur, ob du willst oder nicht.«
»Dann nenn mir einen plausiblen Grund, warum ich es tun sollte.«
»Weil ich dich im Namen unserer alten Freundschaft inständig darum bitte.«
Gerry wandte sich ab, als hätte ihn Jacks Bitte unangenehm berührt. »Du machst ja eine fürchterlich persönliche Sache daraus.«
»Was mich betrifft, kann ich mir nichts Persönlicheres vorstellen.«
Gerry saß eine Weile schweigend da und dachte nach. Schließlich blickte er auf. »Was brauchst du?«
»In dem NCIS-Bericht fehlen jede Menge Informationen, aber eine Lücke gibt mir besondere Rätsel auf. Lindsey Hart behauptet, ihr Mann sei noch am Leben gewesen, als sie das Haus um halb sechs morgens verließ. Der Gerichtsmediziner setzt den Todeszeitpunkt zwischen drei und fünf Uhr an.«
»Das ist nicht gerade das erste Mal, dass der gerichtsmedizinische Befund im Widerspruch zu der Version eines Verdächtigen steht.«
»Ich bin noch nicht fertig. Das Opfer wurde durch einen Kopfschuss aus seiner eigenen Waffe getötet. Der Bericht erwähnt keinen Schalldämpfer. Er wurde also mit seiner eigenen Pistole erschossen, die im Schlafzimmer auf dem Boden lag, nicht weit von der Leiche entfernt. Weit und breit kein Schalldämpfer, kein zerfetztes Kissen, keine durchlöcherte Decke, womit man den Lärm hätte dämpfen können.«
»Und?«
»Das Ehepaar hat einen zehnjährigen Sohn. Wenn Lindsey Hart ihren Mann zwischen drei und fünf Uhr früh erschossen hat, müsste doch ihr Sohn den Schuss gehört haben, oder?«
»Kommt drauf an, wie groß das Haus ist.«
»Das ist eine Militärbasis. Selbst die Unterkünfte der Offiziere verfügen lediglich über zwei Schlafzimmer, die direkt nebeneinander liegen, die Größe der Wohnungen beträgt gerade mal hundert Quadratmeter.«
»Was steht dazu in dem Bericht?«
»Ich habe nichts gefunden. Vielleicht stand was auf den Seiten, die geschwärzt wurden.«
»Möglich.«
»Wie auch immer, ich würde gerne wissen, inwiefern die Ermittler das Schussgeräusch berücksichtigt haben. Wie ist es möglich, dass eine Frau eine 9-mm-Beretta abfeuert und ihr zehnjähriger Sohn im Nebenzimmer seelenruhig weiterschläft?«
»Vielleicht hat der Junge einen gesunden Schlaf.«
»Bestimmt. Das könnte auch die offizielle Erklärung sein.«
»Und wenn es so ist?«
Jack ließ einen Augenblick verstreichen, als wollte er damit seinen nächsten Worten mehr Gewicht verleihen. »Wenn das die beste Erklärung ist, die sie zu bieten haben, dann hat Lindsey Hart wohl gerade einen Anwalt gefunden.«
Ein bedrückendes Schweigen lag im Raum. Schließlich sagte Gerry: »Ich werde sehen, was ich tun kann. Jack Swyteck von dem Fall fern zu halten könnte für den Chefankläger ausreichend Anreiz sein, ein paar Informationen auszuspucken.«
»Wow. Das ist wahrscheinlich das Positivste, was du je über mich gesagt hast.«
»Oder vielleicht kann ich es auch nicht ausstehen, wenn Frauen erst ihre Männer umbringen und sich anschließend einen Spitzenanwalt nehmen.«
Jack nickte bedächtig, als hätte er die Antwort verdient. »Je eher, desto besser, okay?«
»Wie gesagt, ich werde sehen, was ich tun kann.«
»Klar.« Er stand auf, bedankte sich und reichte Gerry zum Abschied die Hand. Den Weg hinaus kannte er.
4
Die Antwort kam früher als erwartet. Aber sie war nicht die, mit der Jack gerechnet hatte.
Er hatte sich ein ruhiges Wochenende gegönnt, eine Bootsfahrt mit Theo in der Bucht, ein bisschen Gartenarbeit. Aber nichts hatte ihn davon abgehalten, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie anders sein Leben hätte verlaufen können. Anfangs hatte ihn Jessie Merrill körperlich unglaublich angezogen. Sie war eine auffällige Schönheit gewesen, nicht im Geringsten prüde, auch wenn ihr Bad-Girl-Image größtenteils gespielt war. Auch was ihre Intelligenz betraf, konnte sie es spielend mit den Frauen aufnehmen, die er während des Studiums kennen gelernt hatte, und was hätte er dagegen haben sollen, dass sie nicht nur gebildet, sondern auch gut im Bett war? Leider war ihm erst aufgegangen, dass sie womöglich die Richtige gewesen wäre, nachdem sie sich mit den klischeehaften Worten: »Ich habe dich nicht verdient, aber ich hoffe, wir können Freunde bleiben«, verabschiedet hatte. Jack hätte alles gegeben, um sie zurückzubekommen. Fünf Monate später, als sie tatsächlich zu ihm zurückkam, war er bereits in Cindy Paige verliebt gewesen, die Frau seiner Träume, seine zukünftige Ehefrau, von der er später geschieden wurde und mit der er seither nie wieder ein Wort wechselte. Jessie hatte bescheiden einen Rückzieher gemacht und ihm alles Gute gewünscht, ohne auch nur mit einem Wort zu erwähnen, dass sie von ihm schwanger war.
Was wäre wohl gewesen, wenn er Cindy nie kennen gelernt hätte? Ob er Jessie geheiratet hätte? Vielleicht hätte Jessie die Weichen für ihr Leben anders gestellt, so dass sie nicht in jungen Jahren hätte sterben müssen. Jack hätte vielleicht einen Sohn gehabt, den er zu Baseballspielen und zum Angeln mitnehmen und mit Zähnen und Klauen gegen Onkel Theos schädliche Einflüsse verteidigen konnte. Bis zum Sonntagabend hatte er sich eine kleine heile Welt erschaffen, in der sie alle drei glücklich miteinander lebten, und in seinem Kopf hatte er eine klare Vorstellung von seinem Sohn, so real wie sie nur sein konnte – den Klang seiner Stimme, den Duft seiner Haare, die dünnen Arme des Zehnjährigen, die sich um ihn schlangen, wenn sie auf dem Boden miteinander rangelten.
Dann, am Montagmorgen, kam der Anruf aus dem Büro des Bundesanwalts, der ihn wieder daran erinnerte, dass nichts im Leben jemals perfekt war.
»Lindsey Harts Sohn ist taub«, sagte Gerry Chavetz.
Jack war so verdattert, dass er nur stottern konnte: »Deshalb hat er den Schuss nicht gehört.«
»Deshalb kann er überhaupt nichts hören«, erwiderte der Staatsanwalt.
Während Gerry weiterredete, umklammerte Jack den Telefonhörer, als fürchtete er, er könnte ihm aus der Hand fallen. Jack hätte nach mehr Informationen gebohrt und sicherlich versucht, Gerry den ganzen Vormittag am Reden zu halten, wenn es um einen x-beliebigen Jungen gegangen wäre. Aber unter den gegebenen Umständen gelang es ihm einfach nicht, so zu tun, als wenn ihn die Sache nicht berührte, und seine Verbindung zu Lindsey Harts Sohn ging weder Gerry noch sonst jemanden etwas an. Er konnte sich keinen Ausrutscher leisten.
»Gerry, ganz herzlichen Dank für den Gefallen.«
»Heißt das, du wirst sie nicht verteidigen?«
»Ich muss noch darüber nachdenken.«
»Aber du hast doch gesagt, dass –«
»Ich weiß. Tut mir Leid, aber ich habe es sehr eilig.«
Der Hörer landete heftiger als normalerweise auf der Gabel. Jack ging in die Küche und starrte hinaus auf die Biscayne Bay. Er beobachtete, wie eine warme Brise aus Südost beständig Wellen landeinwärts trieb, die sanft gegen die Uferbefestigung plätscherten. Es waren keine eindrucksvollen Naturgewalten, kein Anblick, der die Seele erschütterte. Es war eher ein unablässiges Nichtsdestoweniger, so unerbittlich wie die Gewalt der Gefühle, die durch Jacks Adern pulsierten.
Ein Bild kam ihm in den Sinn, wie er in der Säuglingsstation eines Krankenhauses stand und ein Baby im Arm hielt, der stolze junge Vater, der über das ganze Gesicht strahlt, während ein Arzt sich ihm langsam mit ernster Miene nähert, die sein Lächeln gefrieren lässt. Offensichtlich bringt der Arzt keine guten Nachrichten, und irgendwie ahnt Jack, dass der Arzt ihm jetzt gleich eröffnen wird, dass sein Sohn taub ist. Plötzlich verändert sich das Bild. Jack ist nicht länger ein Vater, sondern selbst ein kleines Baby in den Armen eines anderen Mannes. Der Mann ist Jacks Vater, ein junger Harry Swyteck, und wundersamerweise kann dieses schläfrige kleine Neugeborene namens Jack sowohl hören als auch verstehen, wie der Arzt Harry Swyteck die Hand auf die Schulter legt und mit sanfter Stimme sagt: »Es tut mir sehr Leid, Mr Swyteck. Wir haben alles versucht, was in unserer Macht lag, aber wir konnten das Leben Ihrer Frau nicht retten.« Jack fühlt, wie er fällt, als sein Vater in einem Sessel zusammenbricht, fühlt, wie sein Vater am ganzen Körper zittert, als ihm die grausame Wahrheit bewusst wird, fühlt, wie der junge Witwer ihn fester an sich drückt, so als wollte er sein Kind nie wieder loslassen. Harry sagt irgendetwas, ringt sich mit erstickter Stimme Worte ab, während er sein Gesicht in die Baumwolldecke presst, in die sein Sohn gewickelt ist. Die Worte sind eine verwirrende Mischung aus Liebe und Wut, eine Wut, die sowohl verbittert als auch dauerhaft ist. Vor seinem geistigen Auge ist Jack immer noch in jene Decke gewickelt, während die Jahre vorüberfliegen. Sein Vater redet immer weiter, anscheinend ohne zu bemerken, dass der Junge größer wird, überzeugt, dass ihn sein Sohn sowieso nicht hören kann. Jack ist nicht ganz klar, wann genau es passiert, aber irgendwann kommt der Arzt zurück. Er weigert sich, Jack oder seinem Vater in die Augen zu sehen, als wüsste er nicht, wem von beiden er die schreckliche Nachricht überbringen soll.
»Der Junge ist taub«, sagt der Arzt, und es ist Harry, der schluchzt, obwohl es Jack wehtut, zu wissen, dass er fast dreißig Jahre benötigen wird, um sein Gehör zurückzuerlangen und zu verstehen, was sein Vater ihm sagen will.
Jack trat vom Fenster weg und schüttelte die verzerrten Erinnerungen ab, obwohl sie ja eigentlich keine Erinnerungen waren, sondern eher schmerzende Bilder einer Vergangenheit, die ihn offenbar noch immer verfolgte, einer Vergangenheit, die er nie völlig zu erforschen gewagt hatte. Die Entdeckung seines eigenen Sohnes machte die Sache auch nicht gerade leichter.
Oder vielleicht doch?
Als er nach dem Telefonhörer griff, war er plötzlich wieder ganz Anwalt. Er rief im Hotel InterContinental an und sagte mit geschäftsmäßiger Stimme: »Ich möchte bitte mit Lindsey Hart sprechen. Sie ist Gast bei Ihnen. Es ist dringend.«
5
Jack empfing Lindsey in seiner Kanzlei unter vier Augen. Er musste sich von ihrer Glaubwürdigkeit überzeugen und dazu würde ein Telefongespräch nicht ausreichen.
»Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass er taub ist?«
Lindsey erstarrte angesichts seines vorwurfsvollen Tonfalls, aber sie antwortete ruhig. »Er ist taub auf die Welt gekommen. Ich dachte, Sie wüssten es.«
»Bitte lügen Sie mich nicht an.«
»Es ist die reine Wahrheit.«
Jack dachte über ihre Worte nach, konzentrierte sich jedoch mehr auf ihre Körpersprache. Ihr Mund wurde noch schmaler. »Das kaufe ich Ihnen nicht ab«, sagte er.
»Warum sollte ich Sie ausgerechnet bei so etwas täuschen wollen?«
»Nach Durchsicht des NCIS-Berichts habe ich Sie angerufen und Ihnen erklärt, dass mich die Feststellung des Todeszeitpunkts durch den Gerichtsmediziner beunruhigte. Es ergab für mich keinen Sinn, dass Sie angeblich vor fünf Uhr eine Waffe in Ihrer Wohnung abgefeuert haben sollten und der Bericht keine Zeugenaussage von Ihrem Sohn enthielt; dass Ihr Sohn nicht einmal erwähnt wurde. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er trotz des lauten Knalls im Nebenzimmer weitergeschlafen haben sollte.«
»Und ich war mit Ihnen einer Meinung.«
»Aber die wichtigste Tatsache haben Sie mir vorenthalten.«
»Er kann nicht hören, Jack. Das macht aber aus ihm noch lange kein Möbelstück. Er kann Dinge spüren.«
»Also, als ich Sie anrief und Ihnen sagte, dass es eine riesige Lücke in dem Ermittlungsbericht gibt, dachten Sie, ich redete davon – dass Ihr Sohn einen Schuss im Nebenzimmer gespürt haben müsste?«
»Eine Tür, die zugeschlagen wird, die panischen Schritte des Schützen, der durch den Raum läuft. All diese Bewegungen erzeugen spürbare Schwingungen.«
»Bitte beantworten Sie meine Frage. Haben Sie tatsächlich geglaubt, das hätte ich gemeint?«
Es widerstrebte Jack, so hart mit ihr umzuspringen. Aber wenn es etwas gab, womit er nicht umgehen konnte, dann war es eine Mandantin, die ihren Anwalt belog.
»Nein«, sagte sie schließlich. »Ich wusste genau, was Sie dachten. Dass er den Schuss gehört haben musste.«
»Aha. Und dennoch lassen Sie mich ins Büro des Bundesanwalts rennen und dort vorbringen, dass Lindsey Hart ihren Mann nicht erschossen haben kann, ohne dass der Junge es gehört hat.«
»Ich wusste nicht, dass Sie mit dem Ankläger reden würden. Sie haben gesagt, Sie bräuchten noch etwas Bedenkzeit und würden mir Bescheid geben, ob Sie den Fall übernehmen.«
»Demnach war es in Ordnung, mich in die Irre zu führen, solange es nur zwischen uns beiden blieb?«
Mit gesenktem Blick erwiderte sie: »Ich hatte das Gefühl, Ihnen schon eine Menge aufgebürdet zu haben, auch ohne Ihnen zu sagen, dass der Junge taub ist.«
Ihre Worte klangen aufrichtig, aber wieder war ihr Mund verräterisch schmal. »Ich bin mir nicht sicher, dass das alles erklärt«, sagte Jack.
Sie antwortete mit leiser, ruhiger Stimme, vermied aber immer noch den Blickkontakt. »Sie müssen das verstehen. Als Sie mich anriefen, nachdem Sie den Bericht gelesen hatten, klangen Sie so überzeugt von der Idee, dass der Todeszeitpunkt meine Unschuld beweisen würde. Ich … Ich wollte einfach nicht meinen besten Trumpf verlieren. Nicht gleich zu Anfang.«
»Haben Sie geglaubt, Sie könnten mich austricksen, damit ich Ihre Verteidigung übernehme?«
Plötzlich begann sie zu zittern. Instinktiv öffnete Jack die Schachtel mit Papiertaschentüchern auf seinem Schreibtisch und reichte ihr eins.
»Ich bin unschuldig«, sagte sie mit zittriger Stimme. »Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn man zu Unrecht beschuldigt wird, den Vater des eigenen Kindes getötet zu haben?«
»Ich kann es nur ahnen.«
»Dann müssen Sie das doch verstehen. Zu dem Zeitpunkt war es mir völlig egal, warum Sie geglaubt haben, dass ich unschuldig bin. Entscheidend für mich war, dass Sie es geglaubt haben.«
»Mich in die Irre zu führen kann mich nur schwerlich in diesem Glauben bestärken.«
»Wenn ich Ihnen meine Unschuld beweisen könnte, bräuchte ich Sie nicht.«
Sie tupfte eine Träne ab, und Jack ließ ihr einen Augenblick Zeit, ihre Fassung wiederzugewinnen. »Da haben Sie Recht. Aber wenn Sie mich anlügen, können Sie nicht mit mir rechnen.«
»Es tut mir Leid. Es wird nicht wieder vorkommen. Seit diese Geschichte passiert ist, habe ich das Gefühl, dass niemand auf meiner Seite steht. Die Polizei nicht und sonst auch niemand. Alle scheinen sich ihre Meinung bereits gebildet zu haben.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Wegen einer Sache, die ich der Gazette gesagt habe.«
»Was ist die Gazette?«
»So heißt das Blättchen auf der Militärbasis. Sie haben mich gefragt, was meiner Meinung nach meinem Ehemann zugestoßen ist, und ich habe es ihnen gesagt, und sie haben es gedruckt. Von diesem Tag an konnte man glauben, ich hätte einen Stempel auf meiner Stirn mit der Aufschrift ›Staatsfeindin‹.«
»Was haben Sie denen denn gesagt?«
Sie zögerte, als wüsste sie nicht recht, ob sie Jack ihre Theorie anvertrauen konnte. »Mein Mann wurde nicht unbedingt ermordet. Er wurde … liquidiert.«
»Liquidiert?«
»Zum Schweigen gebracht.«
»Von wem?«
Es schien ihr nicht bewusst zu sein, aber sie hatte die Hand, die das Taschentuch hielt, wütend zur Faust geballt. »Dieser NCIS-Bericht ist völlig keimfrei gemacht worden. Fragen Sie sich nicht, was da unterschlagen wurde?«
»Soweit ich gehört habe, ist diese Art der Zensur nichts Ungewöhnliches.«
»Ich bin davon überzeugt, dass das dauernd vorkommt. Immer wenn die Navy etwas zu verbergen hat.«
Allmählich kam sie Jack leicht paranoid vor, aber er wägte seine Worte sorgfältig ab. »Nach allem, was Sie durchgemacht haben, ist Ihr Argwohn nicht verwunderlich.«
»Das mag Ihnen vielleicht nicht bekannt sein, aber die Ermittlungsakten des Militärs über Tötungsdelikte in den eigenen Reihen sind in der Regel alles andere als vollständig.«
»Das ist allerdings ein krasser Vorwurf.«
»Ich behaupte ja nicht, dass die Militärs inkompetent sind. Ich behaupte aber, dass gewisse Leute dort nicht vor Vertuschung zurückschrecken.«
»Und das wissen Sie, weil Sie …«
»Weil ich zwölf Jahre lang mit einem Berufsoffizier verheiratet war. Und ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Wussten Sie, dass die NCIS einmal versucht hat, einer Mutter und einem Vater einzureden, ihr Sohn hätte sich selbst erschossen, obwohl er beim Abdrücken auf dem Kopf gestanden haben müsste, damit die Kugel den festgestellten Einschusskanal verursacht haben könnte?«
»Unglaublich.«
»Es kommt noch besser. In einem anderen Todesfall stellte die NCIS am neunten Juli fest, dass ein Angehöriger der Marines sich die tödlichen Verletzungen selbst beigebracht hatte. Und jetzt raten Sie mal, wann die Untersuchungsergebnisse über die Flugbahn der Kugel, der Schmauchspuren und der Blut- und Gewebetests vorlagen? Am sechsten August.«
»Sie haben offenbar Einblick in diese Dinge gehabt. Aber in diesem Fall geht es nicht darum, dass ein Mord als Selbstmord vertuscht werden soll.«
»Es geht darum, dass die in der Lage sind, alles so hinzudrehen, wie sie es brauchen. Sie wollten meinen Mann aus dem Weg räumen, aber niemand hätte ihnen abgekauft, dass er Selbstmord begangen hätte. Er war viel zu lebenslustig. Also haben sie ihn beseitigt, aber anstatt es wie einen Suizid aussehen zu lassen, bezichtigt man mich des Mordes an meinem Mann. Und dann erstellen sie diesen so genannten Untersuchungsbericht, der voller Lücken ist. Alle wesentlichen Informationen werden entfernt, angeblich zum Schutz militärischer Geheimnisse und der nationalen Sicherheit.«
Jack musterte sie eingehend. »Also gut, nehmen wir mal an, wir haben es mit Vertuschung zu tun. Sie sagen, das Militär wollte den Tod Ihres Mannes nicht als Suizid ausgeben, weil ihnen niemand abgenommen hätte, dass er sich selbst töten würde.«
»Richtig.«
»Aber anscheinend geht man davon aus, dass kein Mensch ein Problem damit haben würde, Sie für die Mörderin Ihres Mannes zu halten.«
Sie antwortete nicht sofort, offenbar war sie unangenehm berührt von der Art, wie Jack die Situation analysierte. »Solche Annahmen sind immer die Voraussetzung, wenn man jemandem etwas anhängen will.«
»Aber jemandem einen Mord anzuhängen ist eine Ungeheuerlichkeit. Zumal Sie mir noch kein Motiv dafür genannt haben.«
»Wenn Sie meinen Mann gekannt hätten, würden Sie meinen Verdacht verstehen. Wir haben fast ein Drittel unserer Ehe auf diesem kleinen eingezäunten Stückchen Kuba verbracht. Immer wieder habe ich ihn angefleht, seine Versetzung zu beantragen. Die Leute dort sind zwar ganz nett und es gibt auch eine Art Gemeinschaftssinn. Aber ich konnte die Isolation nicht ertragen. Oscar dagegen war durch und durch Mr Guantánamo. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, auf der Insel Karriere zu machen, er hatte kein Bedürfnis, woanders hinzugehen. Und dann, von heute auf morgen, war er wie verwandelt. Zwei Wochen vor seinem Tod erklärte er mir aus heiterem Himmel, er denke, es sei an der Zeit, die Insel zu verlassen.«
»Vielleicht ein Sinneswandel?«
»Nein. Ich konnte die Veränderung an vielen kleinen Dingen ablesen – daran, dass er nachts dauernd wachlag, dass er irgendwann anfing, immer eine geladene Waffe in der Nachttischschublade zu haben. Wahrscheinlich dachte er, ich würde das alles nicht bemerken, aber ich habe es bemerkt. Irgendetwas hat ihn zutiefst beunruhigt. Er benahm sich plötzlich wie jemand auf der Flucht. Wie ein Mann, der etwas wusste, das er nicht wissen sollte.«
»Zum Beispiel?«
»Beim Militär wimmelt es von Geheimnissen. Und eine Menge Leute sind bei dem Versuch, sie für sich zu behalten, gestorben.«
»Ich brauche schon noch ein bisschen mehr.«
»Dann helfen Sie mir, es herauszufinden, verdammt noch mal.«
Sie war zweifellos frustriert, was Jack gut verstehen konnte. Er stand auf und setzte sich vor sie auf die Schreibtischkante, damit keine Barriere mehr zwischen ihnen stand. »Vermutlich glauben Sie, dass Anwälte immerzu schuldige Mandanten verteidigen, und fragen sich, warum reitet der Typ hier dermaßen auf Schuld oder Unschuld herum. Aber dieser Fall ist –«
»Anders«, beendete sie den Satz für ihn. »Ich weiß.«
»Verstehen Sie auch, warum?«
»Selbstverständlich. Sie wollen das Beste für Ihren«, sie unterbrach sich und fuhr fort: »für meinen Sohn. So wie ich auch. Aus diesem Grund hätte ich auch nie – selbst wenn ich Oscar den Tod gewünscht hätte –, hätte ich ihn niemals in unserem Haus erschossen, während unser Sohn im Nebenzimmer schlief. Können Sie das irgendwie nachvollziehen, Mr Swyteck?«
Jack hielt ihrem Blick stand und plötzlich war das Schweigen zwischen ihnen nicht mehr peinlich. Es war, als wäre ihm endlich das sprichwörtliche Licht aufgegangen. »Ja, das kann ich, Lindsey. Und ich finde, es wird Zeit, dass Sie mich Jack nennen.«
6
Alejandro Pintado war auf der Suche nach guten Nachrichten. Buchstäblich.
Wie üblich hatte ihn seine Suche zur Florida Straits geführt, einer ungefähr hundertfünfzig Kilometer breiten Meerenge, die den Golf von Mexiko mit dem Atlantischen Ozean verband und Key West von Kuba, somit Freiheit von Tyrannei trennte. Seit mehr als vier Jahrzehnten flüchteten Kubaner aus Fidel Castros repressivem kommunistischem Regime auf selbst gezimmerten Flößen, leckgeschlagenen Booten oder zusammengeklebten Reifenschläuchen. Sie riskierten ihr Leben auf hoher See, und viele schafften es in die Vereinigten Staaten, aber ebenso viele kamen in der von tropischen Stürmen aufgewühlten See um, verdursteten unter der unbarmherzigen Sonne oder gingen mit ihren alten Kähnen unter und endeten als Haifutter. Es war eine Tragödie, deren Entwicklung Alejandro mit eigenen Augen erlebte, seit er seinen ersten Einsatz im Jahre 1992 gehabt hatte. Zweimal war er über ein kleines Boot geflogen. Beim ersten Mal hatte er neun Leichen gezählt, die in einer Weise über das Deck verstreut lagen, als wären sie einfach zusammengebrochen. Beim zweiten Überflug bewegte sich eine Frau am Bug, die kaum noch in der Lage war, ihren Arm zu heben. Danach rührte sie sich nicht mehr. Die Küstenwache war zu dem Schluss gelangt, dass ein Sturm bereits in der ersten Nacht ihrer Überfahrt Wasser und Lebensmittelvorräte über Bord gespült hatte. In ihrer Verzweiflung hatten die Leute Meerwasser getrunken. Niemand überlebte. Kein Wunder, dass die kubanische Exilgemeinde in Miami die Straits of Florida als kubanischen Privatfriedhof bezeichnete.
Aber trotz der Gefahren kamen immer wieder Flüchtlinge. Und solange das nicht aufhörte, würde Alejandro Pintado nach ihnen Ausschau halten.
»Key West, hier Brother One«, sagte er in sein Funkgerät. »Ich habe etwas im Visier.«
»Verstanden«, lautete die Antwort.
Alejandro drückte den Steuerknüppel nach vorn und ging hinunter auf eine Höhe von hundertfünfzig Metern. Die alte einmotorige Cessna heulte auf, als er die Geschwindigkeit erhöhte. Obwohl ihm die Szenerie auf dem offenen Meer da unten vertraut war, verursachte sie ihm immer noch Herzrasen. Mehr als zwei Meter hohe Wellen, die sich mit weißen Schaumkronen im riesigen blauen Ozean brachen, ein fantastisches Naturschauspiel, wenn es nur nicht so gefährlich wäre. Ein kleines Boot, das sich in der Dünung hob und wieder in den Wellentälern verschwand, das weiße Segel von einem Sturm gepeitscht, der viel heftiger war als für die meisten Flüchtlinge vorstellbar. Wie üblich war das Boot überladen, voll gepackt mit drei Kindern, fünf Frauen, von denen eine einen Säugling im Arm hielt, und sechs Männern. Einige standen auf, als sie das Flugzeug erblickten, und fuchtelten wie wild mit den Rudern in der Luft herum, um die Aufmerksamkeit des Piloten zu erwecken.
Ihr seid schon fast zu Hause, dachte Alejandro und musste lächeln.
Er ging noch tiefer hinunter. Hundert Meter. Sechzig. Die Flüchtlinge hüpften herum und schrien vor Freude, als Alejandro an ihnen vorbeiflog. Er winkte aus dem Cockpit, dann begann er über dem Boot zu kreisen.
»Key West, hier Brother One«, sagte er. »Sieht nach einem fröhlichen Grüppchen aus. Alle sind in vergleichsweise guter Verfassung.«
Alejandro hatte schon erheblich Schlimmeres gesehen. Anfang der neunziger Jahre hatte er als Pilot bei Brothers to the Rescue angefangen, einer Gruppe von Exilkubanern, die sich zu Such- und Rettungstrupps zusammengetan hatten, nachdem ein neunjähriger Junge bei der Überfahrt von Kuba an Dehydrierung gestorben war. Nicht alle waren mit dem kompromisslosen Anti-Castro-Kurs der Organisation einverstanden, aber sie hatten für ihre erstaunlich hohe Rettungsbilanz internationale Anerkennung verbuchen können. Im Durchschnitt rettete die Gruppe ein Menschenleben pro zwei Stunden Flugzeit, und es gelang ihr, Tausende zu bergen, die ansonsten bei ihrer Flucht in die Freiheit auf hoher See umgekommen wären. Seit kubanische MiGs im Jahre 1996 zwei ihrer Flugzeuge abgeschossen hatten, verwandte die Organisation jedoch zunehmend mehr Energie darauf, Anti-Castro-Flugblätter zu drucken und zu verteilen. Damals verließ Alejandro die Organisation und gründete eine eigene Gruppe, die Brothers for Freedom. Die bekannteren Brothers to the Rescue stellten ihre Flüge schließlich völlig ein. Aber Alejandro hatte sich gelobt, niemals aufzugeben. Da Rettungseinsätze kostspielig waren und private Spender nur schwer zu gewinnen, finanzierte er die Organisation aus eigener Tasche. Die Brothers for Freedom – und damit die Hoffnung auf ein freies Kuba – bestanden weiter.
»Brother One, hier Key West. Hast du schon die genaue Position?«
»Verstanden. Ich muss noch einen Überflug machen und –« Er starrte zum Fenster hinaus in Richtung Horizont und wurde augenblicklich wütend, als er sah, wie das Schiff Kurs auf die Flüchtlinge nahm. »Vergiss es«, sagte Alejandro in sein Funkgerät. »Die Küstenwache ist schon unterwegs.«
Alejandro nahm die Enttäuschung in seiner eigenen Stimme wahr und zugleich die Absurdität der Situation. In den ersten Jahren war der Anblick der Küstenwache noch ein Segen gewesen. Er hatte sie sogar verständigt, wenn er ein Boot entdeckt hatte. All das hatte sich 1996 mit der Neuorientierung der US-amerikanischen Einwanderungspolitik geändert. Auf See aufgegriffene Flüchtlinge wurden nicht länger in die USA gebracht, sondern entweder in ein anderes Land umgeleitet oder nach Kuba zurückverfrachtet. Und eine Rückkehr nach Kuba konnte gut und gerne fünf Jahre in Castros Gefängnissen bedeuten.
»Die Scheißkerle schnappen sich wieder ein Boot«, sagte Alejandro.
»Tut mir Leid, Alejandro. Bist du schon auf dem Rückweg?«
»Ja.«
»Gut. Ich habe vor zwanzig Minuten einen Anruf erhalten. Ein Anwalt aus Miami, der dich gerne treffen würde, ist auf dem Weg hierher. Sein Name ist Jack Swyteck.«
Alejandro nestelte an seinen Kopfhörern, um sich zu vergewissern, dass er richtig verstanden hatte. »Swyteck? Hat der was mit Harry Swyteck, dem ehemaligen Gouverneur, zu tun?«
»Ich glaube, er ist sein Sohn.«
»Was will er?«
»Er hat gesagt, es handelt sich um eine juristische Angelegenheit. Es geht um deinen Sohn.«
Alejandro hatte plötzlich einen Kloß im Hals. Es war schon einige Wochen her, dass er die Art von Nachricht erhalten hatte, die Eltern eigentlich erspart bleiben sollte, aber es kam ihm so vor, als sei es erst gestern gewesen. »Was hat er damit zu tun?«
»Er hat im Auftrag von Lindsey angerufen.«
Lindsey. Lindsey Hart. Die Gringo-Schwiegertochter, die sich während ihrer ganzen zwölfjährigen Ehe geweigert hatte, den hispanischen Familiennamen ihres Mannes anzunehmen. »Erzähl mir nicht, die Frau hat aus eigenen Stücken den Sohn des früheren Gouverneurs angeheuert«, sagte Alejandro.
»Ich bin mir nicht sicher. Soweit ich verstanden habe, möchte er zuerst mit dir reden, bevor er den Fall übernimmt. Ich habe ihm gesagt, er soll um zwei Uhr herkommen.«
Alejandro antwortete nicht.
Das Funkgerät rauschte. »Soll ich ihn zurückrufen und absagen?«
»Nein«, erwiderte Alejandro. »Ich werde mich mit ihm treffen. Ich denke, er sollte sich anhören, was ich zu sagen habe.«
»Verstanden. Pass auf dich auf, Alejandro.«
»Verstanden. Wir sehen uns in ungefähr vierzig Minuten.«
Alejandro warf noch einen letzten Blick auf die Flüchtlinge in dem Boot, und ihm wurde ganz schwer ums Herz, als er sah, dass sie dem Rettungsflugzeug über ihnen immer noch verzweifelt zuwinkten. Sie wähnten sich schon auf der Schwelle zur Freiheit und glaubten, in wenigen Stunden sicher auf dem Boden der Vereinigten Staaten von Amerika anzukommen. Aber die US-Küstenwache hatte andere Pläne, und wenn die Grenzpatrouille die Flüchtlinge erst erspäht hatte, gab es nichts mehr, was Alejandro oder sonst jemand noch für sie tun konnte. Es machte ihn ganz krank, den Kurs zu ändern, weil er genau wusste, dass sich der kurze Hoffnungsschimmer seiner Landsleute in Luft auflösen würde, sobald die Cessna aus ihrem Blickfeld verschwand.
Alejandros Hand zitterte, als er unter seinen Hemdkragen fasste. Um seinen Hals hing ein goldenes Medaillon der Virgen de El Cobre, der heiligen Schutzpatronin von Kuba, ein Glücksbringer, wie er häufig von Kubanern in Miami an ihre Verwandten in Kuba geschickt wurde, damit sie ihre Flucht in die Freiheit sicher überstanden. Er hatte das Medaillon vor dreißig Jahren bei seiner eigenen Überfahrt in einem Ruderboot getragen.
Traurig küsste er das Medaillon und flog zurück nach Key West.
7
»Ich liebe diesen Wagen«, sagte Theo.
Jack warf ihm vom Beifahrersitz einen finsteren Blick zu. »Er gehört mir und er steht nicht zum Verkauf.«
Theo legte den Gang ein, worauf der Wagen einen Satz machte.
Von Miami nach Key West waren es gut vier Stunden Fahrt, drei, wenn Theo am Steuer saß, und er hatte darauf bestanden. Einen dreißig Jahre alten Mustang Cabrio zu besitzen hatte seine Nachteile, aber eine Fahrt durch die Keys war etwas, was jeder Autonarr in vollen Zügen genoss. Meile um Meile war die U.S. 1 ein malerisches Asphaltband, das die Inseln miteinander verband, das türkisfarbene Meer teilte und durch Orte führte, die aus den Mangroven zu sprießen schienen. Jede Menge warme Sonne auf der Haut, ein fantastischer blauer Himmel, eine Meeresbrise wie Samt. Sie hatten sich darauf geeinigt, dass Theo hin und Jack zurück fahren würde. Ein fairer Kompromiss, fand Jack, allein wegen des Unterhaltungswerts, den Theos Gesellschaft bedeutete.
»Was hast du gesagt?«, fragte Jack. Theos Lippen bewegten sich, aber der Motorlärm und die Windgeräusche verschluckten seine Worte.
»Wenn du die Kiste schon nicht verkaufst«, schrie Theo, »kannst du sie mir wenigstens überlassen.«
»Was meinst du mit überlassen?«
»In deinem Testament, Alter.«
»Ich habe gar kein Testament.«
»Ein Anwalt ohne Testament? Das ist wie ’ne Nutte ohne Kondome.«
»Wozu brauche ich ein Testament? Ich bin ein kinderloser Single.«
Sie tauschten einen Blick aus, als hätte das Wort »kinderlos« plötzlich noch eine Fußnote verdient.
»Scheiß auf das Testament«, sagte Theo. »Nimm ihn lieber mit ins Grab. Gott würde diesen Wagen auch lieben.«
Jack widmete sich wieder seiner Lektüre. Bevor sie von Miami aufgebrochen waren, hatte er im Internet recherchiert und sich ein paar Informationen über die US-Militärbasis in der Bucht von Guantánamo ausgedruckt, gerade so viel, wie er brauchte, um sich mit Lindseys Schwiegervater unterhalten zu können. Theo ließ ihn in Ruhe, bis sie die Stockton Bridge erreichten, ungefähr eineinhalb Kilometer entfernt vom Key West International Airport.
»Du musst also zum Camp Geronimo?«
»Guantánamo, nicht Geronimo. Das ist eine Militärbasis und keine indianische Begräbnisstätte.«
»Wieso haben wir überhaupt eine Militärbasis auf Kuba?«
Jack blätterte in seinen Ausdrucken. »Hier steht, dass wir sie gepachtet haben.«
»Castro ist also unser Grundherr?«
»Im Prinzip ja.«
»Mist. Was macht ein Typ wie Castro, wenn die Pacht zu spät bezahlt wird? Bringt er deine ganze Familie um die Ecke?«
»Tatsächlich hat er unsere Pachtzahlungen nie angerührt. Der Pachtvertrag wurde unterzeichnet, lange bevor er an die Macht kam, und er weigert sich, ihn anzuerkennen.«
»Aber offenbar hat er auch nicht vor, uns rauszuschmeißen.«
»Es sei denn, er hätte gern einen Tritt mit einem Stiefel made in America in seinen Kommunistenarsch.«
»Wir sind also für lau da draußen. Aber wie lange noch?«
»In dem Vertrag steht, wir können so lange bleiben, wie wir wollen.«
»Nicht zu glauben. Wer auch immer dieses Dokument verfasst hat, gehört in die Hall of Fame der Rechtsanwälte.«
Sie fuhren von der Roosevelt Road auf das Flughafengelände und hielten sich in Richtung der Hangars für Privatflugzeuge, wobei sie den Anweisungen folgten, die Jack per Telefon erhalten hatte. Ein Sicherheitsmann geleitete sie zu einem eingezäunten Parkplatz. Das Büro der Brothers for Freedom bestand aus einem kleinen Verschlag an einem der hinteren Hangars, der kaum genug Platz für einen Schreibtisch und zwei Stühle bot. Ein Mann kam aus dem Verschlag, um sie in Empfang zu nehmen, und sie folgten ihm zur Rollbahn, eine Schar hungriger Möwen im Schlepptau. Der Flughafen, der nur einen Meter über dem Meeresspiegel lag, war berüchtigt für seine zahllosen Vögel, von denen viele bei den ständigen Starts und Landungen von Propellermaschinen buchstäblich zerfetzt wurden. Die Männer gingen vorbei an mehreren Reihen privater Flugzeuge, unter denen alle Typen vom Wasserflugzeug bis zum Learjet vertreten waren. Schließlich entdeckten sie Alejandro Pintado, der an seiner zuverlässigen alten Cessna werkelte. Jack hätte das Flugzeug wahrscheinlich auch ohne jede Hilfe finden können, denn die Kiste schien nur von Aufklebern zusammengehalten zu werden, mit aussagekräftigen Slogans wie BEFREIT KUBA, CASTRO NO, KEIN PROBLEM oder ICH GLAUBE DER MIAMI TRIBUNE NICHT – letzterer ein Seitenhieb gegen die »liberalen Medien«, die manchmal die Strategie der Exilkubaner im Kampf gegen Castro kritisierten.
»Mr Pintado?«, sagte Jack.
Ein korpulenter Mann mit grauen Haaren ließ seinen Putzlappen in einen Eimer fallen und kam unter einer Tragfläche hervor. »Sie müssen Jack Swyteck sein.«
»Stimmt.«
»Wer ist Ihr Freund? Michael Jordan mit Steroiden aufgepumpt?«
»Das ist –«
»Michael Barischnikow«, sagte Theo und reichte Pintado die Hand.
»Mein Ermittler Theo Knight.«
Alejandro versuchte sich in die Brust zu werfen, aber der Bauch ragte einfach zu weit vor. »Sie wollen also meine Schwiegertochter verteidigen.«
»Ich ziehe es in Betracht«, erwiderte Jack. »Können wir uns hier irgendwo in Ruhe unterhalten?«
»Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Wir werden nicht lange brauchen.«
Jack wippte auf den Fersen. Der Mann war feindseliger, als er befürchtet hatte. »Als Erstes möchte ich Ihnen sagen, dass mir das mit Ihrem Sohn Leid tut.«
»Und warum vertreten Sie dann die Frau, die ihn getötet hat?«
»In erster Linie, weil ich nicht zu dem Schluss gekommen bin, dass sie es getan hat.«
»Da sind Sie ja wohl der Einzige.«
»Gibt es etwas, das Sie mir erzählen können? Womit Sie mich aufklären könnten?«
Pintado warf Theo einen argwöhnischen Blick zu, dann wandte er sich wieder Jack zu. »Ich werde euch beiden Witzbolden überhaupt nichts erzählen. Sie sind nicht hergekommen, um mir zu helfen. Sie sind doch bloß darauf aus, sie aus der Geschichte rauszuhauen.«
»Mr Pintado, ich möchte Ihnen nichts vormachen. Ich habe durchaus schon Mandanten vertreten, die schuldig waren. Aber dies hier ist ein außergewöhnlicher Fall für mich. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich kein Interesse daran habe, Lindsey Hart zu verteidigen, wenn sie schuldig ist.«
»Gut. Dann packen Sie am besten Ihren Kram und fahren gleich wieder nach Hause.«