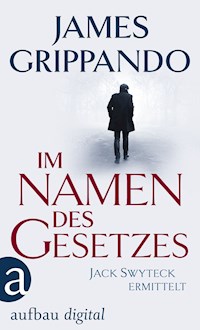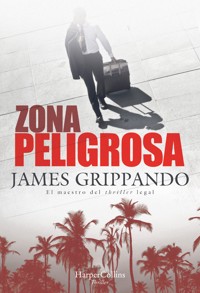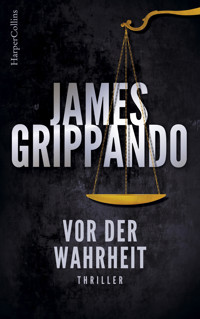8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nachdem Ruban sein Haus und sein Restaurant unverschuldet an die Bank verliert, beschließt er, das Glück selbst in die Hand zu nehmen: Jeden Tag landen Flugzeuge mit riesigen Mengen Bargeld an Bord auf dem Miami Airport, die für die Federal Reserve Bank bestimmt sind. Zusammen mit seinem nichtsnutzigen Schwager Jeffrey und dessen kleinkriminellen Onkel Pinky stiehlt er sieben Millionen Dollar. Dies ruft nicht nur das FBI auf den Plan. Die Möchtegern-Gangster sehen sich plötzlich mehr und mehr im Fokus von wirklich schweren Jungs - nicht zuletzt dank Jeffreys zunehmender Eskapaden. Während Ruban versucht seinen Schwager im Zaum und ihnen FBI und Verbrecher vom Hals zu halten, muss er erkennen: Die richtigen Probleme fangen mit dem Geld erst an!
"Grippando nimmt sich einer wahren Geschichte an und macht daraus Thriller-Gold."
Mystery Scene
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
James Grippando
Cash Landing – Der Preis des Geldes
Roman
Aus dem Amerikanischen von Marco Mewes
HarperCollins®
HarperCollins® Bücher
erscheinen in der HarperCollins Germany GmbH,
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2016 by HarperCollins
in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
Cash Landing
Copyright © 2015 by James Grippando
erschienen bei: HarperCollins, New York
Published by arrangement with
Harper, an imprint of HarperCollins, LLC.
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner GmbH, Köln
Umschlaggestaltung: büropecher, Köln
Redaktion: Thorben Buttke
Titelabbildung: Getty Images, München / Siri Stafford; Tetra images
ISBN 978-3-95967-967-1
www.harpercollins.de
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
www.readbox.net
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Für Tiffany
November 2009
1. KAPITEL
In Miami reich zu werden, war ein Kinderspiel. Zumindest hatte man das Ruban Betancourt so erzählt.
Der Begriff Boomtown prangte quasi in großen Lettern über Miamis Skyline – wieder einmal. Die Finanzkrise war vorüber. Die Gefahr, sich rücksichtslos zu verschulden durch einen der berüchtigten NINA-Kredite – „No Income, No Assets, No Problem“, also „Kein Einkommen, Kein Vermögen, Kein Problem“ –, war Schnee von gestern. Heute regierte Bargeld die Stadt. Ein nagelneuer Bentley Continental GT, wie Paris Hilton ihn fuhr? Barzahlung. Ein Trip nach Miami Beach, um sämtliche Chanel-Vorräte der Bal-Harbour-Shops aufzukaufen? Noch mehr Cash. Ein Penthouse am Sunny Isles Beach? Nur Bares ist Wahres und erspart einem auch die Hypothek. Brasilianer, Argentinier, Mexikaner – jeder vermögende Lateinamerikaner badete in Bargeld und kaufte halb Miami auf.
Ruban entdeckte die teuren Autos und Juwelen, wohin er auch blickte, aber er war kein Teil dieser „New Economy“, und er verstand sie auch nicht. Noch vor wenigen Jahren hatten ihn die Banken geliebt. Sie konnten ihm gar nicht genug Kredite geben und hatten ihn und seine Frau zu einem Haus und einem NINA-Kredit überredet, den sie sich auf keinen Fall hatten leisten können. „Alles, was Sie brauchen, ist ein Puls und eine Kreditwürdigkeit“, hatte ihr Hypothekenmakler ihnen versichert. Wie sich herausstellte, war der Puls sogar optional. Scheinkredite an verstorbene Kunden nahmen sprunghaft zu, ebenso wie die Einnahmen der Banken. Zwei Jahre nachdem sie ihren überdimensionierten Kredit aufgenommen hatten, fanden sich die Betancourts in der Zwangsvollstreckung wieder und saßen auf der Straße. Ihr Traumhaus wurde vom Gericht einkassiert und umgehend an die meistbietenden Investoren verhökert, die – was auch sonst? – bar bezahlten. Am Anfang und am Ende des ganzen Betrugs verdienten die Banken. Aber diesmal nicht. Ruban war cleverer geworden und hatte den Blick nach oben gerichtet. Nicht zu den neuen Hochhäusern voller Eigentumswohnungen und Bürotürmen die Miamis Skyline veränderten. Er konzentrierte sich auf die „Geldflüge“ – normale Linienflüge, deren Laderäume zum Bersten mit Geldsäcken voller US-Dollar gefüllt waren.
„Touchdown!“, rief Ruban.
Er saß auf dem Beifahrersitz eines geliehenen Pick-up-Trucks und verfolgte im Radio das Footballspiel der Miami Dolphins. Der Co-Kommentator fügte sein patentiertes „Der war SUPER, Miami!“ aus den Lautsprechern hinzu. Ruban klatschte mit seinem Schwager, Jeffrey Beauchamp, der hinter dem Lenkrad saß, ab. Der Wagen parkte direkt an der Perimeter Road, dicht am Miami International Airport. Jeffreys Onkel, Craig „Pinky“ Perez, saß auf dem Rücksitz. In seinem Gürtel steckte eine geladene Makarow 9 Millimeter.
„Sie werden trotzdem verlieren“, meinte Pinky.
Der Pessimismus war gerechtfertigt. Das Team „stellte sich neu auf“, und obwohl die neue Saison erst acht Wochen alt war, hatten sie bereits fünf Niederlagen zu verkraften.
„Vielleicht sollte ich das Team kaufen“, sagte Jeffrey.
„Vielleicht solltest du die Klappe halten“, erwiderte Pinky.
„Vielleicht solltest du …“
„Haltet alle die Klappe!“, rief Ruban. „Seid einfach still und behaltet die Scheißflugzeuge im Auge.“
Die Familienstreitereien gingen Ruban allmählich an die Substanz. Er hatte sich mit seinem Plan an ein paar Kumpels gewandt, zwei Vollprofis mit Eiern, so dick wie Fußbälle, aber sie hatten dankend abgelehnt, weil ihnen die Sache zu riskant war. Also musste er auf seine Familie ausweichen. Für Pinky würde das vermutlich kein Problem werden, wie sein eindrucksvolles Strafregister bewies. Jeffrey hingegen war nicht ganz einen Meter siebzig groß, wog hundertdreißig Kilo, und die wichtigste Frau in seinem Leben war noch immer seine Mutter. Er grinste immerzu und lachte viel und gerne, sogar über sich selbst. Aber er war leichtgläubig wie ein Zehnjähriger. Ihn mit hineinzuziehen war, als würde man den tatsächlichen Verlierer der Sendung The Biggest Loser fragen, bei einem Banküberfall mitzumachen, zusätzlich zu den erschwerten Umständen einer Drogensucht, die mit sich brachte, dass Jeffrey die eine Hälfte seiner Zeit damit zubrachte, völlig zugekokst durchs Leben zu turnen, und die andere Hälfte damit, sich auszuschlafen. Jeffrey würde ihr Fahrer sein. Nur ihr Fahrer.
„Hey, ist es das da?“, fragte Jeffrey, während er durch die Windschutzscheibe starrte.
Ihr Truck stand südlich des Flughafens auf der anderen Seite eines vier Meter hohen Maschendrahtzauns, dessen Spitze mit Stacheldraht versehen war. Sie hatten klare Sicht auf die Landebahn und den Tower.
„Sieht für mich wie ein Jumbojet aus“, meinte Pinky.
Das Flugzeug sank von Westen her in Richtung Flughafen und überflog gerade die unbewohnten Everglades. Ruban hatte seit 13 Uhr wenigstens vier Dutzend Landungen verzeichnet – ein normaler Nachmittag am Miami Airport, der auf Platz zwei der meistgenutzten Flughäfen stand, die in den USA den internationalen Flugverkehr abwickelten. Aber Ruban wurde allmählich unruhig. Die geplante Ankunft für den Lufthansa-Flug 462 aus Frankfurt war 13:50 Uhr gewesen – jetzt war es bereits zwei. Er lächelte, als er die verräterische Wölbung des Daches, die das zweite Geschoss beherbergte, an der vorderen Hälfte des Flugzeuges erkannte. Es war eine Boeing 747.
„Das ist es, Bruder!“
„Yeah, Baby!“
Das Fahrwerk senkte sich, die Nase wanderte nach oben, und das Flugzeug setzte am westlichen Ende der Landebahn auf. Die Turbinen jaulten, als die Maschine an ihnen vorbeirollte. Das Logo der Fluglinie – ein goldgelber Kreis auf der tiefblauen Heckflosse des Flugzeugs, in dessen Mitte ein stilisierter Vogel abgebildet war – schien sie anzulächeln wie die Sonne Floridas.
„Zahltag“, sagte Ruban.
„Der war SUPER, Miami!“, rief Jeffrey. „Touchdown!“
Die Idee für den Überfall war Ruban im Laufe des Sommers gekommen. Als er die Geschichten seines alten Freundes gehört hatte, hätte es ihn beinahe umgehauen. „Geldflüge gibt es jeden Tag, Bruder. Achtzig Millionen Dollar. Hundert Millionen Dollar. Jeden beschissenen Tag.“ Miamis Ableger der Federal Reserve Bank von Atlanta, die mit den elf anderen Federal-Reserve-Banken die Bundeszentralbank der USA bildete, lag nordwestlich des Miami International Airport – Luftlinie vier Meilen, fünfzehn Minuten Fahrt für den Geldtransporter. Wenn eine ausländische Bank mehr US-Währung in ihren Tresoren besaß, als sie brauchte, flog sie die Überschüsse direkt zurück in die Staaten, damit sie dort in einer der zwölf Federal-Reserve-Banken eingelagert wurden. Südfloridas immerzu nach Bargeld hungernde Latino-Gemeinde machte Miami dabei zum bevorzugten Ziel.
Ruban hatte monatelang geplant und sich vorbereitet. Er hatte die Karten des Geländes ausreichend studiert, um zu wissen, dass die Lufthansa-Maschine direkt an der Federal Reserve Bank vorbeifliegen würde, wenn sie die südliche Landebahn anflog. Die planmäßige Endstation der Ladung war allerdings ebenso irrelevant wie die globalökonomischen Ereignisse, die den Wert des US-Dollars gedrückt und damit erst für die aktuelle Menge an Geldflügen gesorgt hatten. Für Ruban und seine Partner war diese 747 nichts anderes als ein überreifer Baum voller in Säcke gepackter Scheine. Niedrig hängende Früchte, die nur darauf warteten, von ihnen gepflückt zu werden.
Rubans Handy klingelte, und er ging sofort dran. Es war sein Informant – der alte Freund, der ihm von den „Geldflügen“ erzählt hatte. Dies war der Anruf, auf den er gewartet hatte. Es war Zeit loszulegen.
„Verstanden. Zehn Minuten.“
Ruban legte auf. Die Zollabfertigung dauerte für gewöhnlich zwei Stunden, aber die Fahrer des Geldtransporters waren schneller als gewöhnlich. Der Lufthansa-Container war bereits aus dem Flugzeug in die Lagerhalle transportiert worden. Alle Geldsäcke waren daraufhin untersucht worden, ob man sie manipuliert hatte oder ob sie gerissen waren. Das Geld war gezählt worden und die Säcke neu versiegelt. Bald würden sie das Fahrzeug beladen. In einer weiteren halben Stunde würde das Geld auf dem Weg Richtung Norden sein, den Palmetto Expressway runter mit 90 km/h – außer, Ruban schlug zu.
„Fahr los“, wies Ruban seinen Schwager an.
„Von wie viel reden wir?“
„Etwas über vierzig Säcke. Zwei Millionen pro Sack, plus/ minus ein paar Kröten, je nachdem, wie die Scheine zusammengestellt sind.“
Die Berechnung überstieg Jeffreys Möglichkeiten. „Nice“, sagte er und lenkte das Fahrzeug auf die Perimeter Road.
Es war eine kurze Fahrt zum Lagerhaus des Flughafens an der Northwest Eighteenth Street. Ruban und Pinky zogen sich Gummihandschuhe über, um sicherzustellen, dass sie keine Fingerabdrücke hinterließen, wenn sie sich auf die Laderampe zogen. Jeffrey parkte außerhalb des geöffneten Frachttors. Er ließ den Motor laufen. Die Uhr zeigte 15:08 Uhr an.
Ruban konnte nur schwer glauben, dass das riesige Ladetor weit offen stand, auch wenn er gewusst hatte, dass es das tun würde. Es war einer der vielen Sicherheitsmängel, die ihm die Sache so einfach machen würden. Jede dieser Schwachstellen war ihm im Voraus genau aufgezählt worden. Gebündelte Geldscheine lagen offen auf dem Betonboden. Ein Bundesgesetz verbot jedem Zivilbürger – also auch dem Personal des privaten Sicherheitsdienstes, das den Geldtransport durchführte –, innerhalb des Zollareals Waffen zu tragen, deshalb mussten die Wachen ihre Pistolen abgeben, bevor sie die Lagerhalle betraten und sich an die Arbeit machten. Die Überwachungskameras wurden von der Sicherheitsmannschaft des Flughafenterminals überwacht, weit weg von der Lagerhalle, und die Diebe wären längst über alle Berge, ehe die Wochenendschicht auch nur bemerkte, dass auf einem der unzähligen Monitore vor ihnen etwas Seltsames vorging, und die Polizei informierte. Das Irrste aber an dieser ganzen unglaublichen Sache war, dass die weit offen stehenden Tore der Lagerhalle direkt auf eine öffentliche Zufahrtsstraße führten, die parallel zum Gebäude verlief. Ein schnelles Auto konnte so das Gelände des Flughafens und das Wachhäuschen umgehen und innerhalb von sechzig Sekunden auf dem Expressway verschwinden.
Ruban hatte all diese Informationen von einem alten Vertrauten erhalten, einem Freund aus Kindheitstagen, mit dem er in Kuba aufgewachsen war.
Rubans ursprünglicher Name war „Karl“ gewesen, was kein hispanischer Name war, aber über die Jahrzehnte hatte der sowjetische Einfluss auf Kuba viele Gesichter gehabt. Eines davon war Rubans Vater gewesen, ein russischer Soldat, der Rubans Mutter nie geheiratet hatte und nach Afghanistan versetzt wurde, wo er starb, als Ruban drei Jahre alt war. Karl und seine ältere Schwester waren russische Halb-Kubaner – „Rubaner“ –, die von dem Einkommen einer alleinerziehenden Mutter überleben mussten, umgerechnet etwa zwanzig Dollar im Monat, die in moneda nacional ausgezahlt wurden, und mit ein paar Rationen Reis und Bohnen und weiterer „Notwendigkeiten“ ergänzt wurden, die die kubanische Regierung zur Verfügung stellte. Sie besaßen kein Auto. Ihr Fernseher funktionierte nur von Zeit zu Zeit, aber auch wenn, dann gab es dort nur das zu sehen, was die Regierung ihnen zu sehen erlaubte. Das Ausreiseverbot der Castro-Regierung für kubanische Bürger bedeutete, dass niemand aus der Betancourt-Familie die Insel seit 1959 verlassen hatte. Ruban gehörte zur nächsten Generation von Flüchtlingen, die Teil von Präsident Clintons Kubakrise wurde, da sich die Flüchtlinge nur dann entschieden, die Insel zu verlassen, wenn sie sicher waren, dass sie niemals zurückkehren würden. Ruban war mit siebzehn geflohen, und er schwor sich, dass er, sollte er überhaupt jemals zurückkehren, es als reicher Mann täte. Er würde im Hotel Nacional wohnen, zusammen mit den Touristen aus Europa. Er würde den ganzen Tag Mojitos trinken und sich faul auf den weißen Sandstränden von Varadero fläzen. Aber vorher hatte er noch etwas zu tun.
Sein eigentlicher Job als Restaurantmanager forderte ihm zu viel Zeit ab, um einem Hobby zu frönen, dennoch hatte Ruban eines: seine Pistolensammlung. Es waren vor allem russische Modelle, die ihm bei diesem neuen Job eine gute Hilfe sein würden.
„Bereit, Ruban?“, fragte Pinky. Der Spitzname war an ihm hängen geblieben. Nicht einmal seine Frau nannte ihn Karl.
„Legen wir los“, erwiderte Ruban.
Ruban und Pinky setzten sich Sonnenbrillen auf, um ihre Augen zu verbergen, und zogen sich Skimasken über den Kopf. Sie stiegen aus dem Truck und hievten sich auf die Laderampe der Lagerhalle. Pinky zog seine Makarow hervor, während sie in die Lagerhalle liefen. Ruban gab die Befehle, zuerst auf Englisch und dann noch einmal auf Spanisch.
„Runter auf den Boden! Alle runter!“
Die Situation war genau so, wie sie Ruban beschrieben worden war. Eine riesige Lagerhalle, vollgestellt mit Kisten, zwischen denen Fetzen von Plastikfolie herumlagen. Direkt neben den Türen lagen Säcke aus Segeltuch, die nur von einer Handvoll unbewaffneter Wachen und Arbeiter geschützt wurden. Sie gehorchten auf der Stelle und warfen sich zu Boden.
Die Diebe bewegten sich schnell. Ruban schnappte sich vier Säcke, zwei in jeder Hand, beinahe sein eigenes Körpergewicht in Fünfzig- und Hundert-Dollar-Scheinen. Pinky fuchtelte mit seiner Makarow herum und erlaubte sich keine einzige Sekunde der Unachtsamkeit, schnappte sich aber zwei weitere Säcke mit der freien Hand.
„Wie Zementsäcke“, meinte Ruban und ächzte. Leicht verdientes Geld hieß nicht, dass es auch leicht zu tragen war. Ein Sack fiel auf den Boden, als sie zum Truck zurückliefen
„Shit!“
„Lass ihn liegen! Los, weiter, weiter!“
Sie ließen ihn liegen, warfen die fünf restlichen Säcke von der Laderampe auf die Transportfläche des Trucks und sprangen wieder ins Fahrerhäuschen.
„Vaya!“
Jeffrey trat aufs Gas. Der Truck schoss davon. Die Männer zogen sich die Skimasken vom Kopf und klatschten mit lauten High fives ab, während sie sich selbst johlend und grölend zu ihrem Erfolg gratulierten. Jeffrey spürte die Erregung. Vielleicht ein bisschen zu sehr.
„Hey, Ruban?“ Er fuhr so schnell, dass das Lenkrad in seinen Händen vibrierte. „Sag mir noch mal, wohin wir fahren?“
Ruban schlug ihm auf den Arm. Sie waren die Flucht endlose Male durchgegangen. „Scheiße, Jeffrey! Bieg hier ab!“
Eine scharfe Rechtskurve, und die Reifen quietschten, als sie ein Stoppschild überfuhren. Sie steckten tief im Lagerhaus-Bezirk.
„Links!“, rief Ruban.
Jeffrey lenkte sie in Richtung von Frank’s Fliesen & Marmor Depot. Es hatte sonntags geschlossen, aber die Garagentür stand offen, als sie sich näherten. Der schwarze Pick-up fuhr hinein, vorbei an Paletten voller Fliesen und Marmor, die sich zu beiden Seiten bis an die Decke stapelten. Während sich das Garagentor hinter ihnen schloss, öffnete sich eine Ladetür vor ihnen. Sie führte zur hinteren Laderampe, an die ein großer Lastwagen rückwärts direkt herangefahren worden war. Sein Rolltor stand offen. Jeffrey fuhr den Pick-up direkt in den leeren Laderaum des Lasters, hielt an und schaltete die Scheinwerfer ein, damit sie etwas sehen konnten. Ruban und Pinky sprangen aus dem Fahrzeug, sicherten die Achsen mit Ketten am Boden des Lasters und blockierten die Reifen mit Holzkeilen.
„Fertig!“, rief Ruban.
Pinky zog das Rolltor herunter, und Ruban schlug gegen die Metallwand hinter dem Führerhäuschen des großen Transporters. Der Fahrer war Marco, ein Staplerfahrer, der hier sonntags der einzige Sicherheitsmann war – und ein Freund von Pinky.
„Los!“
Sie sprangen auf die Ladefläche des Pick-ups. Segeltuchsäcke voller Geld lagen zwischen ihnen, als der Lastwagen vorwärtsrollte und sich von der Laderampe entfernte.
„In Sicherheit“, sagte Pinky. „Ein leichter Job!“
Ruban lehnte sich gegen einen der Säcke zurück, eine klumpige Matratze aus Geldscheinen. „Zu leicht.“
Das ist es, was mir Sorgen macht.
2. KAPITEL
Die Fahndung nach einem schwarzen Pick-up-Truck mit verlängertem Fahrerhaus lief auf Hochtouren.
Sie wurde vom FBI angeführt, aber es war eine ganze Buchstabensuppe von örtlichen und Bundesbehörden involviert, sie reichten von der FHP (Florida Highway Patrol) und dem FDLE (Florida Department of Law Enforcement) bis zum MDPD (Miami-Dade County Police Department) und ihrer Unterabteilung der Flughafensicherheit. Unzählige Einsatzfahrzeuge waren alarmiert und durchkämmten das Tri-County Areal, im Norden bis nach Palm Beach und im Süden bis zu den Florida Keys. In der Luft schwirrten Hubschrauber des FBI und des MDPD kreuz und quer durch den Himmel. Der schwarze Pick-up war ihr Heiliger Gral, aber sie suchten auch nach weggeworfenen Geldsäcken, Waffen, Latexhandschuhen oder Skimasken neben der Straße. Berücksichtigend, dass ethnisches Profiling ein gesetzliches No-go war, hielten die Gesetzeshüter die Augen nach Fahrzeugen auf, in denen drei Personen saßen. Möglicherweise suchten sie drei Latinos. Besonders verdächtig waren Fahrzeuge, die schnell fuhren und augenscheinlich versuchten zu entkommen. Die Zugangsstraße, über die die Räuber geflohen waren, war komplett abgeriegelt worden und die gesamte Lagerhalle und deren Umgebung mittlerweile ein gesicherter Tatort.
Special Agent Andie Henning war die Erste vom FBI, die an der Lagerhalle eintraf.
Andie begann gerade ihr fünftes Jahr beim Bureau, die sie bis auf die letzten sechs Wochen im Regionalbüro in Seattle verbracht hatte, wo sie achtzehn Monate bei der Abteilung für Bankraub verbracht hatte. Sie hatte sich einen Namen gemacht, als sie einen langwierigen Undercover-Auftrag im Yakima Valley durchgeführt hatte, und man hatte ihr noch mehr solcher Aufträge versprochen, wenn sie sich nach Miami versetzen ließe. Bisher war dieses Versprechen nicht eingelöst worden. Man hatte sie „Tom Cat“ zugewiesen, einer behördenübergreifenden Einsatztruppe, die sich auf die wachsende Zahl von Syndikaten konzentrierte, deren Fokus auf Frachtdiebstählen lag. Wenigstens hatte die Versetzung zweitausend Meilen zwischen Andie und ihren Exverlobten gebracht. Aber das war eine andere Geschichte.
„Ich seh schon, sonntagnachmittags schickt das FBI die Neulinge vorbei“, wurde sie von Lieutenant Elgin Watts von der Miami-Dade County Police begrüßt. Er war einer der Mitbegründer von Tom Cat.
Andie war nicht direkt ein „Neuling“, aber sie wusste, was er meinte. „Littleford ist unterwegs.“
Supervisory Special Agent Michael Littleford war der Chef der Abteilung für Bankraub des FBI, ein Veteran mit fünfundzwanzig Jahren Erfahrung.
Ein Dutzend Beamte von der MDPD waren bereits eingetroffen, die meisten von ihnen waren Tom Cat zugeteilt. Es war nicht Andies Aufgabe, ihnen mitzuteilen – zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt –, dass Tom Cat in diesem Fall nur eine Nebenrolle spielen würde. Der typische Frachtdiebstahl beinhaltete ganze Lkw-Ladungen, von Designerkleidung bis zu Medikamenten, und der Schlüssel für die Polizei, solche Fälle zu lösen, lag darin, die Lagerräume ausfindig zu machen, in denen die Syndikate ihr Diebesgut versteckten. In diesem Fall war das gestohlene Geld unterwegs zur Federal Reserve Bank gewesen, und das Lagerhaus war nur der Ausgangspunkt der Suche. Das FBI würde seine Zuständigkeit bei Bankraub geltend machen, sobald Littleford hier eintraf.
„Wie viel haben die sich geholt?“, fragte Andie. Sie standen vor den sechsunddreißig Säcken voller Bargeld, die die Räuber unangetastet gelassen hatten. Der leere Geldtransporter war nicht bewegt worden, seine Türen standen noch immer weit offen.
„Wir sind noch nicht sicher“, antwortete Watts. „Aber wenn Sie auf unnützes Wissen stehen: Ich würde sagen, wenigstens ein paar Millionen mehr als beim Lufthansa-Raub am JFK-Flughafen. Wir könnten hier einen neuen Rekord haben.“
Jeder Polizist, der einmal einen Bankraub oder den Überfall auf einen Geldtransporter bearbeitet hatte, wusste von dem Überfall am JFK, aber dies war nicht der Augenblick, um den Wert des Dollars von 1978 mit dem des einundzwanzigsten Jahrhunderts zu vergleichen. „Wer war als Erstes am Tatort?“
„Officer Foreman. Er sitzt in der Flughafenstation des MDPD.“
„Wie viele Zeugen?“, fragte Andie.
„Vier Wachen und vier Lagerhausangestellte. Sie sitzen dort drüben, bei Foreman“, erklärte er und deutete mit einem knappen Nicken in ihre Richtung.
Andie fragte sich, welcher von ihnen seine Uniform gegen eine Gefängniskluft tauschen würde. „Einen Job wie diesen zieht man nicht ohne die Informationen eines Insiders durch.“
„Stimmt“, sagte Watts.
„Was ist mit der Kameraüberwachung?“
„Zwei Kameras draußen, vier hier drinnen. Sie werden alle von der Flughafensicherheit im Hauptterminal überwacht. Die Gauner waren hier wieder raus, bevor man dort etwas bemerkt und die Polizei gerufen hat.“
„Denken Sie, derjenige, der die Monitore überwacht, steckt mit drin? Dass er vielleicht in die andere Richtung geguckt hat?“
„Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich habe mit dem Leiter der Flughafensicherheit gesprochen. Dieses Wochenende sind sie unterbesetzt, es gab nur drei Leute, die Dutzende von Monitoren im Auge behalten mussten, die das gesamte Flughafengelände zeigen.“
„Sollten sie sich nicht ein bisschen mehr auf diese Lagerhalle konzentrieren, wenn hier hundert Millionen Dollar Bargeld durch den Zoll laufen?“
„Die Bestimmungen sehen vor, dass die Mitarbeiter vor den Monitoren nicht im Vorfeld darüber informiert werden, dass eine Geldlieferung eintrifft. Und auch niemand anderes, der nicht Teil jener sehr kleinen Gruppe ist, die unbedingt Bescheid wissen muss. Das ergibt auch Sinn: Je mehr Fünfzehn-Dollar-pro-Stunde-Mitarbeiter exakt wissen, wann hier hundert Millionen Mäuse über den Boden verteilt herumliegen, desto mehr Menschen sind versucht, sich einen Insider-Job zusammenzubasteln.“
Dieser Logik konnte Andie nicht widersprechen, aber sie vermutete dennoch, dass hier ein Insider am Werk war. Ihr Blick glitt zurück zu den acht Männern, die während des Überfalls in der Lagerhalle gewesen waren – insbesondere die Wachmänner des Geldtransporters.
„Auf wen davon haben Sie ein besonderes Auge geworfen?“, fragte Andie.
„Eine der Wachen. Octavio Alvarez. Ein Kuba-Amerikaner.“
Watts bewies die Voreingenommenheit, die er sich bei Tom Cat angeeignet hatte, wo die sogenannte „Kuba Connection“ fester Bestandteil jeder Untersuchung zu einem Frachtüberfall war. Miamis kubanisch-amerikanische Verbrecherbanden suchten ihren Nachwuchs unter den Kubanern in Havanna oder anderen Städten auf der Insel. Der Preis für einen Trip nach Florida war ein unbefristetes Dasein als „Hafenratte“, die Lkw-Ladungen gestohlener Güter abladen musste, meist gefolgt von einer Reihe von Überfällen im ganzen Land. Für einige junge Männer war das Risiko, in den USA eingesperrt zu werden, verlockender als die Vorstellung, auf einem undichten Boot das haiverseuchte Meer nach Florida zu überqueren.
„Wieso Alvarez?“, fragte sie.
Er zuckte mit den Schultern. „Bauchgefühl.“
Es war möglich, dass er mit seinem Bauchgefühl richtiglag, aber Andie versuchte, ihren Kopf von den ganzen Stereotypen zu befreien, die in einem Tom-Cat-Fall angebracht gewesen wären. Frachtdiebstahl gehörte beim FBI zur Kategorie des „Schweren Diebstahls“ und wurde ebenso behandelt wie gestohlene Juwelen, Kunst, Fahrzeuge und Ähnliches. Bankraub gehörte zur Abteilung „Gewaltverbrechen“, wo es gemeinsam mit Gang-Verbrechen, Entführung, Auftragsmord und Serienmorden rangierte. Es ging hier nicht um Revierverhalten. Aber je nachdem, aus welcher Kategorie man Verbrechen ermittelte, bedurfte es einer anderen Ausbildung, eines anderen Denkens der Beamten, und es veränderte die Art, wie man die Fakten betrachtete. Soweit es kriminelle Unternehmungen betraf, beinhaltete Frachtdiebstahl ein verhältnismäßig geringes Risiko, während Diebe, die einen Geldtransport aufs Korn nahmen, historisch betrachtet einen Hang dazu aufwiesen, irgendwann tot oder im Gefängnis zu enden. Das „Bauchgefühl“, dem ein Ermittler früh in einer Ermittlung folgte, konnte entscheidend für die Aufklärung sein, was Andies Meinung zufolge unterstrich, wie wichtig es war, dass das FBI die Kontrolle für den Fall übernahm.
Wo zur Hölle stecken Sie, Littleford?
„Ich will mit sämtlichen Wachen sprechen“, sagte Andie.
„Dann beeilen Sie sich lieber. Braxton Security wird jeden Augenblick ihre Anwälte hier haben. Für den Informationsfluss ist das selten eine gute Sache.“
Andie warf einen Blick auf ihre Uhr. Littleford besaß eine „Ärmel hoch“-Mentalität, und sie wusste, dass er bei der Zeugenbefragung dabei sein wollen würde. Sie würde ihm noch zwei Minuten geben, höchstens.
„Erzählen Sie mir mehr über die Überwachungskameras. Was haben wir da?“
„Nicht viel mehr als von den Augenzeugen. Die Außenkameras bestätigen, dass das Fluchtfahrzeug ein schwarzer Ford F-150 ist. Man erkennt sogar ein Kennzeichen, aber es wurde einer alten Lady in Doral von ihrem Cadillac gestohlen, hilft uns also nicht weiter. Die Kameras innen zeigen beide Täter, aber im Grunde bleibt uns auch damit nur die Information, es mit zwei Männern von durchschnittlicher Größe und Gewicht zu tun zu haben, die Skimasken und Sonnenbrillen trugen.“
„Ich werde meine Techniker anweisen, ob sie das Ganze etwas vergrößern können.“
Andie schickte eine kurze Nachricht an ihren Kollegen aus der technischen Abteilung und ging dann zum Frachtlift hinüber. Watts zeigte ihr, wo der schwarze Pick-up geparkt hatte, und deutete auf den Geldsack, der es nie bis zum Fluchtfahrzeug geschafft hatte. Er lag noch immer genau dort am Boden, wo die Diebe ihn verloren hatten.
„Teurer Fall von ‚Oops, runtergefallen‘“, meinte Andie. „Suchen Sie nach Fingerabdrücken.“
„Wir werden mit Sicherheit welche finden, aber nicht von den Tätern. Die Zeugen sagen aus, dass sie Handschuhe trugen.“
Ein FBI-Van fuhr vor und hielt außerhalb der Halle neben den Frachttoren. Etliche Agents sprangen heraus und betraten die Halle. Ein zweiter Van kam direkt dahinter zum Stehen. Special Agent Littleford schwang sich auf die Laderampe und betrat ebenfalls das Lagerhaus.
„Was haben wir?“, sagte er zu Watts. „Und von hier an übernimmt das FBI den Fall.“
Die direkte Art. Andie hörte zu, als Watts Littleford dieselbe Zusammenfassung gab wie ihr, anschließend stellte Littleford selbst ein paar Fragen.
„Es fielen keine Schüsse? Haben Sie das überprüft?“, fragte er.
„Korrekt. Keine Schüsse.“
„Wie gut waren die Täter bewaffnet?“
„Wenigstens eine Pistole. Die Zeugen stimmen überein, dass es sich wohl um eine Halbautomatik handelte.“
„Ich habe die Techniker bereits angewiesen, das Überwachungsvideo zu untersuchen“, meinte Andie. „Hoffentlich können wir darauf Hersteller und Modell der Waffe erkennen.“
„Die sie mittlerweile bestimmt längst entsorgt haben, wenn sie clever sind“, meinte Littleford.
Watts stimmte zu. „Wirkt auf mich, als hätten sie gewusst, dass keine der Wachen bewaffnet sein würde, und als hätten sie möglichst viele Hände frei haben wollen, um die Geldsäcke zu tragen. Aber wir können sicher davon ausgehen, dass sie im Fahrzeug noch mehr Feuerkraft verstaut hatten, um eine Verfolgung abzuwehren. Die Fahndungsmeldung weist darauf hin, dass sie bewaffnet und gefährlich sind.“
Littleford begann, durch das Lagerhaus zu laufen, und nahm Andie mit sich. „Reden wir mit den Zeugen“, sagte er, blieb dann aber abrupt neben dem Geldsack stehen, den die Räuber fallen gelassen hatten.
„Das hier ist unser neuer bester Freund“, meinte er. „Selbst wenn sie Handschuhe anhatten und keinen einzigen Abdruck hinterlassen haben.“
„Wieso das?“, fragte Andie.
„Wir haben keine abgefeuerten Schüsse, kein Blut und keine Verletzten. Nun, das wird sich ändern. Ich muss kein Mäuschen spielen, um zu wissen, dass die Typen jetzt schon streiten: ‚Alter, du hast den Sack fallen lassen. Damit schrumpft dein Anteil an der Beute.‘ Oh, das wird hässlich. Wirklich hässlich.“
Andie erwiderte sein schmales Polizistenlächeln. Das hier war zwar nicht die Undercover-Arbeit, für die sie sich ans andere Ende des Landes hatte versetzen lassen, aber ihr gefiel Littlefords Art, den Fall anzugehen.
„Kommen Sie“, sagte er, „finden wir ihren Insider.“
3. KAPITEL
Fünf versiegelte Segeltuchsäcke lagen auf einem Haufen, ein buchstäblicher Berg aus Bargeld, der auf dem rissigen und mit Öl befleckten Garagenboden thronte.
Die Geldsäcke aus dem Flucht-Lkw in den Kofferraum von Rubans Auto umzuladen, war ohne jeden Zwischenfall geglückt. Marco aus dem Fliesenlager hatte ihnen den „geliehenen“ schwarzen Pick-up besorgt, und es war seine Aufgabe, ihn loszuwerden. Jeffrey und sein Onkel waren in unterschiedlichen Autos davongefahren. Ruban fuhr mit dem Geld weiter, aber erst, nachdem er all seinen Komplizen versichert hatte, dass sämtliche fünf Säcke versiegelt bleiben würden, bis es an der Zeit war, die Beute aufzuteilen. Sie einigten sich darauf, dass das noch heute Nacht geschehen sollte, in der Garage des gemieteten Hauses der Betancourts.
„Mach sie auf, Bruder“, sagte Jeffrey.
Ruban stand über die Säcke gebeugt mit einem Küchenmesser in der Hand da. Pinky stand neben ihm. Sie waren nur zu dritt. Die anderen würden ihr Geld später bekommen.
„Augenblick“, meinte Pinky. „Was, wenn da so einer von diesen blauen Farbbeuteln drin ist? Ihr wisst schon, die explodieren und einem das Gesicht mit Farbe bespritzen, wenn man den Sack öffnet.“
„Alvarez meinte, es gäbe keine Farbbeutel“, erwiderte Ruban.
„Was, wenn sich beim Öffnen eine Art Peilsender aktiviert?“
„Alvarez sagt, es wäre alles in Ordnung. Es gibt nichts als das Geld da drin.“
Jeffrey kicherte. „Die Volltrottel sollten mehr Krimiserien gucken. Mach sie auf, Bruder.“
Ruban versuchte, die Messerspitze in den Sack zu stoßen, und brach beinahe die Klinge ab. Der Beutel war undurchdringlich. „Ich brauch was Stärkeres.“
Jeffrey holte eine Bohrmaschine und einen Stahlbohrer vom Werkzeugregal. Ruban benutzte ihn wie eine Stichsäge, um ein etwa faustgroßes Loch in den Boden des Sacks zu schneiden. Er griff ungeduldig hinein, packte zu und zog Geldbündel um Geldbündel durch die Öffnung. Der Sack spie Fünfzig- und Hundert-Dollar-Scheine aus, bis er leer war.
„Hei-liii-ge Scheiße“, stieß Jeffrey aus und starrte auf den Geldberg am Betonboden.
„Hübsch, oder?“, meinte Ruban. „Und es gibt noch vier weitere davon.“
„Wer wird es zählen?“, fragte Pinky.
„Das mach ich“, antwortete Jeffrey.
„Du kannst gar nicht so weit zählen.“
„Dann lassen wir Savannah sie zählen“, schlug Jeffrey vor. „Sie wird das hinkriegen.“
Savannah war Rubans Frau und Jeffreys jüngere Schwester. Ein beliebter Witz in der Familie besagte: „Savannah hat zwar das Aussehen, aber dafür hat Savannah den Verstand“ – was, aus unerfindlichen Gründen, ihren Bruder Jeffrey immer zum Lachen brachte. Sie war eine Latino-Schönheit ohne Jeffreys Gewichtsprobleme. „Wow“, „hinreißend“, „sexy“ und „linda, como su madre“ war die übliche Art und Weise, mit der sie beschrieben wurde. Ruban war gut aussehend, nicht im klassischen Sinne, eher im Marc-Anthony-Bad-Boy-Sinn, daher war offensichtlich, weshalb er sich in die Mädchen-von-Nebenan-Version von J-Lo verliebt hatte. Einige meinten, dass es nichts gäbe, das er nicht tun würde, um sie bei sich zu behalten.
„Savannah ist nicht zu Hause“, meinte Ruban. „Dafür habe ich gesorgt.“
„Wie viel weiß sie?“, fragte Pinky.
Ruban sah seinen Partner direkt an, um sicherzugehen, dass er gut zuhörte. „Nada. Savannah weiß nicht das Geringste.“
„Aber irgendwann muss sie es erfahren“, sagte Jeffrey.
„Sie wird es erfahren, wenn ich so weit bin, es ihr zu erzählen. Verstanden?“
„Ja, sicher. Was immer du sagst.“
„Ich werde das Geld zählen“, erklärte Ruban.
Es dauerte Stunden, die Säcke aufzuschneiden, jeden einzelnen Schein zu zählen und den Anteil jedes Beteiligten in einem gesonderten Haufen zu stapeln. Dreimal entschuldigte Jeffrey sich, um „mal das Bad zu benutzen“. Jedes Mal kam er völlig aufgekratzt zurück und zog ständig die Nase hoch. Unfähig, still zu stehen, marschierte er in einem weiten Kreis unablässig um das Geld. Es war offensichtlich, dass er sich mit Koks vollgepumpt hatte, eine Droge, für die Ruban keine Verwendung hatte. Einige Typen behaupteten, es wäre ein Aphrodisiakum, aber soweit Ruban das betrachten konnte, bewirkte Koks nur eines: dass man noch mehr Koks wollte.
Um Mitternacht lagen sieben Stapel auf dem Boden. Ruban läutete die letzte Kontrollrunde ein. Sie hatten eine Million für Alvarez, den Insider aus der Wachmannschaft des Geldtransporters. Eine weitere Million für Marco.
„Der Rest gehört uns“, erklärte Ruban. „Durch drei geteilt.“
„Wie viel? Wie viel?“, fragte Jeffrey.
„Zwei Komma fünf Millionen und Kleingeld.“
„Ju-huu! Warte mal, ist das vor oder nach den Steuern?“
Es war spät, Ruban war erschöpft, und er war nicht in der Stimmung für die Witze seines Schwagers. „Hör zu“, sagte er. „Ich werde dafür sorgen, dass Alvarez sein Geld bekommt. Pinky, hast du mit Marco was abgemacht, wann er seinen Anteil erhalten soll?“
Pinky hatte Marco dazugeholt. Sie hatten sich im Gefängnis kennengelernt. „Ich kümmere mich darum.“
„Verdammt, Pinky. Ich will nicht, dass irgendwelche Telefonate durchs Netz sausen, in denen es darum geht, die Beute aufzuteilen. Ich habe Alvarez klare Anweisungen gegeben: Der dritte Dienstag, acht Uhr morgens, an der Ecke U. S. 1 und Bird. Bäm. Octavio weiß, wo er zu sein hat, und man braucht keine Telefonate. Du und Marco hättet das genauso machen sollen.“
„Alvarez ist was anderes. Das FBI wird die Wachmänner im Auge behalten. Keiner von denen weiß, dass er Marco im Auge behalten sollte.“
„Wir können uns keine Fehler erlauben.“
„Ich hab ’ne Idee“, wandte Jeffrey ein. „Ich nehme meinen Anteil jetzt mit. Heute Nacht werde ich fai-ärn.“
„Nein, wirst du nicht“, erwiderte Ruban. „Wir werden den Ball flach halten, ganz unten.“
„Unten, ah-hah, ganz unten“, sagte Jeffrey in der tiefen, rhythmischen Stimme eines Rappers. Er drückte den Rücken durch und imitierte einen Limbo-Tanz, wobei ihm das Hemd hochrutschte und seinen riesigen Bauch über dem Gürtel entblößte. „Wie tief … kommst du runter … Bruder?“
Ruban schlug ihm mit der flachen Hand gegen die Stirn, sodass Jeffrey auf den Hintern plumpste. „Ich mein’s ernst. Hör auf rumzualbern.“
Jeffrey rappelte sich hoch. „Es ist mein Geld, Bruder.“
„Wir hängen da gemeinsam drin. Wenn einer von uns geschnappt wird, werden wir alle geschnappt.“
„Wenn sie mich keschen, werd ich keinen von euch verpfeifen“, meinte Jeffrey.
„Hör mir einfach zu“, erwiderte Ruban. „Es wird so gemacht, wie ich es sage: Wir gehen nicht raus, um zu saufen oder zu feiern. Wir wedeln nicht mit Geldscheinen rum. Wir stehen alle auf und tun das, was wir an jedem verdammten Montagmorgen tun.“
„Cool. Dann schlaf ich bis Mittag“, sagte Jeffrey.
„Die perfekte Tarnung für dich wäre, da rauszugehen und dir einen Job zu suchen“, sagte Ruban.
„Scheiß drauf“, erwiderte Jeffrey. „Ich werde ab jetzt nie wieder arbeiten müssen.“
„Es geht um die Wahrnehmung“, sagte Ruban. „Hast du je den Film Goodfellas gesehen, Jeffrey?“
„Nein. Was ist das? Ein Schwulenporno?“
„Es geht um die Jungs, die den größten Überfall aller Zeiten durchgeführt haben, den Lufthansa-Raub am JFK International Airport. Der Überfall lief perfekt.“
„Wie bei uns.“
„Ja. Außer, dass wir nicht so enden wollen wie die. Die haben schon Koks geschnupft, bevor sie anfingen, das Geld zu zählen. Am Ende gab es einen verdammten Mafiakrieg. Ein gutes Dutzend Jungs ging dabei drauf.“
„Ja? Und? Das waren aber nicht wir.“
„Das könnten wir aber sein. Das hier ist kein Spiel, Bruder. Wir dürfen nicht auffallen.“
„Und was machen wir mit der Kohle, während wir nicht auffallen?“, fragte Jeffrey.
„Wir verstecken es“, erklärte Ruban. „Neunzig Tage, Minimum. Wir tun so, als wäre das hier alles nie passiert.“
„Nein, nein“, warf Pinky ein. „Wir müssen es waschen. Ich hab das in diesem Ben-Affleck-Film gesehen. Du kaufst jede Menge Scheiß, du gehst ins Casino, du …“
„Vergiss es“, sagte Ruban. „Das Geld zu waschen ist genau das, was die Bullen von uns erwarten. Wenn wir tun, was sie erwarten, werden wir geschnappt.“
„Also, was genau meinst du mit verstecken?“, wollte Pinky wissen.
„Ganz einfach. Zuerst packen wir das Geld in Vakuumbeutel.“
„Du meinst Staubsaugerbeutel?“, fragte Jeffrey.
„Nein, Idiot. Die sind für eine Maschine. Die habe ich bereits gekauft. Sie versiegelt Dinge in Plastik, sodass keine Luft und kein Wasser eindringen kann. Man kann sie für alles benutzen, Nahrung, Kleidung …“
„Geld.“
„Ganz genau. Also versiegeln wir die Geldbündel in Päckchen, die alle zwischen zehn- und fünfundzwanzigtausend Dollar enthalten, und stopfen die Päckchen in ein Plastikrohr. Auch das Rohr habe ich bereits besorgt.“
„Okay, und was dann?“
Ruban ging hinüber zum Werkzeugregal auf der anderen Seite der Garage und schnappte sich eine Schaufel. „Wir verbuddeln es.“
„Du willst siebeneinhalb Millionen Mäuse in der Erde versenken?“, fragte Pinky.
„Japp.“
„Wo?“
Ruban erlaubte sich ein schmales Lächeln. „Wo niemand es finden wird.“
Jeffrey verzog das Gesicht. Es war deutlich, dass ihm die Idee nicht gefiel. Pinky äußerte seinen Missmut etwas deutlicher: „Das ist dämlich. Marco und Octavio bekommen ihr Geld, und wir sollen unseres einbuddeln?“
„Mit den Kerlen bin ich nicht verwandt“, erwiderte Ruban. „Wir sind eine Familie. Wir müssen als eine Einheit arbeiten. Und diese Einheit wird schön unter dem Radar bleiben.“
„Fein“, sagte Pinky. „Versiegel das Geld, und jeder von uns verbuddelt seinen eigenen Anteil.“
„Ich vertraue euch aber nicht, dass ihr es vergrabt“, meinte Ruban.
„Und ich vertraue dir nicht, mein Geld zu behalten“, antwortete Pinky.
„Das ist nicht zu verhandeln“, gab Ruban zurück. „Ich habe hier das Sagen.“
„Nicht, was mein Geld angeht; ganz sicher nicht.“
„Meins auch nicht“, schaltete Jeffrey sich ein.
„Halt dich da raus, Jeffrey“, blaffte Ruban.
Pinky kam einen Schritt auf ihn zu. „Gib mir mein Geld, Kumpel, bevor das hier hässlich wird.“
Jeffrey trat nervös von den beiden zurück. „Jungs, kommt schon. Lasst uns nicht streiten.“
Pinky zog sein Handy aus der Tasche, den Blick fest auf Ruban gerichtet. „Niemand streitet hier. Entweder spaziere ich hier mit meiner Kohle raus, oder ich rufe meine süße kleine Nichte an und erzähle ihr, was ihr Ehemann in letzter Zeit so treibt.“
„Ich werd’s ihr schon selbst sagen“, meinte Ruban.
„Bullshit“, stieß Pinky aus. „Du willst nur so lange auf dem Geld sitzen bleiben, bis dir irgendeine Ausrede eingefallen ist, wo du es herbekommen hast, ohne es zu stehlen.“
Ihre Blicke blieben fest ineinander verhakt und wurden immer schneidender. Keiner von ihnen blinzelte, und Ruban konnte das Prickeln in der Luft spüren, als sich die Machtverhältnisse verschoben. Die Flitterwochen hatten noch nicht einmal richtig begonnen.
Und schon waren sie wieder vorbei.
4. KAPITEL
Es war fünf Uhr morgens, als Ruban nach Hause kam. Er versuchte, Savannah nicht aufzuwecken, als er sich ins Bett schlich, aber sein Kopf fiel so schwer aufs Kissen, dass sie aufwachte. Sie kuschelte sich an ihn.
„Wie ist es gelaufen?“, fragte sie.
Er hatte ihr erzählt, dass Jeffrey wieder Koks nahm, was sogar stimmte, und dass er ihn für eine „Intervention“ besuchte, die möglicherweise länger dauern würde, was gelogen war. Seine Muskeln schmerzten noch immer vom Vergraben des Geldes: sein Anteil zusammen mit Octavios und einigem von Jeffreys Geld. Pinky hatte seinen Willen bekommen.
„Ich mache mir wirklich Sorgen um Jeffrey“, erzählte er ihr.
„Dafür liebe ich dich so sehr. Ich wüsste nicht, was meine arme Mutter ohne dich tun würde. Hat Jeffrey es dir schwer gemacht?“
„Oh ja. Er hat sich ziemlich quergestellt.“
Pinkys Beharren, dass jeder von ihnen seinen eigenen Anteil verstecken sollte, hatte Jeffrey ermutigt, und irgendwann war der Dritte Weltkrieg ausgebrochen und Jeffrey nur schwer dazu zu bringen gewesen, einen „Notgroschen“ von fünfhunderttausend Dollar zurückzulassen, die Ruban vergraben konnte. „Du kannst den Rest haben und selbst verbuddeln“, hatte Ruban ihm erzählt. „Aber sobald ich mitbekomme, dass du mit Geld um dich schmeißt, bist du die halbe Million hier los, klar?“ In jenem Augenblick hatte das wie eine gangbare Lösung gewirkt, aber mittlerweile waren Ruban Zweifel gekommen.
„Ich fürchte, er wird uns alle in den Abgrund reißen“, sagte er.
„So schlimm wird es nicht werden“, erwiderte sie.
„Sei dir da nicht so sicher“, gab er zurück. Sie redeten über völlig verschiedene Dinge, aber Ruban war noch nicht so weit, ihr von dem Geld zu erzählen. Nicht jetzt jedenfalls.
„Jeffrey kann uns nichts tun“, meinte sie.
„Natürlich kann er das. Er ist ’ne Koksnase.“
Sie strich mit den Fingern sanft über seine Brust. „Er, ja. Aber wir nicht. Du bist stark. Du bist klug. Du hast eine wunderschöne, erotische Ehefrau.“ Sie küsste seinen Mundwinkel, aber er reagierte nicht.
„Ein kleiner Fehler, und das ist alles futsch“, sagte er. Er stützte sich auf die Ellenbogen und betrachtete Savannah in der Dunkelheit. Es fiel gerade genug Mondlicht durch die Jalousien, dass er etwas erkennen konnte. „Nur der winzigste Ausrutscher, mehr braucht es nicht. Puff, schon hast du alles verloren.“
„Ruban, du machst mir Angst.“
Er zögerte und fragte sich, ob das die richtige Zeit war. Dann gab er nach. „Heute Nacht ging es nicht um Jeffreys Kokssucht.“
„Was?“
„Es ging um Geld.“
„Du meinst, unser Geld?“
Er antwortete nicht. Sie sah ihn besorgt an. „Ruban, stecken wir wieder in finanziellen Schwierigkeiten?“
Die Furcht in ihrer Stimme war eine unwillkommene Erinnerung an schlechte alte Zeiten, in denen sie nachts wach gelegen und sich gefragt hatten, wie lange sie noch ihre Hypothekenzahlungen würden leisten können. In denen sie sich fragten, ob die Bank ihnen noch helfen würde. Ob sie die Zwangsvollstreckung verhindern konnten. Ob morgen der Tag war, an dem die Polizei mit einem Gerichtsbeschluss vor ihrer Tür stünde, um sie und ihren Besitz auf die Straße zu werfen. Es war eine Reise, die sie gemeinsam durchgestanden hatten, und er war auf jedem schmerzhaften Schritt davon immer ehrlich zu ihr gewesen. Das hier war etwas anderes. Savannah war kein Teil davon.
„Jeffrey hat diesmal wirklich Scheiße gebaut“, sagte er.
„Braucht er Geld? Bitte gib ihm kein Geld, damit er sich Drogen kaufen kann.“
„Nein. Das ist es nicht.“
Ruban griff nach seinem Smartphone auf dem Nachttisch, rief die Titelseite des Miami Herald auf und reichte ihr das Gerät. Sie las den Artikel stumm, ihr irritiertes Gesicht beleuchtet von dem Handydisplay.
„Willst du mir sagen, dass Jeffrey in diese Sache verwickelt ist?“
„Ja“, sagte Ruban. „Jeffrey und dein Onkel.“
„Oh nein. Ich schwöre dir, ich wünschte, mein nichtsnutziger Onkel wäre nie aus dem Gefängnis gekommen. Es gibt kein Familienmitglied, das er nicht beschämt oder verletzt hat. Das war immer meine größte Sorge – dass Jeffrey eines Tages in seine Geschichten verstrickt sein würde.“
„Oh, er ist wirklich tief verstrickt.“
Sie warf einen Blick auf das Display, und ihre Augen weiteten sich. „Hier steht, dass die geraubte Summe in die Millionen gehen könnte. Sie haben das alles gestohlen?“
„Mit ein paar anderen Jungs zusammen.“
„Wem?“
„Einem von Pinkys Freunden“, antwortete er – eine Halbwahrheit. „Sie haben neun Komma sechs Millionen erbeutet.“
„Wo steht das?“, fragte sie und überflog den Artikel erneut.
„Das steht da nicht.“
„Woher weißt du es dann?“
Wenn er es ihr sagen wollte, war das seine Gelegenheit. Aber es war schwer, mit offenen Karten zu spielen, wenn ein Teil von ihm noch immer nicht glauben konnte, dass er so eine Sache überhaupt nur versucht hatte, ganz zu schweigen davon, dass er damit durchgekommen war. Selbst nachdem er das Geld in seinen eigenen Händen gehalten hatte, fühlte es sich einfach nicht an wie eine glaubhafte Wahrheit: Ruban Betancourt, kriminelles Superhirn hinter dem größten Raubüberfall in Miamis Geschichte.
„Ich war die ganze Nacht dort“, erklärte er. „Ich habe ihnen geholfen, ihren Anteil zu verstecken.“
Sie setzte sich auf, sprang förmlich nach oben wie ein Klappmesser. „Ruban – nein!“
Ihre Reaktion ließ ihn zusammenzucken und ermutigte ihn nur noch mehr, ihr die neue Wahrheit zu erzählen. „Was hätte ich tun sollen, Savannah? Die zwei tauchten an unserer Haustür auf, mit Säcken voller Geld, die Polizei suchte nach ihnen, und sie wussten nicht, was sie tun sollten.“
„Sie sollten das Geld zurückgeben.“
„Du kannst nicht einfach das Geld zurückgeben, und die Sache löst sich in Luft auf. Das ist nichts anderes, als eine Bank zu überfallen, und dein Onkel hatte eine Pistole. Mit einer Waffe derartig viel Geld zu rauben, könnte sie beide für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis bringen.“
„Oh, meine arme Mutter.“
„Wir brauchen es deiner Mutter nicht erzählen. Wir brauchen es niemandem zu erzählen.“
Sie ließ sich zurück aufs Kissen fallen. „Was sollen wir nur tun?“
„Für den Augenblick ist alles unter Kontrolle. Sie haben versprochen, nichts von dem Geld auszugeben und es zu verstecken, bis wir wissen, was wir tun sollen.“
„Auf das Versprechen würde ich nichts geben!“
Da waren sie einer Meinung, aber er musste ihre Besorgnis irgendwie zerstreuen. „Es ist in Ordnung. Das Geld ist in versiegelten Beuteln vergraben.“
„Alles davon?“
Eine weitere Lüge konnte nicht schaden. „Ja. Alles davon.“
„Aber wenn du ihnen geholfen hast, das Geld zu verstecken, dann macht uns das zu Mittätern.“
Er nahm ihre Hand. „Nein. Es macht mich zu einem Mittäter. Nicht dich.“
Selbst in der Dunkelheit konnte er sehen, dass er ihr Herz berührt hatte. Sie setzte sich wieder auf und nahm ihn fest in die Arme.
„Oh, Liebling. Meine Familie ist so kaputt, und du verwendest so viel Zeit deines Lebens darauf, die Scherben aufzusammeln. Aber das hier ist viel mehr, als ich verlangen könnte.“
„Nein, wir sind alle eine Familie. Ich werde das in Ordnung bringen. Erzähl nur Jeffrey oder deinem Onkel nicht, dass du irgendetwas weißt. Sie vertrauen mir. Wenn sie herausfinden, dass ich es dir verraten habe, werden sie das Geld ausbuddeln, und die Hölle wird über uns hereinbrechen.“
„Ich werde kein Wort sagen. Aber bitte, lass uns nicht zu lange warten. Wir müssen uns schnell für etwas entscheiden.“
Sie umarmte ihn fest. Ruban legte sich zurück auf sein Kissen. Savannah kuschelte sich eng an ihn und legte ihren Kopf auf seine Brust.
„Glaubst du wirklich, du kannst das wieder in Ordnung bringen?“
„Ja. Alles wird gut. Denk nur daran: Das ist unser Geheimnis. Ich kümmere mich darum.“
„Okay. Ich verspreche es.“ Sie drehte sich auf ihre Seite.
Eine weitere Sache, die er auf die Liste eines Tages voller unglaublicher Dinge setzen konnte: Sie hatte es ihm abgekauft.
Ruban war todmüde, aber er konnte die Augen nicht schließen. Als er dort lag und an die Decke starrte, lief die Wahrheit wieder und wieder vor seinem inneren Auge ab. Er und Pinky, die in die Lagerhalle stürmten. Der Griff nach dem Geld. Die Flucht. Er schüttelte diese unvergesslichen Bilder ab und blickte hinüber zu seiner Frau. Die Kurven von Savannahs Körper, die sich unter dem Laken abzeichneten. Sie lag direkt neben ihm, so dicht wie eh und je – so dicht wie der Sack voller Geld, die zwei Millionen Dollar, die ihm aus der Hand geglitten waren und die er auf dem Boden des Lagerhauses hatte liegen lassen.
Denk nicht daran.
Er langte hinüber und ließ seine Hand sanft auf ihrer Hüfte ruhen. „Geht es dir jetzt besser?“, fragte er.
„Viel besser.“
Ruban sog tief die Luft ein und stieß sie aus. Die Klimaanlage schaltete sich aus, und Ruhe flutete das Schlafzimmer.
„Mir auch“, sagte er in die Dunkelheit.
5. KAPITEL
Am Montagmorgen fuhren Andie und Agent Littleford bei der Sicherheitsfirma Braxton Security vorbei. Eine ganze Flotte von Geldtransportern stand weniger als zwei Meilen von der Federal Reserve Bank von Miami entfernt geparkt, jenen Tresoren also, in denen offiziell 9,6 Millionen Dollar fehlten. Andie fragte sich, ob die Räuber sich gerade auf der anderen Straßenseite befanden, im Doral Country Club, Zigarren rauchten und den Gesetzeshütern eine lange Nase drehten, während sie sich auf dem getrimmten Grün des „Blue Monster“ amüsierten, einem der berühmtesten Golfplätze der Welt.
„Spielen Sie Golf, Andie?“, fragte Littleford.
Andie ließ den Blick kurz durch die Beifahrerscheibe streifen, als sie an den gepflegten Fairways vorbeifuhren. „Nö.“
„Sollten Sie je vierhundert Scheine hinlegen wollen, um sie gegen fünf Stunden Zorn und achtzehn Gründe, sich die Kehle wund zu fluchen, einzutauschen, ist das hier der perfekte Ort dafür.“
„Ich werd’s mir merken.“
Littleford sah aus, als könne er augenblicklich zu einer Runde Golf aufbrechen, offenbar trug er seine Khakihosen und sein kurzärmeliges Hawaiihemd nicht nur am Wochenende. Die Befragungen am Sonntagnachmittag an der Flughafen-Lagerhalle waren wie erwartet verlaufen. Niemand war eingeknickt, hatte gestanden oder um Gnade gewinselt.
Dafür hatten sich zwei der Wachmänner dafür empfohlen, sie heute noch einmal zu befragen. Besonders Alvarez. Andie und ihr Vorgesetzter trafen sich mit ihnen im Konferenzraum der Braxton-Büroräume. Der stellvertretende Konzernjustiziar, begleitet von einem jungen Anwalt des Unternehmens, war ebenfalls anwesend. Andie führte die Befragungen. Jede dauerte etwa eine Stunde. Sie holten Alvarez noch einmal zurück für eine kurze Nachbefragung. Die Anwälte von Braxton Security gaben grünes Licht, ihn auf etwas stärkerer Flamme zu rösten, ein Angebot, das Andie gerne annahm.
„Mr. Alvarez, lassen Sie es mich ganz deutlich sagen: Wir glauben, dass sie etwas verschweigen.“
„Ich? Nein. Ich verschweige nichts.“
Andie ließ zu, dass sich die Decke des Schweigens über ihnen ausbreiten konnte. Es war erstaunlich, was einer nervösen Zielperson rausrutschen konnte, wenn man sie ein wenig in ihrem eigenen Saft schmoren ließ, ohne dass irgendwelche Fragen im Raum standen.
Alvarez lebte seit gut fünfzehn Jahren in Miami, nachdem er nur sechs Monate nach seinem Highschool-Abschluss in Havanna hierhergekommen war. Es war unmöglich, einen Job bei Braxton Security zu bekommen, wenn man Vorstrafen hatte, und er hatte auch keine, zumindest nicht, seit er in dieses Land gekommen war. Andie fragte sich, was wohl in seiner Jugendakte stand, die unerreichbar in einem Land lag, das keinerlei Informationen mit den Vereinigten Staaten teilte.
Sie beugte sich vor und stützte ihre gekreuzten Unterarme auf dem Tisch ab. „Einer der Arbeiter im Lagerhaus sagt, er habe gesehen, wie Sie kurz vor dem Überfall Ihr Handy benutzt haben.“
Es war ein Bluff, aber das FBI war überzeugt, dass irgendjemand im Lagerhaus den Räubern ein Signal gegeben hatte. Der Typ blieb völlig ruhig.
„Das ist eine Lüge“, meinte Alvarez. „Ich benutze niemals mein Handy während der Arbeit.“
Andie zögerte keine Sekunde. „Lassen Sie mich ganz deutlich werden, Mr. Alvarez. Wir werden diese Lagerhalle auf den Kopf stellen und völlig umkrempeln. Vielleicht haben Sie das Handy von jemand anderem geklont, sodass es nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden kann. Vielleicht war es das Handy Ihrer Schwester oder ein Prepaid-Gerät. Ganz gleich, was für ein Telefon Sie benutzt haben, Sie müssen es irgendwo in diesem Lagerhaus entsorgt haben. Wir werden es finden. Ich gebe Ihnen eine letzte Chance, mir jetzt die Wahrheit zu sagen, bevor alle Angebote von unserer Seite vom Tisch sind.“
„Vielleicht haben Sie mich beim ersten Mal nicht richtig verstanden“, gab er ohne das geringste Zittern in der Stimme zurück. „Ich benutze niemals ein Handy während der Arbeit.“
„Wie Sie wollen“, meinte Andie. „Aber merken Sie sich, was ich Ihnen heute erzähle. Punkt eins: Octavio Alvarez war Teil eines Komplotts zur Schädigung des Finanzhandels, indem er an einem Raubüberfall beteiligt war, bei dem etwa neun Komma sechs Millionen US-Dollar mithilfe von echter und angedrohter Gewalt erbeutet wurden. Punkt zwei: Octavio Alvarez und seine Komplizen haben wissentlich ein Gewaltverbrechen verübt, indem sie eine Schusswaffe verwendet haben.
Ich schätze, für Punkt eins allein erwarten Sie fünfzehn Jahre in einem Bundesgefängnis, und weitere zehn bis fünfzehn Jahre für Punkt zwei. Und das sind nur die offensichtlichen Anklagepunkte. Ich bin mir sicher, der Staatsanwalt wird noch zwei oder drei weitere finden, die er mit dranhängt, inklusive einer Verurteilung zur Rückzahlung der Schadenssumme in voller Höhe, die Sie für den Rest Ihres Lebens verfolgen wird. Meiner Einschätzung nach werden Sie ein sechzigjähriger Mann sein, der sich wünscht, er könnte die Kosten für seine Viagra-Pillen bezahlen, wenn Sie wieder aus dem Gefängnis kommen und sich mit einer Frau vergnügen können. Haben Sie einen schönen Tag, Mr. Alvarez.“
Alvarez wandte sich an die Anwälte seiner Firma: „War es das?“
„Ja, Mr. Alvarez. Sie können gehen.“
Er stand auf, der junge Anwalt begleitete ihn zur Tür, und Alvarez verließ den Raum.
„Glauben Sie, er ist unser Mann?“, fragte der stellvertretende Justiziar.
„Schwer zu sagen“, meinte Littleford. „Wenn er es ist, wissen wir, dass er kein Handy benutzt hat, das auf seinen Namen läuft.“
„Woher wissen Sie das?“
Andie erklärte es. „Wir brauchen keinen Gerichtsbeschluss, um die Verbindungsinformationen eines Handys einzusehen. Das bedeutet, Zeit und Datum der Anrufe, die GPS-Koordinaten des Anrufers und die gewählten Nummern stehen uns zur Verfügung. Alvarez’ Handy ist für den gestrigen Nachmittag absolut sauber. Keine Anrufe. Das Gleiche gilt für alle Braxton-Wachmänner.“
„So sollte es auch sein“, meinte der Anwalt. „Unsere Männer dürfen während der Schicht nicht telefonieren.“
„Deshalb glauben wir, dass unser Insider ein Telefon benutzt hat, das nicht auf seinen Namen registriert ist, und das er irgendwo in dieser Lagerhalle entsorgt hat“, erklärte Littleford.
„Oder es könnte in tausend Einzelteile zerbrochen die Toilette hinuntergespült worden sein“, fügte Andie hinzu.
„Also, was kommt jetzt?“, wollte der Anwalt wissen. „Zapfen Sie sein Telefon an? Beschatten Sie ihn?“
„Wir werden es Sie wissen lassen“, meinte Littleford.
„Es gibt noch eine Sache, die wir besprechen sollten“, sagte Andie. „Die Belohnung.“
„Wir sind dran“, meinte der Anwalt. „Braxton wird zweihundertfünfzigtausend Dollar für Informationen bereitstellen, die zur Verhaftung und Verurteilung der verantwortlichen Personen und zur Rückerstattung des Geldes führen.“
„Damit habe ich ein Problem“, sagte Littleford.
„Das ist eine ziemlich große Belohnung. Was ist das Problem?“
„Sie sollten die Belohnung nicht an eine Rückerstattung des Geldes knüpfen.“
Der Anwalt lächelte mild, aber es war kein freundliches Lächeln. „Verstehen Sie mich nicht falsch, aber es ist der Job des FBI, die Diebe zu fangen. Braxtons größtes Interesse gilt der Wiederbeschaffung des Geldes.“
„Sie verlangen, dass jemand sein Leben riskiert, indem er sich vorwagt und mit dem Finger auf diejenigen zeigt, die das hier getan haben. Verhaftung und Verurteilung ist ausreichend. Seien Sie nicht das Arschloch, das sagt: ‚Sorry, wir haben nur neun von den neun Komma sechs Millionen zurückerhalten, also haben wir heute leider keine Belohnung für dich.‘ Damit sind Sie nicht besser als diese Autowerbung, die ein voll ausgestattetes Luxusauto für neunundneunzig Dollar im Monat anbietet, bei denen das Kleingedruckte dann aber verlangt, dass man bei Unterzeichnung des Kaufvertrags neunundzwanzigtausend Dollar hinblättern soll.“
„Da bin ich anderer Ansicht. Glücklicherweise wurde in diesem Fall niemand verletzt. Alles, worüber wir reden, ist Geld, also ist die Belohnung an dessen Rückzahlung gebunden.“
„Sie sehen das große Ganze nicht“, sagte Littleford.
„Ich versichere Ihnen, wir gehen sehr bedacht bei der Formulierung unserer Belohnungen vor.“
Littleford nickte, als würde er dem Mann zustimmen. „Lassen Sie mich Ihnen und Ihrer Firma eine etwas andere Perspektive näherbringen. Jeder erinnert sich an den großen Lufthansa-Raub im Dezember 1978, weil Martin Scorsese daraus einen Film gemacht hat.“
„Goodfellas. Ich weiß. In meinem Beruf ist der Film praktisch unverzichtbares Grundwissen.“
„Sehen Sie, das ist das Problem. Die Leute vergessen all die anderen Diebstähle, all die anderen Raubüberfälle in New York. Aber ich erinnere mich daran, weil mein alter Herr bei der New Yorker Polizei war, als ich noch ein Kind war. Ein Volltreffer wie dieser füllt die Köpfe von Dieben mit allen möglichen Ideen. Ein paar Monate nach dem Lufthansa-Raub gab es in New York achtzehn Banküberfälle – achtzehn in drei Tagen. Fünf am Montag, zehn am Dienstag und drei weitere am Mittwoch. Zwei davon waren große Dinger mit über einer Million Dollar Beute, wie am JFK-Flughafen. Bürgermeister Koch ist völlig ausgeflippt, er hat diese Leute in den Zeitungen und im Fernsehen gewarnt und daran erinnert, was mit John Dillinger geschehen ist.“
„Das ist eine schöne Geschichtsstunde, aber wir haben eine makellose Sicherheitsliste.“
„Geschichte wiederholt sich. Sie haben da jeden Tag eine Menge Geldtransporter auf Miamis Straßen. Hunderte von Gang-Mitgliedern und Kleinverbrechern mit großen Wünschen im Schädel sehen die Nachrichten über diesen Multimillionen-Dollar-Coup am Flughafen. Ein schneller Hinweis auf die Täter ist die schnellste Art, diesen Fall zu lösen. Und diese Jungs schnell zu fangen, ist der einfachste Weg, sicherzugehen, dass wir nächste Woche nicht plötzlich achtzehn weitere Überfälle auf Geldtransporter haben.“
Der Anwalt dachte einen Augenblick darüber nach. „Ich sehe, worauf Sie hinauswollen. Ich werde dem Hauptquartier nahelegen, dass wir die Belohnung auf Verhaftung und Verurteilung reduzieren. Keine Bedingung, dass wir das Geld zurückerhalten.“
„Clevere Entscheidung“, sagte Littleford. „Wenden Sie sich wegen weiterer Fragen an Andie, sie wird diese Ermittlung leiten.“
„Werde ich.“
„Sie hören von mir“, verabschiedete sich Andie.
Die Agents verließen das Büro und gingen zu ihrem Wagen. „Gute Arbeit da drinnen“, sagte Andie.
„Danke.“
Sie stiegen ein und schlossen die Türen. Die Sonne brannte auf sie nieder. Die Temperaturen waren seit ihrer Ankunft um wenigstens fünf Grad gestiegen und mittlerweile an der Dreißig-Grad-Grenze. Es war bestes Strandwetter. Littleford schaltete die Klimaanlage ein. „Ah, November in Miami“, sagte er. „Nicht ganz dasselbe wie in Seattle, oder?“
„Nein. Nicht ganz.“
Er legte einen Gang ein, behielt den Fuß aber auf der Bremse. „Hey, ich weiß, Sie haben sich nicht hierher versetzen lassen, um in meiner Einheit zu arbeiten, aber wir leisten hier gute Arbeit.“
„Das sehe ich.“
„Eine Menge junger Agents glauben, sie würden gerne diese Undercover-Aktionen machen, die Sachen, die sie aus dem Kino kennen. Ich will damit nur sagen: Mir gefällt, was ich in Ihnen sehe. Bleiben Sie also offen für Alternativen.“
Sie lächelte verstohlen. Streicheleinheiten wurden beim FBI nicht gerade großzügig verteilt. Besonders nicht an Andie in letzter Zeit. „Danke. Das werde ich.“
Littleford fuhr aus der Parklücke und auf die Straße. Sie passierten eine lange Reihe von Geldtransportern, die auf der anderen Seite des Maschendrahtzauns geparkt waren. Dutzende von Transportern. Vielleicht hundert. Während sie vorbeifuhren, dachte Andie an Littlefords kleine Geschichtsstunde über die Raubserie in New York, und sie erwischte sich dabei, wie sie die Fahrzeuge in der vordersten Reihe zählte.
Bei Nummer achtzehn hörte sie auf.
6. KAPITEL
Ruban hielt an seinem Plan fest und ging zur Arbeit. Nur eine weitere stinknormale Woche im Restaurant.
Von Montag bis Mittwoch gab es keine Überraschungen. Donnerstag fand sein monatliches Meeting mit einem Meeresfrüchte-Lieferanten aus Nicaragua statt, der, wie üblich, den Preis seiner Shrimps hochtreiben wollte, die in Rubans berühmtestem Gericht steckten: russischer Borschtsch mit gegrillten camarones in einer kubanischen Marinade. Sie trafen sich morgens um acht und feilschten über zwei Tassen dampfenden Kaffees im leeren Gastraum des Café Ruban.
Das Café Ruban war Rubans Idee gewesen, eine Mischung aus russischer und kubanischer Küche, was eine einzigartige Speisekarte ergab, die von Appetizern wie karamellisierter Yucca-Wurzel mit Kaviar bis zu russischem Gebäck reichte, das eine göttliche Nachspeise war, wenn man es in kubanischen Kaffee tauchte. Ursprünglich hatte er das Café in Miamis „Little Havana“ eröffnet, wo es jedoch ein völliger Reinfall gewesen war. Die kompromisslosen Auswanderer weigerten sich standhaft, dass irgendetwas Positives, geschweige denn Genießbares, aus dem sowjetisch besetzten Kuba stammen könnte. Am Ende hatte diese Geisteshaltung sich jedoch zu Rubans Vorteil ausgewirkt. Soweit er es beurteilen konnte, war seine nächstgelegene Konkurrenz das „O! Cuba“ in St. Petersburg – dem in Russland, nicht in Florida. Er zog mit seinem Restaurant in den Norden von „Little Moscow“ in Sunny Isles, wo es gerade dabei war, sich zu einem Hit zu entwickeln, als seine und Savannahs Finanzen ihnen um die Ohren flogen.
„Komm schon, Ruban“, flehte sein Lieferant. „Einen weiteren Nickel pro Pfund. Das sind fünf Cent. Das kannst du dir leisten.“
Wenn der wüsste. „Nein“, erwiderte Ruban. „Njet.“
Ruban waren die paar Pennys hier und dort herzlich egal. Es ging darum, seinen Boss glücklich zu machen, und der bestand darauf, den Lieferanten möglichst eisern entgegenzutreten.
Das Café Ruban trug zwar seinen Namen, aber Ruban war nicht der Eigentümer. Nicht mehr. Es war eine großartige Geschäftsidee, und ein reicher russischer Kunde hatte sich so sehr darin verliebt, dass er angeboten hatte, es zu kaufen. Ruban hatte sich geweigert zu verkaufen. Dann kamen er und Savannah mit der Ratenzahlung ihrer Hypothek nicht hinterher und rutschten in die roten Zahlen. Tief in die roten Zahlen. Die Bank versprach ihnen, sollten sie ihre Rückstände ausgleichen, ihnen eine neue Ratenzahlung anzubieten, die sie besser begleichen könnten. Ruban besuchte seinen russischen Freund und lieh sich zwanzigtausend Dollar, für die er sein Restaurant als Sicherheit anbot. Er bezahlte die Bank, die sich dann geradeheraus weigerte, ihren Kredit neu zu verhandeln. Die versprochene „gemeinsame Lösung“ war eine Lüge gewesen, natürlich, dieselbe Lüge, die Tausende besorgte Hausbesitzer auf dem Höhepunkt der Hypothekenkrise erzählt bekommen hatten. Ihr Kredit „mit flexibler Rückzahlung“ schoss in den Himmel und riss sie damit nur noch tiefer in den Abgrund. Schließlich zog die Bank ihr Haus ein. Das Café Ruban hatte einen neuen, russischen Eigentümer, der clever genug war, Ruban als Manager einzustellen.
Ruban konnte es gar nicht abwarten, das Restaurant zurückzukaufen.
Sein Lieferant stimmte schließlich zu, ihn noch einen weiteren Monat zum aktuellen Preis mit Shrimps zu beliefern. Ruban bekam von seiner Chefköchin ein High five.
„Der Boss wird glücklich sein“, sagte sie.
„Ich hoffe es“, gab Ruban zurück. „Er wirkte etwas wütend, weil ich Savannahs Geburtstagsfeier nicht hier veranstalte.“
„Ich denke, er versteht es.“
Claudia, die Köchin im Café Ruban, kannte Savannah seit der Highschool, und es war Savannahs Vorschlag gewesen, dass sie und Ruban gemeinsam ein Restaurant eröffneten. Die Zwangsvollstreckung jedoch hatte jegliche positive Energie aus dem Laden gesogen, jedenfalls von Savannahs Gesichtspunkt aus.
„Du kommst Samstag, oder? Club Media Noche.“
„Vor Mitternacht komme ich nicht hier weg.“
„Es ist Savannahs neunundzwanzigster Geburtstag, nicht ihr neunundvierzigster. Um Mitternacht wird schon noch was los sein.“
Sie lachte. „Dann werde ich kommen.“
„Großartig.“
Claudia wollte zurück in die Küche gehen, aber Ruban hielt sie auf. „Hey, kann ich deine grauen Zellen ein bisschen auf Trab bringen? Mir raucht schon der Kopf von der Suche nach einem Geschenk. Was, denkst du, würde Savannah sich wirklich wünschen?“
Claudia lächelte freundlich, aber auch ein wenig traurig. „Du weißt, was sie wirklich will.“
Das tat er. Besser als jeder andere. „Okay, abgesehen davon, womit mache ich ihr eine Freude?“
„Versuch es mit etwas, das funkelt.“
„Schmuck?“
„Ich spreche nicht von einem Feuerwerk.“
Sie hatten Savannahs teuersten Schmuck verpfändet, als sie versucht hatten, das Restaurant zu retten – ein weiterer Grund, die Party nicht hier abzuhalten. Seit der Vollstreckung hatte er ihr keinen neuen Schmuck mehr gekauft. „Das werde ich tun“, sagte er.
„Sie wird sich freuen.“
Claudia ging in die Küche. Ruban durchquerte den Speisesaal zum Getränkelager. Er musste den Warenbestand durchgehen und sicherstellen, dass sein neuer Barkeeper ihm nicht das Geld unterm Hintern wegklaute, aber ein Klopfen an der Frontscheibe erregte seine Aufmerksamkeit. Es war Pinky, der andere Neumillionär in Rubans angeheirateter Familie. Er stand direkt vor dem Restaurant und wartete auf dem Gehweg.
Ruban entriegelte die Vordertür, ließ Pinky aber nicht herein.
„Gehen wir spazieren“, sagte er stattdessen und führte Pinky um das Gebäude herum in die Seitengasse. Sie sprachen miteinander, während sie sie entlangschlenderten.
„Was willst du hier?“, fragte Ruban.
„Du meintest: keine Handytelefonate. Ich habe nur ein Handy.“