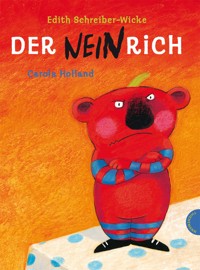21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dunkle Zeiten in Venedig 1943. Lilly Salomon lebt unerkannt inmitten der verwinkelten Gassen der Serenissima. Ihre Vergangenheit als Star der Wiener Opernwelt liegt hinter ihr – und lässt sie doch nicht los. Als sie dem Maler Mario de Silva wiederbegegnet und sich verliebt, kann sie für kurze Zeit den drohenden Schatten des Nationalsozialismus vergessen. Doch dieser rückt unaufhaltsam näher, als sie die Aufmerksamkeit eines einflussreichen Mannes auf sich zieht. Viele Jahre später führen die Ermittlungen in einem Mordfall hinein in eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte Venedigs: die Deportation der jüdischen Bewohner aufgrund der in Kraft tretenden Rassengesetze. Niemand scheint etwas über das Schicksal Lilly Salomons zu wissen, und besonders eine mächtige Adelsfamilie hat Interesse daran, die Vergangenheit ruhen zu lassen … Ein kraftvoller und zugleich poetischer Roman
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Edith Schreiber-Wicke
Im Schatten deiner Flügel
Roman
Gefördert von der Stadt Wien Kultur
Der Umwelt zuliebe #ohnefolie
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2022 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Johanna Uhrmann
Umschlagabbildungen: Markussäule Venedig © mauritius images/age fotostock/Guillem López; Lagune © mauritius images/Bernd Schunack
Lektorat: Senta Wagner
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 10,7/13,97 pt Sabon LT Pro
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-226-6
eISBN 978-3-903441-03-3
Inhalt
Prolog
Die unerzählte Geschichte
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Die vergessene Stimme
1 Der Tag ist perfekt
2 Der Mensch ist ein starrsinniges Wesen
3 Der Mann trägt
4 Das Licht
5 Die Reaktion ist
6 »Was ist mit Gregor?«
7 Die Juden dieser Stadt
8 An sich ein ganz normales
9 Kaffeekränzchen
10 Der Colonello sitzt
11 Ein Motiv aus
12 »Was suchen Sie da?«
13 Es trifft Nicolao
14 Der Gegensatz könnte
15 Spurensuche in Dorsoduro
16 Zahlen auf einem Zettel
17 Nicolao schläft schlecht
18 Wieder steht er
19 »Jetzt ist er da«
20 Rat mal
21 Wie geht es
22 Alle sind schon versammelt
23 Nicolao öffnet die Tür
24 Sie hat wirklich
25 »Pronto«, sagt die Stimme
26 Die Faust trifft
27 »Ich hatte recht«
28 »Leugnen ist wohl zwecklos«
29 Haben wir ein
30 Luisa Padovan wirkt
31 »Versteh ich das richtig?«
32 »Bin ich verdächtig?«
33 Niemand kann sich
34 Sara Pereira starrt
35 Noch immer lächelt
36 Sara versucht
37 Nicolao würde gerne
38 Nicolao geht rasch
39 Wo ist Sara
40 In eine Pistolenmündung
41 »Und der Chef?«
42 Irgendwo bellt
43 Was vom Traum
44 Ein Tsunami
45 Einen Müllberg vor Augen
46 Aber natürlich
47 Noch immer fühlt
48 Arturo ringt die Hände
49 Nicolao steht im Schatten
50 Amberg oder Cranz?
51 »Conte Ludovico!«
52 Was jetzt?
53 Endlich einmal früh
54 Das Gewitter als Urgewalt
Epilog
Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
Kurt Tucholsky
IL TRAMONTO DI FOSSOLI
Io so cosa vuol dire non tornare.
A traverso il filo spinato
Ho visto il sole scendere e morire;
Ho sentito lacerarmi la carne
Le parole del vecchio poeta:
«Possono i soli cadere e tornare:
A noi, quando la breve luce è spenta,
Una notte infinita è da dormire.»
Primo Levi, 1946
SONNENUNTERGANG IN FOSSOLI
Ich weiß, was es heißt: nicht heimkehren.
Durch den Stacheldraht hab ich
Die Sonne versinken und sterben gesehen.
Ich habe gespürt, wie die Worte des alten Poeten
Mir Herz und Körper zerreißen:
»Sonnen können vergehen und entstehen:
Ist jedoch uns das kurze Licht erst erloschen,
Bleibt nur die unendliche Nacht zum Schlaf.«
Übersetzung: Edith Schreiber-Wicke
Für Aldo Izzo
Prolog
Die Lagune Venedigs, Nacht
Es ist anders
Es ist anders als von Regisseuren inszeniert, in Nahtodberichten geschildert. Kein Film mit Lebensbildern im Zeitraffer. Keine Flashbacks in frühe Szenen der Kindheit. Oder Jugend. Aber auch kein Trailer aus den späteren Jahren. Weder Highlights noch Niederlagen. Nichts dergleichen.
Überhaupt kein Kino. Kein innerer Fellini, Pasolini, Visconti.
Da ist nicht einmal der so oft beschriebene Tunnel, weder mit noch ohne Licht am Ende.
Kein Begrüßungskomitee, zusammengesetzt aus jüngst oder längst verstorbenen Familienmitgliedern. Nicht, dass er sich etwas Derartiges gewünscht hätte. Ganz bestimmt nicht. Mit gutem Grund hat er zwischen sich und seine Familie eine beträchtliche Distanz und eine neue Staatsbürgerschaft gebracht. Aber das ist es nicht, womit sich seine Gedanken jetzt beschäftigen.
Seine Gedanken sind bei dem, was mit ihm in diesen Augenblicken passiert.
Sterben? Ist es das?
Natürlich hat er früher schon manchmal über den Tod nachgedacht. Seinen eigenen Tod. Wer tut das nicht? Goldhamster vielleicht. Aber so hat er es sich nie vorgestellt. So kalt, so dunkel, so nass.
Und so überraschend. Nichts hat ihn darauf vorbereitet, was geschehen würde. Nach der Explosion in seinem Kopf, nach dem kurzen Nichts ist er jetzt dabei zu ertrinken. Er spürt, wie er salziges Lagunenwasser in seine Lungen atmet, und weiß, dass er umgehend damit aufhören muss. Was er braucht, ist der Stoff, an den seine Lungen gewöhnt sind – Luft.
Das für Überlebensprogramme vorgesehene Nervensystem tut, was es soll, und arbeitet auf Hochtouren. Neuronen transportieren im Eiltempo per Botenstoff Notfallmeldungen und Befehle zur Lösung der Krisensituation.
Jetzt oder nie ist die Devise.
Jetzt oder nie mehr.
Adrenalin wird gepumpt. Alle für das Überleben wichtigen Körperfunktionen werden mit Notenergie versorgt. Wie so oft reichen die Notfallpläne aber nicht aus oder setzen zu spät ein. Man kennt das von Atomkraftwerken.
Die Nacht schlägt über ihm zusammen. Schwarz. Kalt.
Der verzweifelte Antrieb ist da, aber Arme und Beine verweigern die dringend nötigen Schwimmbewegungen. Panik übernimmt das Kommando. In Sachen Strategie noch nie eine gute Ratgeberin. Und dann beherrscht ihn nur noch ein Gedanke: Das kann es nicht gewesen sein.
Sein Projekt. Die unerzählte Geschichte. Wenn er untergeht, bleibt sie unerzählt. Dann hat ihm der Zufall vergeblich diese unglaubliche Story in die Hände gespielt. Zu früh sterben – das ist wie auf Urlaub gehen mit einem Stapel unerledigter Akten auf dem Schreibtisch.
Der Tod als unerwünschte Auszeit. Zurück bleibt ein Stapel ungelebten Lebens.
Jemand sagt etwas zu ihm. Una storia ancora da scrivere. Eine Geschichte, die noch geschrieben werden muss.
Er wird sie schreiben.
Falls er diese kalte, schwarze Nacht überlebt.
Die unerzählte Geschichte
Venedig, Sommer 1943
1
Die Musik ist immer da. Töne, so laut und klar in ihrem Kopf, dass sie nicht überrascht wäre, wenn andere sie ebenfalls hören könnten. Manchmal erwartet sie fast, dass jemand in ihrer Nähe irritiert stehen bleibt, zu einem der offenen Fenster hinaufschaut und wissen möchte, woher die Musik kommt. Aber ihr inneres Radio ist Privatsache. Einen mentalen Lautstärkeregler hat es natürlich, für die Momente, in denen sie Brot kauft, ein paar Worte mit der Nachbarin wechselt. Damit sie nicht lauter reden muss als unbedingt nötig. Das würde auffallen. Und auffallen ist gefährlich.
Sie geht wie fast täglich über die kleine Brücke bei den Magazzini del Sale, dann weiter zur Punta della Dogana.
Un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo … Eines schönen Tages werden wir Rauch an der fernen Meeresgrenze aufsteigen sehen. Und dann erscheint das Schiff. Arie der Madame Butterfly. Musik einer unerfüllten Hoffnung. Der Rauch steigt zwar auf, das Schiff am Horizont erscheint tatsächlich und der ersehnte Mister Pinkerton ist an Bord. Aber leider in Begleitung seiner amerikanischen Ehefrau. Und mit dem Vorsatz ihr den Sohn wegzunehmen. Ihr das Einzige wegzunehmen, was ihr geblieben ist. Ende der Hoffnung. Wie das Libretto so spielt. Und das Leben.
Hoffnung. Mit dieser Materie kennt sie sich aus. Wenn auch das, worauf sie hofft, nichts mit Liebe zu tun hat. Weder enttäuscht, noch erfüllt. Man verliebt sich nicht in Zeiten wie diesen.
Was Sex betrifft, den hat sie gelegentlich. Mit sich selbst. Na und. Selbstbefriedigung ist schließlich Sex mit jemandem, den man gut kennt und mag. Es hat Vorteile als Tochter eines Freidenkers und Arztes aufzuwachsen. Der seine Patienten nicht nur vom Tripper befreite, sondern auch von der Furcht, Onanieren führe zu unheilbaren Hirnschäden.
Sie lehnt sich an eine der Säulen der ehemaligen Zollstation und sieht zu, wie sich letzte Morgennebel im Bacino San Marco vergeblich, aber sehr dekorativ dagegen wehren, von der Sonne aufgelöst zu werden. Der Schleiertanz einer stadtgewordenen Salome. Schön anzusehen, aber die Schönheit ist obszön. Und unbarmherzig. Wie Jochanaan erzählen könnte, wenn er erzählen könnte.
Ah! Ich, ich habe deinen Mund geküsst … Problemlos wechselt das innere Klassikprogramm die Oper und den Gesangspart. Es war ein bitterer Geschmack auf deinen Lippen … Die Salome hat sie einstudiert, aber nur zwei Mal gesungen. Sie weiß, dass Else Schulz derzeit die Partie in Wien singt. Zuletzt am 24. Juni dieses Jahres. Knappertsbusch am Pult.
Ein bitterer Geschmack …
Täglich mehrmals tauscht sie das innere Musikprogramm gegen BBC oder Radio Vatikan und hofft zu hören, dass der Wahnsinn zu Ende ist.
Es ist Sommer in Venedig, Sommer im Jahr 1943. Der Sommer nach Stalingrad. Der Anfang vom Ende des Tausendjährigen Reichs wie Radio Londra prophezeit. Wenn er nur schon anfangen würde, der Anfang.
Die Stimme, die innere Stimme, die sonst keiner mehr hört, ist die Stimme von Lilly Bergmann, vielversprechende Sopranistin bis zum rassegesetzbedingten Karriereknick. Aus Wochen wurden Monate, dann Jahre. Sie zählt nicht mit. Als sie in ihr Exil nach Venedig ging, fing die Zeit an, seltsamen Gesetzen zu folgen. Auf lähmenden Stillstand, wie die feuchtheiße Sommerluft über der Lagune, wie die regenschweren Ewigkeiten des Winters, folgen Tage, getrieben vom Scirocco oder von der Bora.
Was sie manchmal verletzt, ist die erbarmungslose Schönheit, der sie hier ausgesetzt ist. Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, so farbgewaltig, als wären sie von Turner gemalt. Unanständig schön, weil Schönheit zur Beleidigung geworden ist, seit der Mann mit der seltsamen Barttracht und dem noch seltsameren Gruß die Welt zu seiner Bühne gemacht hat.
Ein Witz.
Ein Witz, über den man besser nicht lacht. Sie denkt an ihren Freund Robert Dorsay. Schauspieler, Kabarettist, Antifaschist. Im Freundeskreis bekannt für seine wagemutigen politischen Witze.
Zwei Psychiater begegnen einander. Sagt der eine: »Heil Hitler!« Darauf der andere: »Leicht gesagt!«
Du wirst dich noch einmal um Kopf und Kragen witzeln. Ständige Warnung von Freunden. Ist doch ein Witz, für einen Witz wird man nicht umgebracht. Sagt Dorsay. Nicht einmal in Zeiten wie diesen. Unterschätzt er die Gefahr?
Was gibt’s für neue Witze? Zwei Monate Dachau!
Robert Dorsay ist im Widerstand. Nur hantiert er nicht mit Flugzetteln oder Sprengstoff. Der Sprengstoff liegt in seinen Anekdoten und Witzen, die weitergeflüstert werden.
Bei Müllers läutet das Telefon. Falsche Verbindung. Eine Stimme sagt: »Entschuldigen Sie, ich habe falsch gewählt.«
Müller antwortet: »Das haben wir alle!«
Flüsterwitze. Mit der inneren Stimme darf man sie erzählen. In der Lautstärke derer, die überleben wollen. Also ohne Ton.
»Ein kleiner Aff«, so hat die Jüdin Blanca Moser angeblich den Mann aus Braunau am Inn genannt. Unerhörterweise sogar hörbar für andere. Sie fühlt sich offenbar sicher in der Popularität ihres Ehemannes Hans Moser. Vertraut darauf, dass die Unantastbarkeit des berühmten Nuschlers auch sie einschließt. Mutig? Oder die Realität verkennend?
Sie selbst ist nicht mutig. Sie möchte leben. Sie möchte ihren Vater wiedersehen. Und irgendwann wieder vor Publikum singen.
Immer öfter, vor allem in den schwebenden Momenten nach dem Aufwachen, wenn die sogenannte Wirklichkeit nicht mehr ist als eine Möglichkeit, hat sie Schwierigkeiten zu realisieren, dass es kein skurriles Stück ist, das da gespielt wird. Der mäßig begabte Landschaftsmaler, den sie an der Kunstakademie nicht wollten, keine überzeichnete Figur aus der Feder eines ebenso mittelmäßigen Librettisten mit Albträumen. Aber Tatsache ist, dass sie sich in einer kleinen Wohnung in der Nähe der Salute-Kirche versteckt und nicht mehr weiß, ob es ihre Stimme noch gibt. Dass ihr Vater in ein Konzentrationslager gebracht wurde und sie seit Monaten keine Nachricht von ihm hat. Dass Menschen wie Robert Dorsay für das Erzählen eines Witzes eingesperrt werden können. Auch ermordet? Das wohl nicht – oder doch?
Niemand aus ihrer Familie, aus ihrem Freundeskreis hat ihn ernst genommen, den Mann aus Braunau. Ein fataler Fehler, wie sich im Lauf der Jahre herausstellte.
Jüdischsein war nie ein Thema in ihrer Familie. »Religion ist eine Droge, egal an welchen Gott man glaubt. Und ich bin gegen Drogen.« Das Credo ihres Vaters, Doktor Nathan Salomon. Arzt aus Berufung. Salomon ist auch ihr Name. Für die Bühne hat sie den Familiennamen ihrer verstorbenen Mutter angenommen: Bergmann. Die schwedische Schauspielerin Ingrid Bergman ist zwar auch jüdisch, aber keiner weiß davon. Ein Name, der so schön deutsch klingt! Der Vater hielt die Namensänderung für vernünftig. Papa! Gedanken können körperlich schmerzen. Besonders Gedanken. Irgendwo zwischen Zwerchfell und Kehlkopf.
O mio babbino caro! Da ist sie wieder, die Musik. Eine Weile hört sie einfach zu. Lässt die innere Stimme Töne aus der Erinnerung holen. Hat das Gefühl, das Vibrieren der Stimmbänder zu spüren. Arie der Lauretta aus Gianni Schicchi. Auch die hat sie gerne gesungen. Wie alles von Puccini.
Sie weiß nicht, wo ihr Vater jetzt ist. Nur, dass sie ihn abholten, während sie auf der Bühne stand. Donna Anna in Don Giovanni. Für sie die letzte Vorstellung, weil die Direktion ihren Vertrag plötzlich kündigte. Bergmann statt Salomon. Ein kleiner Aufschub. Mehr nicht. Jedenfalls war sie nicht zu Hause, als die Stiefel durch das Treppenhaus polterten, die Türglocke ungeduldig im Dauerton schrillte. Abends. Normalerweise kommen sie in den frühen Morgenstunden.
Hatte die Musik sie gerettet? Einfach weil sie zufällig nicht in der Wohnung war? Oder war es Absicht, ihr die Gelegenheit zur Flucht zu geben? Weil sie für die Wiener Opernbesucher schon ein Begriff war? Zumindest für die Kenner unter ihnen. Wie seltsam, dass sie in Mozarts Oper gegen den Mörder ihres Vaters auf Rache sann, während ihr eigener Vater von staatlich autorisierten Verbrechern abgeholt wurde. Or sai chi l’onore rapire a me volse, chi fu il traditore che il padre mi tolse … Jetzt weiß ich, wer mir die Ehre rauben wollte, wer der Verräter ist, der den Vater mir genommen.
Noch während der Vorstellung der Anruf der Nachbarin. »Mein Gott, Fräulein Bergmann, gut, dass ich Sie erreiche! Die SS war da. Die haben den Herrn Doktor mitgenommen. Was für ein Unglück. Sie dürfen auf keinen Fall herkommen! Wahrscheinlich wird die Wohnung überwacht.« Das Telefon stand in der Garderobe. Die Donna Elvira der Vorstellung hörte zufällig mit. Zog die richtigen Schlüsse aus ihren verzweifelten Fragen an die ratlose Nachbarin.
»Du musst untertauchen. Singen lässt man dich so und so nicht mehr. Du wohnst für die nächsten Tage bei mir. Dann sehen wir weiter.«
»Aber ich muss herausfinden, was mit meinem Vater geschieht.«
»Deinem Vater kannst du im Augenblick nicht helfen. Geh nach Amerika, die Met wartet. Ich habe Verbindungen.«
»Nicht ohne meinen Vater. Außerdem verhaftet man mich spätestens am Flughafen.«
»Dann wenigstens weg aus Wien. Du kannst meine kleine Wohnung in Venedig haben.«
»Venedig? Aber die Italiener sind doch auch auf der Seite der Deutschen.«
»Die Italiener vielleicht, aber die Venezianer sind immer nur auf Seiten der Venezianer.«
»Und Mussolini?«
»Der hatte jahrelang eine jüdische Geliebte. Noch nie von Margherita Sarfatti gehört? Venezianerin übrigens. Der Mann hat garantiert nichts mit Antisemitismus im Sinn.«
»Außer er möchte seinem Freund in Deutschland einen kleinen Gefallen tun.«
»Ach was. Venedig ist zu schön für Antisemitismus. Du wirst es mögen.«
»Warum tust du das für mich?«
»Erstens bin ich im inneren Widerstand und zweitens in dich verliebt.«
»Aber ich …«
»Jaja, schon gut, ich habe gesehen, wie du diesen spanischen Bühnenbildner angeschaut hast. Alles klar – du bist hoffnungslos hetero. Niemand ist fehlerfrei.«
Man kann auch in solchen Situationen gemeinsam lachen.
»Ich habe mir keinen Augenblick lang Hoffnungen gemacht. Außerdem bin ich daran gewöhnt, unglücklich verliebt zu sein. In Zeiten wie diesen ist die Angst größer als die Liebe. Meine Art von Liebe.«
Homosexuelle Liebe ist genauso gefährlich wie Witze über Hitler.
Die Kollegin, die sie eigentlich kaum kannte, hob für sie Geld vom Bankkonto ab. Ging sogar in ihre Wohnung, um ein paar persönliche Sachen und den Schmuck abzuholen. Riskierte viel.
»Glaub mir, sie haben deinen Vater bewusst zu einer Zeit geholt, wo du nicht da warst. Immerhin kennen dich die Wiener Opernbesucher. Du weißt doch, Publikumslieblinge sind hier sakrosankt. Max Lorenz zeigt sich mit seiner jüdischen Ehefrau Lotte sogar in der Öffentlichkeit. Sie steht unter dem persönlichen Schutz Görings. Oder denk an Hans Moser. Seine Frau Blanca ist auch Jüdin. Und sie lebt. Sogar ohne den Vermerk »Sara« in ihrem Pass. Und du weißt, wie sie Hitler öffentlich genannt hat.
»Die Frage ist, ob es ausreicht, dass sie mich mögen. Meinem Vater hat es jedenfalls nicht geholfen.«
»Mach dir nicht zu viele Sorgen. Er ist Arzt. Und Ärzte braucht man. Besonders in diesen Lagern.«
Später organisierte die Kollegin sogar eine sichere Mitfahrgelegenheit nach Italien.
»Hier sind die Schlüssel. In der Wohnung nebenan wohnt Maria. Du kannst ihr vertrauen. Nur ihr, niemandem sonst. Ich habe mit ihr telefoniert. Du nimmst einfach den Platz ihrer Cousine ein, die nach Amerika ausgewandert ist. Ja und noch etwas: Sing nicht unter der Dusche.«
»Ich soll WAS nicht?«
»Unter der Dusche singen. Du singst nicht wie Marias Cousine. Glaub mir.«
»Du meinst, jemand könnte meine Stimme erkennen?«
»Es gibt nicht viele Stimmen wie deine.«
Wieder einmal fragt sie sich, ob diese Stimme noch existiert. Sie hat nicht mehr gesungen seit jenem Abend. Nicht unter der Dusche und auch sonst nicht. Sie spricht natürlich. Mit Maria. Beim Einkaufen aber nur das Nötigste. Wie gut, dass sie Italienisch gelernt hat. Wer mit Vorliebe Puccini und Verdi singt, muss die Sprache können. Und lieben.
Es ist natürlich trotz allem nicht ungefährlich für sie in Venedig. Die Deutschen sind auch hier. Aber in Venedig sind sie weniger deutsch. Das hat die Stadt so an sich. Die deutsche Platzkommandatur auf dem Lido ist weit weg. Überhaupt leben die venezianischen Juden einigermaßen unbehelligt in Venedig. Niemand wird erniedrigt, körperlich angegriffen, deportiert. Bis jetzt. Juden wohnen überall in der Stadt. Nicht nur im Ghetto.
Ghetto. Das Wort macht ihr Angst. Ein Wort wie aus rostfreiem Stahl – spitz, unnachgiebig. Und es hat in der Tat mit Metall zu tun. Mit der Gießerei im gleichen Viertel. Geto vecchio – alte Gießerei.
Absurd. Ich verstecke mich in der Stadt, in der das Wort Ghetto erfunden wurde.
Nur ein einziges Mal war sie dort. Hat die Häuser gesehen, die so hoch sind wie sonst nirgendwo in Venedig. Vielstöckige, gedrängt stehende Wohnhäuser mit so niedrigen Räumen, dass die Bewohner gerade noch aufrecht stehen können.
Warum? Ein kleines Buch aus dem Trödlerladen gibt bereitwillig Auskunft.
Gezwungenermaßen musste man auf engstem Raum so viele Wohnungen unterbringen wie irgend möglich. Damals, nach dem Dekret von 1516, als venezianische Juden nur noch im Ghetto wohnen durften. In San Girolamo, der Gegend um die alten Gießereien. In der Nacht wurden die Tore geschlossen und bewacht. Eine »Dienstleistung«, die von den Juden selbst bezahlt werden musste. Ausnahmen gab es natürlich. Wenn ein einflussreicher Venezianer in der Nacht krank wurde und seinen jüdischen Hausarzt brauchte. Venedig und die Juden. Eine Geschichte voller Widersprüche. Man brauchte sie als Geldverleiher, man schätzte das Können und Wissen der jüdischen Ärzte. Aber christliche Prediger hetzten gegen alles Jüdische und dann kam auch noch Papst Paul IV. mit seiner unseligen Bulle »Cum nimis absurdum«, die im ganzen Kirchenstaat die räumliche Absonderung der Juden einführte.
Nur ein einziges Mal ist sie durch den schmalen sottoportego gegangen, vorbei an dem Altwarenhändler, der Synagoge, dem koscheren Restaurant. Seither war sie nie wieder in diesem Teil der Stadt. Jeder Venezianer ist in seinem Viertel zu Hause. Ihre Gegend ist Dorsoduro. Was sollte sie in Cannaregio? Außerdem ist sie abergläubisch wie alle Sänger und davon überzeugt, dass Unglück ansteckend ist. Dass die vielfenstrigen Häuser im jüdischen Ghetto Unglück ausatmen wie Kranke ihre Bazillen.
2
Die Stimme des Nachrichtensprechers meldet schwere Schäden durch die Bomben, die in der Nacht auf Mailand fielen. Auch auf die Scala, das berühmte Opernhaus, in dem sie – wann war das? – die Mimi in La Bohème gesungen hat. Mi chiamano Mimi … Antwort der inneren Stimme auf die Nachrichten. Mimis Arie, nachdem Rodolfo ihr kaltes Händchen gehalten, sich als Poet zu erkennen gegeben hat und mehr über seine schöne Nachbarin wissen möchte. Man nennt mich Mimi …
Mi piaccion quelle cose … Mimis Bekenntnis zum Zauber des Lebens, zur Liebe, zum Frühling, zu Traumbildern, zur Poesie. Durchaus nachvollziehbar. Nur dass es letzten Endes nicht gegen eisigkalte Händchen, Armut und Schwindsucht half. Weniger und weniger hilft auch die innere Musik gegen zynische Gedanken. Und Hoffnungslosigkeit.
Bombennacht in Mailand. Sie versucht zu begreifen. Warum werfen die Alliierten ihre Bomben auf Italien, wenn doch das deutsch-italienische Bündnis ganz offensichtlich nicht halten wird? Oder lügt auch Radio Londra? Propaganda auf beiden Seiten? Werden auch Bomben auf Venedig fallen? Es ist kaum vorstellbar, dass diese Stadt von der Wirklichkeit eingeholt werden kann.
Sie will weg von den näher rückenden Wänden der kleinen Wohnung. Wieder steht sie an der Dogana, keine Nebelschleier diesmal, nur ein leichter Dunst über der Lagune. Und die Musik im Kopf. Nach wie vor La Bohème, obwohl die Geschichte ja eigentlich in Paris spielt. Aber Venedig ist die Stadt, in der alle Tragödien denkbar sind.
Ein neuer venezianischer Sommertag kündigt sich an. Schon jetzt klatscht die Stadt feuchtwarme Umschläge auf alles, was sich bewegt. Etwas Kühle erwartet sie in Marias kleiner Boutique für Glasschmuck. Wo sie anfangs Perlen nach Marias Vorschlägen fädelte, jetzt nach eigenen Entwürfen. Die Einkäufe auf der Glasbläserinsel Murano machen sie mittlerweile ebenfalls gemeinsam. Was als Teil ihrer Tarnung gedacht war, gefällt ihr inzwischen. Sie kann Maria etwas zurückgeben. Und ihr Italienisch bekommt eine weiche venezianische Färbung. Auch das ist gut für die Tarnung.
Zurück geht sie an der Salute-Kirche vorbei, über die kleine Eisenbrücke und steht plötzlich einem bekannten Namen gegenüber. Einem Namen, der nicht hierher gehört, sondern in eine andere Welt. Mario de Silva. Erst erinnern sich ihre Ohren. An eine Stimme, die sehr leise sehr präzise Anordnungen gibt. Kleine Szenen setzen eine umfassendere Erinnerung zusammen. Die Hände, lang, schmal, ein Lächeln, ein intensiver Blick. Die Augen im Schatten liegend, ihr dunkles Braun nicht samtig, sondern glänzend, wie von innen beleuchtet. Oder in einem ständigen leichten Fieber. Die Bemerkung der Kollegin: »Ich habe gesehen, wie du diesen spanischen Bühnenbildner angeschaut hast.« Und hier das Plakat mit seinem Namen. Mario de Silva, Venezianische Impressionen, Chiostro Madonna dell’Orto. Täglich von 10 bis 17 Uhr. Dann noch das Datum der Eröffnung. Sie rechnet nach. Übermorgen.
Er gehört also zu den Künstlern, die arbeiten dürfen. Auch in Zeiten wie diesen. Heißt das, er ist einer von denen, die sich arrangieren? Es passt nicht zu ihm. Sagt ihr Gefühl. Außerdem: Darf sie über andere urteilen? Würde sie selbst nicht auch singen, wenn man sie ließe? Natürlich würde sie. Vor einem Publikum, das an den Endsieg glaubt. Selbst vor Hitler.
Was war denn das eben? Ihre Gedanken halten erschrocken inne. Kontrollieren sich selbst. Eigenzensur. Zucken dann mit den Schultern, sofern man sich schulterzuckende Gedanken vorstellen mag. Ja, selbst vor Hitler.
Die Geräusche der erwachenden Stadt vermischen sich mit der Ouvertüre zu Fidelio aus ihrem inneren Radio. Sie denkt an die Festvorstellung zu Ehren Hermann Görings. Und an die Stimme Hilde Konetznis. Abscheulicher, wo eilst du hin? Was hast du vor in wildem Grimme? Eine großartige Leonore. Wann war das? Im März 1938, als auch Lilly Salomon noch glaubte, eine Zukunft vor sich zu haben. Vielleicht ermutigt durch Max Lorenz, der in dieser Vorstellung den Florestan sang. Max Lorenz, bekanntermaßen homosexuell UND mit einer Jüdin verheiratet. Trotzdem viel beschäftigter Sänger in Wien und Bayreuth.
Maria erwartet sie mit gerötetem Gesicht. Sichtlich aufgeregt. Worüber? Schlechte Nachrichten oder gute?
Ein Anruf aus Wien ist zu erwarten. Heute Abend, gegen acht in Marias Wohnung. Sie selbst hat kein Telefon. Je weniger Bürokratie mit dem Namen, den sie trägt, umso besser. Sie weiß jetzt schon, dass die Stunden bis dahin wie zähflüssige Lava verrinnen werden. Lava – wie kommt sie auf dieses Bild? Die Hitze vermutlich. Und natürlich die Briefe.
Wenige Tage zuvor wollte sie in Marias Bibliothek ein Buch zurück in die Reihe schieben, aus der es auffällig herausstand. Es war eine Übersetzung der Briefe, die Plinius der Jüngere an den Historiker Tacitus schrieb. Kurz nachdem er den Ausbruch des Vesuvs miterlebt und überlebt und vom Tod des Onkels erfahren hatte. Seltsam berührt bat sie Maria darum, das Buch ausleihen zu dürfen. Sie fand eine interessante Parallele zwischen dem Vulkanausbruch und dem Nationalsozialismus. Jedenfalls was die Reaktion der Menschen betraf. Natürlich gab es erste Anzeichen. Aber niemand nahm sie ernst. Die Erde bebte ein bisschen. Na und. Daran war man in dieser Gegend gewöhnt. Man dachte an ein neuerliches kleines Erdbeben. Das letzte war noch nicht allzu lange her. Noch immer verdienten die Handwerker gut daran, diverse Schäden an den Häusern auszubessern. Dann eine Rauchsäule, auch sie beunruhigte nur wenige. Vulkane machen das manchmal. Dazu sind sie berechtigt. Erst als der Berg dann begann, glühende Brocken und Bimsstein zu speien, machte man sich ernsthafte Sorgen. Je nach Charakter und körperlicher Befindlichkeit verkroch man sich in der scheinbaren Sicherheit der Häuser oder begab sich in einen aussichtslosen Wettlauf mit dem Ascheregen, dem Lavastrom, dem glühenden Atem des Vulkans. Manche versuchten zu helfen, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, sich in Sicherheit zu bringen. Wie etwa Plinius der Ältere, der Onkel des Briefe schreibenden Neffen. Obwohl er mit seinem Schiff außerhalb der Gefahrenzone war, wollte er bedrohten Freunden zu Hilfe eilen. Und starb mit ihnen. Der Neffe fand Trost im Bewusstsein, ein wichtiger Zeitzeuge zu sein und dem Onkel durch seine Berichte an Tacitus zur Unsterblichkeit zu verhelfen. Was ihm ja auch gelang.
Ist sie selbst Zeitzeugin? Hat sie die Verpflichtung zu berichten? Bis jetzt war da nie ein derartiger Auftrag spürbar. Andererseits ist sie davon überzeugt, dass Bücher wie Botschafter sind. Sie werden vom Schicksal losgeschickt, um dann zum richtigen Zeitpunkt im Leben eines Menschen aufzutauchen. Nötigenfalls indem sie sich aus der Ordnung der benachbarten Bücherrücken herausbewegen.
Sie beschließt, ein Tagebuch zu führen. Ihren persönlichen Blick auf die große Katastrophe dieses Jahrhunderts zu beschreiben. Selbst wenn sie den Vesuv mittlerweile nur aus einer gewissen Distanz beobachtet. Aber die glühenden Brocken fliegen weit. Und könnten sie immer noch vernichten.
Auch die zähflüssigsten Lavastunden verrinnen. Es sind dann gute Nachrichten und schlechte, die sie erfährt, den Hörer fest ans Ohr gepresst, weil die Verbindung durch Geräusche gestört wird, die sie wieder an Pompeji im Jahr 79 erinnern. Geräuschbrocken, die hörbar zu Boden fallen und bersten.
3
Die immer etwas atemlose Stimme der Freundin aus Wien. So nahe, als wäre sie im Zimmer nebenan.
»Er lebt, dein Vater lebt. Es geht ihm gut – im Rahmen des Möglichen. Dachau ist nicht das schlimmste von diesen Lagern.«
»Woher weißt du das?«
»Jemand mit guten Informationen. Er hat nach der Vorstellung auf mich gewartet. Und mir erzählt, was dein Vater alles für die Leute im Lager tut.«
»Papa … er lebt!«
»Ja, er lebt. Mach dir nicht zu viele Sorgen, es kann ja nicht mehr lange dauern.«
»Das meint die BBC auch. Hoffentlich haben sie recht damit. Werden eigentlich noch immer Opern in Wien gespielt?«
»Ja, irgendwie unfassbar, nicht wahr? Ich singe die Dorabella in Così fan tutte. Demnächst ist Premiere. «
»Wer dirigiert? Karl Böhm?«
»Nein, Knappertsbusch. Ich mag ihn. Übrigens: Du kennst doch Robert Dorsay?«
»Ja, natürlich, sehr gut sogar.«
»Sie haben ihn verhaftet.«
»Oh nein! Wann wird dieser Irrsinn endlich aufhören?«
»Ziemlich genau das stand in dem Brief, den sie abgefangen haben. Sie haben nur darauf gewartet, etwas gegen ihn in der Hand zu haben. Jetzt haben sie diesen Brief.«
»Aber man bringt doch niemanden um, weil er so einen Satz niederschreibt?«
»Umbringen? Nein, so schlimm wird es wohl nicht werden.«
Die Freundin hat versucht, optimistisch zu klingen. Mit wenig Erfolg.
»Und dein Leben? Was machst du so? Venedig ist doch trotzdem schön, oder?«
Ja. Venedig ist trotzdem schön. Auch wenn man lebendig begraben ist unter Erinnerungen. Und darauf wartet, dass endlich das Leben, das richtige Leben weitergeht. Dass die Töne in ihr von vibrierenden Stimmbändern erzeugt werden und nicht von der Verzweiflung.
4
Mario, Mario, Mario! Liebesduett aus Tosca, erster Akt. Seltsame Namensgleichheit. Und auch noch Maler. Auch er. Die Musik halb Jubelruf, halb Angstschrei. Die Freude, ihn zu sehen, die Sorge, ihn zu verlieren. Schon verloren zu haben. An diese schöne andere, die er gemalt hat. Aber Puccinis Musik und Marios Worte besänftigen und überzeugen.
Dilla ancora la parola che consola … Dilla ancora! Sag das Wort noch einmal, das Wort, das tröstet.
Kann man sich am Rande eines Abgrunds verlieben? Man muss sogar, hat der andere Mario behauptet, als er sie an sich zog. Wie viele Hände dieser Mann hat! Und was für Hände …
Sie lächelt unwillkürlich. Eine ältere Frau, die ihr entgegenkommt, übernimmt dieses Lächeln, trägt es weiter, wirkt augenblicklich um ein halbes Leben jünger. Sie nicken einander zu. Freundinnen für wenige Sekunden.
Ein paar Tage sind es erst, seit sie zu der Ausstellungseröffnung im Kloster Madonna dell’Orto gegangen ist. Die Bogengänge ein perfekter Rahmen für seine Venezianischen Impressionen. Viel Licht, viel Lagune, wenig Architektur. Keine Uniformen. Kein Krieg.
Auf die Mailänder Scala fallen die Bomben der Alliierten, in Venedig geht man in Ausstellungen, wird Kunst gezeigt. Die Bilder von Mario de Silva, dem Maler, der in Wien das Bühnenbild zu Don Giovanni entworfen hat. Dem Mann mit den schönen Händen und den fiebrigen Augen. Da musste sie doch einfach hin, auch wenn Maria dagegen war.
»Zu gefährlich. Ganz Venedig kommt zu solchen Eröffnungen. Es könnten Leute da sein, die dich kennen.«
»Mich kennt hier keiner.«
»Du warst in Wien sehr bekannt.«
»Betonung auf WARST. Ich will seine Bilder sehen.«
»Die Bilder kannst du auch irgendwann später noch sehen. Nicht nur bei der Eröffnung.«
»Na schön, ich will IHN sehen. Er ist ein Stück Erinnerung aus einer anderen Zeit.«
»Gut, dann geh ich mit. Du brauchst die Stimme der Vernunft neben dir.«
Zu Marias Erleichterung sahen sie ihn aber nur von fern. Er war ständig umringt von Frauen, die alle so wirkten, als käme das Wort »Krieg« in ihrem Vokabular nicht vor. Frauen, die ihr Interesse an dem Maler nur unzureichend mit der Begeisterung für seine Kunst tarnten. Oder eine Tarnung erst gar nicht versuchten. Maria war trotzdem nervös.
»Komm, lass uns gehen. Ich habe kein gutes Gefühl. Du hast seine Bilder gesehen, du hast ihn gesehen. Was ist, wenn er dich entdeckt und erkennt?«
Die Stimme der Vernunft. Wer will sie schon hören?
»Wird er nicht. Wir haben in Wien nicht einmal miteinander gesprochen. Ich habe ihn nur bei der Arbeit beobachtet.«
»Aber wenn er dich doch erkennt? Wenn er laut deinen Namen sagt? Oder noch schlimmer: wenn er ihn leise sagt? Zu einem der Spitzel. Wer in Zeiten wie diesen als Künstler nicht nur ungestört arbeiten kann, sondern sogar ausstellen darf, der hat sich mit denen arrangiert, die jetzt das Sagen haben.«
»Ja. Vielleicht. Aber es muss nicht so sein.«
Dann wurde Maria wortreich von einigen Bekannten begrüßt, war plötzlich verschwunden zwischen Hüten, Kleidern, Umarmungen. Halbherzig suchte sie nach ihr, verließ dann den Bogengang mit den Bildern, ging durch die unauffällige Tür in den Klostergarten. Kohl, Bohnen, Tomaten im Gemüsegarten für die Klosterküche. Beneidenswerte Ordensbrüder. An der Südwand der Klostermauer die Kräuter. Alles da – sogar Schnittlauch, erba cipollina, hier in Italien nur wenig verwendet. Ein blühender Rosmarinstrauch versuchte vergeblich, sich duftmäßig gegen wuchernden Lavendel durchzusetzen. Und dann die Rosen. Einer der Padri Giuseppini hatte wohl höhere Ambitionen als die tägliche Minestrone. Ein Strauch voll Blüten genau in ihrer Lieblingsfarbe. Weiß mit einem Hauch von Blassrosa. Manche noch Knospen, viele im Aufblühen oder voll erblüht. Keine welken. Die wurden wohl von dem rosenkundigen Padre im Sinne der Ästhetik rechtzeitig entfernt. Sie stand da und hatte plötzlich das Gefühl, dass alles gut werden könnte. Dass dieser Krieg vorbei sein würde, noch ehe sie unter voll erblüht oder gar welk einzuordnen wäre. Ein Leben nach dem Krieg. Mit ihrem Vater, seiner Praxis. Mit einer Stimme, die wieder gehört werden durfte, mit Rollen in den Opernhäusern der Welt.
»Schön«, sagte eine Stimme wie als Antwort auf ihre Gedanken.
Diese Stimme. Sie hatte sie noch im Ohr von damals, als er seinen Assistenten Anweisungen gab.
Sie schaute auf. »Ja, wunderbare Rosen«, sagte sie.
»Das meinte ich nicht.«
Schmales Gesicht, dunkle lockige Haare, noch glanzäugiger, als sie ihn in Erinnerung hatte.
»Schön, Sie zu sehen, Donna Anna.« Er sagte es sehr leise.
Sie erstarrte. Nicht sicher, wie sie sich verhalten sollte. Behaupten, dass er sich irrte?
Wer in Zeiten wie diesen als Künstler arbeiten kann, der hat sich arrangiert.
Ein Mann, der malte wie er, war kein Verräter. Sie war so sicher gewesen, dass er sie nicht erkennen würde. Die Frau, die sie jetzt ist, die Frau, die nicht singt, nicht einmal unter der Dusche, hat wenig gemeinsam mit der Donna Anna aus der Vorstellung in Wien. Aber nun hatte er sie doch erkannt. In seinem Blick war alles Mögliche. Freude, Vorsicht, Besorgnis. Noch ehe sie antworten konnte, kam jemand mit raschen Schritten auf sie zu.
»Maestro de Silva! Man vermisst Sie. Warum verstecken Sie sich vor Ihren Bewunderern?«
Befehlsgewohnte Stimme, metallen, schneidfähig. Der zielgerichtete Habichtblick ließ unerwartet den Maler los, erfasste die Frau neben ihm, packte zu. Sie mutierte zum anvisierten Kaninchen. Sogar das Zucken ihrer Nase vermeinte sie zu spüren. Der Mann hätte ganz attraktiv sein können, wäre da nicht dieser leicht angewiderte Ausdruck um den Mund gewesen. So als hätte er von einer Speise gekostet, für deren Geschmack er den Küchenchef umgehend enthaupten lassen würde.
Dem Blick, der auf sie fiel, tatsächlich im schweren Sinn des Wortes wie ein Gewicht fiel, folgte ein Lächeln, das allerdings den anstrengenden weiten Weg bis zu den Augen nicht schaffte. Die Augen lächelten nicht, sondern begannen unverzüglich damit, sie prüfend abzutasten. Nicht begehrlich. Nein, das nicht. Eher waren es die Blicke eines Kunsthändlers, auf der Suche nach einem Fehler an dem fraglichen Objekt, aufgrund dessen man einen Preisnachlass erreichen konnte.
»Ich kann Sie ja verstehen! Wollen Sie mich der bellissima Signorina nicht vorstellen?«
»Conte Alvise Montanara«, begann Mario. Dann eine kurze Pause der Ratlosigkeit. Natürlich, er kannte ja ihren neuen Namen nicht.
»Teresa Padovan«, sagte sie schnell.
»Teresa«, wiederholte der Conte. In seinem Ton ein Vorwegnehmen späterer Vertrautheit.
Bilden Sie sich bloß nichts ein, Herr Graf. Se vuol ballare, Signor Contino, hört sie einen Bassbariton in spöttischem Tonfall. War es Hans Hotter als Figaro?
»Hat Ihnen schon jemand gesagt, dass Sie Bellinis Maria Magdalena ähnlich sehen?«
Nein, das hatte noch niemand. Sie nahm an, dass es als Kompliment gemeint war, hatte aber an Bellinis Maria Magdalena keinerlei Erinnerung. Mario sprang ein.
»Ah – ich weiß, was Sie meinen, Conte, die rotblonden Locken, der Gesichtsschnitt vielleicht, aber sonst … Bellinis Magdalena hat auffallend dunkle Augen, nicht dieses helle Graugrün.«
Zwei Paar Männeraugen verloren sich im Graugrün. Ein Paar zu viel.
»Mag sein«, sagte er, ohne das Graugrün zu verlassen. »Ich hoffe, wir sehen uns öfter, Signorina Padovan.«
Bloß nicht!
Sie lächelte möglichst unverbindlich.
»Ich hole Ihnen ein Glas Wein. Ein ausgezeichneter Verduzzo von meinem Gut bei Treviso.«
»Vielen Dank, sehr freundlich.« Hoffentlich holt er es in Treviso.
Immer mehr Ausstellungsbesucher entzauberten durch ihre Anwesenheit den Klostergarten. Einer, der sich als Kunsthändler vorstellte, zog Mario zur Seite. Maria hatte recht gehabt, sie hätte nicht herkommen sollen. Aber diese Bilder. Und der Mann, der sie gemalt hat. Mario, Mario, Mario! Es ist Vollmond und der Blütenduft der Nacht berauscht das Herz.
Sie brauchte weder Vollmond noch Blütenduft, um sich berauscht zu fühlen. Wein schon gar nicht. Aber zu einem Liebesduett gehören bekanntlich zwei.
Der Kunsthändler redete auf de Silva ein. Sie stand da und hoffte, Maria in der Menge der Besucher zu entdecken.
Wo bleibt sie denn, die Stimme der Vernunft?
Dann war Mario de Silva wieder neben ihr, nahm ihre Hand. »Lassen Sie uns von hier verschwinden.«
Gemeinsam stahlen sie sich davon. Ließen Venedigs Kunstwelt einfach stehen. Und den Conte, der sich suchend nach ihr umschaute, ein Glas Verduzzo in der Hand. Von seinem Gut in Treviso.
5
Am nächsten Morgen nach nur wenigen Stunden Schlaf entschuldigt sie sich bei Maria für ihr Verschwinden. Die antwortet mit einer mariatypischen wegwerfenden Handbewegung. »Ich bin nicht das Problem, aber einen Conte Montanara kann man nicht einfach so stehen lassen.«
»Du hast doch gesehen: Man kann.« Sie lächelt unwillkürlich beim Gedanken an den Conte mit dem Weinglas in der Hand. »Er wird seinen Verduzzo einer anderen angeboten haben.«
Maria schüttelt den Kopf. »Du kennst Venedig nicht. Und schon gar nicht diese Sorte adeliger Venezianer. Eine Auffassung von Ehre, dagegen ist jeder gehörnte Sizilianer ein Vorbild an Toleranz. Dazu die Arroganz von Renaissancefürsten. Ius primae noctis und so, du weißt schon.«
»Zu spät.« Sie lacht.
Maria lacht nicht. »Außerdem verfügt jemand wie er über ein Spionagesystem in Gestapoqualität.«
»Eine ungemütliche Mischung. Aber ich habe nur ein paar Worte mit ihm geredet. Daraus kann doch auch ein venezianischer Adeliger keine Besitzansprüche ableiten. Du machst dir zu viele Sorgen.«
»Und du bist verliebt, daher unzurechnungsfähig.«
Ist sie verliebt? Jedenfalls unzurechnungsfähig. So viel ist sicher. Sie hat Mario alles erzählt. Ihm, den sie kaum kennt.
Warum hat sie ihre eigene und Marias Sicherheit aufs Spiel gesetzt? Weil er so unglaubliche Augen hat und so schöne Bilder malt? Idiotin! Ist das vielleicht eine Garantie für einen verlässlichen Charakter?
Ihr Verstand neigt zum Sarkasmus, also arbeitet er noch. Aber er ist auf verlorenem Posten gegen die Informationen, die in ihren Körperzellen abgespeichert sind. Es sind überwiegend Mario!Mario!Mario!-Zellen. Mit der dazu passenden Musik aus Tosca.
Dieser Abend …
Es war, als wäre ein Damm gebrochen, hinter dem sich ungesprochene Worte aus mehr als drei Jahren aufgestaut hatten. Eine unstoppbare Erzählflut. Von dem Abend, als der Anruf der Nachbarin kam, bis zu ihrer neuen Existenz in Venedig als Teresa Padovan, Marias Cousine aus dem Veneto. Er stellte keine Fragen, hörte nur zu.
»Der Wahnsinn ist bald vorbei«, sagte er dann. »Bis dahin bist du in Venedig sicher.«
Sie waren ziellos durch die dunklen Gassen Venedigs gegangen, einem zufälligen Mäandermuster folgend. Ziellos? Zufällig? Zumindest was sie selbst betraf. Irgendwann in der Nähe des Campo San Polo blieb Mario plötzlich vor einem Haus stehen. »Meine Dachterrasse hat einen schönen Blick zum Canal Grande.« Befangenheit stand zwischen ihnen wie eine gläserne Wand.
»Du klingst wie ein Immobilienmakler.«
»Na ja, das mit der Briefmarkensammlung kam mir zu banal vor.«
»Du sammelst Briefmarken?«
»Nein. Das ist ein weiteres Problem.«
Im Lachen zerfiel die gläserne Wand.
»Warum fragst du nicht einfach, ob ich mit dir schlafen will?«
Eine allererste Verabredung, weitere Treffen, ein langsames Kennenlernen, beginnende Vertrautheit, körperliches Verlangen – all das passte mühelos in einen einzigen Abend, eine einzige Nacht. Zeit ist ein Element, das sich fast unendlich dehnen und komprimieren lässt.
»Ich bin eine Schlampe.« Das war später dann auf der Dachterrasse. Unter dem diensteifrigen Gefunkel eines zum Greifen nahen Sternenhimmels.
»Warum sagst du so etwas?«
»Weil mich der umschwärmte Künstler gleich am ersten Abend in seinem Bett vorfindet.«
»Ich hoffe dich für den Rest meines Lebens in meiner Nähe vorzufinden.« Er klang ernst.
Sie wollte, dass der Augenblick seine Schwerelosigkeit behielt. »Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Manchmal kriegt man, was man sich wünscht.«
Er zog sie an sich.
6
Sie wehrt sich erfolgreich gegen unerklärliche Kräfte, die sie nach San Polo ziehen wollen, und geht ihre übliche Runde. Schließlich kann sie nicht vor seiner Tür warten so wie ihre Verehrer in einem anderen Leben, die vor dem Bühneneingang der Staatsoper standen und auf ein Autogramm hofften.
Es gibt keine Verabredung. Sehen wir uns morgen? Die Frage kam weder von ihr noch von Mario. Das Morgen schien weit weg zu sein. Aber jetzt ist es da und fühlt sich leer an. Ohne eine konkrete Erwartung, ohne Aussicht auf ein Wiedersehen. Er hat erwähnt, dass er arbeiten will. In seinem Studio am Lido. Sie ist nicht mehr auf dem Lido gewesen, seit die Deutschen dort ihre Platzkommandatur eingerichtet haben. Platzkommandatur. Allein das Wort klingt nach widerhallenden Schritten von Soldatenstiefeln.
Als sie nach Hause kommt, arbeiten Maler an der Fassade des Hauses. Ein neuer intonaco war dringend nötig. Venedigs Häuser werden nicht erst verputzt und dann bemalt, die Farbe wird in den Verputz gemischt. Gemeinsam mit Maria hat sie ein tiefes dunkles Rot ausgesucht. Sie hat noch den Geruch von Mörtel und Farbe in der Nase, daher kann sie diesen anderen, viel subtileren Geruch nicht sofort identifizieren, der ihr im Inneren des Hauses entgegenschlägt. Sie geht die Treppen hoch und steht vor einem Zinnkübel, der mit Rosen gefüllt ist. Fünfzig? Hundert? Jedenfalls sehr viele. Der blasseste aller Rosatöne leuchtet ihr in einem riesigen Strauß entgegen. Sie spürt einen kleinen spitzen Schmerz in der Zwerchfellgegend. Sie erkennt diese Art von Schmerz von früheren Gelegenheiten wieder. So fühlt sich Enttäuschung an.