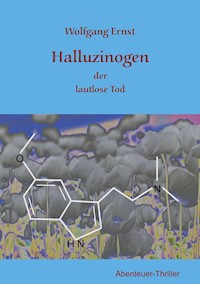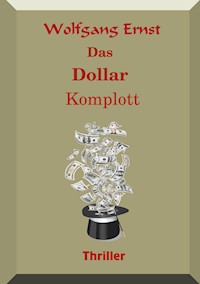Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der amerikanische Zoologe George Baker unterschreibt die Verpflichtung, eine Expedition nach Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo, anzuführen. Die Aufgabe seines Teams besteht laut seinen Auftraggebern darin, rätselhafte Todesfälle unter Orang-Utans aufzuklären, die zuvor klammheimlich in den angestammten Lebensraum dieser Tiere ausgewildert wurden. Schon während seines kurzen Aufenthaltes in dem von der Außenwelt abgeschirmten Institut als Vertragspartner, ereignen sich merkwürdige Dinge, die erste Zweifel an der Seriosität des Unternehmens aufkommen lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch: Im Schatten der Siebziger ist eine spannungsgeladene Verknüpfung von klassischer Abenteuerliteratur und modernem Thriller.
Der amerikanische Zoologe George Baker unterschreibt die Verpflichtung, eine Expedition nach Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo, anzuführen. Die Aufgabe seines Teams besteht laut seiner Auftraggeber darin, rätselhafte Todesfälle unter Orang-Utans aufzuklären, die zuvor klammheimlich in den angestammten Lebensraum dieser Tiere ausgewildert wurden. Schon während seines kurzen Aufenthaltes in dem von der Außenwelt abgeschirmten Institut als sein Vertragspartner, ereignen sich merkwürdige Dinge, die erste Zweifel an der Seriosität des Unternehmens aufkommen lassen. Gleich zu Beginn der Expedition stellt sich heraus, dass nicht Georg Baker selbst, sondern der Mann, der ihn geködert hat, die Befehle erteilt, wobei er nicht vor brutaler Gewalt zurückschreckt.
Während der Expedition im tiefen Dschungel, kommt es auch zu unerwarteten Kontakten mit den Dajaks, den Ureinwohnern dieses Gebietes.
Für einige Beteiligte endet das Unternehmen dramatisch.
Der Autor. Wolfgang Ernst, im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen, lebt in der Erzgebirgsstadt Aue und ist verheiratet. Er war langjährig in leitender Position in der Wirtschaft tätig. Im Schatten der Siebziger ist sein dritter veröffentlichter Roman. Dank seiner zahlreichen Auslandsreisen und intensiven Recherchen hat er sich im Laufe der Jahre umfangreiche Kenntnisse zu fremden Ländern und deren Bewohner angeeignet. Diese Kenntnisse fließen in seine spannenden Geschichten ein.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Prolog
Es ist Spätsommer. Noch während die letzte Morgenkühle wenn auch nur zögernd den Rückzug antritt, hat mich die erwachende Natur hinaus ins Freie gelockt, wo ich mich nun geruhsam in meiner Hängematte, die im Schatten einer tausendjährigen Eiche unweit unseres Hauses baumelt, erholen und die Beschaulichkeit des neuen Tages wie ein gutes Getränk Schluck für Schluck genießen möchte. Wie so häufig zu dieser Jahreszeit zeigt sich das Wetter von seiner prächtigen Seite. Die Sonne spendet schon die erste wohltuende Wärme und verleiht dem Tag eine freundliche und zugleich friedliche Atmosphäre. Eine leichte Brise streicht flüsternd durch die Blätter der Büsche und Bäume. Der Himmel weist jetzt eine blassgelbe Tönung auf mit einem Schuss Purpur darin. Die ersten Wespen schwirren laut summend aus ihren geheimen Verstecken. Plötzlich schlägt unweit von mir kraftvoll eine Spottdrossel an. Ihr Gesang klingt zuerst wie der schneidende Pfiff durch zwei Finger, bevor er wie der ferne Hall eines Schmiedehammers ausläuft. Der Vogel gehört zu einem Pärchen, das schon mehrere Jahre hintereinander in einem nahe gelegenen Weidebusch genistet und Junge aufgezogen hat. Ich schaukle mit der Hängematte leicht hin und her, und während ich hinauf in die stolze Krone des stattlichen Baumes blinzele, wo sich zwischen den vom Wind gerührten Blättern zuweilen zaghaft ein goldener Sonnenstrahl hindurchstiehlt, durchdringt mich wieder diese seltsame Unruhe, wie immer in den Augenblicken, in denen ich leidenschaftlich an die Vergangenheit denken muss. Und sobald ich mir die Zukunft vor Augen führe, ertrinken meine weitgefächerten Gedanken unweigerlich in einer Flut offener Fragen; Fragen, die mein persönliches Schicksal berühren und solche, die sich mit dem Fortbestand von Natur und Menschheit auf unserem einmalig schönen Planeten befassen.
Meiner heutigen Geburtstagsfeier anlässlich des Sechzigsten sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Einerseits kann ich von Glück reden, wieder ein ganz normales Leben ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu führen. Anders als damals vor mehr als drei Jahrzehnten, als mich die tägliche Angst, das mit der Unberechenbarkeit eines feuerspeienden Berges ausgebrochene Fieber könne mich womöglich unerbittlich von innen heraus zerstören, beinahe um den Verstand brachte. Mein Hausarzt behauptete zu jener Zeit, das Fieber sei aus medizinischer Sicht nur dem Anschein nach bösartig, und außergewöhnlich sei so etwas in meiner Situation überhaupt nicht. Im Gegenteil es würde ihn sehr wundern, wenn das Fieber ausbliebe, denn mein Gehirn hätte es logischerweise als Abwehrreaktion gebildet, um die schrecklichen Erlebnisse rascher und nachhaltiger verarbeiten zu können. Und er versicherte gleichzeitig, diese Krankheit, die eigentlich den Ausdruck Krankheit überhaupt nicht verdient hätte, wäre lediglich eine vorübergehende Erscheinung. Mein Schwager William, auch Arzt und dazu noch ein sehr guter, nicht einer von diesen arroganten, geldgierigen Scharlatanen einer neuen Generation, die inzwischen das ganze Land wie eine Seuche überfluten, schloss sich dieser optimistischen Prognose an, allerdings erst als ihm das Ergebnis weiterer gründlicher Untersuchungen vorlag. Und er sollte Recht behalten. Zumindest bis zum heutigen Tag. Doch der Sechzigste ist nicht irgendein Geburtstag. Wenn man so in die Jahre kommt, dann lässt man unwillkürlich die Zeit Revue passieren, und es stellt sich schon die Frage: Was hat man noch zu erwarten, bis es soweit ist? Natürlich bleibt es da nicht aus, dass sich bei dieser Gelegenheit auch eine gewisse Angst vor dem Altwerden in die Gedankengänge drängt.
Während ich in den grünen Schirm aus Blättern starre, beginnen meine Gedanken unwillkürlich durch die Vergangenheit zu schweifen. Vieles hat sich seither geändert. Mein Sohn ist viel zu schnell zu einem Mann herangewachsen. Seine anfänglichen biologischen Fähigkeiten, die er als Kind mit einer umfangreichen Schmetterlingssammlung und einem für Forschungszwecke sezierten Laubfrosch unter Beweis gestellt hatte, sind offenbar verkümmert, seit ihm mit zunehmenden Alter bewusst wurde, wie wunderbar es sich im Taumel aller Verlockungen der modernen Zivilisation leben lässt, anstatt sich so leidlich über die Jahre zu quälen. Man hat nur ein Leben und das sollte man auch genießen, solange es Zeit dafür ist, begründete er seine von der Allmacht des Geldes geprägte Lebensauffassung, als ihn seine Mutter einmal deswegen beiseite nahm. Er hat den sonnigen Süden inzwischen mit dem pulsierenden Leben und den kalten, weißen Wintern in den Straßenschluchten New Yorks eingetauscht. Seine Karriere ist inzwischen beängstigend schwindelerregend. Schon kurz nach dem bravourösen Abschluss seines Jurastudiums hatte ihn eine sehr angesehene, international verzweigte Kanzlei zu sich geholt, und er sagte mir kürzlich am Telefon, die Chancen, in Kürze als Juniorpartner mit 2000 Dollar die Stunde einzusteigen, stünden mehr als nur gut.
Meine eigene Karriere hingegen hält sich in Grenzen. Als es mir damals wieder etwas besser ging und ich mir allmählich darüber klar werden musste, welchen Beitrag ich zur Ernährung meiner Familie für angemessen halte, kam ich zu dem Schluss, es sei wohl das klügste, dort weiter zu machen, wo ich einst aufgehört hatte, nämlich in dem nahe unserer Behausung gelegenen Safaripark, der sich innerhalb kurzer Zeit zu einem gewinnträchtigen Touristenmagneten gemausert hatte.
Der Verwaltungschef sah mir auf meine Frage nach dem alten Job in der Primatenabteilung erst eine ganze Weile forschend in die Augen. Womöglich wollte er sich auf diese eindringliche Weise Gewissheit verschaffen, ob ich bei meiner verunglückten Suche nach dem vollendeten Abenteuer auch keine geistige Behinderung davon getragen habe. Als er damit fertig war, starrte er auf die Schreibtischplatte und strich sich mehrmals über die gerunzelte Stirn, was auf einen tiefen inneren Konflikt schließen ließ. Nach bangen fünf Minuten seiner Zwiesprache, bekam ich einen Gesprächstermin beim Direktor. Das Resultat, ich durfte wieder anfangen. Als der Direktor vor fünf Jahren in den Ruhestand ging, wurde ich sein Stellvertreter, weil der vorangegangene Stellvertreter auf seinen Posten nachgerückt war.
Immer dann, wenn ich an diesem ruhigen Ort, der auch einen schönen Schuss Romantik in sich birgt, gemütlich in der Hängematte über die Gegenwart und zunehmend auch über den Herbst, den nahenden Spätherbst und manchmal auch schon über den Winter meines Lebens nachdenke, verbinden sich meine Gedanken unwillkürlich mit den furchtbaren Erlebnissen aus jener Zeit. Natürlich, das eine oder andere davon ist im Laufe der Jahre verblasst. Aber es gibt auch genügend Erinnerungen, die sich mit einer Hartnäckigkeit in meinem Gedächtnis eingebrannt haben, als hätten wir uns für alle Ewigkeit Treue geschworen.
Vor einigen Wochen, es war an einem wunderschönen Sonntagnachmittag, hatte ich genau an dieser Stelle ein seltsames Erlebnis. Ich war kurz davor einzuschlummern, da drang ausgelöst von einer schwachen Windböe, weit über mir ein außergewöhnlich heller Lichtstrahl wie ein glühender Pfeil durch das dichte Blattwerk. Um mich gegen die plötzlich einfallende Helligkeit zu schützen, verschloss ich rasch die Augen. Genau in diesem Augenblick trat hinter meinen geschlossenen Lidern ein Trupp Orang-Utans in Erscheinung. Alle Tiere wiesen eine eigentümliche Rotfärbung auf, als sei ihr buschiges Fell über und über mit flammendem Haar besetzt. So wie sie sich erhaben und in voller Schönheit vor mir präsentierten, fiel es mir schwer der Tatsache ins Auge zu sehen, wie ungewiss das Schicksal dieser prachtvollen Tierart ist, die ohne drastische Schutzmaßnahmen in nicht allzu ferner Zeit restlos aus ihren ursprünglichen Lebensräumen verschwinden wird, so als hätte sie niemals existiert. Ein mächtiges, majestätisch wirkendes männliches Tier löste sich aus der Menge und kam in beängstigender Weise geradewegs auf mich zu.
Plötzlich verharrte es und begann mit menschlicher Stimme zu sprechen: »Auch wenn ihr Menschen es nicht wahrhaben möchtet, so könnt ihr euch der Tatsache des fortwährenden Unterganges unserer Art nicht länger verschließen. Denn ganz allein ihr Menschen seid es, die gnadenlos in die Natur eingreifen, um sie uneingeschränkt auszuplündern oder sie zu euren Gunsten zu verändern, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wie schnell die Vergehen an der Natur eines Tages auf euch selbst zurückfallen könnten. Wäre es unter diesen Umständen nicht klug und für alle das Vernünftigste, auf die Natur nur insofern einzuwirken, wie es für beide, für die Natur und dem Menschen gleichermaßen vorteilhaft ist? Der Mensch benötigt die Natur, die Natur hingegen kann auf die Anwesenheit des Menschen durchaus verzichten.«
Es ist nicht das erste Mal, dass die Eigentümlichkeit dieses Ortes meine Gedanken in dieser tiefgründigen Weise herausgefordert hat. Wäre es vielleicht besser, diesen Fleck zukünftig zu meiden?, frage im mich zum tausendsten Male, aber immer wieder ohne es ernsthaft in Erwägung zu ziehen.
Die eigentliche Geburtstagsfeier soll heute Nachmittag steigen. Auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin, hält sich die Gästeschar in Grenzen. Unser Sohn Tom mit Ehefrau Nancy und dem achtjährigen Enkelkind Paul haben sich dafür angesagt. Auch Kathrins Bruder William versprach kurz einmal vorbeizuschauen. Meine Mutter ist schon vor einigen Tagen aus ihrem kleinen Kaff in der Nähe von Boston angereist, und nun sorgt sie nicht allein nur mit ihrer Anwesenheit sondern auch mit ihrer umgänglichen und warmherzigen Art für eine ausgewogene Balance des Schwiegermutter-Schwiegertochter-Verhältnisses. Auf Kathrins Anregung hin, haben wir einen der größten Lebensmittelmärkte im Umkreis von fünfzig Kilometern geplündert und das Auto bis zum Dach mit verschiedenen Fleischprodukten für den Grill, einer Unmenge teils harmloser, teils berauschender Getränke und allerlei anderer Köstlichkeiten vollgepackt. Da auch das Wetter hervorragend mitspielt, dürfte einem ungetrübten Verlauf der Geburtstagsfete eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
Aus meinem Blickwinkel kann ich, wenn ich den Kopf ein wenig anhebe, beobachten, was auf der Terrasse vor sich geht. Im Augenblick ist es Kathrin, die diesen Ort mit ihrer Anwesenheit belebt. Offenbar hält sie nach unseren Gästen Ausschau. Als mich ihr Blick streift, verharrt sie kurz und winkt mir wie einem alten Bekannten zu. Ich wedele, soweit es mir die Hängematte erlaubt, zurück. Kathrin ist zu weit entfernt, um ihren Gesichtsausdruck von meinem Beobachtungspunkt aus zu deuten. Aber ich bin mir sicher, sie lächelt, bevor sie wieder ins Haus geht.
Unwillkürlich muss ich an unsere allererste Begegnung vor mehr als einem viertel Jahrhundert zurückdenken. Ich stand damals kurz vor dem Examen an der Universität Boston und es lag die Aufgabe vor mir, mich nach einem geeigneten Job als Zoologe umzusehen, was sich allerdings schwieriger als vermutet erweisen sollte, denn ich wollte nicht wie viele andere aus meiner Fakultät in einem landwirtschaftlichen Institut Hochleistungskühe für die profitorientierte Milchindustrie oder für dreistöckige Riesenhamburger züchten, sondern es lag mir mehr an einer Tätigkeit, die mich beruflich voll ausfüllt, auch auf die reale Möglichkeit eines bescheideneren Einkommens hin. Zudem wollte ich auf keinen Fall Gefahr laufen, irgendwann einmal in dem wogenden Menschenmeer einer Millionenstadt der Ostküste hoffnungslos zu ertrinken; die erdrückende Eingeschlossenheit verglasten Betons, nie enden wollende Autolawinen, die sich über schwarze, stinkende Teerstraßen ergießen und diese panischen Großstadtgeschöpfe, die rastlos und hysterisch wie fehlprogrammiert über die Gehsteige hetzen, vor allem abends wenn sich ihre Brillen, Köpfe und Anzüge im pulsierenden Neonlicht wie in einer Diskothek für Schwule und Lesben blau, rot und grün färben.
Also bewarb ich mich auf einen freundlichen Hinweis meines Anatomieprofessors hin bei der Personalabteilung eines Safariparks, der zu jener Zeit weiter unten im Süden in der Nähe von Jackson, einer Stadt von mittelmäßiger Größe und akzeptabler Kriminalität, gerade im Entstehen begriffen war. Ich hatte tatsächlich Glück und kam in der Primatenabteilung unter. Das war eine Arbeit, die ganz meinen Neigungen und Fähigkeiten entsprach. Doch bevor ich den neuen Job endgültig antreten konnte, musste ich mich zunächst einmal nach einer geeigneten Unterkunft umsehen. Bei dieser Gelegenheit lernte ich auch Kathrin kennen. Sie vermietete damals zwei möblierte Zimmer in ihrem Haus, das für sie zu groß war, um es mit genügend Leben ausfüllen zu können.
Gleich im ersten Augenblick unserer Begegnung verfiel ich, von der magischen Anziehungskraft ihrer ausdrucksstarken tiefbraunen Augen gefangen, in eine seltsame Körperstarre. Es dauerte erst eine geraume Weile bis mir wieder einfiel, warum ich eigentlich hier war. Doch auch während ich meine Frage, ob ich vielleicht hier wohnen dürfe, mit bebender Stimme herausstotterte, starrte ich sie wie benommen an. Als ihr das bewusst wurde, reagierte sie zunächst mit deutlicher Nervosität und sie versuchte meinem Blick auszuweichen. Allerdings vergeblich. Schon eine Sekunde später verfingen sich unsere Blicke, so als seien sie eins. Meine innere Stimme sagte mir genau in diesem Moment: Die Augen sind der Spiegel der Seele. Und wie es sich schnell zeigte, sollte mein Bauchgefühl auch Recht behalten.
Spätestens von da an war ich wie besessen von dem Wunsch, diese wundervolle und mit vielen Reizen ausgestattete Schönheit zu erobern. Das Mischlingsblut, das durch ihre Adern floss verfeinerte ihren Anblick noch zusätzlich. Obgleich ich nicht vorhatte, schon bald eine feste Bindung einzugehen, verfolgte ich dennoch von Anfang an mit viel Beharrlichkeit eine daraufhin zielende Taktik. Aber es sollten dennoch drei lange Monate vergehen, bis ich endlich am Ziel meiner geheimsten Wünsche angelangt war. Es war unvergesslich.
Tom unser einziges Kind wurde drei Jahre später geboren.
Noch einen Augenblick lang verharren meine Gedanken bei Kathrin, mit einer Intensität, als wäre es mir möglich, sie durch die geschlossenen Wände unseres Hauses zu beobachten.
Wie es scheint, hat Kathrin wieder einmal ihren sechsten Sinn spielen lassen, denn genau in der Minute, als sie erneut heraus auf die Terrasse tritt, taucht ein schwarzer BMW der gehobenen Oberklasse vor der Einfahrt auf. Mir ist augenblicklich klar, Tom hat sich dieses luxuriöse Gefährt am Flughafen gemietet, um seiner Gattin den Anspruch auf eine standesgemäße Anreise zu ermöglichen. Später, als ich Kathrin wegen ihrer Fähigkeit, Ereignisse punktgenau vorauszusehen, ein Kompliment hinüberreiche, gesteht sie mir schmunzelnd, nicht eine außergewöhnliche Begabung hätte sie eben in dem Moment aus dem Haus gelockt, sondern eine der vielen neuen technischen Errungenschaften unseres Jahrhunderts, die sich Handy nennt.
Kaum steht der Wagen, da fliegt die hintere Tür auf und unser Enkelkind Paul kommt mit einem kleinen Hund im Schlepptau angeprescht. Meine Mittagsruhe ist dahin.
Wir hatten in den vergangenen zehn Jahren keinen einzigen Geburtstag mehr in Familie gefeiert, was auch ein wenig mit der Schuleinführung unseres Enkels zusammenhing, die vor reichlich zwei Jahren in New York mit großem Pomp wie ein Allerweltereignis gefeiert wurde.
Für das Barbecue und die anschließend zu erwartende Nachfeier habe ich aus der Nachbarschaft einige Gartentische organisiert und für jeden meiner Gäste einen halbwegs bequemen mit weichen Kissen gepolsterten Plastiksessel hingestellt. Aber bevor alles, was wir zum Essen und Trinken herangeschleppt hatten, aufgefahren wird, geht es erst einmal ans Auspacken der Geschenke. Lediglich die Geburtstagstorte – ein wahres Prachtstück, zwei Etagen hoch, mit extra bunter Glasur und handwerklich gekonnt, mit verschiedenen Ornamenten verziert – dient jetzt schon als Blickfang der den heutigen feierlichen Anlass angemessen unterstreichen soll. Für alle gut sichtbar warten die sechzig roten Kerzen schon ungeduldig darauf, bis sie angezündet und einer ziemlich unsinnigen Tradition folgend anschließend wieder ausgepustet werden.
Die einzelnen Geschenkpäckchen hüten, in glänzendem, buntbedrucktem Geschenkpapier eingeschlossen, zunächst noch ihr Geheimnis. Um die Spannung etwas anzuheben, nehme ich jedes einzelne Päckchen der Reihe nach in die Hand und gebe vor, ich könne den Inhalt durch leichtes Schütteln ergründen. Alle sitzen in ihren Plastiksesseln und schauen gespannt zu, wie ich mich abmühe, die kunstvoll gefertigten Knoten und Schleifchen möglichst gewaltfrei zu öffnen. Endlich ist es geschafft. Das erste Päckchen gibt seinen Inhalt preis. Es ist eine viel zu teure Armbanduhr mit Gravierung. Da mich Kathrin mit über der Brust verschränkten Armen und bohrendem Blick anstarrt, ist mir klar, wem ich dieses kostbare Stück zu verdanken habe. Peinlich berührt schließe ich sie in die Arme und küsse sie auf den Mund.
»Woher wusstest du?«, fragt sie erstaunt.
»Ich wusste es eben.«
Im nächsten Päckchen hat sich ein i Pad versteckt. Tom muss sich nicht erst großartig verstellen, ich kann ihm auch so ansehen, wessen Idee das war.
Er erhebt sich und umschließt mich mit den Armen wie es sich für Vater und Sohn gehört. »Noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich denke, das kannst du gut gebrauchen.« Es hört sich wie eine Entschuldigung an.
Schließlich greife ich nach etwas Blattgedrücktem. Wie es scheint, ein großer Briefumschlag. Ich habe richtig getippt. Als ich genauer hinschaue, ist mir klar, Familie Baker Junior hat eine Reise nach Hawaii springen lassen. Ich reiche Kathrin den Umschlag. Sie braucht erst eine ganze Weile, um sich durch die malerisch schöne Hochglanzwelt zu arbeiten. Als ihr bewusst wird, was sie da erblickt, macht sie zunächst den Eindruck, als würde sie innerhalb der nächsten Sekunde in eine tiefe Ohnmacht sinken.
»Seid ihr denn verrückt«, rutscht es ihr in der ersten Überraschung heraus.«
Doch dann entdecke ich einen Schleier von Misstrauen in Ihren Augen. Ich weiß sofort, was gerade in ihr vorgeht; die nächste Feier im trauten Familienkreis wird es in absehbarer Zeit nicht geben.
Nach einer peinlichen Pause meldet sich unsere Schwiegertochter zu Wort: »Wir dachten, da ihr in Kürze einen runden Hochzeitstag habt, könnte euch vielleicht eine kleine Abwechslung ganz gut tun.«
Ich sehe Kathrin an.
Nachdem wir mit den Augen einige kurze aber eindeutige Informationen ausgetauscht haben, sage ich: »Ach, das wäre doch nicht notwendig gewesen. Aber trotzdem vielen Dank.«
Auch Nancy tauscht mit ihrem Mann einige stille Informationen aus.
Die restlichen Geschenke setzen sich aus verschiedenen Textilien, darunter auch solche für die Nacht, einen etwas unpassenden Schlips, Rasierwasser und einer Flasche Bourbon zusammen. Das meiste davon trägt die Handschrift meiner Mutter. Manches würde ich ganz gut gebrauchen können – vor allem den Whisky.
Um keine Trauer aufkommen zu lassen, klatsche ich laut in die Hände und verkünde: »Und jetzt kommen wir endlich zum gemütlichen Teil.«
Kathrin nimmt eines der überlangen Kaminzündhölzer und zündet eine Geburtstagskerze nach der anderen an. Als sie damit fertig ist, hole ich sehr tief Luft. Ich puste und puste mir dabei fast die Lunge heraus. Das obligatorische ...oooh... verbunden mit lautem Händeklatschen folgt, als ich es endlich im zweiten Anlauf geschafft habe, die kleine Zündelei zu beenden.
Paul hält nicht allzu viel von langweiligen Geburtstagsriten. Er hat sich mit kindlicher Phantasie und Genügsamkeit ein regelrechtes Traummobil aus einem umgekippten alten Stuhl und einigen Brettern zusammengebastelt. Das Speichenrad eines ausgemusterten Handwagens dient als Lenkrad, und als Schalthebel nimmt er einen krummen Holzstock. Es ist deutlich zu vernehmen, wie verblüffend echt er die Motorengeräusche nachahmen kann und immer wenn er eine kurze Pause einlegt, um wieder Luft zu schöpfen, höre ich ihn sagen: »Kupplung... Gang einlegen, Kupplung vorsichtig kommen lassen...« In vielem gleicht er seinem Vater, so als hätten sich dessen Y-Chromosome in ihn eingebrannt.
Gerade als ich über die wichtige Frage nachdenke, ob unser Enkelsohn jetzt vielleicht schon das Zeug für einen guten Autofahrer hat, da biegt plötzlich William mit seinem knallroten Landrover in die Toreinfahrt ein. Paul unterbricht augenblicklich sein Treiben und stürmt mit ein paar langen Sätzen auf das geländegängige Fahrzeug zu. Mit einem kräftigen Ruck hält das Auto an und kaum ist die Tür aufgesprungen, da huscht er rasch in das Wageninnere, wo ich ihn bald mit triumphierenden Augen hinter dem Lenkrad thronen sehen kann. Schon rollt das Fahrzeug mit verhaltener Geschwindigkeit weiter, dreht eine Runde im Hof und kommt nun direkt auf mich zugefahren.
William macht Anstalten, mich zu begrüßen, aber vorerst wird er noch von Kathrin daran gehindert, die sich unauffällig von hinten herangepirscht hat. Er umschlingt sie kraftvoll und drückt ihr dabei einen herzlichen Bruderkuss auf die Wange.
Dann bin ich an der Reihe. Seine großen nussbraunen Augen lächeln mich freimütig an. »Hallo alter Junge. Erst einmal alles Gute zu deinem Runden. Es freut mich, dich gesund und munter zu sehen. Und so soll es auch bleiben. So ein Geburtstag muss doch richtig gefeiert werden.« Er schüttelt mir kräftig die Hand, sodass ich froh bin, als er sie endlich wieder loslässt.
»Ich freue mich, dass du hier bist«, entgegne ich. Und ich meine es ehrlich.
Kathrin bugsiert ihren Bruder auf seinen Platz. »Setzt dich doch erst einmal.«
William huscht hin und wieder einmal bei uns vorbei. Bleibt aber meist nur kurz, weil er immer in Eile ist. Als ich ihn einmal fragte, ob er nicht schon einmal an Ruhestand gedacht habe, zeigte er nur sein breites Lächeln. In die Berge zum Fischen fahren und in einer einsamen Jagdhütte den Tag verbringen, könne warten, bis er einmal alt sei. Wann er diesen Tag für gekommen halte, darüber hüllt er sich in Schweigen. Ich vermeide es auch tunlichst, weiter an dieser Stelle zu schürfen.
Zum Essen hatten wir riesenhafte Steaks, Hamburger und deutsche Bratwürste aus Thüringen, knusprige Chickenflügel und saftige Chickenbrüste aufgefahren. Mehrere Schüsseln bunter Salate, verschiedene Soßen, und in einer länglichen Schale drängen sich echt italienische Oliven dicht aneinander, mit denen ein spanischer Olivenbauer in Kalifornien mehr oder weniger erfolgreich experimentiert. Wir dachten, das italienische Blut in den Adern unserer Schwiegertochter schreit geradezu nach Oliven. Zum Nachtisch gibt es Speiseeis in verschiedenen Variationen, das fast ein Viertel unseres begehbaren Kühlschrankes beansprucht hat. Jeder langt kräftig zu. Als wir uns schließlich mit Messern, Gabeln, Löffeln und den Fingern durch die Essensberge gearbeitet haben, ist von allem noch genug übrig, um die gesamte Nachbarschaft eine Woche lang damit zu verwöhnen. Wie ich Kathrin kenne, wird es wohl eine kleine Nachfeier geben. Ich hasse derartige Gelage mindestens genauso, wie sich die Kinder unserer Nachbarn darauf freuen.
Auch die Menge der Getränke übertrifft bei Weitem den Bedarf einer ausgelassenen Geburtstagssause. Offenbar haben bei Kathrins Planung die Trinkgelüste unserer Nachbarn keine unwesentliche Rolle gespielt. Um Bier und Wein in eine halbwegs akzeptable Temperatur zu versetzen, habe ich Toms alte Kinderbadewanne vom Boden geholt und mit Eiswürfeln versetztem Wasser gefüllt. Cola, Sprite und Fanta gibt es auch, aber in erster Linie für unser Enkelkind Paul. Obwohl ich mir nicht ganz im Klaren darüber bin, ob der Bengel nicht vielleicht schon hin und wieder an hochprozentigen Flüssigkeiten nippt, denn ich muss an Tommy denken, als er in diesem Alter war und Kathrin ihn einmal dabei erwischte, wie er sich Cola, die er mit meinem Whisky präpariert hatte, schmecken ließ.
Die Gespräche kommen in dem Maße in Gang, wie die ersten Promille aus vergorenem Zucker die Blutbahn passieren. Da es für eine ausgiebige Feier noch ziemlich früh am Tage ist, halte ich mich mit dem Alkohol lieber ein wenig zurück und taste zunächst erst einmal zaghaft unsere Biervorräte an. Man kann ja nie so genau wissen, wie sich alles noch entwickelt. Da ist es schon besser, wenn wenigstens einer einen klaren Kopf behält. Trotz dieser unangenehmen Selbstverpflichtung hält sich meine schlechte Laune in Grenzen und allmählich finde ich es schön, wie sie sich alle darüber freuen, wie alt ich heute geworden bin.
Während der anfänglichen Quergespräche bleibt mir genügend Gelegenheit, jeden einzelnen meiner Gäste möglichst unauffällig etwas genauer ins Visier zu nehmen. Da ist erst einmal Tom. Irgendwie wirkt er abwesend, so als würde ihm etwas Wichtiges durch den Kopf gehen. Sobald sich eine passende Gelegenheit ergibt, werde ich Kathrin einen Tipp geben, nehme ich mir vor. Womöglich öffnet er ihr gegenüber sein Herz. Seine Ehefrau Nancy, eine hübsche brünette Erscheinung mit graziösen Bewegungen, endlos langen Beinen und italienischem Vorfahren mütterlicherseits verhält sich Kathrin gegenüber wie gewohnt distanziert. Etwas zu distanziert für meine Begriffe. Meist versteckt sie ihre Augen hinter einer großen dunklen Sonnenbrille. Dabei hätte sie das überhaupt nicht notwendig. Ihre Augen sind so groß und dunkelbraun, wie die Gläser der Brille selbst. Vielleicht befürchtet sie, es könne auf diesem Weg jemand zu tief in ihr Innerstes eindringen. Und um ehrlich zu sein, ihr Blick strahlt bei weitem nicht diese Herzlichkeit aus, die sich Kathrin und ich für unseren Sohn gewünscht hätten. Kathrin sagt, das allein ließe noch nicht auf ein kaltes Herz und einen miesen Charakter schließen. Ich gebe ihr Recht, wenn auch nur zögernd. Im Augenblick hat sie die attraktiven Beine für mein Verständnis etwas zu weit übereinander geschlagen. Normalerweise fände ich das nicht weiter übel. Aber sie ist schließlich die Ehefrau meines Sohnes und deswegen meine Schwiegertochter.
Während Kathrin mit meiner Mutter den letzten Klatsch austauscht und William sich mit seinem Neffen beschäftigt, sitzt Tom immer noch mit unergründlicher Miene da. Was ist bloß los mit ihm? Hat er vielleicht etwas Wichtiges auf dem Herzen?, denke ich gerade. Da steht er auf, schnappt sich seinen Sessel und setzt sich neben mich.
»Ich freue mich, dass ihr da seid«, sage ich und klopfe ihn väterlich auf den Oberschenkel.
»Ich freue mich auch.«
Eine Weile schauen wir zu, wie William mit Paul herumalbert.
»Na, was hast du? Du willst mir doch etwas sagen«, wage ich endlich den Vorstoß.
Tom sieht mir verlegen in die Augen. »Dad, darf ich dich etwas fragen?« »Natürlich. Dafür sind Väter schließlich da.«
Sein Gesicht hellt sich kurzzeitig auf, nimmt aber sofort wieder einen ernsten Ausdruck an. »Weiß du was mir schon lange auf dem Herzen liegt?«
Ich ziehe die Schultern hoch. »Sag's mir!«
»Also die Sache ist die. Ich wollte dich schon immer fragen, ob du mir mal ausführlich davon erzählst, was damals passiert ist. Mom hat sich immer nur scheibchenweise dazu geäußert. Und das auch nur, wenn ich sie speziell danach fragte. Na, und du, du hast immer gekonnt abgeblockt, wenn ich das Thema angerissen habe.«
Ich atme erleichtert auf. »Und ich dachte schon, es ist etwas Schlimmes passiert. Du hast deinen Job verloren ober so etwas in der Art.«
Auf seinem Gesicht erscheint ein Ausdruck, der mit genügend Phantasie als Versuch eines Lächelns zu deuten ist.
»Willst du die ganze Geschichte hören?«, frage ich.
»Wenn möglich ja.«
»Aber das kann dauern.«
»Ich weiß. Aber Morgen ist schließlich auch noch ein Tag.«
»Bleibt ihr länger?«
»Wenn es euch recht ist?«
Ich sehe Tom fragend an. »Wie kommst du denn darauf, wir könnten uns nicht freuen?«
Er übergeht die Bemerkung. »Also bist du einverstanden?«
»Aber vorher hole ich mir noch ein Bier. Ich steure die Kinderbadewanne an und krame dabei in meinem Gedächtnis. Eine Szene aus jener Zeit ist mir sofort gegenwärtig.
Es war kurz nach einem dieser heftigen Fieberanfälle, die mich seinerzeit plagten. Ich lag in meinem Bett ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt war. Als ich endlich aus meiner Ohnmacht erwachte, konnte ich durch den wässrigen Schleier meiner Augen eine dunkelhäutige Frauengestalt erkennen. Erst ganz allmählich hellte sich das mich umschließende Duster auf, aber es sollte noch eine ganze Weile vergehen, bis sich Kathrin klar und deutlich aus der Umgebung abhob. Das Erste was mir sofort auffiel, war der unerklärliche Umstand, mich in meinem Bett vorzufinden, obgleich es eigentlich draußen taghell war. Kathrin, die meine offensichtliche Verwirrung augenblicklich bemerkte, sah mich zunächst mit mitleidigen Augen schweigend an. Dann kam mir ihr Mund entgegen, und es folgte ein lang anhaltender Kuss.
Kaum hatten sich ihre kühlen Lippen wieder gelöst, da verdunkeln sich ihre Augen. »Blass siehst du aus mein lieber Schatz und ganz eingefallen. « Sie richtete sich energisch auf und fügte hinzu: »So kann es auf keinen Fall mit dir weitergehen, nein unter keinen Umständen.«
Doch zunächst befeuchtete sie das Tuch auf meiner Stirn.
»Was ist eigentlich passiert?«, wollte ich wissen.
»Es ist inzwischen mehr als acht Stunden her, als dich Sam zufällig unter der großen Eiche fand. Du bist aus der Hängematte herausgefallen und lagst auf dem Boden«, weihte sie mich in die Zusammenhänge ein.
Sam war ein lieber Mensch, den wir, nachdem Kathrin das Haus erbte, in die Familie aufgenommen hatten. Leider ist er inzwischen gestorben.
»Ach deswegen liege ich jetzt hier?«
»Ja deswegen, und es hätte noch viel schlimmer kommen können. « Auf ihrem Gesicht zog eine dicke Sorgenwolke auf.
Als ich ansetzte etwas zu sagen, erklärte sie: »Dr. Wilson wird gleich auftauchen, um nachzusehen, wie es dir geht. Er hat dir schon eine Spritze gegeben und nun möchte er sich vergewissern, ob sie auch geholfen hat. «
»Lass mich bloß mit diesem dilettantischen Quacksalber zufrieden, der...« Da Sam in diesem Moment seinen schwarzen Mohrenkopf durch die Tür steckte, brach ich mitten im Satz ab.
»Doktor Wilson ist hier. Darf er eintreten?«, wollte er wissen.
Kathrin zupfte nervös ihr kurzes Kleid zurecht, das ihr bis weit über die Knie gerutscht war. »Also schön Sam, von mir aus kannst du ihn jetzt hereinschicken«, sagte sie schließlich.
Wie es aussah, hatte der Arzt schon eine geraume Weile hinter der halb geöffneten Tür gelauert. Plötzlich stand er wie ein aus der Wand heraustretender Schatten genau vor mir.
Mit routinemäßigen Ernst in der Stimme fragte er: »Nun wie geht es uns?«
»So leidlich.« Etwas Vernünftigeres fiel mir nicht ein.
»Dann hat also meine Spritze gewirkt?«
»Vielleicht«, antwortete ich ohne glaubhafte Überzeugung.
»Nun dann wollen wir doch gleich mal nachschauen.« Er holte ein altmodisches Blutdruckmessgerät aus seiner braunen Doktortasche. Dann nahm er die Wasserschüssel vom Hocker, um sich einen Sitzplatz zu verschaffen.
Doch bevor er zu pumpen anfing, sah er Kathrin mit strenger Miene an. »Wie ist es Ms. Baker, haben Sie schon Fieber gemessen?«
Kathrin senkte verlegen die Augen, um seinem durchdringenden Blick auszuweichen. »Leider nein«, antwortete sie kleinlaut. Doch dann fiel ihr etwas ein, was ihr erwähnenswert erschien. »Aber ich habe mich ganz genau an Ihre Anweisung gehalten und ihm keinen einzigen Schluck zu trinken gegeben«, verkündete sie verheißungsvoll.
Der Arzt biss in eine imaginäre Zitrone. »Das hätten Sie lieber tun sollen, das wäre durchaus richtig gewesen. Denn was ich sagte, das gilt, wie jeder weiß, nur für die erste Zeit; dass Ihr Mann nicht versehentlich die Zunge verschluckt und womöglich daran erstickt. «
Kathrin lief hochrot im Gesicht an wie ein Backfisch, der nach dem ersten Freund gefragt wird.
Während Dr. Wilson den Gummischlauch mit wenigen geübten Handgriffen fest um meinen Oberarm schnürte und geräuschvoll pumpte, waren meine Augen gespannt auf das Anzeigegerät gerichtet. »Nun wie sieht es aus Doktor?«
Er zog wichtig die Augenbrauen hoch und antwortete nichtssagend: »Es könnte natürlich viel besser aussehen, aber so schlecht sieht es nun auch wieder nicht aus. Allerdings wenn Sie auf meinen wohlgemeinten Rat hören wollen, dann sollten Sie die Sache möglichst nicht länger hinhängen lassen. Man weiß nie so richtig, was sich alles hinter einem derartig hartnäckigen Fieber verbergen kann. Und bevor es vielleicht zu spät ist, sollten Sie sich lieber stationär behandeln lassen. Dort nimmt man Sie wenigstens einmal gründlich auseinander, und mit ein wenig Glück findet man womöglich heraus, was Ihnen eigentlich fehlt.« Seine Augen waren auf Kathrin gerichtet.
»Ich werde darüber nachdenken«, versprach ich, mehr um ihn endlich loszuwerden.
»Gut, ich lasse Ihnen wenigstens ein Antibiotikum da. Davon nehmen Sie bitte täglich dreimal eine Kapsel – Sie wissen schon wohin. Aber wie gesagt, Sie haben es selbst in der Hand. Ich an Ihrer Stelle würde es jedenfalls nicht auf die lange Bank schieben«, mahnte er noch bis er sich endlich davonscherte.
Kaum hatte sich der Arzt verzogen, erschien Tommys Kopf im Türrahmen. Mit einem raschen Blick erkundete er die Lage. Dann schwang er sich auf die Bettkante, schaukelte lässig mit seinen langen dünnen Beinen hin und her und musterte mich dabei eine Weile interessiert mit seinen dunklen Zigeuneraugen. Offenbar, um sich sein eigenes Bild über meinen Gesundheitszustand zu machen.
Doch das Ergebnis seiner Studie schien ihm nicht völlig zu befriedigen. »Wie sieht es aus Dad, bist du bald wieder okay?«, erkundigte er sich sicherheitshalber.
Bemüht um einen optimistischen Gesichtsausdruck entgegnete ich: »Wieso fragst du, zweifelst du vielleicht? Selbstverständlich werde ich bald wieder okay sein, ich bin schließlich kein hoffnungsloser Fall.«
Tommy nickte heftig und trank hastig einen tüchtigen Schluck aus meinem Wasserglas. Ich betrachtete ihn unauffällig; sein tiefschwarzes, naturgelocktes Haar, die wulstigen, aufgeworfenen Lippen und eine Nase, die leicht nach oben gestülpt ist. Auch seine Haut ist erstaunlich dunkel. Nach Ähnlichkeiten zwischen uns beiden muss ich lange suchen. Aber mein Vertrauen Kathrin gegenüber ist uneingeschränkt, wie auch meine Vatergefühle gefestigt genug sind, um keine falschen Schlüsse aus reinen Äußerlichkeiten abzuleiten, zumal uns andere wertvolle Gemeinsamkeiten verbinden. Über seine hohe Stirn perlten kleine Schweißbläschen und er verbreitete den typischen Kindergeruch von Körperschweiß und Straßenschmutz.
Er ließ sich von der Bettkante gleiten und hüpfte sorglos davon. Bevor er durch die Tür schlüpfte, drehte er sich noch einmal um, kniff pfiffig ein Auge zusammen und ließ seine kleinen weißen Zähne schelmisch aufblitzen.
Die Szene erlischt ebenso rasch, wie sie plötzlich erwacht ist. Tommy ist inzwischen zu einem reifen Mann herangewachsen der jetzt in seinem Gartenstuhl sitzt und nun darauf wartet, bis ich meine Erinnerungen vor ihm ausgrabe.
»Ich habe dir auch gleich noch ein Bier mitgebracht«, sage ich und reiche ihm die Flasche.
Ich schließe für einen Moment die Augen, weil ich mir davon etwas mehr Konzentration verspreche. Als ich mich lange genug konzentriert habe, fange ich an, alles aus meinem Gedächtnis auszugraben, was mir wieder einfällt.
* * *
1. Kapitel
Es begann alles an einem Tag im Frühsommer des Jahres 1979, als mich Professor Bergland, der Direktor des Safariparks, überraschend und ohne Gründe zu nennen, zu sich rufen ließ. Wobei allein schon die Tatsache, ihn im Büro anzutreffen, zu einer großen Seltenheit zählte, denn er ging gewöhnlich mehr als einem Dutzend zeitaufwendiger Nebenbeschäftigungen nach; er hielt populärwissenschaftliche Vorträge, Vorlesungen an den bekanntesten Universitäten des Landes und er war zudem in den vielfältigsten Clubs, Organisationen und wissenschaftlichen Gremien vertreten. Mit regelmäßiger Häufigkeit unternahm er auch ausgedehnte Auslandsreisen, um an den verschiedensten Orten der Welt seine Tierstudien zu treiben, wie er uns wissen ließ. Alle dachten es, aber niemand besaß den Mut es auszusprechen; er nutzte seine Position, um seine Einkommensverhältnisse mit einem regelmäßigen Grundgehalt zu stabilisieren. Die eigentliche Arbeit jedoch lastete auf den Schultern seines unterbezahlten Stellvertreters, der sich Tag für Tag für den Park abrackerte ohne auch nur annähernd in die Reichweite der sprichwörtlichen Lorbeeren zu gelangen.
Neugierig darüber, welchen außergewöhnlichen Anlass ich diese überraschende Audienz zu verdanken hatte, machte ich mich augenblicklich auf den Weg. Um Zeit zu gewinnen, nahm ich gleich den sandfarbenen gut klimatisierten Kleinbus mit den großen Panoramafenstern, den Kathrin für ihre tägliche Arbeit benutzte, denn ihre Aufgabe war es damals, die Parkbesucher bequem durch das weiträumige Areal zu befördern, um ihnen die zahlreichen im Gelände verstreuten Tierarten mit fachkundigen Erläuterungen näher zu bringen.
Eine Viertelstunde später war ich an Ort und Stelle angelangt. Der moderne Mehrzweckbau, der durch eine eindrucksvolle Dachkonstruktion aus dreieckigen Glasgiebeln, die mit starken Stahlseilen zur Aufnahme der bogenförmig durchhängenden Dachhaut miteinander verbunden waren, auffiel, war Verwaltung und Empfang zugleich. Ich stellte den Kleinbus ab und stieg aus. Den Weg zum Eingangsportal säumten üppig blühende Robinien, die einen süßen Duft verbreiteten. Die zartweißen Blüten schwebten wie Schneeflocken auf die Erde herab, wo ihre ursprüngliche Schönheit in kürzester Zeit verblasste.
Leicht verunsichert durchquerte ich die lichtdurchflutete um diese Tageszeit wie leergefegte Empfangshalle. In der Mitte der Halle betupfte der Sprühnebel eines Springbrunnens verschiedene immergrüne tropische Pflanzen. An der einen Wand hing eine übersichtliche Landkarte von beachtlicher Größe, die mit bunten Tiergraphiken versehen war, und die dem Besucher viele nützliche Informationen über die Lebensräume und den Bestand der betreffenden Tierarten vermittelte. An der anderen Wand prangte eine groß aufgemachte Werbetafel mit den Big Fife und anderen Vertreten der afrikanischen Savanne, die zu einer Fotosafari nach dem bekannten Luangwa-Vally in Sambia einlud. Das Büro des Direktors befand sich im Obergeschoss des zweigeschossigen Bauwerkes.
Drinnen wartete die Sekretärin des Professors. Sie war jung, hübsch, rothaarig und trug einen grünen Lederrock, der ihr beim Sitzen nur knapp bis über das Gesäß reichte. Allerdings hatte sie sich viel zu dick mit Make up bekleistert, offensichtlich in der Absicht, ihre eigentlich reizenden Sommersprossen zu kaschieren. Die Maske verlieh ihr beinahe etwas Mumienhaftes. Bei meinem Eintreten gab sie sich den Anschein einer schwer beschäftigten Arbeitssklavin. Jedoch entging mir bei genauerem Hinsehen nicht, dass sie mir ihre Emsigkeit lediglich vorspielte. In der einen spaltbreit geöffneten Schreibtischschublade entdeckte ich in Umrissen die strahlend lächelnden Gesichter der dürren Models einer aufgeschlagenen Modezeitschrift.
Mit einer überheblichen Handbewegung machte sie mir verständlich, ich möge eintreten.
Ich übersah es und bemühte mich gleichzeitig, möglichst freundlich zu erscheinen. »Wissen Sie vielleicht, was es Wichtiges gibt?«, fragte ich schnell noch.
»Das wird man Ihnen schon von ganz alleine erzählen«, ließ sie mich mit grässlich tiefer Stimme wissen. Sie musterte mich geringschätzig von oben bis unten wie einen heruntergekommenen Landstreicher und fügte hinzu: »Sie dürfen sich ruhig hinein bemühen, der Chef wartet schon eine Weile auf Sie.«
»So, tut er das wirklich?«, gab ich zurück.
Bei meinem Eintreten fand ich Professor Bergland in Gesellschaft eines mir unbekannten Mannes vor. Beide waren in ein angeregtes Gespräch vertieft. Als sie mich bemerkten, zuckten sie erschrocken wie bei einer Lüge ertappt zusammen und brachen augenblicklich ihre Unterhaltung ab. Ich wusste nicht gleich, sollte ich näher treten oder besser zunächst an der Tür auf eine Aufforderung warten. Der Professor bemerkte mein Zögern. »Ach bitte nehmen Sie doch Platz«, winkte er mich herbei.
Der unbekannte Mann saß mir am Tisch genau gegenüber. Er war mittelgroß, von kräftiger Statur und trug ein Khakihemd, dazu dunkelgrüne Baumwollhosen, die wulstige Beintaschen hatten. In dieser Aufmachung konnte man ihn durchaus für einen verirrten Guerillakrieger aus den Bergen Mittelamerikas halten. Dieser Eindruck wurde zusätzlich durch sein kurz geschorenes Haar, ein etwas schief zusammengeheiltes Nasenbein und mehrere tiefe Narben im Gesicht verstärkt. Die wässrigen von roten Äderchen netzartig durchzogenen Augen wirkten kalt und brutal und besonders begabt sah er auch nicht aus. Seine äußere Erscheinung mahnte mich vom ersten Moment an zur Vorsicht ihm gegenüber, wobei das eigentlich kaum eine Rolle spielte. Was hatte ich schon mit dem Typ zu schaffen?
Bemüht möglichst freundlich zu wirken, schüttelte er mit überschwänglicher Liebenswürdigkeit meine Hand, so als liege es in seiner Absicht, mit mir eine Freundschaft auf Lebenszeit zu besiegeln. »Ich bin sehr erfreut, Sie kennenzulernen«, krächzte er mit einer Stimme wie ein verrostetes Gartentor.
Auch wenn sich meine innere Abneigung vom ersten Moment unserer Begegnung an wie eine unsichtbare Mauer zwischen mir und ihm aufbaute, so sah ich zunächst keine Veranlassung mir deswegen den Kopf zu zerbrechen. Was hatte ich mit dem Mann schon zu schaffen?
Professor Bergland verfiel, wie bei den meisten seiner direkt unterstellten Mitarbeiter in das vertraute Du. »Das hier ist Mr. Smith. Du wirst dich vielleicht etwas darüber wundern, aber er ist speziell deinetwegen von Florida herüber gekommen und er möchte sich mit dir über eine gewisse Angelegenheit unterhalten. Ich bin überzeugt, du wirst interessiert sein, wenn du erfährst, worum es genau geht«, deutete er den Grund meines Hierseins vage an.
»Und worum geht es im Einzelnen? Könnte ich vielleicht Genaueres erfahren?« Ich sah erst Professor Bergland und danach Mr. Smith herausfordernd an. Denn eines war sicher, niemand macht sich einen derart entsetzlich weiten Weg, nur um ein wenig mit jemandem zu plaudern.
Professor Bergland betrachtete eingehend die Politur seines Konferenztisches und gab damit die Frage an diesen Mr. Smith weiter.
Der holte erst einmal tief Luft, bevor er zu reden begann. »Nun, das ist nicht so schnell mit einem einzigen Satz gesagt. Zunächst einmal so viel: Wir sind eine hoch angebundene Forschungseinrichtung und beschäftigen uns hauptsächlich mit nicht ganz alltäglichen Tierexperimenten für Forschungszwecke und das selbstverständlich unter Nutzung modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse.«
»Nun gut. Aber um ehrlich zu sein, das sagt mir leider noch nicht allzu viel«, bekannte ich meine Phantasielosigkeit und bat: »Es wäre schön, wenn Sie mir die Sache etwas genauer erläutern könnten. Oder kann ich davon ausgehen, Sie befassen sich in ihrer Einrichtung mit Primatenforschung? Sonst würden Sie sich ja kaum an mich wenden.«
Mr. Smith klatschte freudig in die Hände und nickte heftig dabei. »Sie sagen es. Das haben Sie völlig richtig erkannt.«
Für einen winzigen Augenblick tauschten Mr. Smith und der Professor geheimnisvolle Blicke miteinander aus. Aha, dachte ich, die beiden stehen also in gutem Einvernehmen miteinander.
Professor Bergland rutschte während der kurzzeitig eingetretenen Stille nervös in seinem Sessel hin und her, wobei sein Blick unruhig durch den Raum irrte. »Es ist schade, aber ich muss Sie beide leider jetzt allein lassen, denn die Pflicht ruft. Ich habe eine wichtige Vorlesung zu halten«, ließ er uns wissen. Er erhob sich und drehte sich Smith zu. »Sie können selbstverständlich mein Büro benutzen, um die Angelegenheit in aller Ruhe zu besprechen.« Er griff hastig nach seiner braunen Aktentasche. Doch bevor er sich endgültig entfernte, kam er noch einmal dicht an mich heran und flüsterte wohlwollend: »Hör zu George, Mr. Smith hat ein sehr interessantes Angebot für dich. Ich an deiner Stelle würde nicht erst lange überlegen sondern einwilligen. Wer weiß, ob du je wieder eine solch einmalige Chance erhältst. Und noch etwas. Falls du dich entschließen solltest anzunehmen, ich habe nichts dagegen einzuwenden.« Er grüßte flüchtig und stahl sich davon.
»Nun, ich glaube, es ist jetzt wohl an der Zeit, dass Sie mir Ihr Anliegen etwas näher erläutern. Was genau soll ich für Sie tun?«, nahm ich das Gespräch wieder auf.
Wie es schien, war meine Frage nicht tief genug in Mr. Schmidt eingedrungen. Erst einmal betupfte er mit einem Taschentuch sein Gesicht und als er damit fertig war, sagte er: »Natürlich, das Wichtigste hätte ich fast vergessen.« Er fuhr sich an die Stirn und griente mich dabei dümmlich an. Wie es aussah wusste er nicht so recht, womit er beginnen sollte.
»Ich bitte ausdrücklich darum.« Ich wedelte ungeduldig mit dem Arm.
»Nun ich erzähle Ihnen bestimmt keine allzu großen Neuigkeiten, wenn ich Sie daran erinnere, wie schlecht es gegenwärtig um die in freier Wildbahn lebenden Primaten steht. Es werden jeden Tag weniger. Besonders der Orang-Utan ist stark vom Aussterben bedroht. Vielleicht wird es über kurz oder lang überhaupt keine freilebenden Exemplare mehr geben. Würden Sie mir dem beipflichten?«
»Ich weiß, ich weiß. Doch das ist nichts anderes als eine allgemein bekannte Tatsache. Aber was genau haben Sie damit zu tun, wenn Sie mir die Frage gestatten? Soweit ich weiß, ist die Aufzucht gefährdeter Tierarten Sache der zoologischen Gärten. Oder irre ich mich in dieser Hinsicht?«
Mr. Smith zögerte für einen Moment, um sich eine passende Antwort auf meine, wie es schien für ihn überraschende Frage zurechtzulegen. »Grundsätzlich haben Sie selbstverständlich Recht. Das ist doch ganz klar«, stimmte er mir schließlich zu, fügte aber gleich an: »Aber stellen Sie sich doch bloß mal die hohen Kosten vor, die man allein nur für Forschungszwecke zur erfolgversprechenden Wiedereinbürgerung der seltenen Tierarten in ihre ursprünglichen Areale aufwenden müsste. Solche Projekte verschlingen enorme Gelder. Glauben Sie denn allen Ernstes, zoologische Gärten könnten die notwendigen Summen dafür aufbringen? Oder haben Sie vielleicht eine Vorstellung wie teuer Genforschung ist? Also ich sage Ihnen, das sind Millionen.«
»Nun ja, indem muss ich Ihnen leider zustimmen«, sagte ich, wieder etwas zugänglicher.
Es entstand eine Pause, die Mr. Smith nutzte, um sich eine Zigarette mit einem billigen Wegwerffeuerzeug anzuzünden. Ein schwaches Zittern hatte seine Hand erfasst. Er begann mit unterdrückter Nervosität zu rauchen. Für eine Weile sah er mir ernst und fest in die Augen, als ginge er mit sich zurate, ob es überhaupt angebracht sei, mir zu offenbaren, weswegen er hier war.
Endlich hatte er eine Entscheidung getroffen. »Nun ich will Ihnen nichts vormachen und lange drumherum reden will ich auch nicht. Es ist so, das Institut, das ich hier vertrete, braucht dringend einen erfahrenen Zoologen, der etwas von Primaten versteht, und Sie sind unserer Meinung nach der geeignete Mann dafür. Wäre eine solche Zusammenarbeit für Sie vielleicht von Interesse?« Er nahm den Kopf nach hinten und blies eine dicke Rauchwolke in die Luft.
Das Ansinnen traf mich nicht allzu überraschend, denn ich dachte mir inzwischen schon so etwas Ähnliches. Da mir in der Kürze der Zeit nichts einfiel, was ernsthaft dagegen sprach, nickte ich, ohne erst großartig zu überlegen, zweimal mit dem Kopf.
Darauf hatte Mr. Smith nur gewartet. Erleichtert atmete er aus. Er öffnete seinen Pilotenkoffer aus braunem Rindsleder, entnahm ihn einen hauchdünnen Ordner und schob ihn mir über den Tisch. »Am besten Sie lesen selbst, dann können wir gleich alles perfekt machen, denn da die Angelegenheit von größter Dringlichkeit ist, wollen wir keine unnötige Zeit verlieren«, sagte er mit der überrumpelnden Liebenswürdigkeit eines verkaufsgeschulten Versicherungsvertreters.
Ich hatte keine Ahnung weswegen diese Eile geboten war. Aber um ehrlich zu sein, es interessierte mich auch kaum. Von dem Überraschungseffekt wie benommen, fasste ich schnell danach und schlug den Aktendeckel auf. Die wenigen Papiere, die sich darin befanden, wirkten irgendwie offiziell. Ich begann zu lesen.
Vertrag
Zwischen Mr. George Baker und dem Institut für Primatenforschung wird folgender Vertrag geschlossen:
Die Vertragspartner vereinbaren die zeitlich befristete Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Primatenforschung.
Mr. Baker verpflichtet sich, alle ihn übertragenen Aufgaben in jeder Weise und unabhängig vom Einsatzort im Interesse des Institutes für Primatenforschung zu erfüllen.
Für die Dauer der Zusammenarbeit, die zunächst auf acht Wochen ab Vertragsunterzeichnung festgesetzt wird, erhält Mr. Baker monatlich 20.000 $. Für jeden weiteren angefangenen zusätzlichen Monat werden 30.000 $ gezahlt.
Das Institut für Primatenforschung übernimmt alle während der Dauer der Zusammenarbeit anfallenden Kosten und gewährleistet außerdem die kostenlose medizinische Versorgung im Krankheitsfall. Ein darüber hinausgehender Versicherungsschutz besteht nicht.
Der Vertrag ist vor Ablauf der unter Pkt. 3 genannten Vertragsdauer unwiderruflich. Bei einseitiger Kündigung wird eine Vertragsstrafe von 100.000 $ in Anwendung gebracht. Nach dieser Zeitspanne kann der Vertrag mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen gekündigt werden. Geschieht das nicht, verlängert sich der Vertrag stillschweigend um jeweils einen Monat.
Mr. Baker verpflichtet sich, über alle Dinge, über die er während der Zusammenarbeit Kenntnisse erlangt jetzt und später Stillschweigen zu bewahren. Bei Verletzung der Schweigepflicht wird eine Strafe von 100.000 $ fällig.
*
* Bei ernsthafter Beeinträchtigung der Sicherheitsinteressen der USA finden die hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen Anwendung.
Ich war im ersten Augenblick viel zu verwirrt, um jeden einzelnen Punkt des Vertrages geistig zu durchdringen. Aber eines begriff ich sofort. Ich hatte soeben die Chance meines Lebens erhalten. Außerdem ging es um Geld - um sehr viel Geld. Das war eine enorme Summe für einen erstaunlich kurzen Zeitraum, und wie es aussah, brauchte ich dafür nichts anderes zu tun, als mir einen meiner geheimsten Wünsche zu erfüllen; es war der Wunsch, wissenschaftlich auf dem Gebiet der Primatenforschung tätig zu sein.
Mr. Smith saß da wie ein Kartenspieler, der sich sicher ist, alle Trümpfe in der Hand zu haben.
»Nun wie ist es? Unser Angebot ist nicht kleinlich. Wo verdienen sie sonst noch so eine Menge Geld?«, drängte er auf eine rasche Entscheidung. Seine verwässerten Augen weiteten sich ungeduldig.
Während er seinen Blick lauernd auf mich richtete, spürte ich plötzlich wieder diese starke Abneigung gegenüber diesem Mann, der die rücksichtslose Kälte eines skrupellosen Sklavenfängers ausstrahlte, in mir hochsteigen, und ich hätte lieber auf diese unverhoffte Begegnung verzichtet. Aber der vorliegende Vertrag hatte eine völlig neue Situation geschaffen. Eine Situation, die meinen Verstand bis an die Grenze strapazierte. Als mein Gehirn eine Weile gedankliche Purzelbäume geschlagen hatte, kam ich zu dem Ergebnis; bevor ich unterschreibe -und ich wusste, ich würde unterschreiben- sei mir Mr. Smith noch einige wichtige Antworten schuldig.
Nach außen hin bemüht, möglichst gelassen zu erscheinen, sagte ich: »Ich wäre nicht ganz abgeneigt. Allerdings hätte ich, bevor ich mich endgültig entscheide, noch einige Fragen an Sie. Das werden sie sicher verstehen.«
Kurzzeitiges Befremden machte sich auf seinem Gesicht breit. Aber er hatte die Situation hervorragend unter Kontrolle. »Von mir aus. Fragen Sie ruhig.«
»Zunächst würde mich mal interessieren, wer hinter dem Ganzen, wenn auch zugegeben nützlichen Projekt steht und wer freiwillig so viel Geld für einen derartig uneigennützigen Zweck ausgibt«, begann ich nach Details zu forschen.
Mr. Smith hüstelte verlegen und scharrte sich am Ohr. »Betrachten Sie es als eine Art Stiftung von jemanden, der nicht genannt werden möchte.« Er lächelte tölpelhaft.
Ich akzeptierte die Antwort nur ungern und bohrte weiter: »Und nun möchte ich bitte gern noch von Ihnen wissen, welche Aufgabe mir genau zufallen würde, falls ich mich zu einer Zusage entschließen sollte, denn das habe ich noch nicht getan? Und gleichzeitig noch etwas: Warum werden diese Forschungen, die für die Wissenschaft zugegebenermaßen von erheblichem Wert sind, eigentlich insgeheim betrieben? Denn soweit ich mich auf mein Gedächtnis verlassen kann, dann habe ich darüber bisher weder etwas gehört noch gelesen.«
Er musterte mich argwöhnisch. »Ich kann Ihre Verwunderung durchaus verstehen. Sagen wir mal so, die amerikanische Grundlagenforschung nimmt auf vielen Gebieten einen führenden Platz in der Welt ein. Aber ich verrate Ihnen sicher kein allzu großes Geheimnis, wenn ich sage, dass es auch hin und wieder einmal unangenehme Rückschläge gibt, wie sie überall vorkommen. Und das ist es auch, warum man sich davor hüten sollte, mit den Ergebnissen allzu voreilig an die Öffentlichkeit zu treten. Und bitte denken Sie bei dieser Gelegenheit auch an die Konkurrenz, die schläft bekanntlich nicht. Das ist auch der Grund weshalb Hochtechnologien streng geschützt werden und der Präsident eigens dafür entsprechende Richtlinien erlassen hat.«
»Das leuchtet mir in gewisser Weise schon ein«, stimmte ich ihn zu, löcherte ihn aber zugleich mit neuen Bedenken. »Doch da wäre noch etwas, was mir gerade durch den Kopf geht. Es ist doch so, das Problem der im Aussterben begriffenen Menschenaffen ist eine Sache von weltweiter Bedeutung. Und nun frage ich mich, welches Recht befugt eigentlich den Präsident der Vereinigten Staaten, irgendwelche Gesetze darüber zu erlassen? Das ist es, was mich beschäftigt.«
Mr. Smith zog ein verdrießliches Gesicht, aber es war ihm unmöglich meiner Frage zu entgehen. »Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt«, räumte er ein und fuhr fort: »Jedoch, es ist auch eine allgemein bekannte Tatsache, dass wir auf dem Gebiet der Mikrobiologie im Vergleich mit anderen Ländern sehr weit vorn liegen. Dieser Vorsprung versetzt uns zum Beispiel in die Lage, die in den Zellen gespeicherten Erbinformationen fast bis in das kleinste Detail zu entschlüsseln. Was das bedeutet ist Ihnen doch sicher klar?«
»Man wäre damit irgendwann einmal in der Lage die Genaktivitäten aller Lebewesen, auch der höheren, fast beliebig zu beeinflussen. Man kann das perfekte Lebewesen züchten.«
Er blinzelte mir zu. »Das haben Sie völlig richtig erkannt.« Sein Gesichtsausdruck wechselte wieder. »Allerdings und das möchte ich Ihnen auf keinen Fall verschweigen, ist so ein aufwendiges Forschungsprojekt nicht gerade billig; es verschlingt Unsummen. Und natürlich muss das Geld dafür erst einmal aufgebracht werden?«
Ich hatte mir schon die nächste Frage zurechtgelegt. Aber soweit sollte es nicht mehr kommen. Smith stellte mit einem Blick auf seine große schwarze Armbanduhr überrascht fest: »Oh, die Zeit ist unerbittlich. Ich schlage deswegen vor, wir heben uns weitere Betrachtungen für später auf. Sie erhalten noch reichlich Gelegenheit, sich umfassend zu informieren.«
Obgleich das Gespräch zu diesem Zeitpunkt für mich noch viele wichtige Fragen offen ließ, entschloss ich mich, vorerst auf weitere tiefgründige Vorstöße zu verzichten. Ich wollte den Vertrag unbedingt haben und ihn nicht mit meinen vielen Fragen torpedieren. Doch dann fiel mir noch etwas ein, was ich fast vergessen hätte. »Bevor ich mich endgültig entscheide, würde mich noch brennend interessieren, welche Tätigkeit genau mir zufällt.«
Mr. Smith steckte sich in aller Ruhe eine neue Zigarette an und blies den blauen Rauch genussvoll in die Luft. »Es ist vorgesehen, die durch neuartige Züchtungsmethoden mit hervorragenden Eigenschaften ausgestatteten Orang-Utans wieder in ihren ursprünglichen Arealen anzusiedeln, und wir dachten uns, Sie könnten uns bei diesen Einbürgerungsversuchen behilflich sein. Ich denke doch, wir vertrauen Ihnen damit eine Aufgabe an, die Ihren Fähigkeiten durchaus angemessen ist«, entschloss er sich endlich zu einer Antwort. »Also was sagen Sie dazu?«
»Wollen Sie vielleicht damit andeuten, ich soll nach Borneo oder Sumatra reisen?«
»Ganz genau. Sie haben es erraten.«
Das war zunächst weit mehr als ich erwartet hatte und ich dachte gleich daran, ohne neue Wenn und Aber einzuwilligen. Doch plötzlich war es mir nicht mehr wohl bei dem Gedanken, was man mit den Tieren vorhatte. Was war, wenn die ausgesetzten Tiere eine völlig andere Entwicklung als die von ihrem Schöpfer vorausgeplante nehmen würden – wenn man aus Versehen eine falsche Entscheidung traf? Könnten solcherart manipulierte Lebewesen unter dem Einfluss ganz bestimmter Gene nicht irgendwann einmal außer Kontrolle geraten und damit zu einer gefährlichen Bedrohung der ganzen übrigen Tierwelt ausufern? Die Folgen wären nicht auszudenken. Aber diese Art Gedanken währten kaum länger als ein Atemzug. Greifbar nahe tauchten viele bunte tropische Bilder auf: Ich konnte prachtvolle Vögel und Papageien sehen, die ein schönes farbenprächtiges Gefieder wie Juwelen des Waldes hatten. Über im dichten Baldachin des immergrünen Regenwaldes tummelten sich munter kreischend die verschiedensten Affenarten. Die herrlichsten Orchideen erblühten zu tausenden in den vielfältigsten Farben und Formen und die Orang-Utans, die von den vereinzelt durch das Geäst der Bäume dringenden Sonnenstrahlen Rotgold angeleuchtet wurden, führten ein durchweg friedliches und unbekümmertes Leben. Spätestens von diesem Augenblick an wusste ich, ich war durch einen völlig unerwarteten Zufall plötzlich am Ziel meiner geheimsten Wünsche angelangt. Diese Erkenntnis war es auch, die den endgültigen Ausschlag für meine Entscheidung lieferte. Ich sah keinen vernünftigen Grund mehr, diesem verlockenden Angebot noch länger zögernd gegenüber zu stehen und unterschrieb.
Mr. Smith überwachte aufgeregt, wie ein Angler der spürt wenn ein Fisch argwöhnisch den Köder berührt, meine Unterschrift. Kaum hatte ich den Schriftzug gesetzt, da zog er den Vertrag ruckartig weg, um ihn gierig an sich zu nehmen.
»Nun wie fühlen Sie sich jetzt?«, wollte er wissen. Die Erleichterung war ihm ins Gesicht geschrieben.
Ich hob die Schultern an. »Das lässt sich schwer sagen.«
»Ach was, nur keine Bedenken. Ich wusste doch gleich, Sie würden einwilligen.«
Er verstaute den Originalvertrag wie einen wohlgehüteten Schatz in den für einen winzigen Aktenordner viel zu großen Lederkoffer, der auf dem Stuhl nebenan lag.
Während ich mich bemühte, auch meine Vertragskopie vom Tisch zu nehmen, was sich allerdings als überraschend schwierig erwies, denn das Papier verharrte auf der polierten Tischplatte, als sei es deren untrennbarer Bestandteil, als würde sich der Vertrag absichtlich und mit großer Hartnäckigkeit sträuben, in meinen Besitz überzugehen, da fiel mir noch etwas ein, was ich in der ganzen Aufregung bisher vergessen zu fragen hatte.
»Bitte Mr. Smith, ich vergaß ganz zu fragen. Wann soll es denn eigentlich losgehen?«, holte ich das Versäumnis nach.
»Ach, hatte ich das nicht gesagt?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Es tut mir leid. Aber dann muss ich das wohl vergessen haben, zu erwähnen. Da die Sache brandeilig ist, brechen wir natürlich gleich morgen früh auf.«
Die Antwort traf mich im ersten Augenblick wie ein Schock. »Was so schnell schon? Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt?«
Unwillkürlich musste ich an Kathrin denken, und bei der Vorstellung, wie sie auf die große Neuigkeit reagieren würde, wurde es mir gleich ganz unbehaglich zumute. Denn ich war mir aus sehr verständlichen Gründen keinesfalls sicher, dass sie meine Begeisterung auch nur annähernd teilen würde. Doch mir blieb nur wenig Zeit, mich mit diesem Gedanken zu befassen. Mr. Smith kramte einen Moment in seiner mächtigen Tasche und als er damit fertig war, hielt er einen prall mit Geld gefüllten Umschlag in der Hand.
»Hier, das ist für Sie. Eine kleine Anzahlung, die werden Sie bestimmt gut gebrauchen können.« Er schob mir den Umschlag hin.
Die Schilderung dessen, was ich in dem Moment fühlte wäre unvollständig, würde ich die ungeheure Anziehungskraft des vielen Geldes unerwähnt lassen. Ich konnte meine Neugier, einen raschen Blick in den Umschlag zu riskieren, um mir einen Überblick über die Höhe des Betrages zu verschaffen, kaum zügeln. Aber vorerst war mein Stolz stark genug, um der Versuchung zu widerstehen.
Unter dem Einfluss des dicken Geldumschlages stimmte ich schließlich zu, mich so gegen sieben Uhr am Morgen des nächsten Tages reisefertig bereitzuhalten.
Erst auf dem Weg zum Kleinbus kamen die anfänglichen Bedenken wieder hoch und sobald ich an Kathrin dachte, hätte ich am liebsten gleich alles wieder rückgängig gemacht.
Ich stieg ein. Obgleich mich die Glut im Fahrzeuginneren zu ersticken drohte, schloss ich rasch die Tür, denn ich wollte in diesem Augenblick möglichst unbeobachtet sein. Jetzt konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Ohne erst die Klimaanlage anzuwerfen, öffnete ich mit nervösen Fingern den Umschlag und nahm den verlockenden Inhalt heraus, um lüstern zu zählen. Es waren genau zehntausend Dollar in grünen Hunderterscheinen. Völlig unter dem magischen Eindruck des Geldes stehend, wusste ich zunächst nicht wohin damit. Erst nach mehreren Überlegungen entschied ich mich für den Beifahrersitz als den geeigneten Aufbewahrungsort. Dann ließ ich den Motor an und fuhr los. Um etwas Zeit herauszuschlagen, nahm ich gleich den direkten Weg quer durch das Gehege, das überwiegend den in der Savanne lebenden Tierarten vorbehalten war. Es war die kürzeste Verbindung zu unserem Haus.
Gestreifte Zebras begnügten sich mit minderwertigem Gras und die Giraffen streckten ihre langen Hälse in die Höhe, um in den oberen Regionen der Akazien noch frische Triebe und Blätter zu finden. Aus sicherer Entfernung beobachteten mich scheu die Antilopen, aber schon bei der geringsten Annäherung sprangen sie mit großen, schnellen Sätzen davon. Gerade als ich den künstlich angelegten Kanal überquerte, der den zahlreich vertretenen Wasservögeln ein ihren ursprünglichen Lebensbedingungen angepasstes Dasein ermöglichte, da drängte sich Kathrin in mein Gedächtnis und ich versuchte mir ein Bild davon zu machen, wie sie die unverhoffte Nachricht von meiner nahen Abreise wohl auffassen würde. Dabei fiel mein Blick mehr unbeabsichtigt auf das neben mir liegende Geld. Sofort begann mein Gewissen zu rumoren. In meiner Einbildung sah ich sie mit fragenden Augen wie ein Gott von oben auf mich herabblicken. Das irritierte mich dermaßen, dass ich das Geldkuvert nahm und es schleunigst im Handschuhfach verschwinden ließ, um es auf diese Weise ihrem vorwurfsvollen Blick zu entziehen. Dann beschleunigte ich wieder das Tempo. Hinter mir stieg eine rote Staubfahne hoch.
Schneller als gewollt vor unserem Haus angekommen, hielt ich zunächst nach Kathrin Ausschau. Ich fand sie auf der Terrasse mit einer, wie es schien, sehr anspruchsvollen Schreibarbeit beschäftigt, vor.
Um ihr die neue Situation zu schildern, ließ ich mich zunächst unter schwerem Stöhnen in meinen Schaukelstuhl unweit von ihr niedersinken. Dann begann ich heftig mehrmals schnell und geräuschvoll vor und zurück zu schaukeln. Ich hoffte auf diese Weise ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Das Resultat: Sie blickte nur kurz auf und lächelte ein wenig. Dann vertiefte sie sich gleich wieder in ihre Tätigkeit, so als sei mein Auftauchen für sie eine durchaus alltägliche Angelegenheit, über die es sich kaum nachzudenken lohnt.
Eine ganze Weile beobachtete ich sie respektvoll bei der Arbeit. Auf dem Tisch lagen wohlgeordnet verschiedene Formulare in die sie mit sauberer Schrift sorgfältig Zahlen eintrug. Als meine Ungeduld dann ein erträgliches Maß weit überschritten hatte, hüstelte ich einige Male lautstark hintereinander, um mich auf diese Weise wirkungsvoll in Erinnerung zu bringen. Jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Es war unglaublich, ich wollte demnächst zu großen Abenteuern in die weite Welt aufbrechen und meine Frau hatte nichts anderes zu tun, als langweilige Zahlen in eine blöde Tabelle zu übertragen. Kurz entschlossen sprang ich hoch und lief zum Kleinbus, wo noch immer das Geld im Handschuhfach gut verwahrt, ein dunkles Dasein fristete. Auf dem Rückweg bekamen meine streitsüchtigen Gedanken so nach und nach die Oberhand und ich beschloss, Kathrin gegenüber einmal richtig aufzutrumpfen, um ihr eindrucksvoll die andere Seite meines Charakters zu zeigen.
Ich ließ den Umschlag mit einer hochmütigen Geste auf den Tisch flattern und legte los: »Nun kannst du mal richtig staunen, was ich uns mitgebracht habe. Vielleicht hörst du, wenn du das siehst, endlich damit auf, dich hinter diesen langweiligen Schreibkram zu verkriechen. Schließlich gibt es noch wichtigere Dinge auf der Welt.«
Kathrin blickte verstört zu mir empor. Offensichtlich hatte sie nicht die geringste Ahnung wovon ich eigentlich redete. Da ich abwartend dastand, griff sie zögernd nach dem Umschlag. Zuerst musterte sie ihn vorsichtig von allen Seiten als rechne sie schon im nächsten Augenblick mit der gewaltigen Explosion einer Briefbombe.
»Sieh nach was Feines drin ist!«, ermunterte ich sie.
Sie hielt den Umschlag an der oberen linken Ecke fest und schielte vorsichtig hinein. Schon im nächsten Augenblick stieß sie einen entsetzlich lauten Überraschungsschrei aus.