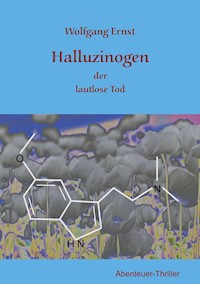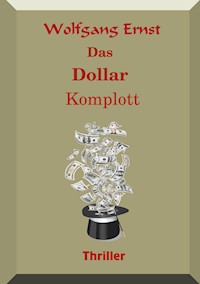Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwei Eingeborene finden George Baker, dem der Erschöpfungstod droht, im dichten Dschungel von Borneo. Auf der Suche nach einem Eingeborenendorf durchqueren die Drei von nun an gemeinsam die tropische Wildnis. Dabei stoßen sie auf ein großes merkwürdiges Tier mit schwer zu deutenden biologischen Merkmalen. Bevor es George Baker gelingt, die Herkunft dieses seltsamen Lebewesens zu ermitteln, entzieht es sich seinen Blicken. In dem Eingeborenendorf angekommen, trifft George Baker auf einen Weltenbummler namens McKinlay. Dieser verspricht, ihn über die indonesisch-malayische Grenze zu führen, was sich bald als ein lebensgefährliches Abenteuer herausstellt. Auf seiner Rückreise in die USA wird George Baker auf Hawaii verhaftet und in einer militärischen Einrichtung verhört. Kaum in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt, erwarten ihn neue Unannehmlichkeiten, die seinen Glauben an Gerechtigkeit schwer erschüttern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch: Im Schatten der Siebziger ist eine spannungsgeladene Verknüpfung von klassischer Abenteuerliteratur und modernem Thriller.
Band 2: Zwei Eingeborene finden George Baker, dem der Erschöpfungstod droht, im dichten Dschungel von Borneo. Auf der Suche nach einem Eingeborenendorf durchqueren die Drei von nun an gemeinsam die tropische Wildnis. Dabei stoßen sie auch auf ein großes, merkwürdiges Tier mit schwer zu deutenden biologischen Merkmalen. Bevor es Georg Baker gelingt, die Herkunft dieses seltsamen Lebewesens zu ermitteln, entzieht es sich seinen Blicken.
In dem Eingeborenendorf angekommen, trifft George Baker auf einen Weltenbummler namens McKinlay. Dieser verspricht, ihn über die indonesisch-malaysische Grenze zu führen.
Auf seiner Rückreise in die USA wird Georg Baker auf Hawaii verhaftet und in einer Militäreinrichtung verhört. Während seines erzwungenen Aufenthaltes geschehen merkwürdige, offenbar mit den Tierexperimenten zusammenhängende Dinge.
Kaum in die USA zurückgekehrt, erwarten ihn neue Unannehmlichkeiten, die seinen Glauben an Gerechtigkeit schwer erschüttern.
Der Autor: Wolfgang Ernst– im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen – lebt in der Erzgebirgsstadt Aue und ist verheiratet. Er war langjährig in leitender Position in der Wirtschaft tätig. Im Schatten der Siebziger ist sein dritter veröffentlichter Roman. Dank seiner zahlreichen Auslandsreisen und intensiven Recherchen hat er sich im Laufe der Jahre umfangreiche Kenntnisse zu fremden Ländern und deren Bewohner angeeignet. Diese Kenntnisse fließen in seine spannenden Geschichten ein.
Inhaltsverzeichnis
Was bisher geschah
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Schluss
Was bisher geschah:
Der amerikanische Biologe George Baker feiert im Kreise seiner Familie seinen 65. Geburtstag. Anwesend sind seine Ehefrau Kathrin, Sohn Tom mit Ehefrau Nancy, die Mutter und anfänglich auch Kathrins Bruder William. Im Laufe der Feier wendet sich Tom mit der Bitte an seinen Vater, ausführlich von den Ereignissen vor mehr als dreißig Jahren zu berichten.
Georg Baker war damals in den Siebzigern in dem benachbarten Safaripark unweit von Jackson als Fachmann für Primaten beschäftigt. Seine Ehefrau trug als Mitarbeiterin der gleichen Einrichtung ihren Teil zum Familieneinkommen bei.
Eines Tages tauchte bei Professor Bergland, dem Chef des Safariparks, ein Mann namens Smith auf, der George Baker mit dem Angebot, sich an einer Expedition nach Kalimantan – dem indonesischen Teil der tropischen Insel Borneo – zu beteiligen, überraschte. Mr. Smith begründete das Ziel der Expedition mit der Erforschung der Ursachen einer möglicherweise unter den Orang-Utans ausgebrochenen Krankheit.
Nicht nur die Aussicht sich mit der Teilnahme an der Expedition einen Lebenstraum zu erfüllen, sondern auch die damit verbundene einmalig hohe Geldsumme, veranlassten Georg Baker schließlich, ohne erst großartig zu überlegen, in die Vertragsbedingungen einzuwilligen. Auch die Bedenken seiner Ehefrau änderten nichts an seiner Entscheidung, sich auf diese Ungewisse Abenteuerreise zu begeben.
Viel Zeit, über den vertraglich zementierten Entschluss nachzudenken, blieb ihm nicht, denn der Aufbruch war schon für den Morgen des darauffolgenden Tages vorgesehen.
Doch zunächst einmal führte die Reise nicht nach Borneo, sondern sie endete in einem abgelegenen Gebiet der Everglades in Florida. Das Herzstück des von der Außenwelt abgeschirmten Areals mit der Bezeichnung Institut für Primatenforschung war ein hochmodernes Laboratorium wo, wie sich schnell zeigte, tatsächlich Tierforschung auf höchstem wissenschaftlichen Niveau betrieben wurde.
Während einer von Professor Douglas, dem wissenschaftlichen Leiter der Forschungseinrichtung geführten Besichtigung, wurde deutlich sichtbar, welch außergewöhnliche Erfolge auf dem Gebiet der Genforschung das Institut vorzuweisen hatte. Für George Baker wollte allerdings die Präsenz des Militärs und die überwiegend von Mr. Smith ausgelöste Geheimniskrämerei nicht so recht in das Bild einer für die Tierwelt äußerst nützlichen Forschungseinrichtung passen. Auch das unerklärliche Verschwinden einer Bardame mit dem Rufnamen Lissy, die sich gleich am ersten Abend telefonisch bei ihm, mit dem Hinweis wichtige Informationen zu besitzen meldete, ließ erste Zweifel an dem rein wissenschaftlichen Charakter des Unternehmens aufkommen.
Erst jetzt wurde George Baker mit der Tatsache konfrontiert, nicht nur Mitglied der Gruppe zu sein, sondern gleichzeitig die Leitung der Expedition zu übernehmen, und das, obwohl er über keinerlei Dschungelerfahrungen verfügte. Smith, der Mann der Georg Baker für diese heikle Aufgabe angeworben hatte, begleitete ihn dabei.
Zunächst führte die Reise nach Singapur. Auf dem Schiff, das für die Überfahrt nach Borneo vorgesehen war, stießen auch die übrigen Expeditionsteilnehmer Mark Bower und Harry Thomsen dazu. Mark Bower hatte bereits dafür gesorgt, dass sich die Ausrüstung vollzählig an Bord befand.
Nach einer Audienz bei dem Gouverneur in der Verwaltungshauptstadt Pontianak machte sich die Expedition zunächst mit dem Hubschrauber und anschließend mit dem Boot eines Warenhändlers auf den Weg in das Innere der Insel. Schon seit dem Aufenthalt in Pontianak gab es immer wieder Anzeichen, die auf eine Beobachtung der Gruppe hindeuteten.
Wegen der frühzeitig einsetzenden Monsunregenfälle und einer von Smith verursachten tätlichen Auseinandersetzung mit dem Oberhaupt einer Holzfällersiedlung waren die Expeditionsteilnehmer gezwungen, den Wasserweg zu verlassen und sich von nun an einen Weg durch den unwegsamen Dschungel zu bahnen, wollten sie in das von Professor Douglas bezeichnete Gebiet vordringen. Die Hilfe der eingeborenen Dajaks – vor allem als Träger für das umfangreiche Gepäck – war dabei unerlässlich. Wie kaum anders zu erwarten, war der Marsch mit vielerlei Gefahren und Abenteuern verbunden und somit äußerst beschwerlich.
Schon bald zeigte es sich, dass es mit Harry Thomsens Gesundheit nicht um Besten stand, und es wurde immer deutlicher, wie wenig er den hohen Belastungen auch in Zukunft gewachsen sein würde.
Ein anderes Problem, was sich schon seit Längerem andeutete, war Larry Smith. Er herrschte wie ein Despot, zettelte ständig Streit mit dem farbigen Mark Bower an, und als er unerwartet eine Pistole zum Vorschein brachte, zögerte er nicht, seine Forderungen von nun an mit Waffengewalt durchzusetzen. Dass er sich täglich mit Whisky zuschüttete und zudem auch Rauschgift nahm, machte ihn noch unberechenbarer.
Nach einem nicht endend wollenden Marsch tauchte in einem dicht bewaldeten Gebiet plötzlich eine kleine Gruppe bewaffneter und kriegerisch anmutender Ureinwohner auf, die jedoch, wie sich schnell zeigte, den Expeditionsteilnehmern gegenüber freundlich gesinnt waren. Die Dajaks führten die Fremden in ihren an einem schönen See gelegenen Heimatort, wo sich auch eine christliche Station befand, die von einem holländischen Missionar betrieben wurde. Der freundliche Missionar hieß die Expeditionsmitglieder herzlich willkommen, versorgte sie mit Speisen und bot ihnen zudem eine Übernachtungsmöglichkeit an. Auch der Bitte, Träger anzuwerben, kam er nach. Allerdings waren die Träger nicht wie erhofft durchweg kräftige Männer, sondern es befanden sich auch zwei Dajakfrauen unter ihnen, was der Versicherung des Missionars nach, bei diesem Eingeborenenstamm durchaus üblich sei.
Auf den Abend zu wurde wie üblich das Lager aufgeschlagen. Während George Baker und Mark Bower am Feuer saßen, machten sich Smith und Harry Thomsen an die beiden Dajakfrauen heran, um sich mit ihnen zu vergnügen, was die Eingeborenen zunächst nicht nur duldeten, sondern wie es schien, auch recht lustig fanden. Möglicherweise brachte dieses Verhalten der Alkohol mit sich, den Smith den Mädchen einflößte, um sie gefügig zu machen.
Doch durch Irgendetwas ausgelöst, änderte sich die Situation plötzlich; eines der Mädchen huschte flüchtend im Dunklen durch den Dschungel. Bald wurde ersichtlich, dass es Smith war, der sie unter lauten Drohungen verfolgte. Schutzsuchend eilte das von Smith bedrängte Mädchen in Richtung ihrer Stammesbrüder. Noch ehe sich George Baker und Mark Bower mit der Situation richtig vertraut machen konnten, krachte ein Schuss und einer der Dajaks sackte tödlich getroffen zusammen. Smith hatte den Dajak ermordet. Daraufhin kam es zu einer Rangelei zwischen Mark Bower und den Eingeborenen, die glücklicherweise unblutig endete. Am darauffolgenden Morgen waren die Dajaks zusammen mit ihrem Toten von der Bildfläche verschwunden.
Jetzt ohne Träger entwickelte sich der Weitermarsch zu einer echten Strapaze. Auch wurde es immer offensichtlicher, wie begründet die Sorge um Harry Thomsens Gesundheitszustand war. Mark Bowers Versuch, über Funk Hilfe für den schwer Erkranken herbeizuholen, verhinderte Smith mit brutaler Waffengewalt.
An einer Stelle bemerkte George Baker im Gebüsch ein eigenartiges Objekt, das sich bei genauerem Hinschauen als der Kadaver eines Orang-Utans herausstellte. Nach gründlichen Inaugenscheinnahme war klar: Der Orang-Utan war vor seinem Tod schwer misshandelt worden, was der eingeschlagene Schädel und die ausgerenkten Gliedmaßen deutlich genug bewiesen. Die Ursache für diese rätselhaften Verletzungen blieb jedoch im Dunklen.
Als eine unüberwindbare Felsenbarriere den Weg versperrte, war die Gruppe gezwungen, die Nacht zunächst an Ort und Stelle zu verbringen. Und dann geschah das, was sich schon seit Längerem angedeutet hatte; Harry Thomsens Lebenskräfte versiegten an diesem Abend. Kaum war Harry Thomsen notdürftig begraben, da drängte Smith auch schon zum Aufbruch.
Da sich die Felswand als unbezwingbar erwies, machte es ich erforderlich, einen längeren Umweg in Kauf zu nehmen, der an einem stark angeschwollenen Flusslauf ein vorläufiges Ende fand. Über den Fluss zu gelangen stellte sich wegen der starken Strömung als ein äußerst wagemutiges Unterfangen heraus. Und die Krokodile, die sich an verschiedenen Stellen aufhielten, erhöhten die Gefahr den Fluss unbeschadet zu überqueren, noch beträchtlich.
Wieder war es Smith, dem wie üblich ein Menschenleben, mit Ausnahme seines eigenen, nichts bedeutete. Seine folgenschwere Entscheidung lief darauf hinaus, dass Mark Bower an das andere Ufer schwimmen sollte, um dort ein Sicherungsseil für die anderen zu befestigen. Da diesem keine andere Wahl blieb, fügte er sich und nahm die Flussüberquerung in Angriff.
Darauf hatten die Krokodile nur gewartet. Sie griffen Mark an und eines von ihnen verbiss sich in sein Bein. George Baker hievte den Schwerverletzten mit äußerster Anstrengung ans Ufer und versorgte ihn anschließen notdürftig.
Kaum war das erledigt, befahl Smith den Weitermarsch ohne Mark Bower. Georg Baker wollte das Unfassbare verhindern, jedoch war er Smith schon wegen dessen geladener Pistole nicht gewachsen. So blieb ihm keine andere Wahl, als erst einmal zu gehorchen wobei sich in seinem Gehirn ein Plan entwickelte, der sich mit der Rettung von Mark Bower beschäftigte.
Doch das Gelände wurde immer unwegsamer und da Smith immer wieder einmal die Richtung änderte, nahmen die Chancen, Mark Bowers Leben vielleicht doch noch zu retten, von Stunde zu Stunde ab.
Plötzlich ereignete sich etwas völlig Unerwartetes, etwas was alles verändern sollte; Smith geriet in eine Speerfalle der Eingeborenen, wobei er sich lebensgefährlich verletzte. George Baker versuchte ihn noch eine Weile zu transportieren und am Leben zu erhalten. Doch alle Bemühungen blieben erfolglos.
Von nun an völlig auf sich allein gestellt, setzte George Baker seinen Ungewissen Weg mit Ungewissem Ziel fort. Nur sein Lebenswille und die Hoffnung, irgendwann einmal auf Menschen zu treffen, trieben ihn an. Aber irgendwann war auch ihm klar, der Wille zum Leben allein würde auf Dauer nicht ausreichen, um dem Tod zu entrinnen.
* * *
1. Kapitel
Zuerst dachte ich, ich hätte mich im Jenseits wiedergefunden und die Seelen der Toten würden mit mir sprechen. Also schärfte ich alle meine Sinne. Doch das Spiel meiner Gedanken währte nur kurz, dann überwog mein von den Instinkten geleiteter Drang die Augen zu öffnen. Als es mir gelungen war, die Lider hochzuschlagen, wollte ich zunächst kam glauben, was ich da zu sehen bekam. Im Schatten der allmählich herabsteigenden Abendsonne erblickte ich zwei Ureinwohner; ein kleines schwarzhaariges Geschöpf mit unverhüllten, spitz vorstehenden Brüsten und ein ungefähr gleichaltriger Mann. Beide standen dicht beieinander. Wie es aussah, führten sie einen angeregten Meinungsstreit.
Als das Mädchen einmal zufällig in meine Richtung schielte, schien sie plötzlich zu bemerkten, dass sich noch Leben in mir regte, womit sie offenbar überhaupt nicht gerechnet hatte. Mit einem Überraschungslaut auf den Lippen stupste sie ihren Partner mit dem Ellenbogen an, um ihn ihre Wahrnehmung mitzuteilen. Als dem Eingeborenen klar wurde, was es mit dem Hinweis auf sich hatte, reagierte er augenblicklich und zwar auf eine für mich wenig erfreuliche Weise. Mit einem Blick, der Zorn und Verachtung gleichzeitig ausdrückte, starrte er mich zunächst nur an. Dann rollte er grimmig mit den Augen. Mit ein paar abrupten Armbewegungen ließ er mich auf seine ihm eigen Weise wissen, was er von meiner unverhofften Auferstehung aus dem Jenseits hielt. Offensichtlich wäre ich ihm als Leiche lieber gewesen.
Doch darauf konnte und wollte ich keine Rücksicht nehmen. Und einfach wieder die Augen zudrücken, so als wäre mein Erwachen lediglich eine vorübergehende Erscheinung gewesen, dazu verspürte ich nun auch keine Lust, zumal die ersten Erinnerungen an den gestrigen Abend allmählich in mein Gedächtnis zurückkehrten. Also beschloss ich, mich aufzurichten, unabhängig davon, ob es dem Eingeborenen nun gefiel oder nicht. Nach einigen Anstrengungen hatte ich es endlich geschafft. Noch etwas wacklig auf den Beinen, ließ ich meinen Blick durch die Umgebung schweifen. Ich konnte mit Ausnahme der beiden Dajaks nichts anderes als kleine und große, üppig wuchernde pflanzliche Gebilde sehen. Und auch die mich umgebenden Geräusche waren eindeutig; ich befand mich mitten im tropischen Dschungel. Diese Erkenntnis genügte, um die verlorengegangenen Erinnerungen wenigstens bruchstückhaft in mein Gehirn zurückzurufen: Da war die undurchdringliche schwarze Masse aus dichtstehenden Bäumen, Büschen und Blattwerk, die das nächtliche Vorankommen in der von unheimlichen Geräuschen durchdrungenen Wust einer üppig sprießenden Natur unmöglich machten. In den Eingeweihten nagte schmerzhaft der Hunger wie ein in meinem Leib gefangenes Tier. Aber das war bei Weitem nicht alles. Da gab es Gedanken, die sich mit Harry Thomsen und seinem frühzeitigen Tod beschäftigten. Und auch vieles was in Verbindung mit diesem skrupellosen Scheusal Smith stand, der letztendlich genauso endete, wie er es verdient hatte, rumorte in meinem Kopf. Den größten Raum jedoch nahmen die schrecklichen Erinnerungen an Mark Bower ein. Und vor allem die Tatsache, dass ich ihn nicht retten konnte, ging mir sehr nahe. Sein Schicksal ruhte bei jedem Schritt wie eine schwere Last auf mir. Doch die Ziellosigkeit meines Unterfangens gab letztendlich irgendwann den Ausschlag für meinen Entschluss, den natürlichen Überlebenstrieb gegen die Stille des Todes einzutauschen.
Beide Dajaks traten einige Schritte zurück. Schließlich blieben sie stehen und fixierten mich von ihrer Position aus mit einem Gesichtsausdruck, der Neugierde, Verachtung und Unschlüssigkeit zugleich in sich barg. Einen Hauch von Freundlichkeit mir gegenüber suchte ich vergeblich in ihren schwarzen Augen.
Damit war klar, wenn ich auf ihre Hilfe zur Verbesserung meiner gegenwärtigen Situation hoffte, so war das nichts anderes als pures Wunschdenken. Aber was war es, was die ansonsten recht zugänglichen Dajaks zu einem derartig unfreundlichen Verhalten veranlasst haben könnte? Ich dachte nach. Um mich besser zu konzentrieren, schloss ich für wenige Augenblicke die Augen. Und da dämmerte es mir plötzlich – Ich hatte die beiden Eingeborenen schon vorher einmal gesehen. Kaum war die Pforte zu meinen inneren Wahrnehmungen aufgestoßen, da vergegenwärtigte sich plötzlich die Szene in meinem Gedächtnis: Smith, schäumend vor Wut, rannte mit heruntergelassenen Hosen keuchend durch den abendlichen Dschungel. Ein vor Angst wie betäubtes Mädchen drängte sich Schutz suchend an einen der Eingeborenen. Dann fiel der tödliche Schuss.
Das war es also. Mit dieser erschreckenden Erkenntnis im Kopf, versuchte ich erst gar nicht, mir vor Augen zu führen, was als Nächstes geschehen könnte. Was mir vorher entgangen war, entdeckte ich jetzt; der Eingeborene hielt das gefährliche Kopfjägerschwert gut sichtbar und fest umklammert in der Hand. Mit steinerner Miene starrte er mich an. Dass er mit der Waffe noch nicht auf mich losgegangen war, verbesserte meine gegenwärtige Situation nur unwesentlich. Am liebsten hätte ich mich jetzt auf der Stelle wieder hingelegt und die Augen zugeklappt.
Mitten in dieser heiklen Situation geschah etwas, womit ich am wenigsten gerechnet hätte. Das Eingeborenenmädchen zupfte sich verlegen ihr dürftiges Röckchen zurecht und lächelte mir unerwartet freundlich zu.
Angespornt von dieser vertraulichen Geste, ließ ich meine ursprünglichen Bedenken zunächst fallen und streckte meine Hand wie zur Begrüßung nach ihr aus.
Doch kaum war ich einen Schritt auf sie zugetreten, da blitzten die Augen ihres Partners wild auf und gleichzeitig setzte er sein scharfes Kopfjägerschwert – das Mandau – unmissverständlich genau zwischen mich und dem Mädchen. Offenbar hatte er meine allzu vertrauliche Geste falsch aufgefasst und er wollte mir auf diese recht bildliche Weise ein unmissverständliches Zeichen setzen, dass er derjenige sei, der hier an diesem Ort das Sagen hatte.
Dieses aggressive Verhalten mahnte mich augenblicklich zur Vorsicht. Ich setzte meinen Fuß wieder zurück und sagte in möglichst ruhigen Tonfall: »Aber, aber... Warum denn gleich so hitzig? Es liegt keinesfalls in meiner Absicht, ihr etwas anzutun. Ganz im Gegenteil, ich möchte mich lediglich herzlich bei euch beiden bedanken.« Ich befeuchtete meine Lippen mit der Zunge. »Denn hättet ihr mich nicht gefunden, dann wäre ich mit Sicherheit jetzt schon tot«, stammelte ich.
Mein konfuser Wortschwall blieb nicht ganz ohne Wirkung. Zumindest wich der starre, furchteinflößende Ausdruck des Dajaks aus seinem Gesicht. Außerdem hatte ich erreicht, dass die Hand sein Mandau weniger fest umklammerte. Jedoch war immer noch deutlich zu sehen, wie stark die Abneigung mir gegenüber seine Gefühle beherrschte.
Damit war die Situation zwar leicht entschärft, aber wer konnte schon so genau wissen, was in dem Kopf des Mannes gerade vorging? Natürlich hätte ich ihn gern eine plausible Erklärung, für alles was damals vorgefallen war, geliefert. Genauso wie ich ihn gern davon erzählt hätte, was inzwischen alles passiert war – warum all die anderen Angehörigen unserer Expedition Harry Thomsen, Smith und Mark nicht mehr bei mir waren. Nur hatte ich nicht die geringste Ahnung, wie ich das anstellen sollte. Zu unüberbrückbar waren die Sprachbarrieren, denen ich mich gegenübersah. Allerdings war mir auch klar, wir konnten nicht nur immerzu dastehen und uns, von irgendwelchen Gefühlen geleitet, anstarren. Also beschloss ich zu handeln. Ich legte mir einige allgemein verständliche Worte zurecht, die ich ihnen, verbunden mit einer möglichst bildhaften Darstellungsweise, übermitteln wollte.
In der Hoffnung, die beiden mögen die richtigen Schlüsse daraus ziehen, verneigte ich mich zunächst einmal übertrieben ehrerbietig.
Ein ironisches Lächeln huschte über das Gesicht des Dajaks. Als es wieder erloschen war, begann ich mit trockener Kehle zu sprechen: »Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich über eure unverhoffte Anwesenheit freue. Denn wie ich schon sagte, hättet ihr mich nicht noch rechtzeitig gefunden, dann wäre ich mit Sicherheit jetzt schon tot. Ich muss euch auch gestehen, nach alledem was ich in den vergangenen Tagen erlebt habe, war ich nahe daran, mir den Tod sehnlichst herbeizuwünschen. Und ich dachte schon, mein Schicksal sei für immer und ewig besiegelt. Aber nun, da ihr zufällig auf mich getroffen seid, habt ihr mir auch wieder meinen Lebenswillen zurückgegeben. Und ich glaube, auch wenn ich im Moment äußerst erschöpft und sehr hungrig bin, kann ich die Kraft aufbringen, um mein Leben fortzusetzen. Das fühle ich ganz genau.« Jedes einzelne meiner Worte unterstützte ich mit einer Art selbst kreierter Gebärdensprache.
Der Dajak hörte mir konzentriert zu, als sei jedes einzelne meiner Worte tief in ihn eingedrungen. Als ich mit meiner Ansprache geendet hatte, wackelte er eigentümlich mit dem Kopf, als wolle er sich auf diese ungewöhnliche Weise von Zweifeln an der Aufrichtigkeit meiner Worte befreien. Auch das immer noch in seinen Augen liegende verächtliche Lächeln löste sich ganz allmählich. Schließlich gab er einen fremdartig klingenden Kehllaut von sich, dessen Bedeutung ich zu deuten nicht in der Lage war. Auch wenn er die letzte Spur Misstrauen nicht vollständig vor mir verbergen konnte, so bemühte er sich wenigstens nach außen hin um einen netten Gesichtsausdruck.
Davon angespornt ergänzte ich schnell: »Also herzlichen Dank noch einmal... Vielen Dank, dass ihr mir das Leben gerettet habt.« Um meiner Aufrichtigkeit mehr Nachdruck zu verleihen, ließ ich gleichzeitig Arme und Hände sprechen.
Diese erfreuliche Wende hatte das Mädchen sehr genau registriert. Sie kam zutraulich auf mich zu und plapperte: »Herzlichen Dank, dass ihr mir vielen Leben gerettet.«
Vor Begeisterung klatschte ich laut in die Hände. »Wie ist so etwas bloß möglich? Fabelhaft, wirklich phantastisch...« Dann wechselte ich etwas die Tonart. »Das hast du schon sehr gut gesagt, aber es heißt: Ich bedanke mich herzlich, dass ihr mir das Leben gerettet habt. Nicht vielen Leben gerettet, wie du gesagt hast.«
Das Mädchen lächelte mich herzlich an und legte los: »Mir nicht vielen Leben gerettet, wie du gesagt hast.«
Ich lächelte zurück und streckte kapitulierend beide Arme in den Himmel.
Das Mädchen schüttelte sich vor heller Freude, wobei ihre ins Auge stechenden Brüste freudig auf und ab hüpften, und sie konnte sich kaum wieder beruhigen.
Nachdem die anfängliche Anspannung von mir abgefallen war, spürte ich mit einem Male, wie außerordentlich durstig und hungrig ich inzwischen war. Meine Beine fingen zu zittern an. Wollte ich nicht vor Schwäche umfallen, dann musste ich mich unverzüglich auf die mit hohen Gräsern und Farnen bewachsene Erde niedersetzen.
Das Mädchen hatte mein Verhalten sehr genau beobachtet. Offenbar spürte sie, wie wacklig ich auf den Beinen stand. Mit einem deutlichen Handzeichen gab sie mir zu verstehen, ich möge noch einen Moment mit dem Hinsetzen warten. Ein kurzer Blick hin zu ihrem Partner und er hatte begriffen. Mit einem kräftigen Schwertstreich fuhr er durch die Halme, wobei er alle Gewächse dicht über der erstaunlich trockenen Erde abmähte. Erst als er sich davon überzeugt hatte, dass keine giftigen Tiere im Verborgenen lauerten, durfte ich mich hinsetzen, was auch ziemlich nottat.
Während der Dajak sich weiterhin bedeckt hielt und lieber stehen blieb, nahm das Mädchen eine halb kniende, halb kauernde Körperhaltung ein. In dieser Verrenkung – die Beine eng aneinander gepresst – konnte sie mit dem Wenigen was sie trug, geschickt ihre Intimitäten verbergen.
Eine Weile begegneten sich nur unsere Blicke. Und obgleich ihre Augen im Widerschein der aufsteigenden Sonne wie fröhliche kleine Flämmchen aufzuckten, konnte ich darin eine Anzahl Fragen und Sorgen lesen. Jetzt hätte ich mir sehnlichst gewünscht, wir könnten uns ein wenig über unsere Erlebnisse austauschen. Denn es stellte sich doch die Frage: Welchen ungewöhnlichen Umstand hatte ich es zu verdanken, dass beide anstatt in ihr an dem herrlichen See gelegenes Heimatdorf zurückzukehren, in diesem gottverlassenen Winkel der Erde gelandet waren? Aber ich musste einsehen, wie wenig an einen ergiebigen Gedankenaustausch zu denken war. Dafür fehlten einfach die sprachlichen Voraussetzungen. Nur mit den Händen gestikulieren, mit dem Kopf wackeln oder einfach nur den Mund bewegen, würde wohl kaum als angemessenes Verständigungsmittel für eine Vielzahl beiderseitiger Erlebnisse dienen können. Nachdem mir das klar geworden war, zog sich, wie auf einen inneren Befehl hin, mein Magen schmerzhaft zusammen, womit er mich eindringlich daran erinnerte, wie lange ich schon nichts mehr gegessen und getrunken hatte.
Zuerst wusste ich nicht gleich, wie ich mich verständlich machen sollte. Doch dann formte ich mit der Hand ein imaginäres Trinkgefäß, führte es zum Mund und sagte: »Wasser... trinken... Ich habe mächtigen Durst und könnte jetzt einen Schluck Wasser gebrauchen.«
Der Dajak hatte sofort kapiert. Er fasste nun nach einem dicken Bambusknüppel, dem ich bisher keinerlei Bedeutung beigemessen hatte, da er an einem nahestehenden Gummibaum gelehnt, wie zufällig dorthin gelangt, stand. Zu meiner großen Überraschung zog er einen Pfropfen heraus. »Du Durst, so trinken«, sagte er und hielt mir den ausgehöhlten Stock hin.
Ich fasste danach und schlürfte gierig. Die Flüssigkeit schmeckte würzig wie eine Mischung aus wildem Jasmin, Lorbeerblatt, Chilli und Gewürznelken. Nur der modrige Beigeschmack störte mich etwas.
»Äußerst praktisch«, sagte ich, dabei anerkennend mit dem Kopf nickend.
Der Dajak nickte zurück.
Kaum hatte ich getrunken, meldete sich wieder der Hunger. Das knurrende Geräusch meines ausgetrockneten Magens musste bis zu dem Dajak durchgedrungen sein, was ihm jedoch keineswegs zu überraschen schien. Womöglich kannte er die Wirkung des Gebräus auf hungrige Mägen sehr genau oder er hatte meine Gedanken erraten. Gleich wie, er griff nach seinem langen Blasrohr. Damit zielte er andeutungsweise in Richtung des dichten Waldes. Aus dieser unmissverständlichen Geste schloss ich, dass er vorhatte, sich nach Nahrung umzusehen – womöglich, um daraus knuspriges Wildbret zu bereiten. Ich nickte heftig zur Bestätigung, verstanden zu haben. Hoffentlich keinen Affen oder eine Schlange dachte ich im Stillen.
Mit einem deutlichen Zeichen, deutete er an, ich solle mich bis zu seiner Rückkehr nicht vom Fleck rühren. Wann damit zu rechnen war, ließ er offen.
Nachdem er mich hinreichend instruiert hatte, wendete er sich an seine Partnerin. Er spie einige unfreundliche Worte ihr gegenüber aus, woraufhin das Mädchen erschrocken hochsprang. Der Dajak setzte sich samt Blasrohr in Marsch. Seine Partnerin trabte ihn gehorsam und ohne zu murren hinterher.
Meine Augen verfolgten die beiden noch solange, bis die Blätter und Zweige hinter ihnen zusammenschlugen.
Allmählich überflutete mich die Dunkelheit. Mit dem Rücken an einen Baum gelehnt, horchte ich angestrengt in den Dschungel hinein. Überall stiegen Schreie auf und ich witterte tausende Gefahren. Zikaden stimmten ihren gemeinsamen Gesang an, der immer wieder einmal, wie von einem Dirigenten aufgezwungen, abrupt abbrach. Blätter rauschten und Zweige knackten verdächtig. Mitten in dieser erdrückenden Einsamkeit plagten mich plötzlich schwere Bedenken, ob die Dajaks überhaupt je zurückkehren würden. Und selbst wenn sie es ehrlich meinten, konnte ich mir dann auch gewiss sein, ob sie mich nicht verfehlten? Was sollte ich tun? Mein Überlebenstrieb war wieder erwacht, aber es war sinnlos, sich nicht einzugestehen, wie sehr mich die Angst plagte, vielleicht ein zweites Mal zu sterben. Denn dass mich wieder jemand in allerletzter Minute vor dem sicheren Tod retten würde, damit war wohl kaum zu rechnen. Also blieb mir keine andere Wahl, als weiterhin auf etwas zu warten, was vielleicht nur noch in meiner Hoffnung existierte?
Mitten in diesem Augenblick dumpfer Resignation, raschelten dicht neben mir Sträucher. Die Angst kroch mir eiskalt über den Rücken. Schutz suchend presste ich mich an einen nahen Baumstamm. Mit angespannten Sinnen versuchte ich die Dunkelheit zu durchdringen. Genau in dem Augenblick als die Geräusche unerträglich wurden, sah ich zwei menschliche Schatten aus dem umgebenden Dunkel hervortreten. Es waren die beiden Eingeborenen. Einer davon trug etwas sehr Schweres auf dem Rücken. Also konnte ich davon ausgehen, dass ihre Jagd erfolgreich verlaufen war. Der Gedanke, nach den Entbehrungen der vergangenen Tage schon in Kürze mit einem Festschmaus verwöhnt zu werden, raubte mir beinahe den Verstand. Ohne auch noch einen Moment zu zögern, trat ich aus meinem Versteck hervor, um die Jagdbeute, die der Dajak gerade ins Gras gleiten ließ, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch gerade als meine Erwartungen auf dem Höhepunkt gipfelten, da stockte mir der Atem. Das Beutetier war ein ausgewachsenes Gibbonweibchen. Es lag, die Arme und Beine weit von sich gestreckt, dicht vor mir auf dem Boden ohne zu bluten. Der winzige Giftpfeil, der seinen Tod verursacht hatte, steckte nicht tiefer als bis zur Spitze in der nur spärlich behaarten Brust.
Völlig deprimiert starrte ich auf das erlegte Tier. »In diesem verfluchten Wald muss es doch auch noch etwas anderes geben, als nur ungenießbare Affen und Schlangen«, stöhnte ich. Die Enttäuschung trieb mir Tränen in die Augen.
Der Eingeborene, der gerade noch in bester Erfolgsstimmung war, reagierte mit einem verächtlichen Lächeln.
»Bitte fasst das nicht als Beleidigung auf, und ich will auch nicht undankbar sein, aber ich kann, so gern ich es auch möchte, kein Affenfleisch essen. Ich würde keinen einzigen Bissen hinunterbringen. Lieber will ich weiter hungern«, versuchte ich den beiden meine Ansicht klar zu machen.
Daraufhin warf mir der Dajak einen düsteren Blick zu, und das Gesicht des Mädchens drückte zumindest Unverständnis aus. Vermutlich hatte sie an meinem Tonfall erraten, worum es mir ging.
Das Mädchen unternahm noch einen schwachen Versuch mich umzustimmen. Ihre Augen blickten mich bittend an. Dabei strich sie sich über ihren für meine Begriffe etwas zu stark gewölbten Leib. »Du Hunger... essen...!«, sagte sie beinahe flehend.
Doch so sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte mich, so gern ich es auch gewollt hätte, einfach nicht überwinden, ihrer inständigen Bitte nachzukommen. Allein schon die bloße Vorstellung, einen enthäuteten Affen zu verspeisen, schnürte mir vor Ekel die Kehle zu, und kannibalische Gedanken überkamen mich. »Nein. Auf keinen Fall. Dafür erinnert mich dieser bedauernswerte Affe zu sehr an ein kleines Kind«, lehnte ich kategorisch ab.
Es war schwer zu sagen, ob der Dajak den Sinn meiner Worte richtig erfasst hatte. Aber von nun an, schien die Angelegenheit für ihn erledigt zu sein. Ohne mich weiter zu beachten, nahm er den Affen wieder auf, warf ihn sich über die Schulter und schleppte ihn zu einer etwas abseits gelegenen Stelle. Das Mädchen stampfte ihm verdrossen hinterher.
Ich war mir nicht sicher, was mich schlimmer plagte; das schlechte Gewissen, den Eingeborenen gegenüber, weil ich ihre Sorge um mein Wohlergehen nicht genügend zu würdigen wusste, oder mein knurrender Magen. Während ich nur still dastand, um ein wenig mit mir zurate zu gehen, ertrank der Tag allmählich im schwachen Mondlicht. In diesen Minuten voller Nachdenklichkeit kehrten auch so nach und nach wieder meine Erinnerungen an die erdrückende Einsamkeit der vergangenen Tage zurück, wobei die Erinnerungen an die vorhergehende Nacht besonders tiefe Spuren in meinem Gedächtnis hinterlassen hatte. Alle meine Ängste malten mir Bilder aus jener Zeit, die ich lieber nicht gesehen hätte. Dennoch reifte die Erkenntnis in mir, dass ich mit dem Hunger womöglich noch eine Weile leben könnte, zumal mir die Aussicht an einem Affenknochen herumzuknappern den Appetit ohnehin gründlich verdorben hatte. Jedoch eine weitere Nacht ohne ein angemessenes Nachtlager...? Schon die Vorstellung, die Nacht in Anwesenheit tausender und abertausender am Boden herumkrabbelnder Lebewesen zu verbringen, die nur auf eine günstige Gelegenheit warteten, mich zu piesacken oder mein Blut zu trinken, würden mich keinen Schlaf finden lassen. Also dachte ich gründlich über eine mögliche Alternative nach, solange bis mir endlich die Erleuchtung kam. Ja, das war es... Das war die Lösung; solange es meine Kräfte erlaubten, wollte ich aus allem, was die Natur so hergab, eine Hängematte anfertigen.
Unverzüglich ging ich an die Arbeit. Mit meinem Buschmesser begann ich alles ringsherum abzuschneiden, was mir als Baumaterial geeignet schien. Dicht gewachsene Farne, große Blätter, biegsame Bambusschösslinge und strapazierfähige Lianen würden meine hohen Anforderungen hervorragend erfüllen. Mein geistiger Bauplan sah vor, rissfeste Schlingpflanzen von etwa gleicher Größe mit anderen dünnen und geschmeidigen Lianen netzartig zu verflechten. Wenn das geschafft war, wollte ich die Hängematte mit Blättern schön weich auspolstern und zwischen zwei günstig stehenden Bäumen befestigen. Das wenige Mondlicht als Lichtquelle war kaum der Rede wert, aber es reichte wenigstens aus, um das Notdürftigste zu erkennen. Den überwiegenden Teil der Arbeiten erledigte ich mit Hilfe meines Tastsinnes.
Als ich damit fertig war, betrachtete ich zunächst mein Werk. Dann ließ ich mich rücklings in die Hängematte fallen, die daraufhin ein wenig nachgab und müde wie ein altes Sofa stöhnte, aber sie hielt mein Gewicht aus. Ich konnte mit dem, was ich geschaffen hatte, durchaus zufrieden sein.
In meiner bequemen Hängematte auf dem Rücken lang ausgestreckt, starrte ich himmelwärts. Aber ich suchte die Sterne vergeblich. Das dicht gefächerte Blattwerk der uralten, weit in den Himmel ragenden Baumriesen nahm den Gestirnen das Licht. Von der nahen Feuerstelle trug die Luft verlockenden Bratenduft herüber. So wie sich mein Hunger immer eindringlicher regte, hätte ich jetzt auch gern einen knusprigen Affenbraten verzehrt. Aber ich hatte meine Wahl nun einmal getroffen. Schon kurze Zeit später fiel ich in einen tiefen Schlaf, der für einige Stunden alle bösartigen Gedanken erstickte, und der selbst die aufdringlichen Laute der nachtaktiven Tiere verstummen ließ.
Als ich starr vor Kälte in der frühen Morgendämmerung des darauffolgenden Tages erwachte, umgab mich eine für diese frühe Stunde außergewöhnliche Lautstille. Dichter vom Boden hochsteigender Nebel nahm mir die Sicht. Zunächst einmal lauschte ich andächtig in den neu angebrochenen Tag hinein. Jedoch so sehr ich mein Gehör auch anstrengte, ich konnte, abgesehen von dieser eigentümlichen umgebenden Ruhe, nichts von Bedeutung vernehmen. Wie ich so in die ungewöhnliche Stille hineinhorchte und nach einer plausiblen Erklärung dafür suchte – möglicherweise waren die tagaktiven Tiere gerade im Begriff die Macht von den nachtaktiven Lebewesen des Dschungels zu übernehmen – musste ich plötzlich an die beiden Eingeborenen denken. Ein schrecklicher Gedanke durchzuckte mich: Was war, wenn sie ohne mich weitergezogen waren? Dass sie mich gestern zufällig gefunden und wieder zum Leben erweckt hatten, musste nicht gleichzeitig besagen, sie würden es für ihre Pflicht ansehen, sich auch weiterhin um mein Schicksal zu sorgen. Gewiss, ich hätte aufstehen und mich an Ort und Stelle von der Situation überzeugen können. Doch irgendetwas, was ich mit der für das Auge undurchdringlichen weißen Wust in Verbindung brachte, hielt mich instinktiv davon ab. Aus der Erfahrung heraus wusste ich, wenn die Sonne höher steigt, wird der Nebel noch einmal sehr dicht und dann, ab einem gewissen Punkt, lichtet er sich, bis er später in Nichts zerfällt.
Ich beschäftigte mich immer noch mit der Frage, ob ich aus meiner selbst kreierten Hängematte, die meine anspruchslosen Erwartungen weit übertroffen hatte, klettern oder lieber noch eine Weile damit warten sollte, da ertönte unverhofft ein schriller, lauter Schrei, der sich anhörte, als wären ganze Heerscharen wild gewordener Bestien auf den Beinen. Erst hatte ich vor Kälte gezittert, jetzt erbebte ich vor Angst. Augenblicklich wurde mir bewusst, irgendwo hatte ich diesen wilden Schrei schon einmal gehört. Alle meine Sinne konzentrierten sich auf das schaurige Gebrüll, das tausendmal rascher als der herannahende Morgen durch den nebelverhangenen Dschungel hallte und überhaupt nicht verstummen wollte. Es schien fast, als hätten sich tausende Einzelschreie über alle Regionen des Waldes gelegt. Ja selbst vom Himmel drangen sie herab. Meine Körperhaare hatten sich hoch aufgerichtet, mein Atem stockte und obgleich zu keiner Bewegung fähig, fuhr ich mir mit der Hand unbewusst an den Hals, als könnte ich mich auf diese Weise vor dem Ersticken bewahren. Ich hatte nicht die geringste Vorstellung, von welcher Tierart dieses entsetzliche Gebrüll herrühren könnte. Aber so viel war sicher, nur ein außerordentlich großes und sehr gefährliches Raubtier einer unbekannten Gattung war in der Lage, seine Anwesenheit derartig laut und angsterregend zu signalisieren. Mit fieberhafter Hast versuchten meine Augen die über mich hinwegfließenden Nebelschwaden zu durchdringen. Ich wollte dem Dschungel unbedingt sein Geheimnis entreißen, denn wenn ich schon einen gefährlichen Feind hatte, so sollte er wenigstens nicht unerkannt bleiben.
Unvermittelt brach der Schrei ab, und es trat absolute Lautlosigkeit ein. Im gleichen Moment zerfiel wie ein Wunder der Nebel oberhalb meines Sichtbereiches in viele kleine Nebelbälle, sodass mein Blick nach oben hin frei wurde.
Erst dachte ich mir nichts dabei, als ich von einem der unteren Äste unmittelbar über meinem Kopf einen länglichen Gegenstand bemerkte, der sich wegen seiner eigentümlichen Gestalt und Farbe nicht so recht in die Umgebung einordnen wollte. Doch dann wurde mir bewusst, dort oben genau über mir, hing eine Schlange drohend wie ein Damoklesschwert.
Kurzzeitig verschluckte ein letzter Nebelfetzen das Reptil. Und genau in diesem Moment stieß das geheimnisvolle Lebewesen wie auf eine geheime Abmachung hin einen weiteren Schrei aus, der noch durchdringender – noch grauenerregender war, als der vorangegangene. In meiner Verzweiflung wusste ich nicht, wovon die größere Bedrohung ausging, von der Schlange oder der geheimnisvollen Kreatur, die in irgendeinem versteckten Winkel ganz in meiner Nähe ihr Unwesen trieb. Aber eines war sicher, ganz gleich was ich tun würde, mein Leben war in jedem Fall in Gefahr.
Da das Reptil höchstens für eine Sekunde sichtbar war, konnte ich unmöglich die von ihr ausgehende Gefahr auch nur annähernd beurteilen. Die Möglichkeit einer harmlosen Schlangenart zog ich gar nicht erst in Erwägung.
Als sich wenig später der Nebelvorhang kurzzeitig öffnete, entpuppte sich die Schlange als ein ausgesprochen großes Exemplar einer wunderschön mit roten silbernen Mustern gezeichneten Krait, die allerdings alles andere als harmlos war. Meiner Vermutung nach, war die gefährliche Schlange vermutlich gerade von ihrer nächtlichen Nahrungssuche zurückgekehrt, und jetzt befand sie sich auf dem Weg zu ihrem Ruheplatz, um dort den weiteren Tag ungestört zu verbringen. Einen Augenblick lang starrten wir uns einander wie hypnotisiert an, so als hätte sich meine Totenstarre geradewegs auf das Reptil übertragen. Aber das konnte mich kaum beruhigen, denn mir war bewusst, ich durfte die Schlange keinesfalls reizen, denn dann würde sie blitzschnell zustoßen und ich wäre ohne entsprechendes Gegengift unweigerlich verloren. Unter den gegenwärtigen Umständen blieb mir also keine andere Wahl, als in meiner jetzigen Position bewegungslos zu verharren und auf ein Wunder zu hoffen.
Seit mir klar geworden war, in welch tödlicher Gefahr ich nun schwebte, hatte meine Aufmerksamkeit dem brüllenden Ungeheuer gegenüber leicht nachgelassen, auch deswegen, weil ich inzwischen nichts Verdächtiges mehr hörte und deswegen annahm, wenigstens diese Bedrohung sei zumindest vorübergehend gebannt. Doch das sollte sich schnell als eine trügerische Hoffnung herausstellen. Denn plötzlich vernahm ich unmittelbar neben mir ein plumpsendes Geräusch. Zuerst dachte ich an eine Kokosnuss. Aber ich hatte, soweit ich mich erinnern konnte, gestern nirgendwo in der näheren Umgebung Kokosnüsse wachsen sehen. Wenn, dann wäre das in Hinsicht auf meinen Hunger und auch meinen Durst ein großes Glück für mich gewesen.
Mehr unbewusst stellte ich eine Gedankenverbindung zwischen dem eigentümlichen Geräusch und dem angsterregenden Schrei her. Ich war noch nicht am Ende meiner Überlegungen angelangt, da füllte sich die Luft erneut mit dem wilden Gebrüll. Damit war klar, ich hatte mich, was den Verursacher der lauten Schreie anging, falschen Hoffnungen hingegeben. Und noch etwas erkannte ich, die dem unbekannten Wesen offensichtlich innewohnende Gefahr übertraf bei Weitem das, was ich von der Giftschlange zu befürchten hatte. Ich überlegte: Vielleicht war es besser, die von der Schlange ausgehende Bedrohung einfach zu ignorieren und lieber alle meine Sinne auf das, was ich da zu hören bekam, zu konzentrieren.
Der Schall ließ die Luft ringsherum erzittern. Obgleich mich die Hängematte in gewisser Weise schützend umschloss, spürte ich die Nähe dieser unbekannten Kreatur. Es war, als brauche ich mich lediglich über den Rand meiner provisorischen Hängematte zu lehnen, dann konnte ich nach dem geheimnisvollen Lebewesen fassen.
Auf dem Gipfelpunkt meiner Angst, beschloss ich endlich etwas zu unternehmen, anstatt mein weiteres Schicksal nur tatenlos abzuwarten. Ich raffte meinen ganzen Mut zusammen und befreite mich aus meiner vorübergehenden Starre. Dann atmete ich tief durch, spannte alle meine Muskeln und ließ mich auf den immer noch im fließenden Nebel verborgenen Waldboden hinabgleiten.
Ich hatte Glück und landete auf den Beinen. Aber um meinen Körper auszubalancieren, musste ich gewaltig mit den Armen rudern. Und bei dieser Gelegenheit spürte ich einen seltsam weichen, warmen Widerstand. Vor Schreck wich ich einen Schritt zurück, wodurch der Nebel in Bewegung geriet. Dabei erblickte ich schemenhaft etwas, was ich zunächst kaum zu deuten vermochte. Es war, soweit ich das auf die Schnelle hin beurteilen konnte, so etwas wie ein in Pelz gehüllter Leib, von dem eine Bewegung ausging.
Gleich darauf geschah etwas durch und durch Rätselhaftes. Anstatt im Schutz des Bodennebels zu verschwinden, schmiegte sich das Fell besetzte Lebewesen behutsam an mich, so als suche es meine Nähe. Dann wurde die Sache noch sonderbarer; ein paar hornartige Krallen berührten zunächst meine Waden, bevor sie weiter über meine Schenkel bis hoch zum Gesäß fuhren. Ein eiskalter Schauer überrieselte mich. Schockiert von dieser abstoßenden Vertraulichkeit riss ich die Arme hoch und wollte seitlich ausweichen. Aber das Tier, sofern es diese Bezeichnung überhaupt verdient hatte, umklammerte fest meine Beine, wodurch ich gleich tüchtig ins Wanken geriet und beinahe umgestürzt wäre. Mit der Kraft der Verzweiflung schlug ich wild um mich – ich hieb, stampfte und schrie wie wahnsinnig, so als hätte ich die Kontrolle über mich verloren. Was ich zwar gehofft jedoch kaum erwartet hatte, geschah; das Wesen lockerte augenblicklich seinen Griff, es gab ein verwundertes Grunzen von sich, und schon kurz darauf war es verschwunden – nichts erinnerte mehr an seine Anwesenheit.
Doch der Schreck über das gerade Erlebte hatte alle meine Instinkte derartig angeregt, dass ich wie von Panik besessen augenblicklich davonstürmte. Ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen hetzte ich durch den Nebel, der mir feucht entgegenschlug. Ich musste weg von hier – nur weit genug weg – alles andere war untergeordnet. Büsche und Sträucher hemmten mich am Vorankommen und Dornen so hart und spitz wie Stahlnadeln hinterließen blutige Risse in meiner Haut. In einer dichten Nebelbank übersah ich ein Erdloch und schlug der Länge nach hin. Mein rechtes Knie war hart und schmerzhaft auf einen Stein geprallt. Ich kam sofort wieder auf die Beine. In diesem Moment war es mir, als würde ich dicht über mir angestrengtes Keuchen hören. Aber da war nichts.
Ursprünglich hatte ich vor, erst dann anzuhalten, wenn ich mich endgültig in Sicherheit wusste. Da jedoch das Gelände von einem gewissen Punkt an leicht anstieg, wurde mir die Atemluft bald knapp. Meine Kräfte verließen mich allmählich und ich strauchelte immer häufiger. Um nicht ein weiteres Mal der Länge nach hinzustürzen, blieb mir keine andere Wahl als anzuhalten, um mich ein wenig auszuruhen. Doch Vorsicht war geboten. Erst musste ich sicher sein, nicht mehr verfolgt zu werden. Ich verharrte mitten aus dem Lauf heraus und lauschte, dabei die Muskeln immer noch fluchtbereit angespannt. Auch wenn ich etwas länger den Atem anhielt, konnte ich nichts Verdächtiges mehr hören. Vielleicht hatte ich es tatsächlich geschafft, dem Etwas, was es auch sein mochte, zu entkommen.
Schwer atmend lehnte ich mich an einen Baumriesen mit großgenoppter Rinde. Die Beine bebten und mein Herzschlag raste. Als Erstes hielt ich intensiv in die Richtung Ausschau, aus der ich soeben gekommen war. Ich konnte nichts anderes sehen als ballenden Nebel. Als ich einigermaßen zur Ruhe gekommen war, versuchte ich, mir die wichtigsten Einzelheiten der letzten Minuten noch einmal zu vergegenwärtigen. Doch es war eigenartig; jetzt, da es wieder ruhig geworden war, regten sich plötzlich Zweifel in mir, und ich fragte mich, ob sich das alles tatsächlich ereignet hatte oder ob die ganze Geschichte möglicherweise nur in meiner überspannten Phantasie existierte.
Wie ich so dastand und über das, was ich soeben erlebt hatte oder was ich vielleicht auch nur meinen überreizten Sinnen zu verdanken hatte, nachdachte, da ging mir ein Gedanke durch den Kopf: War ich vielleicht zufällig mit einem vom Baum gestürzten Orang-Utan zusammengetroffen? Obwohl eine Menge gegen diese Annahme sprach, musste ich es in Erwägung ziehen. Erst als der gemischte Chor aus Vertretern der hiesigen Tierwelt wieder einsetzte, fiel mir das entsetzliche Gebrüll wieder ein, dass den Dschungel vor wenigen Minuten wie tausend außer Rand und Band geratener Bestien durchdrungen hatte und ich löste mich von dieser harmlosen Theorie.
Inzwischen reichten mir die bizarren Nebelgebilde gerade noch bis zur Brust. Unterhalb floss der Nebel wie Wasser zwischen meinen Beinen hindurch. Oben schimmerten zaghaft durch das Blattgrün der Bäume einige Lichtpünktchen der ersten Morgensonne. Nicht mehr lange und auch der allerletzte Dunstschleier würde sich für den heutigen Tag verflüchtigen.
Ich hatte mich immer noch nicht vollständig von meinen reichlich verworrenen Gedanken gelöst, da raschelte es unverhofft rechts von mir im Gebüsch. Meine Sinne wurden gleich wieder hellwach. Instinktiv presste ich mich an den Baum und meine Phantasie malte mir die schrecklichsten Bilder. Mitten auf dem Höhepunkt meiner Furcht, erblickte ich zwei schattenhafte Gestalten. Schon eine Sekunde später erkannte ich die beiden Eingeborenen, die wie geborene Wunder aus dem Nebel traten.
Als sie mich erblickten, blieben sie verdutzt stehen. Offenbar hatten sie überhaupt nicht mit meiner Gegenwart gerechnet.
Ich war nicht weniger über ihr unverhofftes Erscheinen verwundert. Doch gleichzeitig begriff ich auch, welch glückliche Wendung für mein weiteres Schicksal diese Begegnung haben könnte. Vorausgesetzt natürlich, die beiden Dajaks würden mir auch weiterhin freundlich gesinnt sein.
Der Dajak versteckte augenblicklich seine Hand hinter dem Rücken. Seine Augen waren argwöhnisch auf mich gerichtet.
Bemüht, meine Aufregung aus den vorangegangenen Ereignissen zu unterdrücken, fragte ich möglichst freundlich: »Warum nur dieses Misstrauen mir gegenüber? Was habe ich euch denn getan? Ist es vielleicht wegen des Essens, das ich gestern Abend nicht mit euch teilen wollte?«
Der Blick des Dajak blieb versteinert wie ein Monument.
Ich hob die Schultern und setzte fort: »Wenn du irgendetwas gegen mich hast, dann musst du es mir schon sagen. Vielleicht kann ich dann Klarheit in die Sache bringen. Und natürlich bin ich dir und deiner Partnerin unendlich dankbar, dass ihr mich gefunden und damit vor dem sicheren Tod bewahrt habt. Aber das sagte ich ja bereits gestern Abend. Ich erwarte selbstverständlich nicht, dass du mich vor lauter Freude über meine Anwesenheit gleich umarmst. Aber ein ganz klein wenig guten Willen mir gegenüber könntest du schon zeigen.« Da immer noch keine Reaktion auf meine Ansprache folgte, deutete ich mit dem Zeigefinger auf die versteckte Hand des Dajaks. »Ganz gleich was du da hinter deinem Rücken vor mir zu verbergen versuchst. Es ist mir egal. Und selbst wenn es etwas Illegales sein sollte, dann kann ich dir versichern, Geheimnisse sind bei mir bestens aufgehoben. Doch jetzt möchte ich gern etwas von dir hören. Eine Antwort oder etwas in der Art.«
Im starren Gesichtsausdruck des Dajaks vollzog sich ein Wandel. Unschlüssig blickte er hin zu seiner Partnerin, die den kleinen Dialog interessiert verfolgt hatte. Daraufhin nickte sie ihn mit einem sprechenden Lächeln zu.
Erst zögerte der Dajak noch, aber dann streckte er den Arm vor und öffnete die Hand.
Als ich eine schwarze Hornkralle darin liegen sah, die noch leichte Spuren roten Blutes aufwies, bereute ich augenblicklich mein voreiliges Versprechen. Am liebsten hätte ich mich sofort auf ihn gestürzt, um mit einen kräftigen Faustschlag meine Auffassung ihm gegenüber zu demonstrieren. Nur weil ich im Moment keinen zusätzlichen Ärger gebrauchen konnte, gelang es mir, meinen Zorn zurückzuhalten.
Ich tat so, als sei ich wegen dem, was ich da in der Hand des Eingeborenen liegen sah, kein bisschen verärgert und nahm die Kralle wie einen ganz gewöhnlichen Gegenstand, den ich mir nur aus reiner Neugierde einmal kurz betrachten wolle, an mich. Was mir sofort auffiel, war die außergewöhnliche Anatomie. Im Unterschied zu den Gliedmaßen der normal entwickelten Hand eines Orang-Utans war diese Kralle – meiner Einschätzung nach ein Mittelfinger – wesentlich kürzer und gedrungener als üblicherweise zu erwarten. Auch die Hornbildung war weniger ausgeprägt als bei dieser Tierart üblich. Zuerst nahm ich an, irgendeine seltene Krankheit könnte womöglich diese eigentümliche Abnormität hervorgerufen haben. Oder vielleicht hatte ich auch zufällig eine neue bisher unbekannte Unterart entdeckt. Jedoch bei genauerer Überlegung kam mir etwas in den Sinn, was ich mir selbst kaum eingestehen wollte... Die unverkennbare Ähnlichkeit mit der Hand eines frühen Steinzeitmenschen brachte mich auf den Gedanken. Musste ich vielleicht von der Annahme ausgehen, dass mir der Zufall den Finger von einem dieser mysteriösen Institutsaffen zugespielt hatte? So unfassbar es auch war, aber ich musste diese Möglichkeit wenigstens ins Auge fassen. Und sollte meine Vermutung tatsächlich zutreffen, dann galt es ungeachtet meiner gegenwärtigen Situation, sofort nach dem verendeten Tier zu suchen. Nur so konnte ich mir Gewissheit verschaffen. Mir war allerdings auch klar, wollte ich meinen Plan verwirklichen, dann war die Hilfe der beiden Eingeborenen unerlässlich. Und ob ich sie für dieses äußerst Ungewisse Unternehmen gewinnen konnte, dafür standen die Chancen im Augenblick ziemlich schlecht. Aber ich musste es wenigstens versuchen.
Wie ich meinen Blick wieder den Dajaks zuwendete, die sich beide irgendwie abwartend verhielten, stellte ich mir unwillkürlich die Frage, bei welcher Gelegenheit die Hornkralle in den Besitz des Dajaks gelangt sein könnte. Unwillkürlich musste ich auf die Kralle schauen. Da bemerkte ich einen winzigen Rest verwischten Blutes auf meiner eigenen Handfläche. Sofort begriff ich, was das zu bedeuten hatte... Das verendete Tier musste sich hier irgendwo ganz in der Nähe befinden.
Um mir Klarheit zu verschaffen, trat ich einen Schritt näher an den Dajak heran, der nun seinerseits leicht irritiert einen Schritt zurückwich. Mit der linken erhobenen Hand deutete ich in die Richtung, wo die Eingeborenen gerade hergekommen waren. Die Kralle in der rechten Hand benutzte ich als Zeigestock. Dabei nickte ich heftig, um damit anzudeuten, worum es mir ging.
Doch der Dajak sah mich nur begriffsstutzig an und zuckte dabei hilflos mit den Schultern.
Daraufhin versuchte ich ihn mit einer mündlichen Erläuterung mein Anliegen näherzubringen. »Solltest du vielleicht denken, ich will dich wegen der Kralle bei den Behörden anschwärzen, so kann ich dich beruhigen. Das habe ich keinesfalls vor. Ich will lediglich von dir wissen, wo du den toten Affen gefunden hast, damit ich ihn näher untersuchen kann. Vielleicht bekomme ich heraus, woran er gestorben ist. Du siehst also, für dich besteht nicht das geringste Risiko und dazu erweist du der Wissenschaft noch einen großen Dienst.« Ohne die geringste Ahnung, ob er mich verstanden hatte, wartete ich auf seine Reaktion.
Überraschend gab er mir mit einer deutlichen Armbewegung zu verstehen, ich möge mitkommen. Anscheinend hatte er meine Worte richtig gedeutet.
»Warum so schnell? Denn wenn ich nicht bald etwas esse, dann geht es mir vielleicht wie dem Affen. Ich sterbe, wenn auch vor Hunger«, sagte ich, weil mein Magen inzwischen unüberhörbare knurrende Geräusche von sich gab.
Doch darauf wollte der Dajak keine Rücksicht nehmen. Er setzte sich in Bewegung, und mir blieb keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Auch das Mädchen kam mit.
Wir mussten viele dichte Rankenpflanzen aus dem Weg räumen und über morsche Baumstämme steigen, solange bis der Eingeborene anhielt. Er schaute mich unerwartet freundlich an und fragte: »makan babi?«
Da ich nicht die geringste Ahnung hatte, was er damit meinte, war ich es, der diesmal unwissend mit den Schultern zuckte.
Das Mädchen wartete gespannt auf meine Reaktion. Ein verschmitztes Lächeln glitt über ihr Gesicht. Plötzlich lachte sie hell auf. »Essen... du essen«, sagte sie.
Verdutzt hielt ich Ausschau. Doch so sehr ich meine Augen auch anstrengte, ich konnte nichts Essbares entdecken. Lediglich ein künstlich aufgetürmter Hügel aus Farnkraut und großen Blättern wollte sich nicht so recht in die Umgebung einordnen.
Das Mädchen ging darauf zu, beugte sich nieder und scharrte mit den Händen das Grünzeug beiseite.
Meine Überraschung war perfekt. Der Berg aus Blättern und Farnen war, wie sich schnell zeigte, nichts anderes als ein künstlich angelegtes Versteck für ein erlegtes Wildschwein. Das Tier hatte kurze graue Borsten, riesige Ohren, die die Augen verdeckten, eine kurze gedrungene Schnauze und der Bauch hing von der Last der dicken Speckschicht schwer herunter.
Außer mir vor Freude betastete ich das Schwein. Die letzte Körperwärme war noch zu spüren. Schon allein die Aussicht auf eine üppige Mahlzeit hob augenblicklich meine Stimmung an.
Erst hatte mir der Dajak nur zugeschaut. Jetzt, nachdem er meine Reaktion sehr genau verfolgt hatte, nahm er eine kerzengerade Körperhaltung ein. Er stolzierte erhobenen Hauptes mehrmals mit kurzen Schritten vor der Beute auf und ab. Wie es schien erhoffte er sich von dieser Geste, dass ich sein Jagdglück auch gebührend würdigen möge.
Ich ging zu ihm hin. Dann klopfte ich ihn wie einen alten, unverhofft wiedergetroffenen Kriegskameraden auf die gestraffte Schulter. »Also ich muss schon sagen, das war ja eine wahrhaft meisterhafte Leistung von dir, die man nicht genug würdigen kann«, lobte ich, wobei ich nicht einmal lügen musste.
Seine Brust schwoll sichtbar an.
Die unverhoffte Aussicht auf einen saftigen Schweinebraten ließ mich vorerst mein ursprüngliches Vorhaben, nach dem geheimnisvollen Orang-Utan zu suchen, vergessen. Gemeinsam schleppten wir das Schwein aus dem dichten Wald heraus und legten es auf dem Rastplatz der Eingeborenen nieder. In den Ascheresten ihres Feuers lagen noch einige verkohlte Affenknochen, was mich etwas störte, aber nur sehr wenig. Erwartungsvoll sah ich auf das Wildschwein. Es bot einen ausgesprochen schönen und beruhigenden Anblick. Bei dem Gedanken, das Fleisch bald über dem Feuer brutzeln zu sehen, füllte sich mein Mund mit mehr Speichel als ich hinterschlucken konnte. Aber dann fiel mir etwas ein, was mich ziemlich in Verlegenheit versetzte; ich hatte noch niemals im Leben ein Schwein geschlachtet. Allein schon die bloße Vorstellung, es vielleicht jetzt tun zu müssen, bremste mein noch vor wenigen Minuten kaum zu zähmendes Essbedürfnis schlagartig ab. Ich dachte einen Moment nach: Wie konnte ich mich möglichst unauffällig aus der Affäre ziehen? Endlich kam mir eine zündende Idee. Ich trat auf den Dajak zu, der andächtig mit dem Daumen die Schärfe seines Kopfjägerschwertes prüfte. »Wenn du nichts dagegen einzuwenden hast, dann gehe ich mir mal rasch den Orang-Utan ansehen. Du musst mir bloß noch die Stelle sagen, wo ich zu suchen habe, und vor allem in welche Richtung ich gehen muss«, erläuterte ich ihn meine Absicht und gab mit Hilfe der Hände die Konturen eines Menschenaffen in der Luft wieder.
Er sah zu mir hoch. Nach einer kurzen Zeit intensiven Nachdenkens schien er kapiert zu haben, worauf ich hinauswollte.
Bereitwillig, so als sei jedes einzelne meiner Worte bis in den dafür vorgesehenen Bereich seines Gehirn vorgedrungen, streckte er den Arm in eine ganz bestimmte Richtung aus, und über seine Lippen ergoss sich ein unendlicher Wortschwall, der sich wie ein fremdländisches Klagelied anhörte.
Auch wenn ich mir nicht völlig sicher war, so nahm ich an, er wollte damit andeuten, ich solle mich genau dorthin bewegen, wo das Schwein im Laub versteckt gelegen hatte. Von da aus müsste ich noch ein kleines Stück nach rechts gehen. Mit etwas Suchen, würde ich den Affenkadaver schon finden.
Ich bedankte mich für die Auskunft und machte mich auf die Suche. Der Rauch des inzwischen entfachten Feuers würde mich sicher zurückführen.
Unterwegs ließ ich mir die Sache mit der eigentümlich ausgebildeten Hornkralle noch einmal gründlich durch den Kopf gehen. Dabei fiel mir wieder eine Begebenheit ein, die sich einen Tag nach Harry Thomsens Tod zugetragen hatte; Mark nahm mich an jenem Morgen zur Seite, um mich auf eine ungewöhnliche Entdeckung hinzuweisen. Seiner Meinung nach hatte sich Irgendjemand an unseren Tragesäcken vergriffen. Insbesondere die unsachgemäß verknoteten Schnüre veranlassten ihn zu dieser für meine damaligen Begriffe absurden Annahme. Jetzt war ich nahe daran, anders darüber zu denken.
Zunächst langte ich an der Stelle an, wo das Schwein gelegen hatte. Von da an schlängelte sich der Pfad unübersichtlich durch immer dichteren Pflanzenbewuchs. Als ich schon mit dem Gedanken spielte, aufzugeben und umzukehren, weil es kaum noch ein Durchkommen gab und ich außerdem nicht völlig die Orientierung verlieren wollte, da erspähte ich linksseitig im dichten Buschwerk undeutlich einen Gegenstand, der rotbraun wie ein Fuchsfell gefärbt war. Um mich meinem Ziel zu nähern, musste ich erst einige widerspenstige Äste und Zweige zur Seite biegen. Ein überaus heller Sonnenstrahl verlieh dem leblosen Tierkörper, von dem mich höchstens noch vier oder fünf Meter trennten, für wenige Augenblicke ein goldenes Aussehen. Aber schon von dieser Distanz aus, wurde deutlich, dass einiges an diesem verendeten Tier mit meiner Vorstellung von einem wild lebenden Orang-Utan nicht in Einklang zu bringen war. Je weiter ich mich dem toten Tier näherte, umso mehr verstärkte sich der typische Aasgeruch.
Endlich hatte ich mich weit genug voran gearbeitet, um mir ein genaueres Bild von dem Kadaver machen zu können. Doch das was ich da vor mir im Gebüsch liegen sah, war haarsträubend genug, um es vielleicht für immer im Gedächtnis zu verewigen; Der Leib glich nur dem äußeren Schein nach einem Vertreter der Gattung Pongo pygmaeus – also Borneo Orang-Utan oder einer mit ihn verwandten Unterart. Eine Weile betrachtete ich das seltsame Wesen. Der penetrante Verwesungsgestank nahm mir die Luft zum Atmen. Alle wesentlichen Merkmale des Tierkörpers wiesen irgendwelche Verstümmlungen auf. So waren die zottigen Arme völlig unterentwickelt und gut um ein Drittel kürzer als die eines gesund herangewachsenen Orang-Utans. Sie hätten bei diesem merkwürdigen Exemplar, falls es aufrecht dagestanden hätte, kaum weiter als bis zum Gesäß gereicht, und nicht wie üblich bis knapp über den Boden. Nicht weniger abnormal waren die viel zu langen Beine, die kräftig ausgebildete Schenkel und muskulöse Waden hatten, und die sich deswegen bestenfalls zum Gehen geeignet hätten, aber keinesfalls um schnell und geschickt von Ast zu Ast zu hangeln, was auch durch die ungewöhnliche Rückbildung der Zehen kaum möglich gewesen wäre. Auch die viel zu kleinen Füße waren einem menschlichen Fuß nicht unähnlich, genauso wie die fehlentwickelten Hände gewisse Übereinstimmungen mit einer Menschenhand aufwiesen. Es schien, als sei die komplette Biologie bei diesem Exemplar völlig auf den Kopf gestellt. Weder mein Wissen noch meine Vorstellungskraft reichten aus, um mir zu veranschaulichen, wie ein auf diese schaurige Weise verunstaltetes Tier überhaupt dazu fähig sein könnte, die höchsten Bäume zu erklimmen, um in ihnen zu leben und Nachwuchs aufzuziehen. Schon der erste Kletterversuch würde unweigerlich mit einem Debakel enden.
Was ich schon seit einiger Zeit geahnt hatte, war nun zur Gewissheit geworden: Menschen hatten versucht, die Evolution einer Tierart auf künstliche Weise nach Gutdünken zu beeinflussen. Doch wozu? Welches Ziel wurde mit einem derartig rigorosen Eingriff in die Natur verfolgt?
Mehr als nur einmal hatte ich mir während der zurückliegenden Tage die entscheidende Frage gestellt, ob die auf künstlichem Wege gezüchteten Orang-Utans, nach denen unsere kleine Expedition ausgeschickt worden war, in der Wildnis überleben und sich dort behaupten könnten. Aus mehreren ungefähr gleichlautenden wissenschaftlichen Publikationen, die sich mit dem Thema Auswilderung beschäftigten, wusste ich, wie wenig Aussicht auf Erfolg die von engagierten Tierschützern mit viel Zeit und Geduld unternommen Versuche, in Tiergärten aufgezogene Orang-Utans in die freie Wildbahn zu entlassen, zeigten. Aber nun war etwas eingetreten, was sich fernab jeglicher Realität abspielte. Gewissenlose Elemente hatten offenbar die fehlende Überlebensfähigkeit der manipulierten Tiere von vornherein einkalkuliert. Das Ergebnis einer derartig skrupellosen Forschungsarbeit direkt vor meinen Augen zu haben, löste in mir unbändige Wut und blindes Entsetzen zugleich aus.
Als ich meine erste Bestürzung allmählich überwunden hatte, fing ich an, eine kurze biologische Untersuchung in Verbindung mit einer groben Altersbestimmung vorzunehmen. Doch zunächst einmal betrachtete ich den Kadaver in aller Gründlichkeit. Während ich gegen den widerlichen Aasgestank anzukämpfen versuchte, fiel mein Blick auch wieder auf die abnormal gewachsenen Gliedmaßen, und ich musste mir den Affen unwillkürlich aufrecht gehend vorstellen. Und plötzlich wusste ich es; der aufrechte Gang, ja das war es... Aber das würde ja bedeuten... Nein völlig unmöglich, das ergibt keinen Sinn, versuchte ich diesen absurden Gedanken schnell wieder zu verdrängen.