
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saphir im Stahl
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine neue Zeit ward geboren und die Winde des Südens bringen den fauligen Geruch des Todes mit sich. Flüsse und Seen überschwemmen Äcker und Wiesen und auf den verschlammten Feldern schimmern die gebrochenen Augen der Toten wie schwarze Sterne. Die Zeit von Tolkiens Völkergeschichten ist vorbei. Die neue Fantasy beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas GroßHans-Peter Schultes
Im SchattendesBlutmondes
Fantasy-Roman
ebook 006 Im Schatten des Blutmondes
erste Auflage 01.06.2013
© Saphir im Stahl
Verlag Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Casandra Krammer
Lektorat: Thomas Michalski
Vertrieb bookwire
ISBN: 978-3-943948-05-9
Eine neue Zeit ward geboren und die Winde des Südens bringen den fauligen Geruch des Todes mit sich. Flüsse und Seen überschwemmen Äcker und Wiesen und auf den verschlammten Feldern schimmern die gebrochenen Augen der Toten wie jchwarze Sterne. Vögel fallen tot aus den zerfetzen Wolken und die Bäume weinen schwarzes Blut. Feuer lodern in den Städten und Dörfern und die Schwerter der Krieger funkeln wie dunkelrote Rubine im Schatten des Blutmondes. Und sie reiten und reiten und suchen den Feind, doch sie finden ihn nicht.
Die Priester in den Tempeln des Jamus und der Canes – sie treten vor die Menschen und verkünden: „Wehe uns, wehe den Lebenden. Der Mond ist schwanger geworden und er wird uns gebären die Kinder des roten Todes…“
(Bericht des Herosius)
Prolog
Das Schiff der Wakanda kämpfte sich durch die schäumende See. Nass vom Blut der Wunden und der Gischt fochten die überlebenden Krieger mit knirschenden Riemen den ewigen Kampf zwischen Woge und Planke. Sie befanden sich am Rande der Erschöpfung.
Mit leeren Augen bewegten sich ihre Oberkörper vor und zurück. Die Welt, die sie kannten, war in Feuer und Blut vergangen. Schmerz und Leid lagen hinter ihnen und was ihnen folgte, war der Tod.
Unermüdlich ruderten die Männer. Niemand, auch Berengar Skal nicht, dessen langes Haar in dieser Nacht des Grauens silberweiß geworden war, sah den Schatten, der dem Schiff unbeirrbar folgte.
Nach Stunden des Kampfes gegen den Wind und die raue See, beruhigten sich die Wogen unter dem Kiel des Schiffes. Doch das Sterben ging auch nach dem Ende des Sturmes weiter.
Immer häufiger warf man die an ihren Verletzungen und Erschöpfung gestorbenen Männer über Bord. Sie wurden von Bake, dem Großen Hai, und seinen Artgenossen verschlungen, die seit vielen Sonnen beharrlich dem einsamen Schiff folgten. Jede Nacht brodelte das Meer um die von Bohrwürmern zerfressenen Planken des Schiffes. Jede Nacht wurde Berengar Skal einsamer und die Haie fraßen sich an den Toten satt. Als an Bord nur noch die Herzen der stärksten Krieger schlugen, darunter das Herz des Silberhaarigen, der regungslos am Bug stand, wie so viele durchwachte Nächte zuvor, glitten im silbernen Licht des Mondes die schwarzen Schatten der Rückenflossen davon.
Der Blick Berengar Skals schweifte über die breitschultrigen, ebenholzfarbenen Körper der letzten Gefährten, die ihm noch geblieben waren und die unermüdlich im Takt der Trommel die Riemen zogen. Er roch die Nähe der Küste. Sie war nicht mehr fern. Doch würden die Bewohner von Skiluros, der alten Stadt auf dem Hochland von Turia, auf seine Warnung hören, die er ihnen zu überbringen beabsichtigte? Er bezweifelte es. Niemals hatte er daran geglaubt, dass die Urgor den Sieg erringen würden. Aber doch war es geschehen. Die Kraals der Wakanda waren vernichtet, die Reihen der Speerträger zerschlagen, die Weidegebiete verwüstet unter dem Ansturm der Nachtschatten und ihrer Schergen.
Gebannt richtete er den Blick auf den schmalen Küstenstreifen, der sich im Licht der aufgehenden Sonne am Horizont abzuzeichnen begann. Der Weg nach Skiluros war noch weit, selbst wenn sie den Schutz der Küste erreichen würden.
Seine Hände ballten sich um die Heckreling und die Knöchel traten weiß hervor. Schwermut überfiel ihn, als er daran dachte, dass sein Flaggschiff, die Sturmbezwinger, das letzte Schiff der kleinen, von der Südwelt aufgebrochenen Flotte der Wakanda war. Alle anderen Schiffe waren vernichtet oder auf der Überfahrt nach Amarna von den Fluten des ewigen Ozeans verschlungen worden. Erst vor wenigen Nächten hatte er die Windreiter aus den Augen verloren. Mit Sicherheit war sie bereits ein Opfer der Flotte der Urgor geworden, die ihnen folgte.
Die Sturmbezwinger war angeschlagen und an vielen Stellen sah man die Beschädigungen durch die Kämpfe in der alten Heimat. Doch noch war es seetüchtig und trug die Männer auf dem Deck zuverlässig über das Wasser.
Über seinem Kopf hing, seit die Sonne die Herrschaft angetreten hatte, das Segel flach am Mast herab. Die Natur schien sich gegen ihn und sein Schiff verschworen zu haben. Kein Lüftchen regte sich. Er betete still zu seinen Göttern und bat sie um Wind. Wind, der seine Krieger entlasten und das Schiff nach Skiluros bringen würde.
Er sah sie nicht kommen. Er hörte sie.
Trommelschläge hallten über das Wasser und als sein Ohr sie vernahm, wandte er sich voller Furcht um und starrte nach achtern auf das endlos scheinende Meer. In diesem Augenblick wandelte sich sein Funken Hoffnung zu brennendem Hass. Niemals würden sie Ruhe geben. Hinter seinem Rücken spürte er, wie seine Männer für einen Moment die Ruder ruhen ließen. Auch sie lauschten dem Trommeln. Es bedurfte keines Befehls, die Ruder wieder aufzunehmen. Sie ergriffen die langen Hölzer, und ehe er sich ihnen wieder zuwenden konnte, zogen sie die Riemen peitschend durch das Wasser. Wieder und wieder. Nur gemeinsam konnten sie überleben.
Endlich fühlte er ein sanftes Lüftchen auf seiner Haut. Hatten ihn die Götter doch erhört? Er richtete den Blick auf den schlaffen Stoff, der sich zu blähen begann. Der Wind wurde immer kräftiger und schon bald straffte sich das Segel und stand voll am Mast. Würden sie ihren Verfolgern wider Erwarten doch noch entkommen können?
Bedrohlich sah Berengar Skal die schwarzen Segel am Horizont auftauchen, erst eines, dann ein zweites, bis die immer zahlreicher werdenden Schiffe wie eine schwarze, undurchdringliche Wand den Horizont bedeckten. Schweiß perlte auf seiner Stirn. Hastig fuhr er sich mit dem Handrücken über das Gesicht. Seine Männer holten das Letzte aus sich heraus.
Neue Hoffnung keimte in ihm auf. Hoffnung, dass es ihnen gelingen würde, zu entkommen. Beinahe schien es, als würden die Götter ihnen eine Gnadenfrist einräumen. Der Bug der Sturmbezwinger hob sich aus dem Wasser und schob eine Welle vor sich her. Selbst das Schiff kämpfte nun auf der Seite seines Kapitäns. Skiluros war nicht mehr weit.
Als er sich wieder den schwarzen Schiffen zuwandte, musste er schmerzlich feststellen, dass der Feind, trotz der Unterstützung des Windes, den Abstand zur Sturmbezwinger hatte verringern können. Es schien, als würden die Schiffe der Urgor von einer unheimlichen Kraft angetrieben.
Berengar Skals Augen weiteten sich, als er die mächtigen Arme der Wurfmaschinen sah, die auf dem vordersten Schiff der Verfolger plötzlich nach vorne schnellten.
Er duckte sich, als er das Pfeifen der Steinkugel hörte, die über seinen Kopf am Heck vorbeiflog und mit einem lauten Klatschen im Wasser versank. Die Flucht der Sturmbezwinger war zu Ende. Jetzt gab es nur noch den Kampf. Lange hatten sie die Flotte der Nachtschatten auf Distanz halten können. Aber die Übermacht war zu groß. Unaufhaltsam kamen die schwarzen Schiffe näher. Nicht nur die Geschosse der Onager flogen herüber, sondern inzwischen ging in regelmäßigen Abständen ein Pfeilregen auf sie nieder.
Es war reines Glück, dass die Sturmbezwinger nicht schwer getroffen wurde. Er wollte sich gerade zum Bug des Schiffes begeben, als er den Schatten bemerkte, der immer größer wurde. Ein Onagergeschoss flog auf sie zu. Die Steinkugel stürzte herab, schlug mitten in das Schiff hinein, zerstörte Planken und mehrere Ruder und wirbelte drei Männer durch die Luft, die krachend gegen die Bordwand prallten. Die Schmerzensschreie der Verwundeten erfüllten die Luft, doch die meisten seiner Krieger hatten sich in Sicherheit bringen können.
Sofort sprangen mehrere Wakanda mit Ersatzriemen heran, steckten sie in die dafür vorgesehenen Löcher der Bordwand und stießen sie ins Wasser.
Berengar Skal wandte sich dem Steuermann zu und befahl: „Halte das Schiff auf Kurs. Vielleicht schaffen wir es noch, das Land zu erreichen, bevor wir untergehen.“
Der Steuermann nickte wortlos und drückte das Ruder hart nach links. Plötzlich weiteten sich die Augen des Mannes, sein Körper streckte sich kurz, ehe er über dem Ruder zusammenbrach. Entsetzt starrte Berengar Skal auf den schwarzen Pfeil, der aus dem Rücken des Kriegers ragte. Er sprang vor, riss den toten Mann zur Seite und nahm das Steuer in die Hand. Nur langsam drehte sich das Schiff, während seine Männer sich voller Verzweiflung in die Riemen legten.
„Rudert, Wakanda! Rudert!“, brüllte er über das Deck. In den blutunterlaufenen Augen seiner Männer flackerte der Schmerz auf, als sie ihre letzten Kraftreserven abriefen und ihre Riemen in rasenden Schlägen durch das Wasser peitschten.
Als er den schmalen Küstenstreifen größer werden sah, richtete Berengar Skal das Steuer neu aus, griff nach einem neben sich liegenden Seil und zurrte es damit fest. Damit stellte er sicher, dass das Schiff die Richtung beibehielt. Er sprang von dem kleinen Aufbau, rannte zum Mast und kletterte hinauf. Ein Pfeil bohrte sich keine Handbreit neben seiner Wange ins Holz. Fluchend hielt er kurz inne, ehe er sich weiter hochzog, den Mastkorb enterte und sich aus dieser Höhe einen Überblick verschaffte. Bisher war nur ein kleiner Teil der Urgorschiffe zu der Sturmbezwinger vorgestoßen. Die restlichen Schiffe bewegten sich von der Sturmbezwinger fort. Er ahnte, was sie beabsichtigten, denn er kannte diese Art von Manöver. Sie wollten die Sturmbezwinger einkreisen.
Nur wenn es ihm und seinen Männern gelang, sie abzuhängen und der Einkreisung zu entkommen, konnten sie die Küste erreichen. Tief in seinem Innern fühlte er, dass diese Hoffnung trügerisch war. Als er den Onager erblickte, dessen Wurfarm gerade nach hinten gebogen wurde, wusste er, dass seine Zuversicht auf ein Entkommen so viel Überlebensaussicht besaß wie Eis in der Wüstensonne. Deutlich konnte er die geschuppten Echsenwesen erkennen, die das schwarze Schiff bevölkerten und weitere Wurfmaschinen zum Feuern bereit machten.
Der Wurfarm schnellte vor und mit einem lauten Knall, der durch seinen Aufschlag am Querbalken des Onagers entstand, raste ein weiteres Geschoss durch die Luft. Es flog genau auf ihn zu. Berengar Skal fluchte erneut.
Dies war das Ende. Ein Sprung zu den Planken hinab würde seinen Tod bedeuteten. Doch noch wollte er sich nicht geschlagen geben. Er riss sein Obsidianschwert aus dem Gürtel, bohrte die Klinge unterhalb des Mastkorbes in das Segel und sprang hinaus. Kaum hatte er seine Füße befreit, schlug das Geschoss in den Korb ein, zerfetzte ihn in tausend kleine Stücke und säbelte dabei die Mastspitze um. Durch seinen eigenen Schwung getrieben, prallte er auf das Segel und nur das Schwert rettete ihn vor dem Absturz. Er wollte gerade Luft holen, als die scharfe Klinge das Tuch mittig teilte und er mit hoher Geschwindigkeit dem Schiffsboden entgegen rutschte. Kurz vor den Planken blieb das Schwert in einer Querstange hängen und Berengar Skal wurde der Griff aus der Hand geprellt. Hart schlug er mit dem Rücken auf den Boden auf. Ein zweites Geschoss schrammte am Mast vorbei und zerfetzte den oberen Quermast. Splitter flogen auf das Deck und das zerschnittene Segel flatterte im Wind.
Er blickte nach oben und bemerkte die Pfeile, die auf ihn niederregneten.
Reflexartig griff er nach einem der ovalen Lederhautschilde der Wakanda, die am Fuße des Mastes lagen und hielt ihn über sich. Die Pfeile schlugen in den Schild ein, durchbohrten ihn, traten aus der Rückseite wieder heraus und blieben nur eine Fingerlänge über seinen Augen hängen. Berengar Skal stöhnte laut auf.
Die Aussichtslosigkeit seiner Lage verdrängend, warf er den Schild fort, sprang auf und stürzte nach Luft ringend hinter die schützende Wand des Heckaufbaus. Dies geschah auch keinen Augenblick zu spät. Ein erneutes Pfeifen drang zu seinen Ohren durch. Den kurz darauf folgenden Aufprall der Steinkugel spürte er in jedem Körperteil. Die Sturmbezwinger erbebte unter dem Einschlag. Diesmal richtete das Geschoss noch größeren Schaden an. Es riss ein Loch ins Deck, bahnte sich seinen Weg durch das Schiff und durchschlug den Rumpf. Wasser schäumte und gurgelte hinein und begann das Schiff zu füllen.
Der Blick Berengar Skals fiel direkt in die roten Augen eines geflügelten Geschöpfes der Urgor. Ein Labghinn schwebte über ihm. Mit seinen mächtigen Flügeln schlagend, fixierte es den Wakanda. Verzweifelt tastete Berengar Skal nach einer Waffe, doch in seinem Gürtel steckte nur ein Dolch. Enttäuscht ließ er seine Rechte sinken. Nein! Mit dieser Waffe würde er den Labghinn nicht besiegen können. Er spannte alle Muskeln an und wartete auf den Angriff des Wesens, der nicht erfolgte. Wie auf einen geheimen Befehl hin schlug das Ungeheuer heftiger mit den großen Flügeln, schlug einen Bogen, so als wollte es ihm signalisieren, dass er zum Sterben verdammt war, und schwebte, sich hoch in den Himmel schraubend, zurück zu der Flotte der Urgor.
Berengar Skal kletterte auf das Dach der Heckaufbauten, um den Schaden auf dem Deck zu begutachten. Die Bordreling war größtenteils in Trümmer geschossen worden und bot nur noch geringen Schutz gegen die Pfeile der Nachtschatten. Das Loch im Deck war riesig und Wasser sprudelte unerbittlich über die Planken. Der Bug neigte sich unter dem zusätzlichen Gewicht nach unten. Mehrere Wakanda sprangen über Bord und versuchten schwimmend die Küste zu erreichen. Die meisten seiner Männer lagen jedoch mit zerschmetterten und verstümmelten Gliedmaßen an Deck. Diejenigen unter ihnen, in denen noch Leben war, krümmten sich vor Schmerzen und schrieen so furchtbar, dass er in hilfloser Geste die Hände zu Fäusten ballte und mit seinen sterbenden Kriegern seinen Hass und seine Wut dem Feind entgegen rief. Nur ein Schiff der Urgor näherte sich der sinkenden Sturmbezwinger. Es war, als wollte es die Wakanda mit dieser Geste verhöhnen.
Rasch griff er nach einem Tau, eilte zu den Verwundeten und sein Dolch blitzte auf. Es war nur ein kurzer Schnitt, den er durchführte, aber er wollte nicht mit ansehen, wie seine Männer litten und jämmerlich ertranken. Immer wieder führte er die Klinge über eine Kehle und erntete manch dankbaren Blick. Doch er fühlte sich elend dabei. Auf diese Art sollte kein Krieger sterben. Aber er durfte auch nicht zulassen, dass sie den Nachtschatten lebend in die Hände fielen. Damit würde ihnen ein viel grauenvollerer Tod bevorstehen.
Als er keinen Verwundeten mehr fand, nahm er den blutigen Dolch zwischen die Zähne und sah sich ein letztes Mal um. Der Bug befand sich mittlerweile auf der gleichen Ebene wie das Wasser und würde in wenigen Augenblicken darunter verschwinden. Er hechtete ins Wasser, welches über ihm zusammenschlug. Mit kräftigen Zügen entfernte er sich rasch von dem sinkenden Schiff, um nicht von dem Sog mit in die Tiefe hinab gezogen zu werden. Vor ihm trieb ein Balken im Wasser. Er holte ihn zu sich heran und schob sich mit dem Oberkörper hinauf. Mit den Beinen stieß er sich dann weiter fort von der Sturmbezwinger.
Vor ihm schwammen die restlichen überlebenden Männer seines Schiffes und er bemühte sich, sie einzuholen. Die Küste war in Sichtweite und schwimmend leicht zu erreichen.
Auch schienen Raubfische diese Gewässer nicht unsicher zu machen. Er wunderte sich über das Verhalten der schwarzen Schiffe. Sie machten keine Anstalten sich ihnen zu nähern, um sie mit dem Rumpf unter Wasser zu drücken. Erleichterung breitete sich in ihm aus. Kurz darauf erfasste ihn eine unerwartete Schwere. Seine Gliedmaßen fühlten sich an, als wären sie mit Blei gefüllt. War er inzwischen so erschöpft, dass er nicht bemerkt hatte, wie viel Kraft er verloren hatte? Sicher hatte der Kampf ihn ermüdet. Doch als er den Kopf zu drehen versuchte, fühlte er, dass auch dies ihm Schwierigkeiten bereitete. Aus den Augenwinkeln sah er eine dunkel gekleidete Gestalt mit ausgebreiteten Armen in der Ferne auf dem Bug eines der schwarzen Schiffe stehen. Jäh durchfuhr ihn eine schreckliche Erkenntnis. Die finstere Gestalt war ein Zauberer der Urgor, ein Nachtschattenlord.
Mit einem Schlag spürte er die grauenvolle Wahrheit über sein anstehendes Schicksal. Es war keine Erschöpfung, die ihn erfasst hatte, sondern eine Lähmung. Seine Beine wurden steif und auch seine Arme ließen sich nicht mehr bewegen. Den Kopf konnte er nur noch nach vorne richten und dann lag er steif wie das Stück Holz, auf dem er lag, im Wasser. Entsetzt musste er miterleben, wie seine Männer, ebenfalls von der Lähmung erfasst, einer nach dem anderen hilflos im Meer versanken.
Das furchtbare Gefühl, versagt zu haben, flutete durch seinen Körper. Nur er allein trieb noch über den Wellen. Jetzt war auch Skiluros verloren und damit die letzte Hoffnung der Menschen auf Rettung vor den Urgor. Er verfluchte sich dafür, dass er auf das Geheimnis der Nachtschatten gestoßen war. Ein Geheimnis, von dem die Bewohner von Skiluros nichts ahnten. Ein Geheimnis, das seit vielen Sommern in den Tiefen der Stadt, die ihr Ziel gewesen war, im Verborgenen lag. In Skiluros lauerte etwas, dass die Urgor in die alte Kaiserstadt trieb. Etwas, dass sie um jeden Preis in ihren Besitz bringen wollten und sie noch mächtiger machen würde. Und er war wahrscheinlich der letzte Mensch, der das Wissen darüber besaß. Aus diesem Grund jagten sie ihn. Sie wollten unter allen Umständen verhindern, dass er Skiluros erreichte und die Bewohner der Stadt vor ihrem bevorstehenden Schicksal warnte.
Dann geschah es. Er rutschte von dem nassen Balken. Der Dolch fiel aus seinem geöffneten Mund. Er wollte aufschreien, aber seine Stimme gab keinen Ton von sich. Voller Angst versuchte er die Finger zu krümmen, aber sie versagten ihm den Dienst und mit Tränen im Gesicht glitt er ins Wasser. Das Letzte, was er wahrnahm, bevor die Dunkelheit ihm das Bewusstsein raubte, waren die dicht stehenden Pflanzen an der Küste. Berengar Skal starb vor dem Kap der guten Wünsche mit dem Wissen, beobachtet von den rot glühenden Augen des Urgorlords, dass er nicht mehr einen Fuß auf die Erde Amarnas setzen würde.
1.
Ein Schatten glitt über das trockene Gras des Hochlandes. Unter dem wolkenlosen Himmel, der im Westen in einer jähen Röte aufflammte, folgte ihm ein einsamer Reiter. Gemächlich trabte der Wahendawallach dahin. Nach einem langen Blick zurück über die eintönige Hochlandsteppe, die ihn mehrere Tagesritte gekostet hatte, trieb er sein Pferd mit einem aufmunternden Schnalzen einen sanft ansteigenden Hang hoch.
Als er den höchsten Punkt des fast kahlen Hügels erreicht hatte, der wie tausend andere seinesgleichen, gleichförmig, wie die Wellen eines bewegten Meeres, das weite Grasland bedeckte, zügelte er sein erschöpftes Tier. Die schwarzen Augen des Kriegers, die in einem vom Staub langer Tagesritte und durchwachter Nächte gezeichneten Antlitz tief verborgen lagen, suchten aufmerksam die Umgebung ab. Es war ein heißer Sommerabend. Der Gutanikrieger, der etwas über dreißig Sommer zählen mochte, schien mit seinem mächtigen Reittier wie verwachsen. Beide zusammen ergaben auf der Erhebung für einen kurzen Augenblick ein eindrucksvolles Standbild kriegerischen Stolzes und unbeugsamen Willens ab.
Vor ihm erstreckte sich ein Gebirgszug, der sich vom Inneren des Landes bis hin zum Meer erstreckte und an dem das Grasland endete. Im Licht der Nachmittagssonne erhoben sich vor den schroffen Gipfeln und Felsgraten der Berge die mächtigen Türme und weiße Mauern auf einer einsamen Höhe. Die dicht mit Häusern, Tempeln und Palästen bedeckten Hänge erstreckten sich innerhalb der Stadtmauern bis zu den Hafenanlagen am Meer.
Er tätschelte dem Braunen mit einem gutmütigen Brummen den schweißnassen Hals. Weißer Schaum flockte um das Maul des Tieres.
„Ruhig, Alter!“ Der raue Tonfall in der Stimme des Mannes stand ganz im Gegensatz zu dem sanftem Schnauben seines Pferdes.
„Dort liegt Skiluros, die Krone der Welt, deren Glanz schon lange verblasst ist. Aber heute werde ich endlich wieder auf einem weichen Lager schlafen und von dem roten Masuvier zum Goldenen Gai-Taran kosten. Und du, mein Freund, du wirst feinen Hafer bekommen!“
Als er auf die Stadt an dem Ufer des Weltuntergangsmeeres zuritt, verloren sich seine Gedanken an vor Fett triefende Hammelkeulen, warmes Brot und riesige Krüge voll des herben Roten, für den die Bauern des Hinterlandes der Stadt berühmt waren.
Viele Tagesritte trennten Gainas von der östlichen Grenze des Hochlandes und den blutigen Schlachtfeldern an der tungarischen Pforte, wo er zusammen mit seinen Schwertbrüdern, Schulter an Schulter gegen die anstürmenden Scharen der Pferdegeborenen gekämpft hatte. An allen östlichen Grenzmarken des Reiches der Ah’tain waren die unzählbaren Krieger der Steppe aus der aufgehenden Sonne gekommen. Er hatte in dem kniehohen Gras gestanden und sein Schwert kreisen lassen. Wieder und wieder hatte er die Schädel seiner Feinde gespalten, bis seine Arme schwer wie Blei herab gehangen hatten. Als die Schlacht endlich vorbei gewesen war, hatte nur noch Hoffnungslosigkeit in seinen Augen gestanden. Was von dem Heer der Aufständischen nach diesem Tag noch lebte, war geflohen. Aber Gainas wusste, das war erst der Beginn eines langen Krieges. Es gab in Vanland noch zahlreiche Stämme der Pferdegeborenen, die nicht bereit waren, sich den Ah’tain zu unterwerfen.
Auch auf den Seiten der Ah’tain und ihrer Verbündeten war der Blutzoll hoch ausgefallen. Mann für Mann hatten die Krieger der Gutani den Tod gefunden, die zusammen mit Gainas von Halgaland bis hin zu diesen Schlachtfeldern des Todes geritten waren. Nach fünf blutigen Sommern, in denen er und seine Gefährten, Uldin Skeidh, dem Herrscher der Ah’tain zur Heeresfolge verpflichtet, dem Tod ins Auge gesehen hatten, war er allein übrig geblieben.
Seine dichte, schwarze Mähne, die zu einem Zopf geflochten seinen breiten Rücken zierte, verstärkte den Gegensatz zu seinen bleichen Gesichtszügen, die scheinbar von der Sonne gemieden wurden. Die hohe Stirn, die leicht hervortretenden Wangenknochen, der schmallippige Mund und das kantige Kinn vermittelten ruhige Entschlossenheit und Härte. Eine wache, fast gefährlich wirkende Intelligenz blitzte aus der Tiefe der nachtschwarzen Augen hervor. Wenn nicht die fast fingerbreite, blutrote Narbe gewesen wäre, die sich vom Haaransatz über dem rechten Auge bis zum Kinn hin erstreckte, hätte man dieses Gesicht in seiner herben Männlichkeit fast schön nennen können.
Seine vom Kampf gestählte Gestalt, deren eisenharten Muskeln von einem einfachen Lederharnisch verborgen wurden, entsprach nicht so ganz dem Aussehen seines Volkes. Die Gutani stammten zwar von derselben Rasse ab wie die Ah’tain, waren aber grobknochiger und hagerer gebaut. Ihre Haarfarbe reichte von dunkelblond bis rothaarig.
Wie viele andere Stämme und Völker des Graslandes waren sie den Ah’tain unterlegen. In der Zeit der großen Wanderungen hatten sich um die Ah'tain zahlreiche Angehörige fremder Stämme versammelt. Ob Ausgestoßene, Geächtete, Unfreie oder Sklaven war für sie nebensächlich. Durch die Aufnahme in die Reihen der Ah’tain wurden sie frei und geadelt. Aus ihnen erwuchsen neue Gefolgschaften, weitere Uriadhs wurden geboren. Wer sich den Ah'tain anschloss, begann ein neues Leben. Eine Vergangenheit hatte er nicht mehr.
Das Heerkönigtum der Ah’tain hatte bisher viele Rückschläge und Katastrophen überlebt. Viele aus dem Geschlecht Meadhons hatten sich immer wieder als würdige Nachfolger von Göttern und Heroen zu bewähren. So auch Uldin Skeidh, der unaufhaltsam sein Reich ausdehnte. Erst mit der Eroberung von Skiluros, der alten Hauptstadt des Imperiums, war offenbar der Hunger des Herrschers der Ah’tain, der schon fast neunzig Winter gesehen hatte, nach Land und Lebensraum für seine zahlreichen Stämme gestillt.
So kämpften die Gutani für den Traum eines Mannes, der nicht der ihre war. Sie hatten das unstete Leben eines Nomadenvolkes aufgegeben und waren sesshaft geworden. Angezogen von den Errungenschaften der hochzivilisierten Stadtstaaten hatten sie sich an den Küsten des turianischen Hochlandes in Halgaland niedergelassen, einem durch Seen und Sümpfe geprägten fruchtbaren Gebiet, viele Tagesritte nordöstlich von Skiluros. Als Gainas vor fünf Sommern die Ringgabe aus den Händen des Skeidh empfangen und Treue und Gefolgschaft geschworen hatte, war er, wie so viele seines Stammes vor ihm, voller Stolz gewesen, endlich das gleichförmige und ereignislose Leben in Halgaland mit dem eines Gefolgsmannes unter dem Banner des Kriegsherrn der Steppe tauschen zu können.
Er war Seite an Seite mit den goldhaarigen Söhnen der Ah’tain geritten. Mit Männern wie Ardarich und Hisarna, die für ihren Herrscher vor der Festung Mort Skapjon die schwarzen Krieger der Wakanda besiegt hatten. Er war in die Kriege mit Dayra, der letzten Königin des Singenden Landes, gezogen, und er hatte mit den Männern Chelchals die Mauern von Tyras erstürmt. Er war mit den grauen Kriegern Wulfhers gegen die heißblütigen Südländer geritten und unter seiner Klinge waren die Reiter von Tuman-Khand gefallen wie Grashalme unter der Sense des Schnitters. Er war einer der ihren geworden, ein Schwertherr unter dem Zeichen des Raben.
Die Lebensspanne eines Schwertherren aus dem Blute Ah’tains war lang. Länger als die eines gewöhnlichen Menschen. Hundert Sommer waren keine Seltenheit unter den Kriegern, die unter dem Fluch des Schwertes ritten. Nur wenige Tausendschaften zählten die Ah’tain, aber die Männer, die in den Sommern ihrer Jugend diese harte Auslese überlebten, sich stählten in den Stürmen der Jagden und Schlachten, reiften schlussendlich zum Adel der Steppe. Mit diesen erfahrenen Kriegern, die zwischen vierzig und achtzig Sommer zählten, war es dem kleinen Stamm der Ah’tain gelungen, in den Jahrhunderten der endlosen Gemetzel zu überleben und mit Uldin Skeidh das mächtigste Reich zwischen den Stadtstaaten des Westens, den von Eis gekrönten Bergen Vanlands und den östlichen Marken der Steppe zu errichten. Sie waren der kämpfende Stamm der Waranag, der Kern des Volkes unter dem Zeichen des Raben. Wo immer ihre gepanzerten Scharen zuschlugen, floss das Blut in Strömen und Männer verloren ihr Leben.
Gainas hatte des Lebens Bitterkeit und Süße bis zur Neige genossen. Wein und willige Weiber hatte es genug gegeben und die Ringe roten Goldes waren wie Wasser unter seinen Händen zerronnen. In unzähligen Kämpfen hatte er sein Schwert geschwungen, in unzähligen Schlachten sein Blut vergossen. Voller Unrast und nie gestillter Gier war er über die Schlachtfelder dieser Welt gezogen. Ein grimmiger Krieger, der die Härte des Lebens und den Tod nicht fürchtete. Mehr als fünf Sommer und fünf Winter, in denen er die Einsamkeit seiner Tage verflucht und Durga, die Göttin seiner Väter, vergeblich um ein ruhmreiches Ende gebeten hatte. Seit Gainas auf das Schwert der Macht geschworen hatte, seit dieser Stunde fühlte er, wie nahe er dem Tod sein konnte. So war er dem Ruf gefolgt, der ihm sein Schicksal weisen würde. Er hatte an Ellak, Uldins Heerführer in den östlichen Marken, blutige Rache für den Verrat an seinen letzten Männern genommen. Dann, als er den Blutmond, den zweiten Mond der Ah’tain in der Nacht nach dieser Tat erblickt hatte, war er nach Westen geritten.
An seinem abgehärteten Körper gingen die weiten Ritte unter der sengenden Steppensonne fast ebenso spurlos vorüber, wie die endlosen Kämpfe unter dem Rabenbanner des Ah’tainherrschers. Weder Krankheit, noch Wunden hatten ihn auf das Lager geworfen und ungebrochen war die Kraft seiner Arme.
Mit einem leisen Schnalzen setzte er den Braunen wieder in Bewegung, den Hang hinab zu den uralten Mauern der alten Hafenstadt.
Der Lärm und der Gestank von Skiluros trafen Gainas wie ein Hammerschlag, als er mit dem nicht enden wollenden Strom der Händler und Bauern, Söldnern und Angehörigen der Stämme des Graslandes und dem Gesindel, das solch ein Ort immer anzuziehen schien, durch das weit offene Tor in die Stadt ritt.
Skiluros war schon immer der Schmelztiegel des Hochlandes gewesen. Eine uralte Stadt, erbaut noch in den Tagen, da die ersten Raubschiffe der alten Halfarer am Horizont aufgetaucht waren; als die Stämme der Wakanda noch stark gewesen und die Lanzenreiter Tuman-Khands von den Wüsten Salms über das Auge der Welt geboten hatten. Gainas trieb seinen Braunen durch die engen Gassen der Unterstadt, vorbei an Marktständen, die von schreienden Menschen belagert wurden. Vorbei an Tavernen, aus denen der Lärm der Betrunkenen drang, an wimmernden Bettlern, die mit verstümmelten Gliedmaßen am Straßenrand in ihrem eigenen Kot kauerten und an zahllosen Horden schmutziger, diebischer Kinder und Halbwüchsiger, deren Gesichter das Elend eines viel zu kurzen Lebens in sich trugen.
Der Geruch von altem Bratenfett, verfaulten Lebensmitteln, scharfen Gewürzen und schweren exotischen Düften, die Ausscheidungen von Mensch und Tier und der Schweiß, den die Menge verströmte, fand ihren Weg in die Nase des Gutani, der an die reine Luft des Graslandes gewöhnt war. Angewidert von dem Gestank verzog er seinen Mund und spuckte aus. Angehörige der reichen Oberschicht, Kaufleute, Handelsherren und Gutsbesitzer, schoben sich, begleitet von ihren Leibwachen und angeheuerten Söldnern, durch die Menge. Sänften, die von tiefschwarzen Wakanda getragen wurden und in denen glutäugige, verschleierte Schönheiten durch seidene Tücher neugierig hervorblickten, schwankten durch die engen Gassen. Auch Angehörige der Gear, eines Stammes des Hornvolkes, schritten, die nackten Schultern mit Umhängen aus Menschenhaut bedeckt und die Schwerthand an sensenartigen Klingen, mit verhaltener Ruhe durch den Lärm. Hin und wieder warfen die Gear mit ihren schwarz umrandeten Augen feindselige Blicke auf in braunes Leder und Wolle gekleidete Krieger der Waranag, die mit Khorfleisch und kunstvoll punzierten Lederarbeiten handelten. Doch auch die räuberischen Gear mussten hier den Frieden wahren und sich den Herren der Stadt beugen.
In kurzen Abständen ritt Gainas an den stummen Wachen der Ah’tain vorbei, die fast bewegungslos in der Abendsonne in ihren Kettenhemden verharrten, Kriegsspeere und lange Schwerter in den schwieligen Händen haltend. Ihre grauäugigen Gesichter unter den mit rotem Rosshaar geschmückten Spangenhelmen hoben sich kaum, als der Gutani vorüber ritt. Die unverhüllte Arroganz der neuen Gebieter von Skiluros stand der des Schwertherrn, auch wenn er in Wirklichkeit ein Gutani war, nicht nach.
Noch waren Gutani und Ah’tain Verbündete. Gainas hatte den aufopferungsvollen Mut dieser gnadenlosen Krieger in den Kämpfen gegen die Horden der Windreiter kennen und schätzen gelernt. Mehr als einmal hatte das Langschwert eines Ah’tain sein Leben gerettet. Er lächelte unwillkürlich. Ein Leben, dessen er schon längst überdrüssig geworden war.
Als die Gassen immer schmaler wurden und die Menge sich immer dichter zusammendrängte, stieg der Gutani vom Pferd und führte den Braunen, eng am Zügel, hinter sich her. Gainas trug die einfache Kleidung der Pferdegeborenen, der reitenden Völker der Steppe. Lederne Beinkleider und Stiefel aus gekochtem Khorleder und über einem wollenen Wams einen Harnisch, ebenfalls aus Leder gefertigt und mit aufgenähten Eisenringen versehen. Das schwere Kettenhemd, eine kostbare Arbeit der schmiedekundigen Dalapa in den Bergen Brutheims und der eiserne Spangenhelm hingen, gehüllt in den schwarzen Kriegsmantel eines Schwertherren, als klirrendes, schwankendes Bündel am Sattel. Zusammen mit dem Langschwert, das an seiner Linken in einer einfachen Lederscheide fast bis zum Boden baumelte und den Sneidas an seinem breiten Gürtel, den unvermeidlichen Wurfmessern der Pferdegeborenen, war dies seine ganze Habe – und der Beutel voller Gold- und Silbermünzen, auf dem seine Rechte schützend ruhte. Auch ohne die Rüstung war der hochgewachsene, narbengesichtige Gutani eine beeindruckende Erscheinung und die Menge teilte sich vor dem breitschultrigen Krieger mit den schwarzen Augen wie Wasser vor dem Bug eines Schiffes.
Mit den letzten Strahlen der untergehenden Sonne schob sich Gainas durch das laute Treiben des Hafenviertels unterhalb der eigentlichen Stadt und beachtete weder das Keifen der gewöhnlichen Marktweiber, die ihre kümmerliche Ware mit schriller Stimme anpriesen, noch das gewohnte Jammergeschrei der wild mit ihren Händen gestikulierenden Kaufleute. Plötzlich blieben seine Blicke an dem Stand eines alten salmitischen Händlers hängen. Auf einem Tisch aus krummen Holzlatten lagen Waffen aller Art in einem wirren Haufen verstreut. Eine schwankende Konstruktion aus Brettern und Stangen, über die sich ein zerfetztes Dach aus brüchigem Leder breitete, schützte Mann und Ware nur mangelhaft vor Sonne und Regen. Die schwarzen, stechenden Augen, in dem von Hitze und Wind verwüsteten Gesicht des Salmiten, begannen zu glühen, als sie die bleichen, feingliedrigen Hände von Gainas gedankenverloren über die angebotenen Klingen streichen sahen. An dem Blatt eines seltsam gekrümmten Dolchs blieb der Blick des Gutani hängen. Die ellenlange Klinge erinnerte ihn an die sensenartigen Waffen der Gear, aber diese hier verlängerte sich nach vorne hin wie zu einer Hundeschnauze und die Schneide am Ende lief in einer grausamen, leicht nach innen gebogenen, nadelscharfen Spitze aus. Die Klinge schimmerte matt in einem kranken Rot. Eine perfekte Waffe um einen Körper auszuweiden, erschauerte Gainas. Er betrachtete das schwarze Heft des Dolches genauer. Es war aus einem Holz gefertigt, wie er es noch nie zuvor gesehen hatte, und dicht mit rubinroten Metallstreifen beschlagen. Den Knauf krönte ein blasser, milchfarbener Stein. Etwas Fremdes und nicht fassbar Schreckliches ging von dieser Waffe aus, doch auch etwas Geheimnisvolles und Anziehendes. Gainas war der Waffe seit der ersten, tastenden Berührung verfallen.
Der Händler bemerkte mit Genugtuung den verräterisch verlangenden Blick in den schwarzen Augen des Kriegers.
„Ich sehe, Ihr versteht etwas von Waffen, Herr!“ Die Stimme des Alten klang weich und unterwürfig. „Für einen Krieger wie Ihr es seid, ist sie sicher die Richtige.“
Der untersetzte Salmite, der seine besten Jahre schon lange hinter sich hatte, musterte den Gutanikrieger mit gierigen Blicken. Aber Gainas hatte nur Augen für den seltsam geformten Dolch.
„Woher habt Ihr sie?“
In den schwarzen Pupillen des Händlers flackerte kurz etwas wie Irrsinn auf, als er mit ansah, wie Gainas mit einer kurzen Bewegung des Daumens die Schärfe der Klinge prüfte. Rotes Blut quoll sofort aus dem Daumen und färbte das Blatt der Klinge noch dunkler. Feiner Rauch stieg auf. Gainas stutzte. Spielten ihm seine Sinne einen Streich? Nachdenklich musterte er die fremdartigen Schriftzeichen, die auf dem Blatt der geschwungenen Klinge eingeritzt waren.
„Sie soll einst einem mächtigen Krieger gehört haben“, erklärte der Händler ausweichend. „Man sagt sich, dass der Dolch seinem Besitzer Unglück bringt, da er in dem Blut von Menschen gehärtet wurde. Doch dies ist blanker Unsinn, versichere ich Euch. Ich habe sie von einem verarmten Edelmann erhalten, der im Rausch des Weines seine Frau erschlagen haben soll. Und daran wird der Dolch kaum Schuld getragen haben, sondern nur die Sauflust des Mannes.“
Nachdenklich legte Gainas die Waffe wieder zurück. „Wie viel?“, brummte er ungnädig.
Der Alte murmelte etwas in seinen dünnen, ausgefransten Bart. Speichel lief ihm über den zuckenden Mund.
Der Gutani überlegte nicht lange.
„Einverstanden!“ Gainas warf dem Händler, ohne lange verhandeln zu wollen, eine Goldmünze zu. „Dies wird reichen. Ich nehme den Dolch.“
Ohne zu Zögern überließ der Alte die Waffe Gainas. Offenbar schien er froh zu sein, einen Käufer gefunden zu haben. Aber darüber machte Gainas sich keine weiteren Gedanken, denn als sich das schwarze Heft in seine Hand schmiegte, erfüllte ihn ein solches Gefühl der Befriedigung und Stärke, wie er es noch nie in seinem langen Leben kennen gelernt hatte. Mit dem Dolch an der Hüfte setzte er zielstrebig seinen Weg fort.
Nur wenige Fackeln erhellten die Straßen und Plätze vor den zahlreichen Schenken und Garküchen des Hafenviertels; denn die Leuchtsteine, für die Skiluros berühmt war, blieben den Vierteln der Reichen und Mächtigen in der Oberstadt vorbehalten. Um die Öllampen vor den Häusern, Lagerhallen und Kontoren der Händler, hatten sich, seit der Besetzung durch die Schwertherren der Ah’tain vor sechs Sommern, keine der schlecht entlohnten Hafenwachen mehr gekümmert; genauso wenig wie um die Ordnung und Sicherheit dieses Viertels, zumindest des Nachts. Eher machten sie noch mit den Dieben und Mördern gemeinsame Sache und ließen sich mit schlechten Münzen bestechen.
Tagsüber sorgten die Wachen der Ah’tain, im Interesse des ungestörten Handels, für die Sicherheit der Kaufleute und Kunden, aber die Nacht gehörte den skilurischen Halsabschneidern und den Halunken aus einem Dutzend verschiedener Nationen. Nachts war der Abschaum des Hafens unter sich und die Kämpfe der rivalisierenden Banden um Gold, Dirnen, Reviere und gekränkte Ehre hinterließen allzu oft ihre Spuren in den übel riechenden und von Unrat übersäten Gassen und Plätzen.
Im Schein einer einsamen Fackel nahm er im letzten Moment einen Stein war, der auf seinen ungeschützten Kopf zuflog. Hastig duckte er sich und das Geschoss schlug dumpf in den weichen Lehm einer gerade verputzten Hauswand ein. Die Hand von Gainas fuhr zum Schwert und als seine harten Augen die Dämmerung durchforschten, sah er nur noch nackte Füße unter einem zerrissenen Kittel blitzschnell im Dunkel verschwinden.
„Halbwüchsiges Gesindel!“ fluchte er leise. Sollte der Aufruhr der Bevölkerung, der sich in Windeseile in der Stadt gegen die herrschenden Ah’tain ausgebreitet hatte, neue Nahrung gefunden haben? Diesen Menschen konnte es doch gleich sein wer in Skiluros herrschte. Abgaben leisten mussten sie so oder so, und unter der Herrschaft Uldin Skeidhs hatte sich ihre Lage sichtlich verbessert. Die Zeit der imperialen Blutsauger und Ausbeuter, der Archonten, Handelsherren und Senatoren alten Adels, war mit der Eroberung durch die Reiter der Steppe nur noch Vergangenheit.
Aber die Skilurer empfanden dies anders. Sehr schnell hatte sich die Bevölkerung an die Wohltaten und die noch nie gekannte Freiheit gewöhnt, die unter den neuen Herren ihren Einzug gehalten hatte. Zu schnell, denn in den Köpfen der einfachen Menschen verklärte sich jetzt das einst beschwerliche Leben unter der Herrschaft des Kaiser und seiner Archonten zu einem goldenen Zeitalter.
Gainas umfasste den Schwertgriff fester. Ungeachtet der taumelnden Betrunkenen und Beutelschneider bahnte er sich mit gelegentlichen wohlgezielten Schlägen und Kopfnüssen seinen Weg. Endlich erreichte er wieder eine etwas ruhigere Seitengasse und hielt auf eine heruntergekommene Schenke zu, deren Schild am Eingang die unbeholfene Malerarbeit eines goldenen Gai-Taran darbot. Dieser gefährlichste Räuber der Steppe jagte in den südlichen Ausläufern Brutheims und den weiten Ebenen des Graslandes. Es war ein mannshoher, flugunfähiger Raubvogel mit einem mächtigen, bis zu zwei Ellen messenden langen Kopf mit stark gebogenen Schnabel, wild, gefährlich und unzähmbar. Eine Haut, so dick und hart wie Nashornleder, die mit einem kurzen Flaum bedeckt war und die fast kein Stahl zu durchdringen vermochte, schützte ihn und die mächtigen säulenartigen Beine. Mit den messerscharfen Krallen an den drei Zehen entwickelte er eine überraschende Schnelligkeit und das machte ihn zu einem unberechenbaren Gegner. Nur wenige Tapfere überlebten die Begegnung mit dem Gai-Taran, dem großen Zerstörer und Allesfresser, dessen kleine Augen mit unsagbarer tückischer Grausamkeit von den Gipfeln Brutheims herabblickten.
Geschmeidig stieg Gainas vom Pferd und warf einem schnell herbeigelaufenen Stallburschen drei Kupferstücke zu.
„Behandle ihn gut, mein Junge. Mein Brauner verdient den besten Hafer. Reibe ihn gut ab und gib ihm Wasser. Ich werde später nach ihm sehen.“
Der Stallbursche nickte, biss mit seinen schon verfaulten Zähnen auf den Geldstücken herum und ging dann zufrieden grinsend mit dem Pferd davon.
Gainas wollte kein Aufsehen erregen. Daher hatte er beschlossen, sich in den Vierteln der Stadt aufzuhalten, in die sich die Ah’tain nur selten wagten. Er warf sich den schlichten Kapuzenmantel über, den er hinter den Sattel seines Pferdes geschnallt hatte. Dann nahm er das Schwert in die Rechte und warf das Bündel mit seinen Habseligkeiten über die Schulter, ehe er entschlossen die Schenke betrat. Als er durch die offene Tür trat, schlug ihm der unvermeidliche Gestank ungewaschener Leiber entgegen und raubte ihm fast die Sinne. Der Goldene Gai-Taran war eine heruntergekommene Schenke, die direkt an den Hafenmolen lag. Der Dunst von billigem Wein und dünnem Bier hing als schwere und undurchdringliche Wolke in dem großen, niedrigen Raum. Raue Männerstimmen grölten Lieder. Frauen kreischten und lachten. Das rhythmische Hämmern von Fäusten und Dolchknäufen auf Bänke und Tische vermischte sich mit dem Klirren der Krüge und Becher und dem Knurren der Wolfshunde, die sich auf dem von Unrat übersäten, mit fauligem Stroh bestreuten Boden um Knochen und Fleischabfälle balgten.
Gainas bemerkte, wie der Wirt schwitzende Schankmaiden mit Getränken an die Tische schickte. Junge Dinger, spärlich bekleidet, bewegten sich zwischen den Tischen lasziv drehend und windend zu den Klängen der Musik.
Als Gainas nach einem ungestörten Platz suchte, winkte ihn ein Mann in mittleren Jahren zu sich an einen Tisch, der unweit der riesigen Bier- und Weinfässer des Wirtes etwas abseits stand und den Vorteil einer schützenden Wand besaß.
Der Skilurer musste sofort, nachdem Gainas die Schenke betreten hatte, bemerkt haben, dass etwas mit ihm nicht stimmen konnte. Aufgrund der scharfen Musterung nahm Gainas zuerst an, dass es sich bei dem Mann um einen heruntergekommenen Kaufmann handelte, aber als er näher kam, berichtigte er seine Vermutung. Dieser Mann war nie als Händler tätig gewesen. Er war auch nicht einer der zahlreichen Halsabschneider des Hafenviertels, die ihn abschätzend musterten, um zu prüfen, ob er ein lohnendes Opfer darstellte.
Gainas wusste, dass seine zerrissenen Ledersandalen und das dreckige Haupthaar, das unter dem fast alles verhüllenden Mantel ein wenig hervorlugte, irgendwie nicht zu seiner geschmeidigen Gestalt mit den breiten Schultern passten.
„Bei den stinkenden Eingeweiden Uldins, setz dich, Fremder!“, rief der Skilurer ihm zu und verlangte nach einem neuen Krug Wein. „Ich bin Kraton und trinke nicht gerne allein. So wie du aussiehst, benötigst du dringend einen guten Schluck.“
Ohne auf die fast beleidigend wirkenden Worte des Mannes einzugehen, legte Gainas sein Bündel auf einem leeren Hocker nieder und setzte sich, die schlecht verputzte Lehmwand im Rücken, kurz entschlossen auf einen der wackeligen Stühle neben Kraton. Er schlug die Kapuze zurück und betrachtete das Treiben in der Schenke. Die zahlreichen Gäste wechselten kurz einen Blick mit dem fremden Riesen und wandten sich dann wieder ihren Bechern zu. Neben den Gaunern, Zuhältern und Halsabschneidern, erkannte er Taschendiebe aus Skiluros und bullige Schlägertypen aus der Chora, dem Hinterland der alten Stadt, die sich ausschließlich ihren eigenen Geschäften widmeten.
Die Mehrheit aber stellten Söldner und wettergegerbte Seeleute aus allen Häfen der Küste, die über und über mit fremdartigen Tätowierungen übersät waren. Rothaarige, hünenhafte Halfarer, tranken Schulter an Schulter mit geckenhaft gekleideten Männern aus Kor-Bash, die ihre Dolche ebenso offen zur Schau stellten, wie ihre Geldbörsen. Daneben umarmten blonde, barbarische Batarna, die ihre mächtigen Breitschwerter nicht aus den Augen ließen, schlanke, glutäugige Schönheiten, denen das Blut heiß in den Adern floss.
In einer der Ecken saß verschwörerisch flüsternd eine Gruppe hagerer salmitischer Wüstenbewohner. Gehüllt in schimmernde Schuppenpanzer warfen sie Gainas misstrauische Blicke aus schwarzen, stechenden Augen zu.
Doch sie verloren schnell das Interesse an ihm und wandten sich brummend wieder dem Wein und den Tänzerinnen zu, und den olivhäutigen Kauffahrern aus Terbala, die ihre langen, braunen Haare zu kunstvollen Knoten gewunden hatten.
„Gainas! Bei den Schwanzfedern des Raben!“
Der Wirt, untersetzt und dickleibig, füllte drei Krüge aus einem der Fässer und brachte sie an den mit vielen Rissen und Kerben überzogenen Tisch.
„Arus, du verlauste Ratte. Haben dich deine Frauen noch nicht ins Grab gebracht?“ erwiderte Gainas. Nur der schnelle Griff zum Schwertheft ließ ahnen, dass er von der unerwarteten Anrede kurz überrascht worden war.
„Es tut gut, dich wieder zu sehen, alter Freund!“ Arus strich sich über sein kahl werdendes Haupt und wischte sich den Schweiß ab. Der Wirt des Goldenen Gai-Taran war ein Halani, Angehöriger eines Stammes des Geistervolkes. Einst hatte er mit seinen Gefährten an den Küsten der Halbinsel Raubzüge unternommen, bis er an den Resten der skilurischen Zivilisation Gefallen gefunden und seine Klinge an die Archonten der Stadtstaaten verkauft hatte. Das Glück war ihm jedoch nicht hold gewesen und so war er nach vielen Jahren in dieser elenden Spelunke gelandet. Aber er hatte ein Herz aus Gold und Gainas kannte ihn als einen Mann, der noch immer sein Wort gehalten hatte.
„Ihr kennt euch von früher?“ fragte Kraton den Wirt, und das listige Gesicht des Mannes grinste in erwartungsvoller Vorfreude.
Schnaufend wischte sich der übergewichtige Wirt, der schon an die sechzig Sommer zählen mochte, mit einem schmutzigen Lappen über die spiegelblanke Glatze.
„Ja, wir kennen uns und es ist eine lange Geschichte. Für einen Abend zu lang.“
Gainas nickte. „Außerdem sollte man manche Dinge besser dem Vergessen anheimfallen lassen.“ Er grinste Arus an. „Und im Augenblick habe ich nur deinen Wein im Sinn.“
„Ein wahres Wort und in diesen Zeiten die einzige Freude, die uns bleibt“, stimmte Kraton zu und hob den Krug.
„Ich brauche ein Zimmer für die Nacht, Arus. Mein Brauner steht schon im Stall. Ich werde endlich in meine Heimat zurückkehren, nach Halgaland. Hernak, mein Oheim, sucht Männer mit Eisen im Blut und vielleicht, wenn ich mich nicht zu kriegsmüde fühle …“
„Du wirst niemals finden, was du suchst, Gainas. Was immer es sein mag. Ich kenne dich. Du warst schon immer ruhelos wie ein einsamer Wolf und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.“
Gainas lachte heiser auf. „Die Zukunft...?!“
„Die Zukunft eines Mannes, der unter dem Schwur des Schwertes der Macht steht, Gainas. Oder hast du das auch vergessen?“
Nachdenklich blickte der Krieger in seinen Becher. Dann verzogen sie seine schmalen Lippen zu einem traurigen Lächeln. „Ein verlauster Halani muss mich nicht an meine Versprechen erinnern. Aber seit Uldin Skeidh Boten aussandte, um Eide mit den westlichen Stämmen der Windreiter zu tauschen, bin ich niemanden mehr etwas schuldig.“
Der Wirt nickte. „Ganz der Alte. Ich bringe dir etwas zu essen und dann reden und trinken wir. Von den alten Zeiten, Gainas?“
„Vergiss die alten Zeiten, Arus“, warf Kraton ein und trank seinen Becher in einem so schnellen Zug leer, dass ihm der rote Wein wie Blut über Kinn und Brust rann. „Wir leben heute und müssen uns mit den Ah’tain herumärgern. Die scheren sich einen Dreck um die alten Gesetze. Erst haben sie die Leibwache des Archonten über die Klinge springen lassen, und dann hat Uldin Skeidh eigenhändig den Stirnreif des Herrschers den Senatoren vor die Füße geworfen und Pferdeställe aus den Palästen des Canopus und seiner Anhänger gemacht. Ich habe nichts gegen deine Barbaren. Aber frei sind wir nicht, solange die Ah’tain über die Stadt herrschen.“
Selbstzufrieden blickte Kraton in die Runde. Als keiner der Beiden Anstalten machte, das Wort zu ergreifen, wandte sich Kraton sichtlich genervt an Gainas.
„Und du mein schweigsamer, Freund...? Was führt dich in unsere alte glorreiche Stadt. Ich habe dich hier noch nie gesehen...“
Arus wischte sich wieder mit dem schmutzigen und fetten Lappen über die schwitzende Glatze. „Natürlich kennst du ihn nicht, Kraton. Er war schließlich seit mehr als fünf Sommern nicht mehr hier …“
Plötzlich umklammerte eine eiserne Faust die Rechte des Wirtes. Erschrocken über seine Unachtsamkeit blickte Arus in die stählernen Augen des Gutani.
Er seufzte tief und sagte: „Lass nur Gainas, Kraton kannst du wirklich vertrauen. Er mag zwar nicht der ehrlichste Mann unter der Sonne sein und irgendwann seinen Hals nicht mehr aus der Schlinge der Obrigkeit ziehen können, wenn sie ihn bei einer seiner Gaunereien erwischen sollte, aber ich kenne keinen, der verschwiegener ist!“
Gainas hätte gleich erkennen müssen, dass sich hinter der Maske des Händlers im Grunde nur ein Dieb verbarg. Ein Dieb, der dennoch eine größere Bedeutung in dem Kreis des Abschaums dieser Stadt besitzen musste.
„Ich habe gehört, dass Uldin Skeidh dich sucht“, sagte Arus. „Er hat dir den versuchten Mord an Ellak nicht verziehen. Was ist passiert, Gainas? Du hattest alles und …“
„Manchmal muss man eine schwere Entscheidung treffen, Arus. Es ist vorbei, unwiederbringlich vorbei. Und was Uldin Skeidh angeht? Er hatte meine Treue und opferte sie für einen Sieg, als er die Gutani in der Schlacht im Stich ließ und mit seinen Reitern über die Flanken gegen die Stämme der Pferdegeborenen, die sich gegen die Ah’tain auflehnten, vorstieß. Und es war Ellak, der ihm diesen Rat gab, um seine Männer zu retten. Meine Freunde sind alle tot. Und von Uldin Skeidh habe ich wohl wenig zu befürchten.“
„Da kannst du wirklich beruhigt sein. Die Ah’tain haben jetzt andere Sorgen“, erklärte Kraton mit rauer Stimme. „Ich habe gestern einen Händler getroffen, der beunruhigende Nachrichten brachte.“
Neugierig blickte Gainas den Skilurer an, während Arus neuen Wein holte und die Krüge vor den Männern abstellte.
„Was sind das für Nachrichten?“, fragte Arus zerstreut und warf prüfende Blicke auf seine Schankmaiden.
Gainas nahm einen tiefen Schluck aus seinem Krug. „Ein guter Tropfen. Roter Masuvier?“
Arus nickte. „Ein Fässchen für besondere Gäste.“
Kraton beugte sich verschwörerisch vor. „Er erzählte mir, dass er nicht mehr nach Skiluros kommen würde. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass auch die Schiffe, die alle erwarten, nicht mehr kommen werden. Die Schiffe aus Tyras, Zenata, Kan-Tyr und Tauros, die jetzt im Hafen liegen, sind die Letzten, die heil durchgekommen seien. Das Meer soll ein einziges Schlachtfeld sein. Da draußen geht etwas vor sich, vor dem selbst die kühnsten turianischen Segler Angst haben. Ich befürchte, dass die halfarischen Seeräuber, die von den Ah’tain vor drei Sommern fast restlos vernichtet wurden, wieder erstarkt sind.“
Unruhig bewegte sich Gainas auf der harten Bank. „Die Schiffe kommen nicht mehr? Ich denke, das wird bloß eine vorübergehende Sache sein, sobald die Städte sich zusammentun und die Piraten vertreiben. Es hat auch ständig Kämpfe im Osten zwischen den Pferdegeborenen und den anderen Stämmen gegeben. Das hat die Händler nicht gehindert weiter mit uns Geschäfte zu machen. Skiluros ist noch immer die größte, reichste und mächtigste Stadt an den Küsten des turianischen Hochlands. Es werden immer Schiffe kommen.“
„Und wenn nicht, wenn wirklich etwas aus den Tiefen der See auf dem Weg zu unserer Küste ist?“, erwiderte Arus zweifelnd. „Ich habe gehört, dass die Ah’tain die Stadt aufgeben wollen.“
„Die Ah’tain verlassen die Stadt? Dann sind die Gerüchte möglicherweise wahr?“, stieß Kraton überrascht aus.
Gainas runzelte die Stirn. „Es könnte wahr sein, denn selbst an der östlichen Grenze tauchten Neuigkeiten auf, denen ich keinen Glauben schenken wollte, aber ich hörte, wie man davon sprach, dass eine Stadt übergeben werden sollte ...“
Nachdenklich ließ Gainas den letzten Satz ausklingen.
„Du meinst, sie geben die Stadt nicht umsonst auf? Sie werden etwas dafür bekommen?“ Kraton blickte nachdenklich in seinen schon wieder leeren Becher.
„Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Skiluros einen neuen Herrn bekommen würde. Dies ist in den letzten Jahren schon oft geschehen. Die Zeit der Kaiser, die jahrhundertelang über die nördlichen Stadtstaaten geherrscht haben, sie ist schon lange vorbei“, murmelte Arus und erhob sich ächzend. „Die Nacht ist noch jung. Ich denke, ich kümmere mich erst mal um die Küche.“
„Und sie wird lang und finster werden, mein Freund!“, erwiderte Gainas leise und sah auf Arus breiten, schwammigen Rücken, bis dieser hinter dem Tresen verschwunden war. Die Miene des Gutani war bei den Worten des Wirts noch verbitterter geworden. „Seit die Ah’tain vor sechs Sommern hier Fuß gefasst haben, kämpften sie sehr erfolgreich gegen die noch unabhängigen Stämme der Pferdegeborenen. Sie lernen schnell und sie wissen immer wo ihr Vorteil liegt. Aber jetzt haben sie Schwierigkeiten. Große Schwierigkeiten. Ihre wirklichen Probleme liegen im Osten. Ich habe selbst die Vorboten kommender Schrecken gesehen. Ein wildes, ungezügeltes Volk, das raue Sitten pflegt, hat die Weidegebiete der östlichen Stämme überrannt. Die Pferdegeborenen nennen sie Windreiter, denn sie stürmen auf ihren kleinen wendigen Pferden wie der Wind über die Ebenen. Sie sind unterteilt in zahlreiche Stämme, von denen viele untereinander verfeindet sind. Sie wohnen in großen Jurten, die man schnell auf- und abbauen kann, so dass man nie sicher sein kann, wo sich ihr genauer Standort befindet. Man erzählt sich schreckliche Dinge über sie. Viele halten die Windreiter für ein Strafgericht, das über die Stämme des Ostens für ihre Sünden gekommen ist. Eine Bedrohung, wie sie die Steppe noch nie gesehen hat. Und deshalb brauchen die Ah’tain Verbündete, starke Verbündete.“
„Du meinst, sie übergeben Skiluros für ein Bündnis?“ Kratons Gesichtszüge verzogen sich angewidert. „Du selbst hast im Namen Uldins im Osten die letzten freien Stämme besiegt. Viele Stämme der Pferdegeborenen beugen sich den Ah’tain und senden kostbare Felle und edle Steine. Von welchen neuen Verbündeten sprichst du?“
„Ich weiß es noch nicht“, erwiderte der Gutani leise. „Vielleicht wollen sie auch nur Frieden mit den fremden Ankömmlingen schließen, um sich den Rücken freizuhalten. Aber ich werde mir die Antworten zu verschaffen wissen. Doch jetzt lass uns essen. Ich bin seit vielen Tagen unterwegs und alles, was mich aufrecht gehalten hat, war die Aussicht auf die Köstlichkeiten aus der Küche unseres Freundes hier.“
Als wenn dies das Stichwort gewesen wäre, kam schon Arus schnaufend und ächzend um die Ecke und stellte eigenhändig einen Berg knusprig gebratener Khorrippen auf den Tisch. Dazu brachte er noch Fladenbrote, die fast den Durchmesser eines halfarischen Kampfschildes hatten und eine riesige Schüssel mit schwarzer Pfeffersoße. Gainas und der Skilurer ließen sich nicht lange bitten.
„Also“, fragte der Wirt, als die beiden nach einiger Zeit immer noch schwiegen und anscheinend sehr mit ihrem Essen beschäftigt schienen, „was habt ihr ausgebrütet?“ Dabei blickte er Gainas in die Augen. „Ich sehe es dir an, Gainas. Du hast etwas vor – na?“
„Dir kann man nichts vormachen, alter Freund“, lachte Gainas. „Wenn Kraton einverstanden ist, werden wir uns zusammentun und morgen in der Oberstadt unsere Lauscher aufstellen. Was meinst du?“
Gainas blickte fragend, mit hochgezogenen Augenbrauen, auf den Halsabschneider.
„Ich bin dabei, denn auch ich will wissen, was vor sich geht“, nuschelte Kraton mit vollem Mund. „Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich alle angesehenen Bürger und Senatoren, ja, der ganze Rat der Kaufleute und der Adel im Jamustempel versammeln sollen. Es heißt, Uldin Skeidh habe eine Versammlung aller Mächtigen der Stadt einberufen, um über den Krieg und neue Abgaben zu verhandeln.“
„Nun, die Ah’tain waren bisher sehr milde mit ihren Forderungen“, sagte Arus und kratzte sich ausgiebig unter den Achselhöhlen. „Sie hätten uns ausbluten können, doch sie haben nur ein Drittel aller Einkünfte aus Handel und Gewerbe und der Erträge von den Feldern für sich gefordert. Wir konnten sicher und wohlbehalten unter ihrer Herrschaft unseren Geschäften nachgehen. So war es lange nicht mehr. Warum sollten sie jetzt, da anscheinend ein neuer Krieg im Osten droht, nicht um weitere Gelder ersuchen.“
„Du siehst immer noch nicht über die Mauern deiner Schenke hinaus, Arus“, antwortete Kraton verärgert. „Ah’tain ersuchen nicht, sie nehmen sich einfach was sie benötigen. So war es schon immer!“
Gainas nickte wortlos und nagte weiter an seinem saftigen Khorrippenstück. Das Fleisch spülte er mit einem großen Schluck roten Masuviers hinunter.
Es wurde noch eine lange Nacht.
2.
Gainas erwachte aus dem leichten Schlaf eines Kriegers, als das schlurfende Geräusch, das er schon in seinen Träumen vernommen hatte, wiederkehrte. Er war allein. Arus hatte ihm eine der Schankmaiden für die Nacht angeboten, aber er hatte kein Verlangen nach einem Weib verspürt.
Der goldene Gai-Taran war ein altes, fast verfallenes Gemäuer und er wusste, dass sich über seinem Zimmer auch noch ein ausgedehnter Dachboden befand. Arus nutzte diese Räume nicht, und so waren sie wohl das Reich der Ratten und Mäuse. Zufrieden mit dieser Erklärung legte er sich zur Ruhe und es dauerte nicht lange, bis er wieder eingeschlafen war.
Ein weiterer ungewohnter Laut riss ihn erneut aus seinem Schlaf. Es war, als würde ein nasser Sack wieder und wieder über den Dachboden gezogen.
Gainas war ein Mann des Stahls. Er glaubte nur an das, was er sah und mit seinem Schwert zerschmettern konnte. Die Ränke und feinen Machtspiele des Schamanenkreises der Ah’tain waren ihm schon immer ein Gräuel gewesen. Er hasste die geheimnisvollen Riten der Schamanen, sowie ihre Zauberkräfte und ihr Vertrauen in die Runen der Macht, die sie angeblich im Schatten des Raben wandeln ließen.
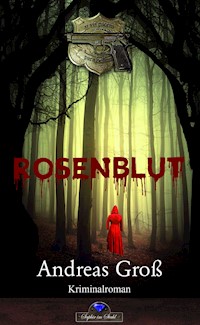
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











