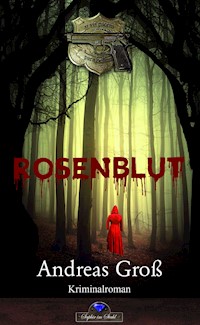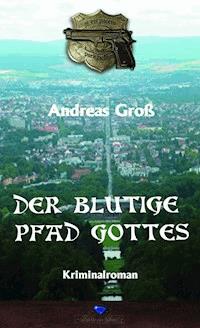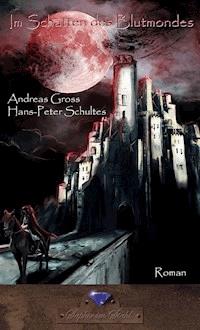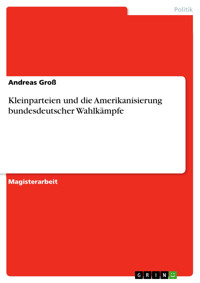
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Politik - Politische Systeme allgemein und im Vergleich, Note: 1,15, Ludwig-Maximilians-Universität München (Geschwister-Scholl-Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Der Wahlkampf entzieht sich nur allzu gern einer umfassenden Analyse: Er basiert auf einer Vielzahl von gesellschaftlichen, politischen und sogar geschichtlichen Aspekten, bewegt sich in einem kaum verbindlich geregelten Umfeld und führt - einmal abgesehen vom Wahlergebnis - zu keinen handfesten Ergebnissen. Sicher ist offenbar nur eines: „No campaign is exactly like any other.“1 Entsprechend schwer tut sich die Wissenschaft, eine auch nur annähernd allgemeine Theorie des Wahlkampfes zu entwickeln. Stattdessen widmet sich ein Großteil der Wahlkampfforschung Einzelaspekten wie dem Verhältnis von Politik und Medien oder beschränkt sich auf Fallanalysen bestimmter Wahlkämpfe. Dieser Sachverhalt bedeutet natürlich nicht, dass die Forschung überhaupt keine allgemein gültigen Grundsätze herausgearbeitet hätte, mit deren Hilfe der Wahlkampf in einem theoretischen Zusammenhang analysiert werden könnte. Insbesondere die These der Amerikanisierung bundesdeutscher Wahlkämpfe hat eine umfangreiche Beachtung gefunden und die wissenschaftliche Auseinandersetzung inzwischen voll in Beschlag genommen. Ausgehend von der Kernaussage der Angleichung bundesdeutscher Wahlkämpfe an die amerikanische Form des ‘Campaigning’ ist diese These zunehmend ausdifferenziert und konkretisiert worden und stellt heute den schlüssigsten theoretischen Rahmen für die Erklärung des Wahlkampfes dar. [...] ______ 1 Swanson, David/Mancini, Paolo: Introduction. In: Dies. (Hrsg.), Politics, Media, and Modern Democracy. An International Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences. Westport, 1996, S. 4.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2002
Ähnliche
Page 1
Page 4
1. Fragestellung und Methode
Der Wahlkampf entzieht sich nur allzu gern einer umfassenden Analyse: Er basiert auf einer Vielzahl von gesellschaftlichen, politischen und sogar geschichtlichen Aspekten, bewegt sich in einem kaum verbindlich geregelten Umfeld und führt - einmal abgesehen vom Wahlergebnis - zu keinen handfesten Ergebnissen. Sicher ist offenbar nur eines: „No campaign is exactly like any other.“1Entsprechend schwer tut sich die Wissenschaft, eine auch nur annähernd allgemeine Theorie des Wahlkampfes zu entwickeln. Stattdessen widmet sich ein Großteil der Wahlkampfforschung Einzelaspekten wie dem Verhältnis von Politik und Medien oder beschränkt sich auf Fallanalysen bestimmter Wahlkämpfe.
Dieser Sachverhalt bedeutet natürlich nicht, dass die Forschung überhaupt keine allgemein gültigen Grundsätze herausgearbeitet hätte, mit deren Hilfe der Wahlkampf in einem theoretischen Zusammenhang analysiert werden könnte. Insbesondere die These der Amerikanisierung bundesdeutscher Wahlkämpfe hat eine umfangreiche Beachtung ge-funden und die wissenschaftliche Auseinandersetzung inzwischen voll in Beschlag genommen. Ausgehend von der Kernaussage der Angleichung bundesdeutscher Wahlkämpfe an die amerikanische Form des ‘Campaigning’ ist diese These zunehmend ausdifferenziert und konkretisiert worden und stellt heute den schlüssigsten theoretischen Rahmen für die Erklärung des Wahlkampfes dar.
Um mögliche Missverständnisse im Zusammenhang mit der Amerikanisierungsthese von vorneherein zu vermeiden, sollte man klar zwischen dem Entwicklungsprozess und den heute gültigen Gesetzmäßigkeiten des Wahlkampfes unterscheiden. In der deutschen Wahlkampfforschung werden beide Aspekte unter dem Begriff der ‘Amerikanisierung’ abgehandelt und häufig auch nicht klar voneinander abgegrenzt. Für die vorliegende Arbeit ist eine entsprechende Unterscheidung insofern relevant, da sie die Fragen des Entwicklungsprozesses außen vor lässt und sich explizit auf die heutige Form des Wahlkampfes konzentriert. Wenn hier vorzugsweise vom amerikanisierten Wahlkampf ge-
racy.An International Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences. West-
port, 1996, S. 4.
Page 5
sprochen wird, dann soll damit die Konzentration auf die aktuellen Gesetzmäßigkeiten des Wahlkampfes auch begrifflich dokumentiert werden.
In dieser Arbeit soll der amerikanisierte Wahlkampf speziell mit dem Parteityp der Kleinpartei in Beziehung gesetzt werden. Als Kleinparteien werden alle Parteien jenseits von CDU und SPD verstanden. Die Frage, inwieweit sich der amerikanisierte Wahlkampf überhaupt auf diese Parteien übertragen lässt, ist bislang weder beantwortet noch überhaupt gestellt worden. Die Gesetzmäßigkeiten, nach denen bundesdeutsche Wahlkämpfe heute ablaufen, sind ausschließlich über Analysen von SPD und CDU herausgearbeitet bzw. überprüft worden. Andere Parteien sind höchstens am Rande berücksichtigt worden, trotz der doch recht offensichtlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Parteitypen. Es lassen sich daher drei konkrete Forschungsfragen formulieren:
(1) Nach welchen Mustern führen Kleinparteien in Deutschland ihre Wahlkampagnen? (2) Mit welchen Bedingungen sind sie dabei konfrontiert? (3) Können die Wahlkampagnen von Kleinparteien in das Schema des amerikanisierten Wahlkampfes eingeordnet werden?
Mit der Beantwortung dieser Fragen wird es am Ende möglich sein, die Kampagnen von Kleinparteien im Rahmen des amerikanisierten Wahlkampfes einzuordnen und mögliche Abweichungen zu benennen. Im Mittelpunkt der Arbeit steht also das wahlkampfbedingte Handeln von Kleinparteien, wobei sich die Untersuchung explizit auf die Bundesebene bezieht. Eine grundlegende Überprüfung der Gesetzmäßigkeiten des amerikanisierten Wahlkampfes kann dagegen nicht geleistet werden; nicht das Konzept der Amerikanisierung an sich steht auf dem Prüfstand, sondern vielmehr seine Anwendung auf Kleinparteien.
Mit der Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes auf das Handeln von Kleinparteien folgt diese Arbeit unter anderem dem Beispiel von Barbara Pfetsch und Rüdiger Schmitt-Beck, deren analytische Schlüsselvariable die Frage ist, welche Kommunikationswege die Parteien im Wahlkampf nutzen und von welchen Überlegungen sie sich dabei lenken lassen.2Während sich Pfetsch und Schmitt-Beck allerdings auf den Bereich der Kommu-
strategienund Massenmedien im politischen Mobilisierungsprozess. In: Jäckel, Michael/Winterhoff-
Spurk, Peter (Hrsg.), Politik und Medien. Berlin, 1994, S. 233.
Page 6
nikation beschränken, wird das Untersuchungsgebiet in dieser Arbeit etwas weiter gefasst und auf alle wahlkampfrelevanten Handlungen ausgedehnt, die neben der Kommunikation beispielsweise auch Fragen der Wahlkampfinhalte oder -organisation betreffen.
Die Themenstellung dieser Arbeit erfordert die umfassende Nutzung sowohl quantitativer als auch qualitativer Methodenelemente. Dazu gehört die Analyse des statistischen Datenmaterials ebenso wie eine Auswertung der Medienberichterstattung und der einsehbaren Parteimaterialien. Das empirische Material entstammt im Wesentlichen der verwendeten Sekundärliteratur und wurde im Hinblick auf die besondere Fragestellung dieser Arbeit einer Sekundäranalyse unterzogen; eigene Umfragedaten konnten aber nicht erhoben werden. Dafür wurde die qualitative Materialbasis über Interviews mit verschiedenen Wahlkampfexperten der Parteien in wichtigen Punkten ergänzt.
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil soll das Modell des amerikanisierten Wahlkampfes vorgestellt werden. Da sich die Wahlkampfforschung wie gesagt durch eine starke Streuung auszeichnet und sich dabei auch über verschiedene Fachrichtungen erstreckt, müssen die Ergebnisse hier erst einmal zusammengetragen und strukturiert werden. Am Ende steht so eine umfassende Darstellung des amerikanisierten Wahlkampfes, die zugleich schon den Überprüfungskatalog darstellt, mit dessen Hilfe die Kampagnen von Kleinparteien analysiert und eingeordnet werden können. Der zweite Teil liefert zunächst eine präzise Bestimmung der Charakteristika von Kleinparteien und überträgt diese auf die konkrete Situation in Deutschland. Im Folgenden steht dann die Frage im Mittelpunkt, welche Bedeutung den spezifischen Merkmalen von Kleinparteien im Wahlkampf zukommt und wie sie sich im Einzelnen auswirken. Die Untersuchung konzentriert sich dabei aus Gründen der Relevanz vor allem auf die eta-blierten Kleinparteien wie die FDP, Bündnis 90/Die Grünen oder die PDS. Vor diesem Hintergrund können zuletzt die Thesen zur Wahlkampfführung von Kleinparteien formuliert werden. Der dritte Teil leistet schließlich die empirische Überprüfung dieser Thesen. Exemplarisch wird dabei die Wahlkampfpraxis von FDP und Bündnis 90/Die Grünen im Bundestagswahlkampf 1998 vorgestellt und auf die einzelnen Annahmen hin analysiert. Da-rüber hinaus werden die Kampagnen der beiden Parteien grundsätzlich am Modell des amerikanisierten Wahlkampfes gemessen. Als Analyseraster dient der im ersten Teil erstellte Überprüfungskatalogs. Abschließend können Kleinparteien dann im Gesamtkontext des amerikanisierten Wahlkampfes verorten und die Ergebnisse diskutiert werden.
Page 7
2. Theoretische Einordnung des Wahlkampfes
In jeder Demokratie ist die Wahl das zivilisierte Verfahren, mit dem der ständige Wettstreit um die Ausgestaltung des Staates und das Streben nach politischer Macht kanalisiert und entschieden wird. Am Wahltag entscheidet der Bürger mit seiner Stimme über die Verteilung der Macht - bis zur nächsten Wahl. Der politische Machtkampf wird also nicht in einer direkten Auseinandersetzung entschieden, sondern immer auf dem Umweg über die Wählerstimmen. Dementsprechend ist es das Ziel jeder Partei oder jedes Kandidaten, über kurz oder lang möglichst viele Wählerstimmen auf sich zu vereinigen und so den Machtkampf für sich zu entscheiden.
DieserWettbewerbder Parteien um Wählerstimmen und damit um Macht ist das zentrale Merkmal des Wahlkampfes.3Allerdings sind Parteien und Politiker in modernen Demokratien fortwährend dazu gezwungen, um Unterstützung für die eigene Politik zu werben und möglichst viele Bürger hinter sich zu bringen, ohne dass gleich von einem permanenten Wahlkampf gesprochen werden kann.4Der tägliche Wettbewerb wird zwar zum Teil auch im Hinblick auf zukünftige Wahlen geführt, kann aber ebenso gut andere Gründe haben. Der Wahlkampf muss also über das Kriterium ‘Wettbewerb um Wählerstimmen’ hinaus noch andere Merkmale aufweisen, die eine genauere Abgrenzung zum normalen Parteienwettbewerb erlauben.
Zwei Aspekte können hier für eine weitere Verengung herangezogen werden: Zum Einen bezieht sich der Wahlkampf auf einen bestimmten Zeitabschnitt vor einer Wahl (Chronologie), zum Anderen hebt er sich organisatorisch und inhaltlich vom normalen Parteienwettbewerb ab (Intensivität). Parteien beginnen demnach zu einem bestimmten Zeitpunkt damit, den Wettbewerb um die Gunst des Bürgers mit zusätzlichen Anstrengungen zu verstärken. In der Regel liegt dieser Punkt etwa 15-18 Monate vor einer Wahl. Ab diesem Moment kann von Wahlkampf gesprochen werden. In der Folge werden die Wahlkampfaktivitäten zunehmend intensiviert, bis schließlich die heiße Wahl-
Radunski,Peter: Wahlkämpfe. Moderne Wahlkampfführung als politische Kommunikation. München
u.a., 1980, S. 11.
Boston, 1980.
Page 8
kampfphase der letzten Wochen erreicht ist, in der die Sonderanstrengungen der Parteien ihren Höhepunkt erreichen und der Wahlkampf in das öffentliche Bewusstsein eindringt.
Fasst man die drei Merkmale zusammen, so definiert sich Wahlkampf insgesamt als einzeitlich begrenzter, im Vorfeld von Wahlen ablaufender Prozess, in dem die Parteien über den üblichen Parteienwettbewerb hinausgehende organisatorische und inhaltliche Anstrengungen unternehmen, um Wählerstimmen zu gewinnen.5Im Rahmen der Wahl-kampfforschung wurde wiederholt versucht, diesen Prozess chronologisch aufzuschlüsseln und ihn in verschiedene Phasen zu unterteilen.6Da diese Versuche allerdings kaum zu griffigen Ergebnissen geführt haben, soll das Augenmerk hier stattdessen auf den zweiten Aspekt, die Anstrengungen der Parteien, gelegt werden. In jedem Fall kann das eigentliche Untersuchungsobjekt noch einmal konkretisiert und auf die einzelnenWahlkampagnender Parteien innerhalb des Gesamtereignisses Wahlkampf zugespitzt werden.
Eine genauere Verortung des Wahlkampfes im Gesamtkomplex der Politik muss zunächst von einer Differenzierung in Politikherstellung und Politikvermittlung ausgehen. DiePolitikherstellungumfasst den gesamten Bereich der politischen Sachentscheidungen und führt in der Regel zu materiellen Ergebnissen in Form von Gesetzen, Vorschriften oder Ähnlichem. DiePolitikvermittlungbezieht sich dagegen auf die öffentliche Darstellung dieser Ergebnisse und ihres Entstehungsprozesses. Diese von Ulrich Sarcinelli geprägte Unterscheidung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Entscheidungen über Sachfragen zwar schon aus legitimatorischen Gründen kontinuierlich an den Wähler vermittelt werden müssen, der Prozess der Vermittlung aber mehr oder weniger losgelöst von diesen Entscheidungen als eigenständiger Politikbereich zu sehen ist.7Es geht bei der Politikvermittlung „nicht um die Durchsetzung politischer Gestaltungsabsichten in Entscheidungsarenen mittels formal institutionalisierter Prozeduren, sondern um Inszenierungen und Realitätsdeutungen.“8Vor diesem Hintergrund kann der Wahlkampf eindeutig dem Bereich der Politikvermittlung zugeordnet werden. Generell können sich die
Schlussphase.Vgl. Wolf, Werner: Der Wahlkampf. Theorie und Praxis. Köln, 1980, S. 118-124.
kampfkommunikation der Bundesrepublik Deutschland. Opladen, 1987, S. 66.
Zur Generierung von Öffentlichkeit. In: Neidhardt, Friedhelm (Hrsg.), Öffentlichkeit, Öffentliche Mein-
ung, Soziale Bewegung. Opladen, 1994, S. 107.
Page 9
Inhalte der Politikvermittlung dabei auf der ganzen Bandbreite zwischen nahezu vollständiger Übereinstimmung mit den tatsächlichen Entscheidungen und einem Surrogat ohne signifikanten Bezug auf die materielle Politik bewegen. Wie sich die Politikvermittlung im Einzelnen darstellt, hängt stark von den Rahmenbedingungen und der konkreten Situation ab. Zwar kann die Politikvermittlung nicht auf Dauer in einem ernstzunehmenden Gegensatz zur Politikherstellung stehen, ohne die Stabilität des Systems zu gefährden. Da dem Wahlkampf in der Regel keine aktuell zu regelnde, konkrete Sachfrage zu Grunde liegt, sondern vielmehr generalisierte, auf die Zukunft gerichtete Grundlinien der Politik im Mittelpunkt stehen, wird er aber zumindest tendenziell immer dem zweiten Pol näher liegen.
Wenn es bei der Politikvermittlung um Inszenierung und Realitätsdeutung geht, so bezieht sich dies immer auf dieÖffentlichkeit.Der öffentliche Raum versammelt eine Vielzahl von Vorstellungen und Sichtweisen, die sich letztlich zu einer vorherrschenden oder öffentlichen Meinung verdichten. Welche Sichtweisen sich dabei durchsetzen und welche Fragen überhaupt in der Öffentlichkeit diskutiert werden, ist mehr oder weniger starken Schwankungen unterworfen. Auf jeden Fall konstituiert sich im öffentlichen Raum das, was nach allgemeinem Verständnis den aktuellen Problemhaushalt der Politik darstellt. Die Öffentlichkeit stellt also ein zentrales Referenzsystem für die Urteilsbildung des Einzelnen dar und spielt damit auch im Wahlkampf eine bedeutende Rolle: Der Kampf um Wählerstimmen wird vor allem ein„Kampf um die Definitionsmacht im Raum der Öffentlichkeit“9sein. Der Wahlkampf stellt also gewissermaßen den Ausnahmefall der Politikvermittlung dar.10
Page 10
Die These von der Amerikanisierung des Wahlkampfes Seite 10
3. Die These von der Amerikanisierung des Wahlkampfes
Der Begriff derAmerikanisierunghat im Zusammenhang mit Wahlkämpfen in den letzten Jahren eine geradezu inflationäre Verwendung erfahren. Demnach könne man „Wahlkämpfe weder verstehen noch konzipieren, wenn man nicht bewußt die Amerikanisierung der politischen Kommunikation bejaht.“11Im Kern soll damit ausgedrückt werden, dass der Wahlkampf heute auch in Deutschland bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt, die früher nur aus den USA bekannt waren. Sowohl die Wahlkampagnen der einzelnen Parteien oder Kandidaten als auch das Umfeld, in dem sie sich bewegen, gleichen in vielerlei Hinsicht den Strukturen amerikanischer Wahlkämpfe.
Wie werden in den USA Wahlkämpfe geführt? Die amerikanischen ‘Campaigns’ zeichnen sich zum Einen durch ihre starke Professionalisierung des Wahlkampfmanagements aus. Begünstigt durch die Charakteristika des politischen Systems hat sich eine eigene Consultant-Branche herausgebildet, die als hochspezialisierte Experten und selbstständige Unternehmer wahlkämpfenden Parteien und Kandidaten ihre Dienste gegen Honorar anbieten. Amerikanische Wahlkampfstäbe setzen sich praktisch vollständig aus solchen Experten zusammen.12Zum Zweiten bauen US-Kampagnen nahezu ausschließlich auf die Macht des Fernsehen: Alleine Bill Clinton schaltete im Präsidentschaftswahlkampf 1996 etwa 55.000 TV-Spots.13Dies hat Drittens zur Folge, dass amerikanische Wahlkämpfe einen immensen Kapitalbedarf aufweisen. So haben die Kampagnen zur Präsidentschafts- und Kongresswahl im Jahr 2000 nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 3 Milliarden US-Dollar gekostet, was selbst in den USA zu einer intensiven Diskussion über die Eindämmung der Kosten geführt hat. Eine professionelle Organisation, die Fernsehzentrierung und die hohen Kosten sind nur die auffälligsten Aspekte amerikanischer ‘Campaigns’; daneben gibt es noch eine Vielzahl von Merkmalen, die typischerweise mit der amerikanischen Form der Wahlkampfführung in Verbindung gebracht werden.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Politik überzeugend vermitteln - Wahlkampfstrategien in Deutschland und
den USA. Gütersloh, 1996, S. 33.
USA. Frankfurt a. M., 1998.
Page 11
Die These von der Amerikanisierung des Wahlkampfes Seite 11
Nach der Amerikanisierungsthese lässt sich ein Großteil dieser Merkmal heute auch in anderen Ländern konstatieren. Tatsächlich haben sich rund um die Welt ähnliche Wahlkampfmuster entwickelt, die in den Grundzügen dem entsprechen, was in den USA schon seit mehreren Jahrzehnten zu beobachten ist. David L. Swanson und Paolo Mancini haben mit ihrer großen internationalen Vergleichsstudie die zentralen Bestandteile des amerikanisierten Wahlkampfes identifiziert: „The defining elements of that model - including personalization of politics; adapting campaign practices to media logic and priorities; and employing technical experts to advise parties on public relations, opinion polling, and marketing strategies - have emerged to a greater or lesser extent in every country we examined.“14In der deutschen Terminologie werden diese Elemente mit den Begriffen(1) Personalisierung, (2) Mediatisierungund(3) Professionalisierungumrissen. Ausgehend von den USA finden sich diese Elemente inzwischen in nahezu allen Ländern der westlichen Hemisphäre und auch darüber hinaus.
Der Ausdruck der Amerikanisierung hat also insofern seine Berechtigung, als er sich auf Grundmerkmale des Wahlkampfes beruft, die zuerst in den USA aufgetreten sind. Kritiker des Begriffes weisen allerdings den starken Bezug zur USA als irreführend zurück. Sie argumentieren, dass es in Deutschland schon aufgrund des politischen Systems nicht zu einer völligen Angleichung der Wahlkampfführung kommen könne. Außerdem lenke die Bezeichnung den Blick fälschlicherweise auf die USA als Vorbild, obwohl der Prozess der Amerikanisierung im Kern nichts originär Amerikanisches an sich habe. Er bezeichne lediglich den Ursprungsort der modernen Kampagneform, nicht aber deren Ur-sprungsgrund.
Unumstritten ist nämlich, dass die heutige Form des Wahlkampfes vor allem auf die generelle und tiefgreifende Veränderung der gesellschaftlichen Zusammenhänge zurückzuführen ist, die in der theoretischen Debatte alsModernisierungbezeichnet wird.15Die Gesetzmäßigkeiten heutiger Wahlkampagnen sind also weniger eine amerikanische Idee als vielmehr das Ergebnis eines veränderten sozialen Kontextes. Die Individualisierung der Gesellschaft und der Aufstieg des Mediensystems zu einem zentralen gesellschaftli-
quences.In: Dies. (Hrsg.), Politics, Media, and Modern Democracy, a.a.O., S. 252.
Page 12
Die These von der Amerikanisierung des Wahlkampfes Seite 12
chen Akteur sollen hier nur als Schlagwörter dienen.16Diese Entwicklungen haben in den USA zwar aus verschiedenen Gründen früher eingesetzt, sie können aber in allen westlichen Industrienationen gleichermaßen beobachtet werden und haben daher auch bei der Form des Wahlkampfes zu ähnlichen Ergebnissen geführt.
Während sich allerdings die gesellschaftlichen Prozesse in eine ähnliche Richtung bewegt haben, bestehen zwischen den politischen Systemen der einzelnen Länder weiterhin fundamentale Unterschiede. Diese Unterschiede werden sich auch auf den jeweiligen Wahlkampf auswirken und so die Entstehung eines Einheitswahlkampfes verhindern. Die Gesetzmäßigkeiten des amerikanisierten Wahlkampfes werden sich im Kontext des jeweiligen politischen Systems vielmehr zu einer spezifischen Form der Wahlkampagne entwickeln. Insgesamt ist es somit durchaus zweckmäßig, wenn der Begriff der Amerikanisierung in der deutschen und internationalen Wissenschaft häufig auch etwas genauer alsModernisierung des Wahlkampfesbezeichnet wird.17Wenn der Ausdruck hier trotzdem weiterverwendet wird, dann nur vor dem Hintergrund dieser begrifflichen Konkretisierung.
378. Swanson/Mancini, Patterns of Modern Electoral Campaigning, a.a.O., S. 250.
Page 13
Das Modell des amerikanisierten Wahlkampfes in Deutschland Seite 13
4. Das Modell des amerikanisierten Wahlkampfes in Deutschland
Die Amerikanisierungsthese und das daraus abgeleitete Modell des amerikanisierten Wahlkampfes ist auch in der deutschen Wahlkampfforschung auf großes Interesse gestoßen und vor allem im Hinblick auf seine Ausprägung im deutschen System untersucht worden. Dabei wurden sowohl die prinzipielle Existenz der zentralen Kampagnenelemente (Personalisierung,Mediatisierung, Professionalisierung)als auch deren konkrete Anwendung durch die Parteien in die Analysen integriert.18
Einschränkend muss festgestellt werden, dass mit dem Modell kein allumfassender theoretischer Rahmen für die Erklärung von Wahlkämpfen verbunden ist, sondern vielmehr deren charakteristische Elemente identifiziert und in einen Zusammenhang gestellt werden. Swanson und Mancini kommen sogar zu dem Ergebnis, dass es sich eher um eine Archetype denn um ein Modell handelt. Diese Bewertung bezieht sich allerdings vor allem auf die internationale Vergleichbarkeit, mit der in der Regel noch einmal besondere Schwierigkeiten für die Formulierung allgemeingültiger Aussagen verbunden sind.19Beschränkt man sich dagegen auf den begrenzten Rahmen eines einzelnen politischen Systems, so kann durchaus von einem Modell im dem Sinne gesprochen werden, dass der Wahlkampf hier mit allgemeinen und zwingend vorhandenen Elementen verbunden werden kann. Die konkrete Form des Wahlkampfes bewegt sich also letztlich in einem klar definierten Bereich. Trotz der genannten Einschränkungen kann das Modell des amerikanisierten Wahlkampfes hier also als theoretischer Bezugsrahmen herangezogen werden.
Wenn das Modell in diesem Kapitel mit Leben gefüllt und seine reale Ausprägung in der Bundesrepublik Deutschland vorgestellt werden soll, so muss dabei ein wesentlicher Aspekt beachtet werden, auf den schon im vorangegangenen Kapitel hingewiesen worden ist: Die spezifische Form des Wahlkampfes hängt stark von den gegebenen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes ab. Vor der Analyse der einzelnen Elemente bundesdeutscher Kampagnen muss also eine Konkretisierung des Handlungsrahmens stehen. Im Folgenden sollen daher zunächst die verschiedenen Kontextfaktoren dargelegt werden,
Entwicklungen der Parteien und des Parteiensystems. In: Ders. (Hrsg.), Die Parteien nach der
Bundestagswahl 1998. Opladen, 1999, S. 9ff.
Page 14
Das Modell des amerikanisierten Wahlkampfes in Deutschland Seite 14
bevor in einem zweiten Schritt die einzelnen Elemente modernen Wahlkampagnen zusammengetragen und analysiert werden können.
4.1 Die Rahmenbedingungen bundesdeutscher Wahlkämpfe
4.1.1 Wahlkampf und institutioneller Kontext
Generell lassen sich die Rahmenbedingungen bundesdeutscher Wahlkämpfe in institutionelle und soziale Faktoren unterteilen. Institutionelle Faktoren betreffen vor allem die Form des politischen System, Gesetze und Richtlinien. Schon die ganz allgemeine Einteilung von Ländern in parlamentarische und präsidentielle Systeme ist von ungeheurem Einfluss auf die Ausgestaltung des Wahlkampfes. Ein präsidentielles System stellt normalerweise die Präsidentenwahl in das Zentrum des Machtkampfes und ist so von vorneherein auf den Wettstreit einzelner Kandidaten ausgerichtet. In einem parlamentarischen System dagegen wird zuvorderst ein Parlament gewählt. In der Regel stehen sich damit in erster Linie Parteien gegenüber. Während das präsidentielle System also sehr stark die einzelne Person in den Mittelpunkt stellt, sind Wahlen in parlamentarischen Systemen vor allem ein Wettstreit der Parteien. Selbst Kanzler- oder Wahlkreiskandidaten stehen dabei nicht als eigenständige Akteure zur Wahl, sondern bewegen sich immer im inhaltlichen und organisatorischen Rahmen der Parteien.20Schon das Regierungssystem fällt demnach eine wesentliche Vorentscheidung über die Form des Wahlkampfes. Darüber hinaus kennt der institutionelle Kontext drei weitere zentrale Faktoren: Das Wahlsystem, die Form des Parteienwettbewerbs und die gesetzliche Regelung des Wahlkampfes.21
4.1.1.1 Das Wahlsystem
Das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland lässt sich im Wesentlichen als Verhältniswahl charakterisieren. Der Bundestag wird laut Bundeswahlgesetz „nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl“ gewählt. Konkret wird diese Kombination von Personen- und Verhältniswahl über ein System mit Erst-
westeuropäischerPolitikberater und Parteimanager. Ergebnis einer Expertenbefragung. Wien, 1998, S.
7f. Die dort außerdem aufgeführten PunkteMediensystem, Grad der gesellschaftlichen Modernisierung
undPolitische Kulturgehören nach der hier vorgenommenen Untergliederung thematisch in den soz-
ialen Kontext.
Page 15
Das Modell des amerikanisierten Wahlkampfes in Deutschland Seite 15
und Zweitstimme erreicht, wobei die Erststimme dem direkt zu wählenden Wahlkreis-kandidaten gilt und die Zweitstimme den von den Parteien aufgestellten Landeslisten. Während die Erststimme per Mehrheitswahl über die Vergabe des Wahlkreises entscheidet, wird bei der Zweitstimme die Verhältniswahl angewandt. Da zwar beide Stimmen eine gewisse Relevanz haben, für den Ausgang der Wahl aber letztlich die Zweitstimme das entscheidende Kriterium ist,22kann das deutsche Wahlsystem insgesamt als Verhältniswahl klassifiziert werden. Das heißt zunächst einmal, dass die Anzahl der Sitze, die eine Partei erhält, proportional zu ihrem Stimmenanteil ist und damit nicht nur die Stimmen der stärksten Partei, sondern auch die der anderen Parteien für die Machtverteilung relevant sind: „Sie zählen alle gleich und haben den gleichen Erfolgswert.“23
Eingeschränkt wird dieses Prinzip lediglich durch eine fünfprozentige Sperrklausel, mit deren Unterschreiten eine Partei bei der Mandatsverteilung nicht mehr berücksichtigt wird.24Die Stimme für eine Partei mit weniger als 5 Prozent hat also gewissermaßen einen geringeren Erfolgwert als die Stimme für eine Partei mit mehr als 5 Prozent. Eine Ausnahme von der Ausnahme ist wiederum die Regel, dass der Einzug in den Bundestag auch bei weniger als 5 Prozent sichergestellt ist, wenn die Partei gleichzeitig mindestens drei Direktmandate errungen hat. Diese Regel ist bislang allerdings einzig in der Bundestagswahl 1994 zugunsten der PDS zur Anwendung gekommen: Bei nur 4,4 Prozent der Zweitstimmen zog die Partie dank der Erringung von vier Direktmandaten in Ost-Berlin in den Bundestag ein.
Die Bedeutung des Wahlsystems für den Wahlkampf ergibt sich zum Einen aus seinen Auswirkungen auf das Wahlverhalten. In einem Mehrheitswahlsystem sind die Chancen von dritten Parteien oder Kandidaten aufgrund des Zwangs zur absoluten oder relativen Mehrheit praktisch gleich Null. Da Wähler im Regelfall ihre Stimme nicht gerne verschenken, werden sie solche Parteien oder Kandidaten von vorneherein meiden und aussichtsreichere Alternativen wählen. Dieser vorauseilende psychologische Faktor der Wahlentscheidung tritt bei der reinen Verhältniswahl nicht auf, da jede Stimme bei der Mandatsverteilung berücksichtigt wird. Wird die Verhältniswahl durch eine Sperrklausel
95. Trotzdem müssen Parteien den Wettbewerb um Direktmandate in ihre Überlegungen mit einbezie-
hen. Der Effekt dieses Systems ist also auch eine Verkomplizierung der Wahlkampfführung.