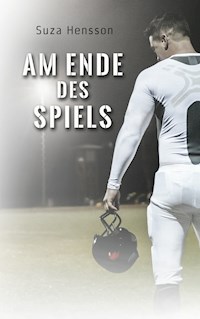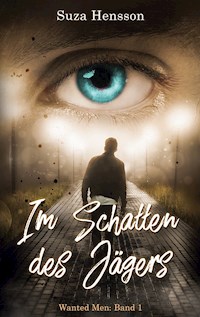
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Serie: Wanted Men
- Sprache: Deutsch
Sommer 2008 - Bei dem zwanzigjährigen Jaxon Lindberg scheint alles in Ordnung zu sein: Er geht mit Freunden feiern, trifft Mädchen und macht sich keine Gedanken um seine Zukunft. Doch als seine Mutter eines Tages ihren neuen Partner mit nach Hause bringt, beginnt sein Leben zu entgleisen. Wenige Wochen später begeht er ein Verbrechen, das seine Familie erschüttert zurücklässt. Dann flieht er Hals über Kopf. Was hat Jaxon zu dieser Tat getrieben? Um zu verstehen, muss seine Mutter mehr als zwanzig Jahre zurückblicken und sich mit einem Schicksalsschlag auseinandersetzen, der seinen Schatten bis heute auf die Familie wirft. Miriam möchte Kunst studieren, aber ihre Eltern haben andere Pläne für sie, die sie mit allen Mitteln versuchen durchzusetzen. Eines Tages taucht ihre neue Liebe Jaxon vor der Tür auf und Miriam ergreift die Gelegenheit: Zusammen mit ihm stürzt sie sich in ein Roadtrip-Abenteuer - nicht ahnend, was Jaxon getan hat. Und dass ihre Reise in Wahrheit eine gefährliche Flucht ist, die kein gutes Ende nehmen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil 1
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Teil 2
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Teil 3
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Prolog
Oktober 1987
Etwas wuchs in ihr heran. Johanna konnte an nichts anderes denken, als sie an einem regnerischen Herbstabend die Hauptstraße in den Nordteil der Stadt hinaufeilte. Ununterbrochen sah sie auf den Asphalt zu ihren Füßen, um die Pfützen zu umgehen, dann erreichte sie den dunkelroten Altbau und blieb unter dem Vordach stehen. Sie strich sich die Kapuze vom Kopf und grüßte den Nachbarn, der aus dem Haus kam und ihr die Tür aufhielt. Johanna lief die Treppen in den dritten Stock hinauf und hielt inne. Laute Stimmen drangen aus Leroys Wohnung. Dem Klang nach zu urteilen, war ein Mann bei ihm.
Eigentlich spürte Johanna, dass sie da jetzt nicht reinzuplatzen hatte, aber ihr Drang, Leroy zu sehen und ihm die Neuigkeit zu überbringen, war stärker. Sie kramte den Schlüssel aus ihrer Manteltasche und steckte ihn in das Schloss. Leroy hatte ihr vor einigen Monaten einen Zweitschlüssel machen lassen, nachdem sie einige Male mit dem Fahrrad den Weg von Kaiserslautern nach Ramstein gekommen war und dann vor seiner Wohnung gesessen hatte.
Johanna schlüpfte in den dunklen Flur und schüttelte sich die Stiefel von den Füßen. Leroy und sein Besucher waren im Wohnzimmer. Die Tür war angelehnt, ein Lichtschein fiel durch den Spalt. Johanna hörte die beiden auf Englisch miteinander streiten.
»Vergiss es, wir haben zweihundertfünfzigtausend gesagt«, waren Leroys erste Worte, die sie hörte. Johanna bewegte sich nicht. Sie hätte doch auf ihr Bauchgefühl hören und im Treppenhaus bleiben sollen. Wenn es um eine solch horrende Geldsumme ging, hatten ihre Ohren hier ganz bestimmt nichts verloren.
»Eine Viertelmillion«, tönte die Stimme des fremden Mannes aus der Nähe der Tür zu ihr heraus. »Das ist eine Menge Holz.« Er lachte auf. »Eine ganze Menge. Und zusätzlich verlieren wir dich.«
»Wie auch immer«, gab Leroy zurück. Johanna kannte diesen Tonfall und wusste, Leroy würde das Geplänkel mit Sicherheit gleich beenden.
»Komm schon. Du weißt, dass wir dich decken können«, versuchte es der Fremde. Dann hörte Johanna mehrmals hintereinander das Klicken eines Feuerzeugs.
»Überleg mal, worum es hier geht«, sagte Leroy, jetzt mit gedämpfter Stimme. »Ich habe den Typen kaltgemacht.« Eine Pause entstand. Schwere Schritte auf den Holzdielen, Leroy näherte sich der Tür. Johanna wich in den Schatten des gegenüberliegenden Schlafzimmers zurück.
»Es bleibt dabei. Ich habe den Coup gerettet und bekomme die Kohle. Es läuft so wie geplant, das kannst du auch Franklin sagen.« Er zog die Wohnzimmertür auf und wartete darauf, dass sein Gast das Zimmer verließ. Kurz darauf schritt ein hochgewachsener Mann von etwa fünfzig Jahren mit grauem Bürstenhaarschnitt an ihm vorbei. Die Kiefer aufeinandergepresst, der Blick finster. Er riss seine Jacke von der Garderobe und verließ türenschlagend die Wohnung. Leroy blieb in der Wohnzimmertür stehen, bis das Poltern aus dem Treppenhaus verklungen war. Erst jetzt regte er sich, nahm die Zigarette aus dem Mund und blies Rauch in die geheizte Luft.
Johanna wagte nicht, sich zu bewegen, aber sie zitterte und musste heftig einatmen. Leroys Blick fuhr herum und nach einer kaum nachzuvollziehenden Bewegung hielt er eine Pistole in beiden Händen, mit der er in das für ihn schwarze Loch des Schlafzimmers zielte. Seine Zigarette hatte er auf den Boden fallen lassen.
»Wer ist da?«, schrie er.
Johanna erstarrte. Als ihr erneut die Luft ausging, wurde sie von einem unkontrollierten Schluchzen geschüttelt. Sofort ließ Leroy die Waffe sinken, sein Blick veränderte sich.
»Johanna?« Mit einem Schritt war er im Zimmer, schaltete das Deckenlicht ein und sah sie im selben Moment schluchzend am Heizkörper unter dem Fenster hinunterrutschen. Die Härte verschwand aus seinem Blick, er warf die Pistole auf das Bett zu seiner Linken und kniete sich neben sie auf den Fußboden.
»Oh Gott, es tut mir so leid, wenn ich dir Angst eingejagt habe«, murmelte er in ihr Haar und schloss die Arme um sie. Johanna klammerte sich an ihn. Sein Herz schlug genau wie ihres hart und schnell. Anscheinend hatte auch er gerade einen ganz schönen Adrenalinschub erhalten.
»Wer war dieser Typ?«, fragte sie, nachdem er sie einige Minuten gehalten hatte. Leroy antwortete nicht sofort. Seine Muskeln spannten sich an, bevor er sie losließ und auf das Bett sank.
»Wieso?«
Johanna rappelte sich auf und lehnte sich rücklings gegen das Fensterbrett. »Ich habe gehört, was ihr geredet habt«, gab sie zu, woraufhin Leroy den Blick senkte. Seine Gedanken schienen zu rasen.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Johanna, die es auf einmal leid war. Sie selbst hatte kein einziges Geheimnis vor ihm und er konnte ihr noch nicht einmal in die Augen sehen.
»Leroy, was wollte der Typ von dir? Und was hast du da vom Kaltmachen gesagt?«
Langsam schüttelte er den Kopf. »Ich kann mit dir da nicht drüber sprechen.«
»Was soll das heißen?« Johanna lachte auf. »Wir lieben uns doch. Es sollte nichts geben, worüber du nicht mit mir sprechen kannst.«
Ein gequälter Ausdruck erschien auf seinem Gesicht. »Johanna, es ist folgendermaßen …«
»Du … du hast jemanden umgebracht?«
»Ich … nein … das ist nicht so einfach zu beantworten …«
Johanna stieß sich vom Fensterbrett ab. »Das ist völlig einfach zu beantworten«, fuhr sie ihn an. »Ja oder nein, Leroy?«
Als er nicht antwortete, fuhr sie fort: »Und was tust du überhaupt mit dieser Pistole hier?«
»Die habe ich schon ewig. Ich bin bei der Army, Hanna.«
»Ja, klar. Aber mit einem netten kleinen Nebengeschäft, oder wo kommt diese Viertelmillion Dollar her, von der ihr geredet habt?« Sie blieb vor ihm stehen. »Denn darum ging es doch, oder?«
Er biss sich auf die Unterlippe. »Diese Sache hat nichts mit dir und mir zu tun.«
»Welche Sache? Die Sache, dass du jemanden getötet hast?«
Er schwieg eine Weile. »Es ist vorbei, das musst du mir glauben.« Er streckte eine Hand nach ihr aus, aber sie wich zurück. Sie starrte ihn an und hatte plötzlich das Gefühl, einen Fremden vor sich zu haben.
»Ich muss hier raus«, stieß sie hervor. Dann stürmte sie aus dem Zimmer.
Auf dem obersten Treppenabsatz hatte er sie eingeholt. Er umfing ihr Handgelenk, zog sie in die Wohnung zurück und stieß mit dem rechten Fuß die Tür zu. Sie wehrte sich, aber er hielt sie zwischen den Jacken gegen die Flurwand gedrückt fest.
»Du kannst jetzt nicht einfach verschwinden«, sagte er. Sein Griff war hart, aber seine Augen waren weich vor Liebe zu ihr.
»Leroy, lass mich los! Ich kann jetzt nicht hierbleiben. Ich … ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch mit dir zusammen sein kann.« Sie wollte sich die Tränen aus dem Gesicht wischen, aber sie konnte ihre Hände nicht befreien.
»Wieso nicht? Johanna, ich schwöre dir, ich bin immer noch derselbe Typ, der ich war, als wir uns kennengelernt haben.« Er ließ sie los und wischte ihr mit den Daumen die Tränen von den Wangen. Dann schloss er sie in die Arme und küsste ihr Haar. »Bleib bei mir.«
Johanna wollte gehen, ihr Verstand wollte es, aber ihr Herz und ihr Körper wollten bleiben und Leroy wusste es. Er wusste, sie war ihm verfallen, seit er vor etwas über zwei Jahren in das Krankenhaus eingeliefert worden war, in dem sie arbeitete. Er hatte eine Schussverletzung gehabt, von der sie bis heute nicht wusste, wie er zu ihr gekommen war.
Was wusste sie überhaupt von ihm?
Leroy drängte sich an sie und küsste ihren Hals. Er wollte ihr den Mantel von den Schultern streifen, aber Johanna versteifte sich. Sie versuchte, ihn von sich zu schieben, bis er von ihr abrückte und sie ansah.
»Johanna, bitte. Wir können doch darüber reden. Ich kann das alles hinter mir lassen. Wir könnten zusammen weggehen, ein neues Leben beginnen …«
»Nein«, unterbrach sie ihn und spürte, wie ihr wieder die Tränen in die Augen stiegen. »Du hast jemanden umgebracht. Und du hast mich angelogen. Ich habe dir vertraut. Ich habe dir mein Kind anvertraut. Und jetzt bin ich wieder schwanger. Von dir.«
Er wich einen Schritt von ihr zurück und starrte sie an. »Nein …«
»Doch. Ich habe zwei Tests gemacht. Einen davon gerade eben, beim Arzt.«
»Oh … Scheiße.« Leroy ließ sich mit dem Rücken gegen die gegenüberliegende Flurwand fallen und fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare. Sein Gesicht nahm eine ungesund-blasse Färbung an. »Gott, Johanna, ich … ich kann jetzt nicht …«
»Du musst auch gar nicht«, erwiderte Johanna und wandte sich ab. Bevor sie die Wohnungstür öffnete, drehte sie sich zu ihm um. Er stand gegen die Wand gelehnt und zitterte am ganzen Leib. Genau wie sie, als sie in den Lauf seiner Waffe geblickt hatte.
Diesem Mann genügte anscheinend nur die Vorstellung eines eigenen Babys und schon verlor er die Fassung.
»Was willst du jetzt tun?«, fragte er, während sie sich den Mantel zuknöpfte. »Willst du … es wegmachen lassen?«
Nach dieser Frage schaffte sie es, ihm einen angemessen verachtenden Blick zuzuwerfen.
»Du bist ein Mistkerl«, sagte sie. »Ich hoffe, ich muss dich nie wiedersehen.«
Das waren die letzten Worte, die sie an ihn richtete.
Teil 1
Eins
Juli 2008
Jaxons Handy klingelte und er fuhr aus einem tiefen, traumlosen Schlaf. Er spürte die Nachmittagssonne, die durch die Holzjalousien in sein Zimmer fiel, und sein T-Shirt, das nach Rauch stank und ihm am Körper klebte. Er wartete, ob das Klingeln wieder aufhörte, dann streckte er den Arm aus und stieß aus Versehen den Kater aus seinem Bett, bevor er das Telefon auf dem Tisch fand.
»Ja?«
»Hey«, drang Liams muntere Stimme an sein Ohr. »Noch nicht wach?«
»Jetzt schon.« Jaxon rappelte sich auf, stellte die Füße auf den Boden und stützte den Kopf in seine freie Hand. Während er darauf wartete, dass sein Kreislauf in die Gänge kam, dachte er an die letzte Nacht zurück. An den etwas heruntergekommenen Schuppen, in dem sie gewesen waren, die ohrenbetäubende Musik und die blauen Rauchschwaden unter der niedrigen Decke. Das blonde Mädchen mit dem enganliegenden, roten Top, das sich an ihn gedrängt und mit dem er kurz darauf eine Nummer auf der Toilette geschoben hatte.
»Was gibt´s?«, brummte er.
Liam lachte. »Du warst unser Fahrer, Jax. Du müsstest taufrisch sein. Oder bist du etwa alleine weitergezogen, nachdem du uns abgesetzt hast?«
Jaxon schaltete den Lautsprecher ein, legte das Handy neben sich auf das Bett und zog sich das T-Shirt über den Kopf. »Es war nach fünf, als ich im Bett war, okay?« Er warf das Kleidungsstück auf seinen Schreibtischstuhl und tastete unter dem Bett nach einer Pizzapackung, die vom Vortag noch dort liegen musste. Er klappte den Deckel auf und stellte fest, dass sie leer war. Um einen Weg in die Küche würde er also nicht herumkommen.
»Schon gut. Ich wollte dich fragen, ob du heute mitkommen willst zu Eriks Party.«
Jaxon rieb sich über das Gesicht. »Erik? Wohnt der nicht in … was weiß ich, Overberge?«
»Jan kommt auch mit. Wir können mit meinem Auto hinfahren, das steht doch sowieso noch bei dir vor der Tür.«
Jaxon stand vom Bett auf. Momentan verspürte er eigentlich keine große Lust auf die nächste Party, aber er wusste, dass sich das in einigen Stunden ändern würde.
»Okay«, sagte er. »Ich hole euch ab.«
Kurz darauf beendete er den Anruf und verließ sein Zimmer. Er hörte jemanden in der Küche herumwerkeln und befürchtete schon, seinem Karnickel von Bruder oder etwa seiner Mutter zu begegnen. Aber als er nach unten kam, war nur Sarah da. Sie stand barfuß, mit Top, Shorts und gelben Gummihandschuhen bekleidet am Spülbecken; rechts von ihr türmte sich gespültes Geschirr, links ungespültes.
»Morgen«, sagte er und inspizierte den Inhalt des Kühlschrankes. Wie zu erwarten gewesen, war er bis auf eine Packung Milch, ein Glas Essiggurken und einige Fläschchen Nagellack leer.
Das Geschirrgeklapper setzte aus und als er sich die Milch herausnahm und den Kühlschrank schloss, begegnete er Sarahs Blick. Sie lächelte.
»Happy Birthday, kleiner Bruder«, sagte sie.
Jaxon verzog einen Mundwinkel. »Danke.« Er schraubte die Milchpackung auf und merkte, dass er allmählich doch Lust auf die Party heute Abend bekam.
Noch während er trank, schlenderte er an Sarah vorbei, zog die Gartentür auf und trat auf die Terrasse hinaus. Eine Weile stand er an die heiße Hauswand gelehnt in der Sonne und hörte Sarah beim Spülen zu.
»Sag mal«, kam es irgendwann durch das gekippte Küchenfenster, »hast du dich eigentlich mittlerweile eingeschrieben?«
»Was?«
»Eingeschrieben. In der Uni.«
Jaxon verdrehte die Augen. Seit Wochen ging Sarah ihm Tag für Tag mit dieser Frage auf die Nerven.
»Noch nicht.« Er legte den Kopf in den Nacken, leerte die Milchpackung und als er ihn wieder senkte, stand sie mit tropfenden Handschuhen in der Tür.
»Was ist?«, fragte er, während er den Getränkekarton in der Hand zerdrückte.
»Heute ist der allerletzte Tag, Jax!«
Als er nichts erwiderte und sie lediglich gegen das Sonnenlicht anblinzelte, verfinsterte sich ihr Blick. Sie strich sich mit dem Unterarm ein paar Haarsträhnen aus dem vom heißen Spülwasser geröteten Gesicht.
»Du warst tatsächlich schon wieder feiern«, stellte sie fest. »Obwohl gestern Donnerstag war und heute die Einschreibefrist endet. Ich meine, hast du mal auf die Uhr geschaut? Das Büro schließt in einer Stunde. Wie willst du das noch schaffen?«
Sie klang ziemlich aufgebracht und Jaxon wandte sich ab. Er ging ein paar Schritte zur Mülltonne an der Hausecke und warf die leere Milchpackung hinein. Er war seit heute zwanzig Jahre alt. Wann würde Sarah damit aufhören, sich seine Schuhe anzuziehen?
»Es ist dir egal, stimmt‘s?«, fuhr sie fort und wich einen Schritt zurück, als er herankam und an ihr vorbei die Küche betrat. »Du hast überhaupt nicht vor, dich einzuschreiben.« Sie folgte ihm durch den Raum hindurch. »Jaxon, verdammt nochmal!«
Im Durchgang zum Flur blieb er abrupt stehen und Sarah, die hinter ihm war, stockte und stieß gegen ihn.
Seine Mutter kam durch die Haustür herein. Sie hatte einen Mann in ihrer Begleitung und lachte über etwas, das er sagte. Ein beklemmendes Gefühl ergriff Jaxon, das er zunächst nicht einordnen konnte, doch es hatte etwas mit dem Unbekannten zu tun, der mit seiner Mutter den Flur betrat. Neben ihr wirkte er sehr groß und breitschultrig. Er trug ein dunkelblaues Poloshirt, das seinen athletischen Oberkörper betonte, seine dunklen Haare waren an den Schläfen ergraut und in einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
»Oh, man«, hörte Jaxon seine Schwester neben sich murmeln.
Das Polohemd hob die Hand. »Hallo, ihr.« Seine Stimme war tief und freundlich. Er hatte wettergegerbte, dunkle Haut, wodurch seine blauen Augen sehr hell wirkten.
Sarah hüstelte. »Äh, hallo.«
Jaxon spürte auf einmal den halben Liter Milch in seinem Magen; er brachte kein Wort heraus. Der Anblick des Mannes rührte an etwas in ihm, einer Erinnerung, die er nicht zu fassen bekam.
Johanna legte ihren Arm um die Hüfte ihres Begleiters. »Das ist Levin«, sagte sie und sah auf einmal ernst aus. Sie fing Sarahs Blick auf. »Wir dachten, wir könnten heute hier zusammen essen. Was meint ihr?«
Drei Sekunden lang herrschte Schweigen.
»Ehm …«, machte Sarah und da seine Mutter ohnehin an ihm vorbeisah, nutzte Jaxon den Moment, um sich Richtung Treppe zu verdrücken. Irgendwas ist los mit dem Kerl, dachte er. Johanna lachte normalerweise nicht. Sie brachte auch keine Männer mit nach Hause. Soweit er wusste, hatte sie seit Michaels Auszug überhaupt keinen Freund mehr gehabt.
Am Fuß der Treppe wandte Jaxon sich um. Sarah hatte die Arme vor der Brust verschränkt und eine Falte zwischen den Brauen, unter denen sie ihn durch den Eingangsbereich hindurch ansah. Sie war sauer auf ihn, weil er das Weite suchte und sie es aussitzen musste. Eine Sekunde lang überkam ihn der Anflug schlechten Gewissens, doch er unterdrückte das Gefühl, wandte sich ab und lief die Treppe hinauf.
***
Miriam hatte etwas Neues erschaffen. Sie trat einen Schritt zurück, dehnte ihre Arme und betrachtete das Resultat. Es war, natürlich, ein Brunnen.
Seit Wochen malte sie nur Brunnen und von Bild zu Bild wurden sie düsterer. Miriam kniff die Augen zusammen. Silhouetten knorriger, laubfreier Bäume waren zu sehen und im Zentrum der Brunnen als schwarzer, tiefer Schlund. Sie überlegte, ob sie einen Vollmond hinzufügen sollte, um die Atmosphäre etwas zu retten, als ihre Mutter ins Zimmer kam.
»Miriam, wir müssen reden«, verkündete sie und nahm auf ihrem Schlafsofa Platz. »Ich habe in Heidelberg angerufen.«
Miriam hielt mitten in der Bewegung, sich den Kittel über den Kopf zu ziehen, inne. »Du hast was?«
»Und es ist so, wie ich schon vermutet hatte.« Ihre Mutter lächelte. »Es gibt auch für Leute wie dich die Möglichkeit, Medizin zu studieren.«
Miriam warf den vollgeklecksten Kittel auf ihren Schreibtisch. »Leute wie mich?«
»Leute mit einem Zweierschnitt, meine ich.« Ihre Mutter machte eine Pause. »Wir werden dich in den Studiengang hineinklagen. Dein Vater recherchiert bereits, wer auf dem Gebiet der Erfolgreichste ist.«
Miriam wandte sich zu ihrem Bild um und sah in die Tiefen des Brunnens hinein. Sie spürte etwas Schweres, das ihr in den Magen fiel. »Mama, ich habe euch doch schon gesagt, dass ich Kunst studieren werde.«
Ihre Mutter erhob sich. »Und ich habe dir gesagt, dass wir das für eine fixe Idee halten und keinesfalls bezuschussen werden.«
»Es ist keine fixe Idee.« Miriam riss ihren Blick von dem Bild los. »Ihr verschwendet eure Zeit. Ich bin schon seit Jahren dabei, mir eine Bewerbungsmappe anzulegen.«
Ihre Mutter zog die Tür auf und wedelte in Richtung Staffelei. »Hör schon auf damit, Miriam. Kunst ist bestenfalls ein Hobby, kein Beruf.«
Miriam holte Luft, um etwas zu entgegnen, als es an der Haustür klingelte. Sie hörte ihren Vater aus dem Wohnzimmer kommen und öffnen.
»Willst du sie gar nicht sehen?«, fragte sie, als sich ihre Mutter zum Gehen wandte.
»Sehen? Wen?«
»Meine Bewerbungsmappe.«
Ihre Mutter verzog das Gesicht, als hätte Miriam vorgeschlagen, ihr ihre Schneckenzucht zu zeigen. Dann kam Miriams Freundin Lena die Treppe heraufgetrampelt und schlängelte sich an der Mutter vorbei in das Zimmer.
»Hi«, rief sie. Sie wartete, bis Miriams Mutter die Tür hinter sich zugezogen hatte und ließ sich auf das Sofa fallen. »Was ist denn mit der los?«
Miriam schlüpfte aus Jeans und T-Shirt und warf beides in den Wäschekorb neben ihrer Kommode. »Das war gerade das Ende von Unsere Tochter soll Ärztin werden, Teil drei«, erklärte sie und schaffte es nicht, ihre Stimme vollkommen frei von Bitterkeit zu halten.
»Tsss.« Lena begann damit, in ihrer Handtasche zu kramen. »Man sollte meinen, dass sie genug zu tun haben, so voll wie es bei denen im Wartezimmer immer ist.« Sie packte einen Kaugummi aus und steckte ihn sich in den Mund, während Miriam ihre Schranktüren öffnete.
»Kannst du mir mal sagen, was ich zu dieser dämlichen Party anziehen soll?«
Lena machte es sich auf dem Schlafsofa bequem. »Keine Ahnung. Du bist die Kreative von uns beiden.« Sie kreuzte die Arme im Nacken und musterte das Kunstwerk auf der hölzernen Staffelei. »Das Bild ist total geil. So schön gruselig. Wenn du es nicht für deine Mappe brauchen würdest, würde ich es in mein neues Zimmer hängen. Wie heißt es? Künstlerin in der Brunnenphase, Teil zwölf?«
Miriam musste lachen. »Du kannst es gerne haben. Ich glaube nicht, dass ich es für die Mappe nehmen will.«
»Wie kann deine Mutter glauben, dass sie dich zum Medizinstudium kriegt, nachdem sie so ein Bild gesehen hat?« Lena ließ ihr Kaugummi knallen.
Miriam knöpfte ihre Jeans zu, dann stellte sie sich auf die Zehenspitzen und angelte ein rosafarbenes Oberteil aus den Tiefen ihres Schrankes. »Sie hat es sich doch gar nicht angesehen«, sagte sie.
Wenig später saß Miriam mit Lena zusammen an der Bar, hinter der Erik stand und Willkommens-Cocktails mixte, und sah sich in dem verrauchten Raum um. Ihr wurde wieder klar, warum sie sich normalerweise von ihrem Bruder und dessen Freunden fernhielt. Hier drängten sich ungefähr fünfzig Leute zusammen, deren Daseinszweck anscheinend hauptsächlich aus Partys, Gras und den Möglichkeiten seiner Beschaffung bestand. Aber sie konnte ihre Freundin, die sich gerade den Kopf nach allen Seiten verrenkte, schlecht alleine hier sitzen lassen.
»Siehst du Tom und Gregor irgendwo? Es kann ja nicht sein, dass sie immer noch nicht hier sind«, sagte sie.
Miriam nippte an ihrem Erdbeer-Cocktail und begann, ebenfalls Ausschau zu halten, als ein Typ zur Tür hereinkam. Er war groß und breitschultrig und hatte dunkle Haare. Unter einem offenen, weiten Hemd trug er ein weißes Shirt und Jeans, die ihm tief auf den schmalen Hüften saßen.
Miriam verschluckte sich an ihrem Getränk und hustete. »Wer ist das denn?«
Lenas Kopf fuhr herum. »Oha.« Sie verfolgte den Typen mit den Augen und stieß Miriam gegen das Knie. »Und er kommt direkt auf uns zu.«
Tatsächlich bahnte er sich, gefolgt von einem sportlich aussehenden, blonden Surfertypen und einem Kerl mit dunklen Locken, einen Weg zur Bar vor. Er grüßte ein paar Leute, dann setzte er sich zwischen seinen Surfer-Kumpel und Miriam auf einen freien Barhocker und bedachte sie und Lena mit einem kurzen Blick.
»Hey, Liam!« Erik stellte eine Flasche beiseite und lehnte sich über den Tresen. »Und du hast deine Kumpels mitgebracht.« Er begrüßte alle drei mit einem Handschlag.
Während sie bei Erik ihre Getränkebestellungen aufgaben und anfingen, mit ihm zu plaudern, musterte Miriam den dunkelhaarigen Kerl von der Seite. Er hatte ein scharfes, ebenmäßiges Profil und muskulöse Unterarme, die unter seinen hochgekrempelten Hemdsärmeln zu sehen waren. Als er den Kopf senkte, fielen ihm die Haare in die Augen, die er mit einer Armbewegung beiseite strich. Miriam bekam Herzklopfen. Sie wünschte, er würde sich einmal zu ihr umdrehen und sie ansehen, da beugte sich Lena mit einer unangezündeten Zigarette im Mundwinkel an ihr vorbei in seine Richtung.
»Hey, du! Hast du mal Feuer für mich?«, rief sie gegen die Musik an. Ihr schien sein Anblick jedenfalls nicht die Sprache verschlagen zu haben.
Der Typ hob den Kopf und sah herüber. Entschuldigend zuckte er die Achseln.
»Na, dann nicht.« Lena zog sich wieder zurück. Sie holte ein Feuerzeug aus ihrer Tasche, steckte sich die Zigarette an und klinkte sich denkbar ungezwungen in das Gespräch zwischen Erik und den drei Jungs ein, das sie gerade unterbrochen hatte.
»Aha«, sagte sie, paffte blaue Schwaden in die rauchgeschwängerte Luft und warf Miriam einen vielsagenden Blick zu. »Ihr habt hier also eine Gärtnerei?«
»Offiziell schon.« Erik, der gerade Eiswürfel auf zwei Gläser verteilte, zwinkerte zu ihr herüber. Dann reckte er den Hals und winkte über seine Bargäste hinweg. »Aah, da kommen gerade meine besten Abnehmer.«
Lena drehte sich um. »Tom und Gregor sind endlich da«, sagte sie zu Miriam. »Komm, lass uns rübergehen.«
Schon war sie aufgestanden, hatte Zigarettenschachtel und Feuerzeug in ihre Jacke gestopft und schob sich durch die Partygäste ins Zentrum des Geschehens vor. Miriam, die noch gar nicht bereit war, ihren Platz neben dem gutaussehenden Unbekannten zu verlassen, blieb sitzen und wandte sich noch einmal zu ihm um. In diesem Moment drehte er den Kopf in ihre Richtung und ihre Blicke trafen sich. Miriam hielt den Atem an, als sie seine Augen sah, die von einem ungewöhnlichen Türkisblau waren. Sie hatte den Eindruck, er würde gleich etwas sagen, sie aufhalten vielleicht. Da reichte Erik ihm sein Getränk über den Tresen und der Moment war wieder vorbei. Er nahm seinen Cocktail entgegen, wandte sich seinen Freunden zu und Miriam folgte Lena in das Getümmel hinein.
Um einen großen Tisch in der Mitte des Raumes hatten sich sechs Männer versammelt, unter ihnen Lenas Freund Tom und Miriams älterer Bruder Gregor. Als Miriam hinter Lena die Runde erreichte, spürte sie gleich, dass eine aufgeladene Stimmung herrschte. Bis auf Tom, der mit vor der Brust verschränkten Armen dasaß und so tat, als hätte er mit dem Geschehen am Tisch nichts zu tun, schienen alle schon ordentlich getrunken zu haben. Am schlimmsten von ihnen war Gregor, der Tom gegenüber in seinem Stuhl hing und sich nur noch mühsam artikulieren konnte.
»Und ob ich das mache«, brachte er heraus. »Ich muss ja, wenn dieser Drecksack mir seine Knarre nicht gibt. Und er gibt sie mir nicht, stimmt´s?«
»Stimmt«, bestätigte Tom ruhig, während der Rest des Tisches in Gelächter ausbrach.
»Das will ich sehen. Das wäre sowas von irre«, sagte ein tätowierter, fetthaariger Typ namens Norman, von dem Miriam wusste, dass er zu Gregors Clique gehörte. Er nahm von seinem Sitznachbarn eine verdächtig riechende Zigarette in Empfang und zog tief daran. Miriam musterte Gregor und erkannte, die Jungs waren nicht einfach nur besoffen. Sie waren high.
»Komm«, murmelte sie Lena zu, die neben ihr stand und die Arme von hinten um Toms Hals geschlungen hatte. »Wir verschwinden lieber.«
»Na gut.« Lena biss Tom zum Abschied zärtlich in den Hals und wollte Miriam folgen, aber er hielt sie fest.
»Heh, wollt ihr Mädchen schon wieder verschwinden?«, sagte er. »Setzt euch doch.«
»Danke, aber wir haben keinen Bedarf an eurem kleinen Gesprächskreis.« Lena versuchte, ihren Arm aus Toms Griff zu befreien, aber er zog sie auf seinen Schoß hinunter. In dem Moment hatte der Joint seine Runde gemacht. Tom nahm ihn entgegen und steckte ihn Lena zwischen die Lippen, die genüsslich daran zog und sich danach von Toms Bier bediente. Miriam spürte, wie ihr der Kopf schwer wurde von dem Geruch des Grases und sie verließ das Haus und stieg die Treppenstufen in den Garten hinunter. Nächtliche Naturgeräusche empfingen sie und ihr wurde erst jetzt bewusst, in was für einer zähen Luft sie sich in der letzten Stunde aufgehalten hatte. Gott, wenn ihre Eltern sie hier sehen würden. Wenn sie wüssten, dass sich ihre Tochter auf einer Party befand, auf der gekifft wurde. Wenn sie wüssten, dass es zwischen ihr und dem gescheiterten Sohn eine außerfamiliäre Schnittmenge gab, sie würden Zustände bekommen. Denn Gregor bemühte sich so sehr, ein aussichtsloser Fall zu sein, dass ihre Eltern von ihm nicht einmal mehr erwarteten, dass er morgens das Bett verließ.
Miriam ließ sich auf einer verwitterten Hollywoodschaukel nieder, die ohne Bedachung mitten in dem großen, verwilderten Garten stand. Eriks Party fand in dem Haupthaus eines alten Gutshofes statt, auf dem es mehrere Gebäude gab, die wie ehemalige Ställe aussahen. Auf dem runden Platz vor dem Haus drängten sich die zahlreichen Autos der Partygäste, dahinter erstreckten sich mehrere schwach erleuchtete Gewächshäuser.
Die Tür flog auf und mit der Musik drang eine ganze Traube Menschen grölend und lachend heraus.
Miriam stand von der Schaukel auf. Sie konnte niemanden erkennen, nur, dass die Horde laut palavernd auf der Terrasse vor dem Haus stehen blieb. Mehrere Personen schienen miteinander zu streiten. Sie hörte Tom irgendwas brüllen, was sie dazu veranlasste, durch den Garten auf das Haus zuzugehen. Als sie die Terrasse erreichte, sah sie, dass sich beinahe alle Partygäste hier versammelt hatten. Sie bildeten einen Halbkreis um jemanden.
»Spring-en, spring-en«, riefen sie im Chor.
Miriam stieß sich bis in die vorderste Reihe vor und sah als erstes Gregor, der sich daranmachte, eine alte Holzleiter auf das Dach hinaufzuklettern. Die anderen feuerten ihn an. Sie feuerten aber auch Norman und Tom an, die in der Mitte des Halbkreises in eine Auseinandersetzung geraten waren. Norman versuchte Tom daran zu hindern, zu Gregor zu gelangen, der langsam aber stoisch Sprosse für Sprosse erklomm.
»Gregor, hör auf damit, verdammt!«, brüllte Tom und versuchte sich aus Normans Griff zu befreien.
»Lass ihn, wir wollen sehen, ob er das wirklich macht«, entgegnete Norman, von der Anstrengung, Tom festzuhalten, keuchend.
»Gregor!« Miriam stürzte zur Leiter, die erst etwa eineinhalb Meter über den Pflastersteinen der Terrasse begann, und umklammerte die unterste Sprosse. »Was machst du da?«
Gregor, der bereits die Hälfte der Leiter bewältigt hatte, schwankte gefährlich und blickte zu ihr hinunter.
»Miri!«, rief er. »Miri, du … du wirst es machen, hörst du? Du wirst das alles hinkriegen, ich weiß es.«
Miriam starrte ihn an. Ihre Kehle zog sich zusammen, als sie merkte, wie dicht er war. Seine Lider waren halb geschlossen, sein Mund war seltsam schlaff, die Arme und Beine kraftlos.
»Gregor, komm runter!«, rief sie. »Bitte!«
Sie überlegte fieberhaft, wie sie ihm folgen konnte, als die Menge hinter ihr plötzlich verstummte. Sie fuhr herum und sah, dass Tom ein Messer gezogen hatte. Norman wich vor ihm zurück.
»Spielverderber.«
»Weg freimachen!«, bellte Tom. »Der bricht sich doch den Hals da oben.«
Mit einer schnellen Bewegung steckte er das Messer wieder ein, war mit einem Satz auf der Leiter und folgte Gregor. Der hatte das Dach bereits erreicht und krabbelte wie ein riesiger, schwarzer Käfer zum Giebel hinauf. Ein Ziegel löste sich unter seinem Gewicht, klatschte auf das Pflaster der Terrasse und zersprang. Miriam machte einen Satz zur Seite. Panik durchflutete sie.
»Tu doch einer was!«, schrie sie die Menge an. Aber niemand tat etwas. Es war richtig unheimlich. Alle standen nur da und sahen wie gebannt nach oben, waren scheinbar nur etwas näher zusammengerückt.
Miriam trat ein paar Schritte zurück und spähte wieder nach oben. Auch Tom hatte das Dach erreicht, bewegte sich jedoch mit äußerster Vorsicht. Als Gregor die Dachkante erreicht hatte und aufstand, hielt er inne.
»Gregor, nein!«
Doch Gregor hörte nicht. Er breitete seine Arme wie Flügel zu den Seiten aus. Und dann ließ er sich einfach nach vorne fallen.
***
Es war noch früh, erst kurz nach Mitternacht, als Jaxon Liams alten Skoda auf dem Stellplatz vor der Garage parkte. Der Motor knackte leise, nachdem er ihn ausgeschaltet hatte, und einen Moment lang verharrte er in der Dunkelheit vor dem Haus. Er hätte sich nicht wieder dazu bereit erklären sollen, nüchtern zu bleiben und zu fahren. Normalerweise fühlte er sich ganz wohl in der Rolle, aber heute hatte er den ganzen Abend lang diesen Typen nicht vergessen können, den seine Mutter mitgebracht hatte. Er hatte versucht, sich abzulenken, aber er war die Frage, an wen er ihn erinnerte, nicht mehr losgeworden.
Bis dieser Verrückte, dicht wie eine Knasttür, von dem Dach gesprungen war. Jaxon hatte gesehen, wie er auf dem Dach entlanggegangen und ohne zu zögern hinuntergesprungen war. Wie die Welt für einen Augenblick stehengeblieben war und die Menge vollkommen reglos den Atem angehalten hatte.
»Ach du Scheiße«, hatte Liam neben ihm gesagt.
Das Mädchen, das zuvor noch neben ihnen an der Bar gesessen hatte, hatte geschrien. Und in dem Moment, in dem ihre Schreie und ihre Verzweiflung Jaxon erreicht hatten, war es ihm wieder eingefallen. Er wusste wieder, an wen ihn Johannas neuer Freund erinnerte.
Stille umfing ihn, als er das Haus betrat und die Tür hinter sich ins Schloss zog. Reglos blieb er im Flur stehen, aber es schien niemand mehr wach zu sein. Er ging ins Wohnzimmer, trat im Vorbeigehen auf den Fußschalter der Stehlampe neben der Couch und ließ sich vor dem Schrank auf die Knie sinken.
Er wusste nicht, wo seine Mutter ihre Fotos aufbewahrte, aber hier irgendwo musste es sein. Er erinnerte sich daran, wie sie es vor auf den Tag genau zehn Jahren aus diesem Schrank genommen hatte. Der gelbe Schein der Lampe warf lange Schatten in den Raum, als Jaxon damit begann, eine Schublade nach der anderen aufzuziehen und zu durchsuchen. Aber in den Schubladen lagen keine Erinnerungen, keine persönlichen Dinge seiner Mutter mehr. Sie musste sie irgendwann umgeräumt haben.
»Verflucht nochmal.« Wütend stieß er die letzte Schublade zu, richtete sich auf und stemmte die Hände in die Hüften. Eigentlich war klar, wo er suchen musste.
Er verließ das Wohnzimmer und verharrte vor der geschlossenen Schlafzimmertür, bevor er sie öffnete und sich lautlos hineinschob. Er hörte Atemgeräusche und wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, dann trat er an das Regal und schob den bodenlangen Vorhang beiseite. An der ganzen Wand entlang drängten sich die Hosen, Röcke, T-Shirts und Kleider seiner Mutter. Jaxon ließ seinen Blick über die Bretter und Stangen wandern und entdeckte zwischen der Kleidung mehrere Pappkartons mit Deckeln. Er suchte sie zusammen, stapelte sie übereinander und wollte sie mit rausnehmen, als ein eindeutig männliches Grunzen ihn herumfahren ließ. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass das Polohemd ebenfalls in diesem Raum war, in diesem Bett lag. Er blieb stehen, hin- und hergerissen zwischen den Möglichkeiten, jetzt schnellstens von hier zu verschwinden und das Foto zu suchen, oder dem Eindringling zu zeigen, was er von ihm hielt. Und mit Eindringling meinte er keinesfalls sich selbst.
Der Drang, so bald wie möglich das Foto zu sehen, war stärker. Jaxon packte die Kartons, schob mit einem Fuß die angelehnte Tür auf und zog sie hinter sich wieder zu.
In der Küche schüttete er den Inhalt des ersten Kartons auf dem Esstisch aus. Briefe, Postkarten und ein zerlesenes Taschenbuch fielen heraus und bildeten zwischen dem Salzstreuer und einem leeren Glas Apfelmus einen unordentlichen Haufen. Jaxon ließ die leere Box auf die Eckbank fallen. Hier gab es keine Fotos, stellte er fest, kurz bevor ihn der Gedanke durchzuckte, dass die ganze Vergangenheit seiner Mutter vor ihm lag. Alles war frei zugänglich für ihn. Ihre Tagebücher lagen hier, in denen bestimmt schwarz auf weiß stand, dass sie ihn hasste.
Angst ergriff ihn und bevor sie sich in ihm ausbreiten konnte, packte er die Briefe und Bücher mit beiden Händen und stopfte alles wieder in die Schachtel zurück. Er drückte den Deckel darauf und stellte die Box aus seiner Sichtweite. Er war auf der Suche nach einem Foto und von nichts anderem wollte er etwas wissen.
Er griff sich die zweite Schachtel, öffnete den Deckel und da lag es. Direkt vor ihm, auf allen anderen Bildern. Ein abgegriffenes, ausgeblichenes Foto, aufgenommen ganz offensichtlich in den Achtzigern.
Jaxon nahm es heraus und betrachtete es. Es war das Bild, das Johanna ihm gezeigt hatte, als er nach seinem Vater gefragt hatte. Es zeigte einen Mann Anfang dreißig, der an einem sonnigen Tag an einen grauen Jeep gelehnt dastand. Er trug ein khakifarbenes Hemd und weite, beige Shorts. Seine Sonnenbrille hatte er in die Haare geschoben, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt, ein Bein über das andere geschlagen und schaute mit etwas schräggelegtem Kopf in die Kamera. Er lachte, sah aber auch genervt aus. Sein Gesichtsausdruck sagte in etwa: Komm, mach schnell dein Foto und dann lass uns weiterfahren.
Jaxon drehte das Bild um und sah zum ersten Mal, was auf der Rückseite stand: Leroy & ich am Ledrosee, Juli ´87.
Der Mann auf dem Foto war Leroy Latham, Jaxons Vater. Und dieses Polohemd, Johannas neue Flamme, war ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie hatte einen Ersatz für ihn gefunden. So, wie sie es schon einmal gemacht hatte.
Zwei
Drei Tage später erfuhr Jaxon, dass Gregor Nordmann, der Junge, der auf Eriks Party von dem zehn Meter hohen Dach des Gutshauses gesprungen war, seinen Verletzungen erlegen war.
Hoffentlich stellen sie nur ein paar Fragen und lassen mich dann wieder gehen, dachte er, als er wenige Stunden nach dem Anruf die verglaste Tür zum Wartebereich der Polizeiwache aufstieß. Seine Hoffnung schwand jedoch, als er sah, dass auf den hellgrünen, an beiden gegenüberliegenden Flurwänden befestigten Plastikstühlen etwa zehn der Leute von Freitagnacht saßen. Manche unterhielten sich leise miteinander, aber die meisten sahen nur geradeaus oder hatten die Augen geschlossen.
Erik war hier, mit Augenringen und zu Berge stehenden, roten Haaren. Von dem spritzigen Cocktailmixer vom letzten Wochenende war nicht mehr viel übrig. Jaxon musste an die Gewächshäuser hinter dem Haus denken und daran, dass ein paar misstrauische Polizeibeamte wahrscheinlich das Letzte waren, was Erik auf seinem Hof gebrauchen konnte.
Drei Sitzschalen weiter saß der Kerl, der Gregor auf das Dach gefolgt war. Er war vielleicht Ende zwanzig, hatte schwarze, halblange Haare und wirkte so angespannt, dass die Luft um ihn herum regelrecht knisterte. Er beachtete Jaxon nicht, als der sich neben ihm fallenließ, sondern hatte seine Aufmerksamkeit auf den Typen gerichtet, mit dem er sich vor dem Haus in den Haaren gehabt und den er mit dem Messer bedroht hatte. Norman. Der schien sich unter dem bohrenden Blick seines Gegenübers überhaupt nicht wohlzufühlen. Unablässig rutschte er auf seinem Stuhl hin und her und versuchte, sich rechts und links Gespräche zu erzwingen. Bis sich endlich eine Tür am anderen Ende des Flures öffnete und zwei Mädchen in den Wartebereich traten. Sie waren ebenfalls auf der Party gewesen, erkannte Jaxon, als sie näherkamen. Es war die Langhaarige, die neben ihm an der Bar gesessen hatte. Ihre Freundin, die ihn angesprochen und nach Feuer gefragt hatte, hatte ihren Arm um sie gelegt und führte sie an den Wartenden vorbei, als wäre sie zu ihrer persönlichen Betreuung abkommandiert worden. Das langhaarige Mädchen war blass und ihre geröteten Augen sahen aus, als hätte sie die letzten Tage ausschließlich mit Heulen verbracht. Jaxon musste wieder daran denken, wie außer sich sie geraten war, als Gregor von dem Dach gesprungen war. Wie sie zu ihm gestürzt war und die Umstehenden angeschrien hatte, bis endlich irgendjemand reagiert und einen Krankenwagen gerufen hatte. Währenddessen hatte sein Sitznachbar, der Messertyp, Norman angebrüllt und gedroht, ihm die Kehle aufzuschlitzen, wobei er von Erik und ein paar anderen Leuten festgehalten worden war.
»Die waren sowas von furchtbar da drinnen zu ihr«, sagte das Mädchen, das direkt vor ihnen stehengeblieben war, und drückte ihre Patientin an sich. »Sie haben so getan, als wüssten sie nicht, dass Gregor ihr Bruder ist.«
Der Beamte, der die beiden Mädchen bis an die Tür begleitet hatte, rief jetzt Norman auf, der erleichtert aufsprang und ihm hinausfolgte. Mit zusammengekniffenen Augen sah Jaxons Sitznachbar ihm hinterher.
»Tom!«, rief das Mädchen, woraufhin er sich ihr zuwandte.
»Beruhige dich, okay?«, sagte er mit leiser Stimme. Er ließ seinen Blick durch den Raum wandern, als würde er alle Anwesenden zum ersten Mal wahrnehmen, bis er schließlich an Jaxon hängenblieb.
»Miriam und ich fahren jetzt«, sagte das Mädchen. »Kommst du nach, wenn du hier fertig bist?«
Er nickte und das Mädchen schob Miriam mit sich Richtung Ausgang.
Jaxon blickte ihnen nach. Als die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, begannen seine Beine zu kribbeln und er fragte sich, wie lange die Warterei hier wohl noch dauerte. Er rutschte im Stuhl hinunter und beobachtete die Leute, die ihm gegenübersaßen und sich leise über das Unglück bei Eriks Party unterhielten. Deren betroffene Gesichter. Eine Fliege zog unbeirrt ihre Kreise und flog dann und wann gegen eine der Scheiben. Neben ihm fischte Tom einen Tabakbeutel aus seiner Hosentasche und begann laut knisternd damit, sich eine Zigarette zu drehen. Gott, wie wenig er sich für Gregors Sprung verantwortlich fühlte. Er hatte rein gar nichts damit zu tun.
Gerade, als er überlegte, was passieren würde, wenn er einfach aufstand und ging, öffnete sich abermals die Glastür am anderen Ende des Raumes und Norman kam heraus. Ohne nach rechts oder links zu sehen durchquerte er den Wartebereich, stieß die Tür zur Eingangshalle auf und verschwand.
Tom sah ihm hinterher. Nach ein paar Sekunden stand er auf und steckte sich den Tabakbeutel in die hintere Jeanstasche.
»Was machst du?«, fragte Jaxon und erhob sich ebenfalls. »Gehst du jetzt einfach?«
Tom wandte sich zu ihm um. Er nickte und trat einen Schritt an ihn heran. »Ich habe nur auf diesen Scheißkerl gewartet«, sagte er so leise, dass niemand außer Jaxon ihn hören konnte. Ganz kurz durchbrach Schmerz seine beherrschte Fassade. »Er hat meinen besten Freund auf dem Gewissen.«
Dann wandte er sich ab und schien es plötzlich eilig zu haben. Jaxon folgte ihm durch die Glastür und die Eingangshalle hinaus auf die Straße. Keine Sekunde länger würde er den Warteraum und die langen Gesichter darin ertragen.
»Was willst du jetzt mit ihm machen?«, fragte er, als Tom neben einem dunkelgrauen Land Rover stehen blieb und seinen Autoschlüssel aus der Jackentasche angelte.
»Ich werde ihm einen Denkzettel verpassen.« Tom öffnete die Fahrertür und musterte ihn. »Wenn du willst, kannst du ja mitkommen.«
***
Norman öffnete zunächst nicht und Tom nutzte die Wartezeit und entleerte die Taschen seiner Jeans in die Altpapiersammlung neben der Wohnungstür. Einen alten Kassenbon zerknüllte er und steckte ihn in die Öffnung des Spions.
»Bist du sicher, dass er überhaupt zu Hause ist?«, fragte Jaxon, der ein Stück hinter ihm stand. Er streckte den Arm aus, um gegen die Tür zu hämmern, aber Tom hielt ihn zurück.
»Na klar«, sagte er und dann hörten sie auch schon Schritte, die sich der Tür näherten. Kurz darauf steckte Norman seinen Kopf heraus. Als er Tom erkannte, verfinsterte sich sein Blick.
»Was wollt ihr hier?«
»Uns mit dir unterhalten«, antwortete Tom und noch ehe Norman die Tür wieder schließen konnte, hatte er einen Fuß hineingestellt. Missmutig senkte Norman den Blick auf Toms Stiefel.
»Verpisst euch.«
»Ja, später.« Tom drängte sich an Norman vorbei in den Flur. Jaxon folgte ihm.
»Wer hat euch gesagt, ihr sollt reinkommen?«, rief Norman ihnen hinterher und warf die Tür ins Schloss. Aber sie waren bereits im Wohnzimmer. Während Tom mitten im Raum stehen blieb, verharrte Jaxon in der Nähe der Tür.
Tom bedachte Norman mit einem vernichtenden Blick. »Also, was sollte das gestern?«
»Was meinst du?«
»Was meinst du«, äffte Tom ihn nach. »Das weißt du verdammt noch mal genau. Du hast Gregor zu dieser Scheißaktion angestiftet und mich davon abgehalten, ihn da runterzuholen.«
Während er redete, ging er rückwärts weiter in den Raum hinein und Norman, der auf ihn fokussiert war, folgte ihm.
»So ein Schwachsinn«, sagte er. »Gregor war ein Psychopath. Er wäre sowieso …«
Weiter kam er nicht, da trat Jaxon hervor, packte ihn am T-Shirt und stieß ihn gegen die Zimmerwand. Sofort wollte er nachsetzen, aber Tom war schneller bei ihm. Mit hassverzerrter Miene hielt er Gregor an der Wand fest und presste ihm mit dem linken Arm die Luft aus dem Brustkorb. Mit der rechten Hand packte er ihn bei den Haaren und wollte seinen Kopf gegen die Wand stoßen, aber Norman riss ein Knie hoch und traf Tom in den Magen. Aufkeuchend taumelte er ein paar Schritte zurück.
Norman sog hektisch Sauerstoff in die Lungen. Eine Sekunde lang schien er unschlüssig, ob er die Gelegenheit ergreifen und sich auf Tom stürzen oder lieber abhauen sollte. Noch bevor er etwas tun konnte, war Jaxon wieder da. Norman wehrte sich verbissen, steckte heftige Schläge ein und teilte aus, so gut er konnte. Aber irgendwann war auch Tom wieder im Spiel. Jaxon trat zurück, als er Norman rücklings zu Boden riss und sich auf ihn setzte. Doch plötzlich hatte der von irgendwoher ein Messer in der Hand. Mit einem zischenden Laut stieß er Tom die Klinge in den Oberschenkel hinein.
Der Abend war angebrochen und es wurde bereits kühler, als sie wenig später auf den Parkplatz hinaustraten.
Jaxon wandte sich um. »Bist du okay?«, fragte er.
Tom war stehengeblieben und drückte sich das Handtuch, das er aus Normans Badezimmer mitgenommen hatte, auf die Wunde am Bein.
»Geht schon«, antwortete er, überließ Jaxon jedoch die Schlüssel, als sie das Auto erreicht hatten.
Nachdem sie eingestiegen und losgefahren waren, nahm er vorsichtig das Handtuch vom Bein. »Scheiße«, entfuhr es ihm.
Jaxon warf ebenfalls einen Blick auf die Stichwunde. »Soll ich dich ins Krankenhaus bringen?«
»Nein, besser nach Hause. Hier rechts, Richtung Dortmund.«
Jaxon bog auf die Hauptstraße ein und eine ganze Weile schwiegen sie. Jaxon genoss das leise Schnurren des Wagens und spürte, wie ihn allmählich Ruhe überkam.
»So ein Arschloch«, schnauzte Tom irgendwann, als sie schon auf der A2 waren. »Ich schwöre dir, wenn ich mein Messer mitgehabt hätte, ich hätte ihm die Kehle aufgeschlitzt.« Er knallte die Faust gegen die Armaturen, so dass das Handschuhfach aufsprang und ein silbernes Springmesser zum Vorschein kam. Er nahm es heraus und steckte es ein.
Jaxon grinste. »Ja, hier liegt es wirklich gut.«
»Allerdings tut es das.« Tom warf das blutige Handtuch in den Fußraum. Dann zog er sich in einer Bewegung das T-Shirt aus, so dass kurz sein Rücken zum Vorschein kam, der vollständig tätowiert war.
»Warum hast du es nicht mitgenommen?«, fragte Jaxon.
»Warum? Habe ich doch gerade gesagt. Weil ich ihm sonst die Kehle aufgeschlitzt hätte, darum«, erwiderte Tom und band sich das T-Shirt fest um den Oberschenkel und die Wunde, aus der immer noch hellrot das Blut pulsierte.
»Und? Hast du nicht gesagt, dass er Gregor auf dem Gewissen hat?«
»Tsss«, machte Tom, »vergiss das mal ganz schnell. Weißt du, was du für Mord bekommst? Fünfzehn Jahre Knast, mindestens.«
Obwohl Jaxon momentan keine Lust auf solch düstere Gedanken hatte, drängte sich ihm die Vorstellung unwillkürlich auf.
Fünfzehn Jahre.
Er sah wieder nach vorne auf die Straße, die unter ihnen hinwegglitt. Obwohl es allmählich dunkel wurde, war der Himmel immer noch blau, die Bäume links und rechts der