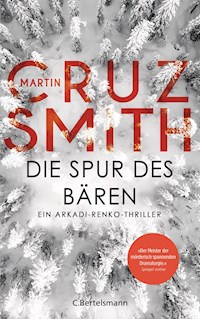5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Venedig, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs: Eines Nachts entdeckt der junge Fischer Cenzo in der Lagune eine junge Frau, die scheinbar leblos im Wasser treibt. Doch Giulia Silber ist nicht tot, sie schwimmt um ihr Leben, denn das Versteck, in das sich ihre Familie mit anderen Juden geflüchtet hatte, wurde verraten, und sie hat als einzige überlebt. Cenzo entscheidet sich, Giulia zu helfen. Doch nachdem er versucht hat, sie in Sicherheit zu bringen, verliert sich von ihr jede Spur. Cenzo macht sich auf die Suche, es ist ein Rennen gegen die Zeit, denn nicht nur er will das schöne eigenwillige Mädchen finden...
»Im Schatten von San Marco« ist ein spannender Liebesroman und eine mitreißende Schilderung der letzten Kriegstage in Norditalien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch:
Venedig, Januar 1945: Der Krieg findet langsam ein Ende, aber die Lagunenstadt ist noch immer besetzt und die Italiener fürchten die Macht des Dritten Reiches.
Eines Nachts entdeckt der Fischer Cenzo in der Lagune eine junge Frau, die scheinbar leblos im Wasser treibt. Er zieht sie in sein Boot und erkennt, dass sie noch am Leben ist. Ihm wird klar, dass die junge Frau in großen Schwierigkeiten steckt.
Giulia stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie und versteckt sich auf der Flucht vor der SS. Anstatt sie den Nazis zu übergeben, beschließt Cenzo, die schöne junge Frau zu beschützen. Die Flucht führt die beiden in die gefährliche untergehende Welt des Duce.
Martin Cruz Smith erzählt in diesem spannenden Roman eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Wirren am Ende des Zweiten Weltkriegs. »Im Schatten von San Marco« zeigt den Sehnsuchtsort Venedig in einem ganz anderen Licht.
»Spannung, Romantik, Spionage, Action – eine grandiose Mischung aus allem. Cruz Smith ist ein Meister schneller Szenenwechsel, der die Action perfekt mit Beschreibungen des venezianischen Alltags verwebt.«
The Washington Post
Der Autor:
Martin Cruz Smith, 1942 in Philadelphia geboren, gelang mit dem Thriller »Gorki Park« ein Welterfolg, der auch in der Verfilmung ein Millionenpublikum begeisterte. Seine Romane werden weltweit gelesen. Zuletzt erschienen von ihm bei C.Bertelsmann die Arkadi-Renko-Thriller »Die goldene Meile« und »Tatjana«.
Martin Cruz Smith lebt mit seiner Frau Emilie in der Bucht von San Francisco.
MARTIN CRUZ SMITH
Im Schatten von San Marco
ROMAN
Deutsch von Rainer Schmidt
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Girl from Venice« im Verlag Simon & Schuster, New York.
Copyright © Titanic Productions, 2016
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
beim C. Bertelsmann Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: buerosued, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21263-6 V002 www.cbertelsmann.de
Für Em, vom Anfang bis zum Ende
1
Ohne das Mondlicht verschwanden kleine Inseln, und Venedig versank in der Dunkelheit. Die Sterne jedoch funkelten so hell, dass Cenzo sich von ihnen angezogen fühlte, während der Schlick zwischen seinen Zehen heraufquoll. Der leise Hall von Kirchenglocken wehte über die Lagune, von den Bauernhöfen trieb der Mistgeruch heran, und ein oder zwei Mal hörte er das Tremolo eines deutschen Kanonenboots, das sich durch das Wasser pflügte.
Die Ausgangssperre verhinderte jede nächtliche Aktivität. Ausnahmen gab es nur für die Fischer. Fischer waren nachtaktive Wesen; sie schliefen bei Tag und fischten bei Nacht. Tagelang blieben sie draußen auf der Lagune, und wenn sie dann an Land kamen, rochen sie so stark nach Fisch, dass die Katzen ihnen auf der Straße nachliefen.
Das einzige Licht, das Cenzo hatte, kam von einer Öllampe, die am Mast hing, aber er brauchte seinen Fang nicht zu sehen. Eine bloße Berührung verriet ihm, ob er es mit einer Meeräsche zu tun hatte, einem Wolfsbarsch oder einem alten Stiefel. Er selbst trug weder Schuhe noch Stiefel, denn der Schlick würde sie ihm von den Füßen saugen. Er hatte eine Vielzahl von Netzen und Fallen, Haken und Dreizacken, um damit zu fischen, und feuchtes Segeltuch, um die Beute zuzudecken. Jede Nacht war anders. Heute fing er hauptsächlich Tintenfische, die zum Laichen hergekommen waren. Sie drehten ihre unwirklichen Augen zur Lampe hin. Fünfzig Prozent der Fischer behaupteten, Tintenfisch fange man am besten bei Vollmond. Die anderen fünfzig Prozent sagten das Gegenteil. Seezunge, Wolfsbarsch und orata kamen in Weidenkörbe. Katzenfische warf Cenzo wieder ins Wasser.
Die Luft vibrierte, als alliierte Bomber über ihm vorbeizogen, um Tod und Zerstörung auf Turin, Mailand oder Verona regnen zu lassen. Auf alles, nur auf Venedig nicht. Das heilige Venedig wurde nur von Tauben angegriffen. Die Bevölkerung der Stadt hatte sich verdreifacht, als im Schutze der Verdunklung die Flüchtlinge hereingeströmt waren.
Nach dem Markt wollte Cenzo nach Hause segeln. Seit einer Woche hatte er sich nicht mehr mit Süßwasser gewaschen oder etwas anderes gegessen als gegrillten Fisch und gebackene Polenta. Er schob das Boot vom Gras herunter und wollte das Ruder hineinwerfen, als etwas Großes an die Oberfläche stieg. Cenzo hielt seine Lampe über das Wasser und erkannte die Gestalt eines Mädchens.
Es durchrieselte ihn kalt. Jeden Moment erwartete er, dass sich das Mädchen als Halluzination erweisen würde. Fischer sahen nachts auf dem Wasser alles Mögliche, und das Auge war leicht zu täuschen. Wenn er sie berührte, würde sie sich in den weißen Bauch eines Rochens oder das ausdruckslose Gesicht eines Oktopus verwandeln. Aber nein, sie blieb, wie sie war.
Sie trieb mit dem Gesicht nach oben in einem schmutzigen Nachthemd auf dem Wasser. Er war kein Fachmann für das Alter solcher Mädchen, doch er schätzte, sie war noch keine zwanzig. Sie war barfuß und hatte die Augen geschlossen, und ihre Haut war fast durchscheinend weiß. Sie hatte violette Lippen, und langes Haar und Seetang hatten sich um ihren Hals geschlungen. Cenzo war eigentlich nicht gläubig, aber er bekreuzigte sich automatisch, bevor er sie in die Fatima hob – was keine ganz leichte Aufgabe war, weil die Toten so schlaffgliedrig sind. Und schon während er sie noch auf den Boden des Bootes legte, wusste er, dass er sie hätte lassen sollen, wo sie war. Eine Frau im Boot brachte Unglück, und ein totes Mädchen war vermutlich noch schlimmer.
Ärger konnte er nicht gebrauchen. Auf der einen Seite waren die Faschisten, auf der anderen die Partisanen und auf der dritten deutsche Soldaten, die gleich schossen, wenn sie dich zu Gesicht bekamen. Nur ein Verrückter würde da die Hand heben und sagen: »Verzeihung, signori, aber ich habe dieses tote Mädchen im Wasser gefunden.« Cenzo fragte sich jedoch, wie ein Mädchen so weit weg vom Festland im Wasser treiben konnte. Gut, der größte Teil der Lagune war flach, doch die Kanäle waren ein Labyrinth, in dem man durch den Sog und Druck der verschiedenen Strömungen gefangen war wie ein Fisch im Netz. Jemand musste sie den weiten Weg hierhergebracht und dann aus irgendeinem Grund ins Wasser geworfen haben. Blutergüsse oder andere Spuren von Gewalt konnte Cenzo nicht erkennen.
Cenzo entwirrte ihr Haar. Sie hatte fedrige schwarze Wimpern und ein kleines Kinn, und mit den geschlossenen Augen und ihrer Jugend sah sie so heiter-gelassen aus wie die Jungfrau auf einem Gemälde. Er konnte sie nicht ins Wasser zurückwerfen wie ein Stück Müll. Aus Anstandsgründen faltete er ihre Hände auf der Brust und bedeckte sie mit dem Segeltuch, das er feucht hielt, um damit die Fische zu kühlen.
Was jetzt? Nach der Bibel sollten die Toten ihre Toten begraben, und die Lebenden sollten ihr Leben weiterführen. Trotzdem … trotzdem empfand er den Tod eines so jungen Menschen fast wie einen Schlag ins Gesicht. Er hielt sich selbst nicht für einen tugendhaften Mann. Kein Überlebender konnte das tun. Aber er war kompromissfähig. In dieser pechschwarzen Finsternis hatte ihn niemand gesehen. Er konnte den Leichnam am Ponte della Paglia in Venedig ablegen, wo die Toten zur Identifizierung aufgereiht lagen, und dann seinen Fang immer noch verkaufen, bevor der Fischmarkt geschlossen wurde.
Genug! Es war entschieden! Cenzo schaute über den Bug, legte die Ruder in die Dollen und beugte sich bei jedem Schlag mit dem ganzen Oberkörper nach vorn. Nach wenigen Augenblicken hatte er seinen Rhythmus gefunden und glitt zügig auf die Grenze zwischen Nacht und Abgrund zu.
Er stellte absichtlich keine Spekulationen über die Herkunft des Mädchens an. Ein grausamer Vater, ein eifersüchtiger Liebhaber, ein selbstmörderischer Kurzschluss? Wahnsinn? Vielleicht hatte der Teufel sie geschickt, damit sie ehrliche Fischer in den Untergang lockte. Beim ersten Windstoß hisste er das Segel, auf dem das Emblem der drei Putten im Dunkeln kaum zu sehen war.
Fischer glaubten an Dämonen und Gespenster. Alle kannten die Geschichten über Männer, die, einen Tag nachdem sie ertrunken waren, ihren Platz am Tisch ihrer Familie einnahmen. Über eine wundersame Erscheinung des heiligen Angelo, der einen Sturm beruhigte. Über einen Kapitän, der eine Warnung der Madonna selbst missachtete und von einem Strudel in die Tiefe gezogen wurde. Aberglaube. Fabeln. Märchen, mit denen man Kinder erschreckte.
Er war kaum aus dem Sumpf ins offene Gewässer gekommen, als das Motorengeräusch, das er vor einer Weile gehört hatte, zurückkam, aber jetzt war es viel näher. Ein deutsches Kanonenboot kam wie eine Lokomotive auf ihn zu, und der Scheinwerfer erfasste ihn mit seinem weißen Lichtstrahl.
2
Starrend von Maschinengewehren zu beiden Seiten und auf der Brücke, beherrschte das Kanonenboot die Lagune. Die entspannten »Kameraden«, die ursprünglich in Venedig stationiert gewesen waren, hatte man durch Veteranen von der Ostfront ersetzt, und die gute Laune angesichts der frühen Siege der Wehrmacht war jetzt, im Frühling 1945, der Erschöpfung eines aussichtslosen Krieges gewichen.
Das Gehirn eines Soldaten war ein einfaches Ding, ein Verbündeter, der bis zum bitteren Ende an seiner Seite kämpfte. Es warf nicht mitten im Krieg das Handtuch und brauchte nicht gerettet zu werden, und es begrüßte den Gegner auch nicht mit Wein und Rosen. Was war Mussolini jetzt – il Duce oder ein Clown? Und was waren die Italiener anderes als Verräter?
Die Soldaten warfen eine Leine zur Fatima hinüber, zogen sie längsseits zu sich heran und winkten Cenzo, er solle sein Segel einholen und herüberkommen. Auf dem Kanonenboot stießen sie ihn grob in die Kabine, wo zwei Offiziere in grauen Uniformen im Licht einer abgeschirmten Verdunklungslampe eine Seekarte studierten. Auch wenn das Kanonenboot die Lagune beherrschte, war es nur ein Insekt im Vergleich zu einem Kampfflugzeug der Alliierten. Der ältere der beiden wirkte abgespannt, während der jüngere, sicherlich von der SS, Frustration ausstrahlte. Um seine Würde zu bewahren, stülpte Cenzo sich seine formlose Mütze auf den Kopf. Soldaten lachten über seine bloßen Füße.
»Sie sind genau der Mann, den wir suchen.« Der ältere Offizier winkte Cenzo heran. »Sie müssen uns helfen, eine Wette unter Ehrenmännern zu entscheiden. Untersturmführer Hoff befürchtet, wir haben uns verirrt.«
Der andere Offizier protestierte. »Nein, Oberst Steiner. Ich habe nur die Meinung geäußert, dass wir uns auf die einheimischen Karten nicht verlassen können. Wir trauen den Leuten hier zu viel zu. Das Fischen in einer Lagune ist wie das Fischen in einer Regentonne.«
»Stimmt das?« Der Oberst sah Cenzo an. »Ist es so einfach wie das Fischen in einer Regentonne?«
»Ja, wenn man weiß, wo die Tonne ist.«
»Genau. Hoff, Sie können selbst von einem schlichten Fischer noch etwas lernen. Es ist bekannt, dass Italiener besser fischen als kämpfen. Meine Frage also: Wo sind wir?«
»Woher soll ich das wissen?«, knurrte der Jüngere. »Es ist stockfinster.«
Der Oberst wandte sich an Cenzo. »Können Sie uns auf dieser Karte zeigen, wo wir sind?«
Seinem Blick auszuweichen war nicht möglich. Die eine Seite seines Gesichts war zerstört und grau, und vom Ohr war nur noch ein Stummel übrig, aber die Augen waren strahlend blau. Er sah aus wie eine edle Büste, an der beim Fall vom Sockel ein Stück abgesplittert war, die aber immer noch beeindruckend wirkte.
Die Maschine des Boots lief im Leerlauf. Alle schauten Cenzo an, als wäre er ein tanzender Hund. »Sie haben es sicher eilig, zum Markt zu kommen. Also zeigen Sie uns auf der Karte, wo wir sind.«
»Das kann ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Die Karte ist zu klein. Wir sind weiter im Norden, vor einem Sumpf namens San Spirito.«
»Kommt es darauf an?«, fragte Hoff. »Das hier ist doch alles ein einziger beschissener Sumpf.«
»Wenn man nicht weiß, wohin man fährt, ja«, erwiderte Cenzo.
Hoffs Blick war verschwiemelt wie bei einem Betrunkenen. »Weißt du, warum Italiener auf Händen und Knien fischen? Das ist doch die normale Stellung für einen Italiener. Fischt ihr nicht so?«
Cenzo zuckte die Achseln. »Kommt auf den Fisch an. Manche fängt man mit der Angel, andere mit dem Netz, und bei manchen muss man auf die Knie, um sie unterm Kinn zu kraulen.«
»Untersturmführer Hoff ist neu auf der Lagune. Vielleicht können Sie ihm Unterricht geben«, sagte der Oberst.
»Worin?«, fragte Cenzo.
»In den einfachen Freuden.«
»Es gibt nur eine Freude für einen Soldaten, und das ist der Dienst am Führer«, sagte Hoff.
»Das ist wahr. Habt ihr das gehört?« Der Oberst hob die Stimme, sodass alle an Bord ihn hören konnten. »Sehen Sie das auch so?«, fragte er Cenzo.
»Keine Ahnung. Ich fische nur. Nachts fische ich, und tagsüber schlafe ich.«
»Allein?«, fragte Oberst Steiner.
»Allein.«
»Und abseits der anderen Fischerboote?«
»Kommt drauf an, wo die Fische sind.«
»Und heute Nacht war es wie immer?«
»Normal, ja.«
»Sie haben nichts gesehen, nichts Ungewöhnliches gehört?«
»Ich fische und ich schlafe. Das ist alles.«
»Ein einfaches Leben.«
»Ja.«
»Zeig mir deine Papiere«, befahl Hoff.
»Habe ich nicht bei mir.«
»Du sollst sie aber immer bei dir tragen.«
»Kann ich nicht. Sie werden nass und fallen auseinander.«
»Du könntest ein Partisan sein. Oder mindestens ein Schmuggler.«
»Zeigen Sie mir Ihre Hände«, forderte der Oberst.
Cenzo hielt sie unter die Lampe. Sie waren muskulös und von Narben bedeckt.
»Die Hände sagen die Wahrheit über den Beruf eines Mannes«, erklärte der Oberst. »Und dies sind die Hände eines Fischers. Wie heißen Sie?«
»Innocenzo Vianello.«
»Und für Ihre Freunde?«
»Cenzo.«
»Aus?«
»Pellestrina.«
»Wo ist das?«, fragte Hoff den Oberst.
»Ein Dorf an der Lagune. Hinter dem Nirgendwo.«
Cenzo fiel auf, dass Steiner nicht nur Italienisch sprach, sondern sogar in den venezianischen Dialekt verfiel, der eigentlich noch einmal eine andere Sprache war.
»Nie gehört«, sagte Hoff.
»Natürlich. Zufällig heißt die Hälfte der Einwohner von Pellestrina Vianello«, sagte Oberst Steiner.
»Hut ab vor Ihren intimen Kenntnissen der lokalen Gegebenheiten«, sagte Hoff, »aber ich finde, Herr Oberst, Sie sind zu nachsichtig gegen Leute, die uns verraten haben. Es klingt ja, als hätten Sie Venedig gern.«
»Ich liebe Venedig. Meine Familie hatte eine Villa hier auf dem Lido, und meine Brüder und ich verbrachten die Sommer hier am Strand. Meine erste Oper habe ich in La Fenice gesehen. Meine erste Liebe, ein Mädchen vom Lido, habe ich in der Cabana neben unserer erlebt. Nach der Universität hier habe ich Architektur in Verona und Mailand studiert. Was glauben Sie, wie es mir geht, wenn ich die großen Tempel unserer Zivilisation in Schutt und Asche gelegt sehe? Schauen Sie sich Rotterdam an. Oder Berlin. Na los, Vianello, verschwinden Sie. Bringen Sie Ihren Fisch zum Markt, solange Sie noch können.«
Die Soldaten gingen zur Seite und machten Cenzo Platz, aber Hoff war noch nicht fertig. »Vianello, wie alt bist du?«
»Achtundzwanzig.«
»Dann musst du doch beim Militär gewesen sein. Wo?«
»In Abessinien.«
»Gegen Eingeborene mit Musketieren und Speeren. Das nennst du Krieg?«
»Mir kam es vor wie einer.«
Cenzo erinnerte sich an Hütten aus Flechtwerk und Lehm, die sich in Staubwolken auflösten, an schwarze Körper, bedeckt mit den nassen Geschwüren, die das Senfgas hervorrief, an Panzer, die im Sand festsaßen und so nützlich waren wie Teekannen in der Wüste.
Hoff folgte Cenzo an die Reling. »Angenommen, du wärst ein Admiral und würdest feststellen, dass du einen Pestkranken an Bord hast.«
»Ich bin kein Admiral, und ich habe kein Schiff.«
»Aber nehmen wir es an. Wäre es nicht deine Verantwortung gegenüber deiner restlichen Besatzung, diesen Mann zu isolieren?«
»Wahrscheinlich.«
»Und das ist im Wesentlichen die Aufgabe, die man Oberst Steiner und mir hier anvertraut hat. Das ist ein heiliges Vertrauen. Bring dein Boot näher heran.«
»Warum?«
»Weil ich es dir befohlen habe. Segelst du dieses Boot allein?«
»Ja.«
»Das muss schwer sein.«
»Mit zwei Mann geht es besser, aber einer genügt.«
»Lass mich sehen.«
»Sie wollen auf mein Boot kommen?«
»So war das gedacht.«
Cenzo packte die Leine der Fatima und zog das Fischerboot heran. Die Soldaten versammelten sich an der Reling. Cenzo hatte sie kaum beachtet, weil er hoffte, sie würden es dann umgekehrt auch nicht tun. Aber jetzt war ihre Neugier geweckt. Ein Hauch von Alkohol hing in der Luft. Die Männer hatten getrunken, das war ihm bisher nicht aufgefallen. Oberst Steiner war wieder in seine Karte vertieft. Von ihm würde keine Hilfe kommen.
Die Fatima schwankte, als Hoff hinunterstieg. Cenzo folgte ihm, Hoff schaltete eine Taschenlampe ein, und Cenzo hob in ihrem Licht feuchtes Segeltuch von den Kisten, aus denen die erstaunten Augen der Tintenfische blickten, und von anderen Kisten mit Seebrassen und Wolfsbarsch. Das Segel der Fatima war eingeholt, und eine Postkarte mit dem Bild der Jungfrau war an den Mast genagelt. Hoff ließ den Strahl seiner Lampe über Zigarrenkisten mit Haken und Nadeln wandern, über einen Dreizack und einen Kescher, über Anker und Gaff, und das alles führte zu dem Haufen Segeltuch im Bug, dessen Falten sich im Licht der Lampe in Hügel und Täler verwandelten. Was mochte darunter sein? Ein Betrunkener? Ein Hund? Ein totes Mädchen?
»Wenn wir dich schon inspizieren, machen wir es richtig«, sagte Hoff.
Er fing mit den Kisten an, aber statt die Tintenfische zu inspizieren, kippte er sie über Bord und trat die Kisten ein.
Die Soldaten hatten ihren Spaß. Manche schlugen vor, was der Leutnant als Nächstes eintreten sollte, als wäre es ein Geschicklichkeitsspiel auf der Kirmes. Cenzo fragte sich, wie sie reagieren würden, wenn Hoff das Segeltuch zurückschlug. Da würde ihnen das Maul offenstehen. Und dann?
Wieso hatte er das Mädchen aufgefischt? Er musste verrückt sein. Das Problem war der Krieg. Er sollte zu Ende sein. Aber die Amerikaner brauchten eine Ewigkeit, Mussolini führte eine Marionettenregierung, und die Deutschen kämpften immer weiter wie enthauptete Ameisen.
»Was ist unter der Plane?«, fragte Hoff.
»Sehen Sie doch nach.«
Cenzo schloss die Augen und malte sich aus, wie er nach Hause kam, empfangen von einer Parade von Kindern und miauenden Katzen. Wie er sich nach dem Baden zum Essen an den Tisch setzte: Melone mit Prosciutto, ein cremiges Risotto mit einer Karaffe kaltem Prosecco, gefolgt von einem Osso Buco und einem schweren Rotwein.
Er öffnete die Augen erst wieder, als er Hoff sagen hörte: »Der übliche Misthaufen!«
Im Flackerlicht sah Cenzo zertretene und geplatzte Tintenfische, zertrümmerte Kisten, zerfetzte Netze und zerschnittenes Segeltuch. Von dem Mädchen war nichts zu sehen. Blut hatte er nicht erwartet – die Toten bluteten nicht. Aber sie lösten sich auch nicht in Luft auf.
Erst einen Augenblick später begriff Cenzo, dass Hoff die Fatima verließ und auf das Kanonenboot zurückkehrte. Von dort genoss der Offizier die Genugtuung, einen letzten Befehl erteilen zu können. »Schaff dein Boot weg von hier! Das ist ja ein schwimmender Schweinestall, eine Schande!«
Cenzo ruderte am Rand des Sumpfs entlang. Er wusste nicht, ob das Kanonenboot ihm folgen würde, und als der Scheinwerferstrahl über das Wasser strich, war er in eine Öffnung geglitten, die so seicht war, dass das Kanonenboot nicht hereinfahren konnte. Sicherheitshalber ließ er das Segel unten und steuerte die Fatima aus einem Kanal in den nächsten, bis sie in einem Dickicht aus Schilf und Gras zum Halten kam.
Er hob seine Lampe und sah sich um. Der Schaden im Boot war nicht so schlimm, wie er zuerst befürchtet hatte. Der Fang einer Nacht war verloren, und seine Kisten waren kaputt. Harpune und Angelrute waren zerbrochen und würden ersetzt werden müssen, aber die Netze und das Segeltuch konnte man flicken. Und das Päckchen mit der gebackenen Polenta war unversehrt. Als er mit seiner Bestandsaufnahme fertig war, sprang er mit der Laterne über Bord ins hüfttiefe Wasser, um ein Netz zu bergen, das sich im Ruder verheddert hatte.
Das Mädchen war ihm ein Rätsel. Wer war sie, wo kam sie her – und wo war sie hin? Möglicherweise hatten die Soldaten vom Kanonenboot sie geholt, während er mit Oberst Steiner und Untersturmführer Hoff beschäftigt gewesen war.
Oder war sie ein Erzeugnis seiner Fantasie, das Wahnbild eines Mannes, der in einer Welt des Zwielichts lebte? Hatte jemand außer ihm das Mädchen gesehen? Und warum hatte Cenzo selbst sie den Deutschen gegenüber nicht sofort erwähnt, als er an Bord des Kanonenboots kam? Es war nicht ungewöhnlich, dass ein Fischer, der Stunde um Stunde in die Dunkelheit starrte, in einem Nebelstreif ein Gespenst sah, und wenn der Wind über eine offene Flasche strich, ein schmachtendes Stöhnen hörte.
Ein dumpfes Dröhnen ließ ihn hochschauen. Bomberverbände – britische Lancasters und amerikanische Liberators – kehrten in lockerer Formation von ihrem nächtlichen Einsatz zurück. Manche klangen gleichmäßig und fern, andere heulten mit sterbenden Motoren. Ein Bomber stand in Flammen, und sein Lärmen und buntes Leuchten erinnerte an ein Kirmeskarussell. Kein lebendes Besatzungsmitglied konnte mehr an Bord sein, aber die lodernde Maschine behielt ihre Höhe und ihren Kurs, bis sie außer Sicht war.
Cenzo hatte vor, diesen Krieg auszusitzen. Abessinien hatte ihm gereicht. Italien war in ein Land eingefallen, dessen Luftwaffe aus einem Flugzeug bestand, hatte unaufgeklärten Eingeborenen die Zivilisation gebracht und die Geburt eines neuen Römischen Reiches verkündet. Jeder Patriot hatte das Recht, sich in die Brust zu werfen und das Kinn vorzustrecken, denn jetzt war das Mittelmeer wieder Mare Nostrum: Unser Meer!
Etwas auf der anderen Seite brachte das Boot ins Schaukeln und riss ihn aus seinen Gedanken. Er war so zufrieden mit sich gewesen, dem Kanonenboot entkommen zu sein, dass er nicht auf den Gedanken gekommen war, einer der Deutschen hätte ihm folgen können.
Er stemmte sich mit den Ellbogen über den Bootsrand, bereit zum Angriff, aber was er vor sich sah, war das vermeintlich tote Mädchen. Sie saß aufrecht im Boot und biss, ohne mit der Wimper zu zucken, in seine Polenta.
3
Cenzo kannte die Strömungen und verborgenen Kanäle der Lagune, die tiefen Siele und die Inseln, die mit Ebbe und Flut bald auftauchten, bald verschwanden, und er hatte gehofft, das Mädchen sei nur eine Vision. Aber hier war sie, leckte sich die Finger und starrte ihn im trüben Licht seiner Laterne an, während sie den letzten Rest seiner gebackenen Polenta verzehrte.
»Schmeckt’s denn?«, fragte Cenzo. »Das ist mein Abendessen. Ist es gut?«
Das Mädchen antwortete nicht.
»Was machst du hier draußen?«, fragte er.
Schweigen.
»Wie heißt du?«
Kein Wort. Aber das war in Ordnung. Je weniger er über sie wusste, desto besser. Sie war wie ein Fisch, der ihm ins Boot gefallen war. Jetzt musste er sie wieder über Bord werfen. Vielleicht würde sie einfach verschwinden. Es war unnatürlich, wie sie erst da war, dann nicht. Ihr Alter konnte er nicht schätzen – irgendwo zwischen fünfzehn und zwanzig.
»Ich dachte, du wärst tot. Warst du tot? Bist du wieder lebendig geworden? Willst du es nicht sagen? Wie du willst. Ich werde dich zur Polizei bringen. Wenn dir das nicht passt, kannst du jederzeit wieder ins Wasser springen.«
Er stand auf, nahm ein Ruder und stieß die Fatima durch das Schilf. Es war eine schöne Nacht, und der Himmel war voller Sterne. Geräusche wurden weit über das Wasser getragen, und so war es gut, dass sie nicht reden wollte. Er verstand nur nicht, wie das Mädchen sich so weit vom Festland hatte entfernen können. Die Lagune war so flach, dass man an vielen Stellen durchs Wasser waten konnte, aber dazu musste man gegen die Strömungen ankämpfen, die hierhin und dorthin flossen. Auch das Sumpfland war ein Labyrinth von Kanälen, wo hier das Schilf, dort das Wasser bis an die Hüften reichte.
Als Wind aufkam, zog er das Segel wieder hoch. Die Fatima war ungefähr so elegant wie ein Holzschuh, aber gerade ihre Schlichtheit war ihre Stärke. Mit ihrem hochgezogenen Bug taugte sie auch für schlechtes Wetter, und mit ihrem platten Boden ohne Kiel konnte sie auch durch seichtes Wasser fahren. Cenzo warf einen Blick auf das Mädchen. Sie kämmte sich das Haar mit den Fingern wie eine Dame und drehte sich hin und her, um zu sehen, wo sie war. Angst hatte sie nicht, das musste er ihr lassen. Aber eine Antwort gab sie ihm immer noch nicht.
Sardinen sprangen ins Boot und schnellten auf dem Deck umher. Freiwillige, wahrscheinlich auf der Flucht vor einem Hecht, dachte Cenzo. Bevor er auf ihnen ausrutschte, warf er sie lieber wieder ins Wasser. Das Mädchen blieb sitzen, ein unwillkommener, aber entschlossener blinder Passagier. Sie ließ ihn nicht aus den Augen.
Cenzo hatte nicht unbedingt ein Herz aus Stein. Doch er sorgte für zwei Familien, und Menschen hingen von ihm ab. Er durfte kein Risiko eingehen. Vor einem Monat war die Leiche eines deutschen Soldaten in der Lagune angeschwemmt worden. Die Deutschen hatten sieben Italiener verhaftet und erschossen.
Vor ihm lag ein altes lazaretto, eine Insel, auf der man Pestopfer isoliert und verbrannt hatte. Kein schöner Nebenschauplatz der venezianischen Geschichte, aber gut geeignet, um jemanden abzusetzen, der dort gefunden und gerettet werden sollte, dachte Cenzo. Dann sah er, dass das Kanonenboot am Anleger der Insel praktisch auf ihn wartete.
Es sah aus wie eine riesige Muschel, die halb aus dem Meer ragte. Auf dem Oberdeck saß Untersturmführer Hoff rittlings am Maschinengewehr und sang mit einer lyrischen Tenorstimme: »Wie einst Lili Marleen«. Vermutlich war es nicht leicht, auf der Verliererseite eines langen Krieges den Korpsgeist noch aufrechtzuerhalten, dachte Cenzo, und eine kleine Aufmunterung war ab und zu nötig. Diese Truppe hier bestand aus wandelnden Toten. Sie hatten in Anzio gekämpft und verloren, sie hatten in Montecassino gekämpft und verloren, und sie hatten genug vom Krieg gesehen, um zu wissen, dass dieser hier für sie höchstwahrscheinlich im Grab enden würde.
Cenzo holte das Segel ein und wich dem Kanonenboot weiträumig aus. Die Fatima, einmal in Fahrt, trieb in die Mündung eines Kanals. Dem Mädchen war anzusehen, dass sie glaubte, er habe einen Handel mit den Deutschen gemacht und sei entschlossen, sie ihnen auszuliefern. Sie warf ihm einen Blick zu, der ihn in die Hölle verbannte, und sprang ins Wasser.
Hoff stieg vom Kanonenboot herunter, knöpfte sich die Hose auf und ging mit unsicherem Schritt in die Dunkelheit, um ein natürliches Bedürfnis zu erledigen. Er pinkelte fröstelnd und stellte sich dann auf die Zehenspitzen, als er das Mädchen am Ufer heraufklettern sah. Seine Geduld war belohnt worden.
Sie war am gegenüberliegenden Ufer und stieg dort zu den Wegen und Bänken eines ungepflegten Gartens hinauf. Eine Meute Ratten kam unter einem Rankendickicht hervor und floh. Eine Balustrade aus Marmor und Ziegelsteinen führte am Kanalufer entlang, und ihr war, als bewegten sich Gesichter hinter den Fenstern im obersten Stock eines Hauses. Mit pantomimischen Gebärden rief sie um Hilfe, aber die Gestalten dort oben schlurften weiter wie in traumartiger Trance umher. Sie stieß eine rostige Eisentür auf und trat ein. Zerbrochenes Glas schnitt sich in ihre Füße, und sie duckte sich, als ein Lichtstrahl sie wie ein weißer Schmetterling durch einen Korridor trieb.
»Mein kleiner Schatz«, rief Hoff auf Deutsch, »weißt du, was das hier war? Ein Heim für die Geisteskranken. Aber diese Insel war auch eine Quarantänestation für Träger des Pestbazillus. Die wurden hier festgehalten, bis sie gesund wurden oder starben. Meistens starben sie.«
Sie drückte sich in einen Raum, der als Rumpelkammer diente. Hier gab es nur noch enthauptete Heiligenfiguren, alte Installationsrohre und Fledermäuse, die wild durcheinanderflatterten. Hoff spielte mit seiner Taschenlampe, als wäre sie eine Taschenuhr an einer Kette. Er kam näher, und seine Stimme wurde nachdenklich, ja philosophisch.
»Der Krieg ist zu anonym geworden. Den Helden von heute wird man keine Oden mehr schreiben. Kein ›Horst-Wessel-Lied‹ und nichts über den ›Angriff der leichten Brigade‹. Auch in den Lagern schrumpft deine Identität auf eine Nummer auf deinem Arm. Du solltest mir dankbar sein, dass ich dir diese Würdelosigkeit erspare.«
Sie schlich hinaus in einen Hof voll verwildertem Oleander. Der Lichtstrahl der Taschenlampe spielte Verstecken mit ihr, bis sie sich hinter einen Marmorbrunnen duckte, der ihr mit seiner Skulptur des geflügelten Löwen, des Symbols Venedigs, bis an die Brust reichte. Der Lichtstrahl hüpfte über die Kacheln des Hofes immer näher an den Brunnen heran, bis das Licht ihr in die Augen schien.
»Giulia«, sagte Hoff. »Fast wärst du uns entwischt. Ja, wir hatten dich schon von der Liste gestrichen. Eine große Enttäuschung.« Er packte sie bei den Haaren, und als sie nach ihm trat, hielt er sie auf Armlänge von sich wie einen gefangenen Fisch. »Bald wirst du deinen Vater sehen. Die Zeit wird knapp.« Der offene Schlund des Brunnens inspirierte Hoff. »Quarantäne. Natürlich. Das vorgeschriebene Mittel gegen Ungeziefer.«
Doch als er sie hochheben wollte, flog sein Kopf zur Seite. Taumelnd drehte er sich um und sah Cenzo mit einem blutigen Eisenrohr in der Hand. Einfach lachhaft, dass ein so unbedeutender Mann – ein Italiener, und noch dazu ein barfüßiger Fischer – einen SS-Offizier angriff! Hoff wich Cenzos zweitem Schlag aus und riss ihm das Rohr aus der Hand. Er öffnete die Halfterklappe seiner Pistole, aber das Mädchen biss ihm in die Hand, und die Waffe fiel zu Boden. Mit einem Schlag schleuderte er sie zur Seite und begann einen Ringkampf mit Cenzo, so intim, als wäre es ein Tanz. Beide würgten einander und traten die Waffe und die Lampe hin und her. Hoff bekam die Pistole zu fassen, aber Cenzo konnte das Rohr aufheben und schlug ihm damit quer über die Stirn. Das Mädchen hob die Lampe auf und leuchtete Hoff damit in die glasig werdenden Augen. Ein Ausdruck von Fassungslosigkeit zog über sein Gesicht, dann erschlafften die Züge. Cenzo stieß den Mann über die Kante des Brunnens, wo er einen Moment lang schwebte, bevor er in den Schacht fiel. Ein dumpfer Aufschlag, und dann war es still.
Cenzo hob Rohr, Pistole und Lampe auf und warf alles hinter Hoff in den Brunnen.
Deutsche stocherten mit Taschenlampen in der Dunkelheit herum und riefen Hoffs Namen. Cenzo und das Mädchen flüchteten aus dem Hof in einen Garten. Er trug sie, denn ihre Fußsohlen waren wund, und seine waren schwielig. Außerdem kannte er die Insel schon seit seiner Kindheit. Er wusste, welche Wege ein Labyrinth bildeten, wo die Artischockendisteln mannshoch wuchsen und wo wilde Ziegen zwischen den Olivenbäumen umherstreunten. Auf einem Pfad, der sich durch die Dunkelheit schlängelte, brachte er sie zum Wasser. Dort setzte er sie ab, und sie wateten zum Heck der Fatima.
Cenzo nahm an, dass ein paar Deutsche an Bord des Kanonenbootes geblieben waren. Er gab dem Mädchen die Bugleine zum Halten und schob die Fatima vom Gras hinaus ins Wasser. Dann ruderte er im Stehen und mit beiden Händen. Er stemmte sich mit seinem ganzen Körper in jeden Schlag, und die Ruderblätter hinterließen kleine Wirbel auf der Wasseroberfläche. Die Rufe auf der Insel verhallten hinter ihnen, aber Cenzo zog das Segel erst auf, als sie wirklich außer Hörweite waren und auch der Scheinwerfer des Kanonenboots sie nicht mehr erreichen konnte.
»Die Deutschen werden ihren Freund im Dunkeln nicht sofort finden, aber sie sind gründlich. Finden werden sie ihn. Dann werden sie dich und mich suchen. Wenn du also irgendwohin kannst, müsstest du es jetzt sagen.«
Sie schwieg.
»Der Deutsche hat dich Giulia genannt«, sagte er. »Ist das dein Name?« Es war, als wollte er eine Muschel mit bloßen Fingern öffnen. »Giulia, warum hat der SS-Mann von einer Liste gesprochen? Was für eine Liste hat er gemeint? Eine Namensliste? Mit jüdischen Namen?« Sie antwortete nicht. »Vielleicht verstehst du es noch nicht: Verglichen mit einem Kanonenboot ist die Fatima nicht viel schneller als – na ja, als ein Korken, der auf dem Wasser schwimmt. Ich kann einfach nicht glauben, dass dein ganzer Plan darin bestand, einfach ins Wasser zu springen.«
Sie zuckte zusammen, als er auf sie zukam, und zog sich seine Jacke um die Schultern. Solange sie schwieg, war sie ein Rätsel. Cenzo wusste nichts über sie, und über die SS wusste er nur, dass es zwei Gruppen von Leuten gab, die sie so wütend verfolgte wie das Mädchen Giulia: Partisanen und Juden. Und natürlich die Leute, die ihnen halfen.
»Giulia?«, fragte er noch einmal, doch die Erschöpfung forderte ihren Tribut, und das Mädchen war eingeschlafen. Cenzo schaute hinauf zum Himmel, zu den Sternbildern, die ihn getröstet hatten, als er ein kleiner Junge war.
Als das Mädchen aufwachte, war der Himmel hell und blau, und die Fatima hielt auf ein paar verwitterte Hütten zu, die auf Pfählen im Wasser standen. Cenzos Hütte war am weitesten vom Ufer entfernt. Er reffte das Segel, machte an seinem Anleger fest und ließ das Mädchen eine Leiter hinaufklettern.
Die Hütte war mit genügend Werg abgedichtet, um ein Boot zu kalfatern. Sie hatte Bullaugen anstelle von Fenstern, und durch Lücken im Boden konnte man in das Wasser darunter schauen. Gummistiefel standen neben einer Seekiste und einem Wäschesack. Zwieback und Käse hingen in einem Netz unter der Decke, wo die Ratten nicht herankommen konnten. In einer Ecke lagen zusammengerollte Fischernetze. Ein Tisch aus Apfelsinenkisten hatte Schubladen für Besteck, Papier, Schnur und Flicknadeln. An einer Wand waren Kleiderhaken befestigt, ein Gemälde an einer anderen zeigte ein Fischerboot auf stürmischer See. Auf dem Boden reihten sich Gläser mit Pinseln, eine Zigarrenkiste mit Farbtuben und Terpentin und eine mit Farbe beschmierte Palette.
»Zieh die nassen Sachen aus.« Cenzo warf ihr ein trockenes Hemd und eine Hose zu, steif vom Salz, und schnitt ein Stück Tau von einer Rolle ab, das sie als Gürtel benutzen konnte. Er kehrte ihr den Rücken zu, während sie sich umzog, und er stellte sich vor, wie er in ihren Augen aussah: ein wilder Mann, halb bekleidet, mit zerzaustem Haar, dunkelhäutig wie ein Inder.
»Jetzt setz dich hin.« Sie gehorchte zögernd, und er untersuchte ihre Füße. Sie waren eher zerkratzt als zerschnitten – erstaunlich nach einem Lauf über die Glasscherben. Bei Licht hatte er das Mädchen noch nicht genauer betrachtet. Herrisch sah sie aus, mit glattem Haar und einem spitzen Kinn. Cenzo hielt ihr zugute, dass die Welt, die sie sah, ein Ort war, an dem ihr Name auf einer Liste stand. Das Mädchen wurde von Geistern verfolgt.
»Giulia, ich heiße Cenzo. Mein Boot ist die Fatima, und das hier ist mein … mein Palast, sozusagen. Entscheidend ist, du bist hier in Sicherheit, solange du dich nicht sehen lässt. Die Fatima ist beschädigt, und ich brauche Material, um sie zu reparieren. Aber Kollaborateure und Faschisten werden mich im Auge behalten. Ich muss mich normal benehmen und tun, was ich immer tue. Ich werde zum Haus meiner Mutter gehen, dort baden, in die Bar gehen und ein bisschen Karten spielen. Tut mir leid, doch das alles wird Stunden dauern. Mach keine Dummheiten – versuch zum Beispiel nicht, über die Lagune zu schwimmen. Das geht nicht. Und vor allem, rühr die Farben nicht an. Bis jetzt habe ich das Kanonenboot noch nicht gesehen, und auch keine SS. Aber wer weiß? Vielleicht haben sie den Offizier noch nicht gefunden, und wenn sie ihn gefunden haben, nehmen sie vielleicht an, er war so betrunken, dass er in den Brunnen gefallen ist. Vielleicht haben sie auch keinen Sprit mehr. Möglich ist alles. Hunger?«
Er nahm den Käse herunter und schnitt ihr ein Stück ab. Sie beobachtete Cenzo misstrauisch, während er eine Flasche Grappa hervorkramte. Hausgebrannter Grappa, und schon der Dunst verschlug ihr den Atem.
»Hör zu, ich verstehe nichts von solchen Geschäften. Ich will versuchen, dir zu helfen, aber du musst sehr vorsichtig sein. Du hast bestimmt schon von amerikanischen Piloten gehört, die von Partisanen gerettet und in Sicherheit gebracht wurden? Ich habe jedoch noch nie einen dieser Helden gesehen.«
»Byron«, sagte sie.
Er war überrascht. »Wer?«
»Byron, der berühmte Dichter. Er ist durch die Lagune geschwommen.« Ihre Stimme war brüchig, weil sie so viel Salzwasser geschluckt hatte.
»Tatsächlich?«
»Ich möchte mitkommen«, sagte sie.
»Das geht nicht. Und ich werde keinen Helden für dich finden, wenn ich hierbleibe.«
»Du bist keiner?«
»Allmählich kapierst du.«
4
Das Fischerdorf Pellestrina lag eingeklemmt zwischen der Lagune auf der einen und dem Meer auf der anderen Seite. Einfache zweigeschossige Häuser standen so dicht zusammen, dass sie einander fast berührten. Was wollte man erwarten von einer Gemeinde, die in ihrem verbissenen Kampf gegen das Meer regelmäßig von acqua alta heimgesucht wurde? Zum Rest des Dorfes gehörten ein Wellenbrecher, den die Römer, und ein Bunker, den die deutsche Wehrmacht gebaut hatten. Heiligenfiguren balancierten kippelig auf dem Dach der Kirche, müde vom Hinausschauen aufs Meer. Am Südende des Dorfes gab es eine Bar und eine Grotte Unserer Lieben Frau von Fatima, doch das Leben im Dorf drehte sich um die Fischerboote, die hier knarrend am Steg dümpelten. Ihr Bug war mit orientalischen Augen bemalt, und die Segel trugen das bunte Emblem ihres Eigners: einen bellenden Hund, ein Einhorn, einen lodernden Märtyrer.
Zwei alte Fischer sogen an ihren Pfeifen und sahen zu, wie Cenzo sein Netz über das Pflaster am Kai ausbreitete. Enrico und Salvatore Albano waren so runzlig und braun von der Sonne, dass man sie für Baumstämme halten konnte.
»Dein Netz ist ja ganz zerrissen. Hattest du Streit mit einem Schwertfisch?«, fragte Enrico.
»Um mit einem Schwertfisch zu kämpfen, braucht man ein Schwert«, sagte Salvatore. »Willst du meins ausborgen? Es ist rostig, aber einsatzbereit.«
»Klingt ja furchterregend«, sagte Cenzo. »Vielleicht erschreckst du den Schwertfisch damit zu Tode.«
»Touché!« Auf diesem Witz würden sie jetzt eine Stunde herumkauen können.
Er ließ ihnen sein Segel zum Flicken da. Damit konnten sie sich ein bisschen Kleingeld verdienen, und sie hatten etwas zum Reden. Sie tratschten nicht weniger als die alten Frauen, und er wusste, was sie über ihn sagten. Er war Innocenzo Vianello, der Mann, der mit der schönsten Frau von Pellestrina nicht ins Bett gehen wollte.
Cenzo ging in das Geschäft für Fischereibedarf, um Ersatz für das zerbrochene Ruder, die Harpune, die Eimer und Kisten zu beschaffen, die Hoff zerbrochen hatte. Die nächste, wichtigere Station war Nidos Bar.
Die Bar hatte keinen Namen außer dem des Eigentümers, Nido. Sie hatte eine lange Theke aus Mahagoni, eine Espressomaschine so groß wie eine Dampflokomotive und lauwarme Flaschen mit Grappa, Wein und anderen Spirituosen. Ein Wandbild aus Muscheln stellte eine Karte von Venedig und der Lagune dar.
Nidos Schädel war so blank wie eine Billardkugel. Er war Boxer gewesen und hatte die Welt gesehen. An der Wand hingen Fotos, die ihn zeigten, wie er mit erhobenen Fäusten neben Georges Carpentier, Max Schmeling und Primo Carnera posierte.
»Der arme Primo«, sagte Nido. »Ich fürchte, er dachte, ich hätte den bösen Blick.«
»Warum?« Cenzo liebte Nidos Boxergeschichten.
»Diese Geschichte von Primo habe ich dir noch nie erzählt. Als Amerika in den Krieg eintrat, ließ Mussolini einen Wochenschaufilm drehen, in dem ein italienischer Held gegen einen amerikanischen Neger kämpfte. Sie engagierten Primo als den Italiener, aber sie konnten nirgendwo in Italien einen Negerboxer finden. Also gaben sie sich mit einem Nordafrikaner zufrieden. Mit einem Musiker ausgerechnet. Zwei von uns kriegten den Auftrag, ihm das Boxen beizubringen. Beim Klang des Gongs kam der Musiker aus seiner Ecke gerannt, schlug einmal zu, und Primo war k. o. Das muss doch der böse Blick gewesen sein.«
Salvatore und Enrico kamen herein und gingen durch die Bar nach hinten. Draußen standen Tische unter einem Spalier aus Weinranken. Ein Kartenspiel war im Gange, und sie setzten sich dazu. Hände, die schwielig waren vom Fischen, hielten die Karten, und ab und zu rief jemand: »Sette!«, wenn er gewann, und »Merda!«, wenn er verlor.
»Ist nicht so, als ob sie Geld hierließen«, sagte Nido zu Cenzo. »Ich würde sie ja rauswerfen, aber sie sind die zuverlässigsten Gäste, die ich habe. Außerdem, wo sollten sie sonst hin?«
»Du hast ein weiches Herz«, sagte Cenzo.
Die Brüder Albano grinsten und gackerten miteinander. Sie hatten ihr Leben lang Karten gespielt. Jetzt war es, dachte Cenzo, ein Wettlauf zwischen Altersweisheit und Altersschwachsinn.
»Wie wär’s mit einem Grappa?«, fragte Salvatore.
Enricos Augen wurden feucht bei diesem Gedanken. »Sehr freundlich.«
Salvatore kam schlurfend von der Bar zurück und lächelte. Er pfiff durch die Lücke, die ein Goldzahn hinterlassen hatte, den er für die Kriegsanstrengung gespendet hatte.
»Schwerter sind Trumpf«, verkündete Enrico und wackelte mit dem Kopf hin und her.
»Was denkst du?«, fragte Nido und sah Cenzo an.
»Ich denke, das bin ich in dreißig Jahren.«
»Ha!«, sagte Enrico. »Der ist nicht so unschuldig, das sage ich dir. Die Weiber kommen und gehen bei dem.«
»Er muss ihnen ausweichen wie ein Stierkämpfer«, fügte Salvatore hinzu.
»Diese Celestina hat einen Arsch wie ein Maserati«, schwärmte Enrico.
»Jetzt habe ich es vergessen. Was ist Trumpf?«, fragte Salvatore.
»Diese Celestina.« Enrico lächelte selig. »Sie ist eine echte nonpareil.«
»Wie war’s beim Fischen?«, fragte Nido.
»Die Nazis waren früh unterwegs«, erwiderte Cenzo.
»Auf der Lagune? Was wollten sie da?«
»Weiß der Teufel. Sie haben mir ein paar Sachen kaputt gemacht und das Boot verwüstet.«
»Und dein Fang?«
»Haben sie zertrampelt.«
»Dann bist du hier richtig. Nicht mal der Teufel kommt hierher.« Nido schenkte zwei Gläser Wein ein. »War das alles?«
»Ich glaube, ja.«
Nido beugte sich über die Theke. »Ich sag dir, was ich gehört habe. Letzte Nacht haben die Deutschen eine Razzia in der psychiatrischen Klinik auf San Clemente gemacht. Da waren Juden versteckt, und ein paar haben sich in die Lagune hinausgeflüchtet.«
»Da müssen sie aber ziemlich verzweifelt gewesen sein.«
»Müssen sie wohl. Sogar der Papst versucht jetzt, ihnen zu helfen. Wenn du ein Jude bist, der darauf gewartet hat, dass der Papst dir hilft, dann ist es jetzt zu spät, mein Freud. Zu spät. Trink aus.«
Der Wein war so sauer, dass Cenzo die Augen brannten, aber Nido trank ihn, als wäre er weich wie Seide. »Als die Deutschen dein Boot verwüstet haben, hast du keinen Widerstand geleistet oder sonst eine Dummheit gemacht?«
»Ich doch nicht.«