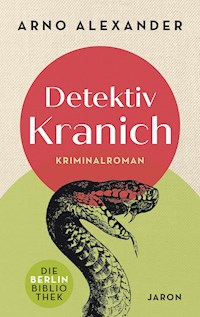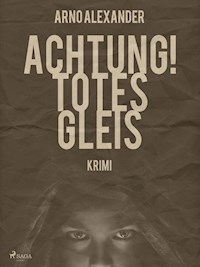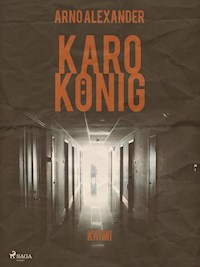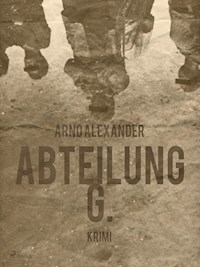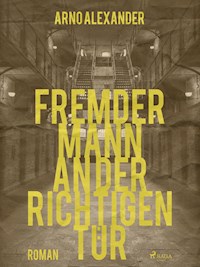Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es beginnt damit, das ein Kind entführt wird. Mr. Harrogate ist verzweifelt und aufgebracht. Vier Detektive der New Yorker Polizei sind daran gescheitert, ihm seinen Sohn wiederzubringen. Auch von Inspektor Bath, der nun mit der Sache betraut wird, hält Harrogate nicht viel: dieses schmächtige Bürschchen mit der großen Hornbrille und der gelben Gesichtsfarbe – ausgerechnet ein Japaner! Da wendet er sich lieber an den Detektiv Flannagan, auch wenn der als ausgemachter Säufer und unzuverlässiger Mensch gilt, der aufgrund seiner Mängel aus dem Polizeidienst entlassen wurde. Dennoch soll Flannagan ausgesprochen tüchtig sein. Aber kaum hat sich Flannagan des Falles angenommen, wird er auch schon heimtückisch vergiftet. Inspektor Bath wiederum kommt zu dem Schluss, dass die Spur zu dem entführten Jungen über den Verbrecherboss McGregor führen muss. Doch an diesen heranzukommen ist nicht ganz ungefährlich ... Mit "Im Schattenkasten" ist Arno Alexander ein packender, höchst fantasievoller und ungewöhnlicher Kriminalroman gelungen, den der Leser und die Leserin, einmal angefangen, am liebsten nicht wieder aus der Hand legen will. Vor allem die Gestalt der schönen und mutigen Tamara Harrogate, der Schwester des Entführten, die eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der Verbrechen spielt, macht die wie ein Wirbelwind vorbeisausenden Geschehnisse zu einem unvergesslichen Erlebnis.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arno Alexander
Im Schattenkasten
Kriminalroman
Im Schattenkasten
© 1949 Arno Alexander
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711626016
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
I.
Mr. Harrogate hatte seinen Bericht beendet. Alles, was ein schmerzerfüllter Vater dem Leiter einer völlig unfähigen Polizei sagen konnte, war gesagt worden, und Mr. Harrogate empfand jetzt neben der Erleichterung, die ihm sein Erguß verschafft hatte, auch ein Gefühl der Leere und Hoffnungslosigkeit. Was für einen Zweck hatten denn seine langen Auseinandersetzungen? Würden sie ihm sein Kind wiederbringen? Und nur darauf allein kam es ihm doch an!
Lincoln, Chefinspektor der New Yorker Polizei, hatte seinen Besucher aufmerksam angehört und dabei auf einen Bogen Papier ein sauber gezirkeltes Fragezeichen neben das andere gemalt. Diese Zeichen bezogen sich aber in keiner Weise auf die Rede Mr. Harrogates.
„Drei Detektive haben versagt, behaupten Sie“, meinte Lincoln nach kurzem Schweigen nachdenklich und betrachtete seine Fragezeichen.
„Vier Detektive!“ betonte Mr. Harrogate aufgebracht.
„Es waren wirklich nur drei“, widersprach der Chefinspektor sanft.
„Vier waren es!“ rief Harrogate mit erhobener Stimme. „Vier versagten — einer nach dem anderen. Was jetzt? Denken Sie vielleicht, ich warte, bis alle Ihre Detektive ihre Unfähigkeit bewiesen haben? Nein, ich weiß, was ich tue: Ich gehe zu Flannagan!“
Die letzten Worte hatte er im Tone einer furchtbaren Drohung hervorgestoßen, und sie verfehlten ihre Wirkung auch nicht ganz: Lincoln sah überrascht auf, musterte eine Weile das hagere, bleiche Gesicht seines Gegenübers, und dann nahmen seine Züge den Ausdruck eines mitleidigen Zweifels an.
„Flannagan?“ sagte er gedehnt. „Haben auch Sie schon von ihm gehört? Ein ausgesprochener Säufer, ein durch und durch unzuverlässiger Mensch, den wir aus dem Dienste entlassen mußten — — —“
„Er soll aber sehr tüchtig sein!“
„Tüchtig? Er war es vielleicht einmal, aber jetzt hat sein Geist schon merklich gelitten, und das wirkt sich bei der Arbeit aus. Und außerdem — was wollen Sie? — Ich glaube nicht, daß Flannagan einen Auftrag von Ihnen annehmen wird.“
„Warum nicht?“ fragte Harrogate heftig.
„Er behauptet, er arbeite nicht für Geld, sondern nur. wenn es ihm Vergnügen mache.“
Harrogate lachte gereizt auf.
„Das wird sich schon geben. Den Menschen möchte ich sehen, der einen Auftrag Harrogates ablehnt!“
„Gehen Sie zu Flannagan, und Sie werden ihn sehen“, erwiderte Lincoln ruhig. „Das können Sie tun oder auch lassen — ganz wie Sie wollen. Ich denke darüber, wie ein Arzt über die Wirkung eines harmlosen Kräutertees denkt: Es wird nicht nützen, kann aber jedenfalls nicht schaden. Neben diesem Kräutertee muß aber der Kranke eine wirkliche Arznei bekommen. Und darum will ich Ihre Sache jetzt meinem besten Mann, dem Detektiv Bath übergeben — — —“
„Ich will von Ihren Detektiven nichts mehr wissen! Ich — — —“
„Bath wird Ihnen helfen, bestimmt.“
„Wenn das so sicher ist, — warum übergaben Sie ihm den Auftrag nicht gleich?“
„Erpressungsfälle dieser berüchtigten Bande übergeben wir Bath nur im äußersten Fall, weil nämlich — — —“
Lincoln schwieg.
„Gut“, erklärte Harrogate düster. „Ich bin bereit, Ihrem Rate zu folgen und mit diesem Bath mein Glück zu versuchen. Wollen Sie ihn hereinrufen, damit wir ihm gemeinsam den Fall erklären?“
Lincoln nickte. Dann nahm er den Hörer ab und gab durch den Fernsprecher einige Weisungen.
„Halt“, sagte Harrogate plötzlich. „Ist Ihr Bath wenigstens waschechter Amerikaner?“
Es klopfte.
„Er ist amerikanischer Bürger, so gut wie Sie und ich“, versetzte der Chefinspektor mit einem schwachen Lächeln. Dann rief er laut: „Herein!“
„Das ist unser Detektiv Bath“, sagte er gleich darauf und wies auf den eingetretenen noch ziemlich jungen Mann.
Nur mit Mühe unterdrückte Harrogate einen Ausruf des Unwillens: Der Mann sah schmächtig aus und war klein von Wuchs, er trug eine große Hornbrille, und seine Gesichtsfarbe war gelb. Es konnte auch gar nicht anders sein denn der Detektiv Bath war durch und durch — Japaner.
II.
Eine halbe Stunde später verließ Mr. Harrogate das Gebäude des Polizeihauptquartiers. Sein Gesicht drückte deutlich erkennbar Unzufriedenheit aus, — noch mehr Unzufriedenheit als vor anderthalb Stunden, da er das Gebäude betreten hatte.
Er ging an einen harrenden Wagen heran, öffnete den Schlag und nahm neben seiner Tochter Platz, die am Steuer saß.
„East 23-rd Street?“ fragte sie kurz.
Er nickte schweigend, und der Wagen setzte sich in Bewegung.
In der East 23-rd Street wohnte der Privatdetektiv Flannagan. Ohne daß Harrogate seiner Tochter auch nur ein Wort über seine Unterredung mit dem Chefinspektor gesagt hatte, war zunächst doch alles Wichtige zwischen ihnen besprochen. Wenn der Vater zu Flannagan fuhr, bedeutete es, er sei mit dem Erfolg seiner Unterredung nicht zufrieden. Dasselbe sagten die senkrechten Falten auf seiner hohen Stirn. Wozu also Fragen stellen?
„Tamara …“, begann Harrogate nach einer Weile, dann schwieg er wieder nachdenklich.
Seine Tochter hieß tatsächlich Tamara. Den schweren Fehler, den er begangen, als er seinem ersten Kind diesen gar nicht amerikanischen Namen gab, konnte sich der Patriot Harrogate nie verzeihen. Er mußte verrückt gewesen sein — das war seine ehrliche Überzeugung bis auf den heutigen Tag. Es war eine Nottaufe gewesen — das Leben von Mutter und Kind schwebte tagelang in Gefahr —, und als der herbeigerufene Pfarrer im letzten Augenblick nach dem Namen fragte, den das Kind bekommen sollte, da stellte es sich heraus, daß Harrogate alle die schönen Namen, die er und seine Frau schon lange vorher ausgesucht, vergessen hatte, einfach vergessen! In seinem Schmerz und in seiner Angst fiel ihm nur der Name Tamara ein, der aus einem kürzlich gelesenen russischen Roman stammte. So kam es, daß die Tochter eines amerikanischen Patrioten einen ganz und gar nicht amerikanischen Namen erhielt.
„Tamara!“ sagte Harrogate wieder, und dann erzählte er zornig von seiner Besprechung mit Lincoln und von deren geringen Erfolgen.
„Einen Japaner!“ rief er endlich aus. „Ausgerechnet einen Japs hat er mir zugedacht! Wie findest du das?“
Tamara überholte erst einen Wagen und winkte freundlich einem Polizisten zu, der seine Hand nach dem Notizbuch ausgestreckt hatte und der daraufhin sofort seine böse Absicht aufgab, sie wegen zu schnellen Fahrens aufzuschreiben. Dann blickte sie schräg zu ihrem Vater auf.
„Das ist natürlich schrecklich“, stellte sie fest. „Aber schließlich kann ein Japaner ganz tüchtig sein, und ein Mann, der zu der Erpresserbande Verbindung hat, eignet sich wohl am besten dazu, uns das Kind wiederzufinden.“
„Aber es ist dennoch schrecklich“, beharrte er.
„Gewiß“, bestätigte sie freundlich, worauf er, zufrieden über die Übereinstimmung ihrer Meinungen, ein paarmal nickte.
Der Wagen hielt.
„Im fünften Stock muß es sein“, rief Tamara dem aussteigenden Vater nach. Dann machte sie sich daran, ihr Gesicht im Handspiegel zu betrachten und alle etwaigen Mängel zu verbessern. Es gab aber nichts zu verbessern, denn Tamara war sehr schön, allerdings nicht ganz nach dem amerikanischen Geschmack. Man hätte das blonde Mädchen mit den klugen, entschlossenen Gesichtszügen und den hellen, blauen Augen viel eher für eine Schwedin gehalten.
Das Haus, in dem Flannagan wohnte, machte einen unfreundlichen, düsteren Eindruck. Zu Mr. Harrogates großem Mißvergnügen gab es hier nicht einmal einen Fahrstuhl. Ob er wollte oder nicht, er mußte sich an die saure und ungewohnte Arbeit machen, fünf Stockwerke hochzuklettern. Es war daher begreiflich, daß sich seine Stimmung keineswegs verbessert hatte, als er endlich schwer atmend mit der Faust gegen eine Tür hämmerte, denn es mangelte hier sogar eines Klingelknopfes.
„Mr. Flannagan zu sprechen?“ herrschte er ein junges Mädchen an, das einen schauerlichen Eindruck auf ihn machte. Sie hatte die Tür geöffnet, stand da und starrte ihn an, als sei er ein Wesen aus einer anderen Welt. Er betrachtete sie prüfend, und seinen Blicken entging nichts: Weder ihr zerzaustes Haar, noch der gewöhnliche Gesichtsausdruck; auch nicht der zerrissene Rock und die ausgetretenen Hausschuhe.
„Mr. Flannagan?“ fragte sie und sah ihn recht blöde an. „Mr. Flannagan — — —?“
„Natürlich Mr. Flannagan!“ sagte er böse. „Habe ich das nicht deutlich genug gesagt?“
Sie trat beiseite und machte eine hilflose Bewegung mit der Hand. Diese Bewegung konnte ebensogut eine Aufforderung näherzutreten sein, als auch der Ausdruck von Abwehr. Harrogate faßte es so auf, wie er es wollte und trat in den dunklen Vorraum ein. Jetzt vernahm er aus einem der Zimmer deutlich das Grölen und Kreischen von Stimmen, und bei diesen Lauten machte er unwillkürlich einen Schritt zurück. Dann aber dachte er an sein Kind und an alles, was er über die Fähigkeiten dieses Flannagan gehört hatte, und wandte sich heftig an das Mädchen:
„Führen Sie mich zu Mr. Flannagan, Nun? Was stehen Sie da und stieren mich an? Nein, ein solches Dienstmädchen ist mir doch Zeit meines Lebens noch nicht vorgekommen.“
„Ich bin gar kein Dienstmädchen“, sagte das zaghafte junge Mädchen plötzlich sehr laut.
„Nicht das Dienstmädchen?“ wiederholte er. „Sie sind nicht das Dienstmädchen von Mr. Flannagan?“
„O nein“, erwiderte sie. „Ich bin seine Braut.“
Harrogate schluckte ein paarmal, ehe er ein Wort hervorbringen konnte.
„Alle guten Geister …“ murmelte er endlich erbittert. „Wo … wo ist Ihr … hm … Bräutigam?“
„Dort“, sagte sie und wies auf eine Tür.
Harrogate klopfte entschlossen an und trat ein.
Das, was et jetzt zu sehen bekam, hatte er noch nie gesehen. Er hätte ein ähnliches Bild in irgendeinem Film sehen können, aber Mr. Harrogate ging nie ins Kino. Drei, nein vier junge Männer saßen mehr liegend als sitzend um einen Tisch herum und spielten Karten. Das Zimmer war so vollgequalmt, daß man kaum zwei Schritte weit sehen konnte, und auf dem Tisch erschienen daher wie in fernem Nebel ganze Wälder von Flaschenköpfen. Auf dem Boden lagen zerbrochene Gläser in schmierigen, dunklen Pfützen. Die Männer selbst hatten die Röcke abgelegt und die Westen aufgeknöpft, so daß man ihre wenig sauberen Hemden sehen konnte.
„Harrogate ist mein Name“, erklärte der Eingetretene. „Wer von Ihnen ist Mr. Flannagan?“
Einer der jungen Männer — vielleicht der wildeste von ihnen — hob bedeutsam den Zeigefinger. Eine deutlichere Antwort zu geben, schien er für überflüssig zu halten.
„Also Sie — — —!“ sagte Harrogate und bohrte seinen Blick durch den Rauchnebel in den jungen Mann. Aber vergeblich suchte er in diesem Gesicht nach Spuren von dem vielgerühmten Geist; er sah das Gesicht eines Mannes, der dem Alkohol völlig verfallen schien. Alles in seinem nicht häßlichen Gesicht war unklar, verschwommen; nichts deutete auf Tatkraft oder Geist. Die hohe Stirn vielleicht? Ja, er schien wenigstens eine hohe Stirn zu haben, aber auch davon sah man nicht viel, da seine zerrauften, schwarzen Haare ihm tief ins Gesicht hingen.
„Ich bin Harrogate“, sagte der Besucher nach einer Weile mit Nachdruck und schwieg erwartungsvoll.
Die Lippen Flannagans verzogen sich zu einem Grinsen.
„Ich bin Flannagan“, sagte er im selben Tonfall, mit derselben Miene wie Harrogate. Seine drei Freunde brachen in ein schallendes Gelächter aus, das aber unter Flannagans drohendem Blick sofort wieder verstummte.
„Sie kennen mich nicht?“ fragte Harrogate ein wenig erstaunt. Er war tatsächlich eher erstaunt als verärgert darüber, daß ihn dieser junge Mann nicht zu kennen schien.
„Ich kenne Ihre Gummifabrik“, erwiderte Flannagan ruhig.
„Das genügt“, versetzte Harrogate und hatte nicht die geringste Lust, darüber nachzudenken, was Flannagan mit seinen letzten Worten eigentlich gemeint haben konnte. „Hauptsache ist, Sie wissen: Vor Ihnen steht ein Mann, der gut bezahlt, sehr gut bezahlt, wenn man ihm einen Dienst erweist.“
Flannagan schüttelte den Kopf.
„Ich erweise keinerlei Dienste, niemandem!“ sagte er und wurde dabei etwas heftig. „Ich brauche Ihr Geld nicht, und ich denke auch nicht ans Arbeiten. Wenn Sie Ihren Sohn wiederhaben wollen, müssen Sie sich an andere wenden.“
„Wir werden uns schon einigen“, lautete die vorsichtige Antwort Harrogates. „Ich sehe, Sie wissen über meine Sache schon Bescheid. Das ist gut, das ist sehr gut! Das erleichtert den Fall, nicht wahr? Ich denke, auch Sie sind der Meinung, mein Sohn könne noch gerettet werden? Nicht wahr, Mr. Flannagan?“
„Ihren Sohn hat die McGregorsche Bande geraubt“, sagte Flannagan. „Ich verrate damit kein Geheimnis, denn das weiß sogar die Polizei. McGregor wollte von Ihnen ein Lösegeld von zweihunderttausend Dollar. Sie haben nicht gezahlt, sondern die Polizei verständigt. Dafür wird McGregor jetzt zur Strafe Ihren Jungen umbringen. So liegt der Fall. Und da ist gar nichts zu machen. Gar nichts.“
Von diesen bestimmten Äußerungen war Harrogate so niedergeschmettert, daß er sich auf den einzigen noch freien Stuhl niederließ, ungeachtet dessen, daß dieser Stuhl einen recht unsauberen Eindruck machte.
„Aber … aber ich will doch jetzt zahlen“, stöhnte er. „Ich habe es den Kerlen geschrieben, mehrmals geschrieben …“
„Das nützt nun nichts mehr“, erklärte Flannagan erbarmungslos. „Was McGregor sagt, das tut er auch. Und er wird an Ihnen — wie man so sagt — ein Exempel statuieren, zur Warnung für alle anderen, die je noch Lust bekommen sollten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Übrigens ein ganz vorzüglicher Gedanke. Der Fall wird Eindruck machen, einen tiefen Eindruck machen. Ich bin überzeugt davon.“
„Sie sind unmenschlich“, murmelte Harrogate verstört. „Sie nehmen mir die letzte Hoffnung … Vielleicht tun Sie es nur und reden so nur, weil Sie getrunken haben. Ich hätte wiederkommen sollen, wenn Sie nüchtern sind …“
„Hahaha!“ lachte Flannagan auf. „Mit Flannagan können Sie nur reden, wenn er besoffen ist. Nüchtern sind seine Gedanken nicht fünf Cent wert. Hach! Können Sie mir vielleicht fünf Dollar leihen? Ich verachte Ihr Geld, und Sie bekommen es auch bestimmt zurück — — —“
„Hier sind zwanzig Dollar“, sagte Harrogate hastig und reichte dem Hausherrn einen Schein. „Und von Zurückgeben wollen wir — — —“
Aber Flannagan hörte nicht mehr auf ihn.
„Tamara!“ brüllte er aus vollem Halse. „Tamara, komm her, holdes Mädchen!“
„Wer ist … Tamara?“ fragte Harrogate entsetzt, aber er ahnte schon die Antwort.
„Meine Braut“, sagte Flannagan ruhig. „He, Tamara!“ rief er dem eintretenden Mädchen zu. „Hol Bier! Zehn Flaschen! Fünfzehn Dollar bringst du dem Herrn hier zurück, verstanden? Ich bin kein Bettler. Ich habe fünf Dollar gepumpt und nehme nicht zwanzig geschenkt. Übrigens ist das ganz dasselbe — von einem höheren Standpunkt aus betrachtet. Also, Tamara, zehn Flaschen Bier, und dann zwei Flaschen Spiritus von Thomson. Und für den Rest etwas zu essen.“
Tamara verschwand lautlos, schweigend, einen üblen Küchengeruch hinterlassend.
„Ich bin überzeugt, Sie könnten mir helfen“, begann Harrogate aufs neue.
„Ich kann nicht, und ich will nicht“, war die störrische Antwort. „Trinken Sie ein Glas Bier mit? Nein? Ist Ihnen wohl zu gewöhnlich? Tut mir leid, Champagner führen wir nicht. Hahaha!“
„Sie sagten mir, McGregor täte immer das, was er verspricht“, fuhr Harrogate unbeirrt fort. „Aber wissen Sie denn, was er mir geschrieben hat? Den Kopf meines Kindes würde er mir schicken, ja, zum Beweise, daß mein Kind tot sei.“
„Wird er tun, verlassen Sie sich darauf. Was McGregor sagt, das gilt.“
„Haben Sie denn gar kein Mitgefühl? Ich biete Ihnen fünfzigtausend Dollar, wenn Sie mir mein Kind lebend wiederbringen. Fünfzigtausend!“
„Ich brauche Ihr Geld nicht!“ rief Flannagan erzürnt. „Haben Sie das denn noch immer nicht begriffen? Sie können ebensogut sagen: fünfhunderttausend. Ich will nicht, ich will nicht, und ich will nicht!“
Tamara trat ein und brachte einen Korb mit Flaschen, die sie schnell auf dem Tisch gegen die leeren vertauschte.
„Trink nicht so viel“, raunte sie Flannagan zu, aber er stieß sie rauh von sich und goß sich ein Glas voll Spiritus und Bier und trank dieses Gemisch in einem Zuge aus.
„Ich verkomme, ich gehe zugrunde!“ brüllte er und lachte. „Nun gut, das sagen sie alle, alle! Auch Sie, Mr. Harrogate sind dieser Meinung, aber Sie haben nicht die Spur von Mitgefühl. Sie wollen mich nur ausnützen! Ha! Und wenn Sie etwa Mitgefühl hätten, dann … dann hätte ich Sie schon längst zum Teufel gejagt. Flannagan braucht euer Geld nicht, und er braucht auch euer Mitgefühl nicht. Aber er hat auch für euch kein Mitgefühl. Ihr Kind? Was geht mich Ihr Kind an? So wenig wie Ihre Gummiwaren! So, jetzt wissen Sie alles, und nun wollen wir weiterspielen. Sie werden uns nicht stören wollen, Mr. Harrogate. Leben Sie wohl!“
Harrogate rührte sich nicht von seinem Platz. Er hatte ein Gefühl, als würde ein Weggehen seinerseits das Todesurteil für sein Kind bedeuten. Dieser Mann, dieser versoffene, verkommene Mensch konnte es retten; Harrogate wußte nicht, woher er diese Überzeugung hatte, aber sie war da, unwandelbar, unbeirrbar. Dieser konnte es, und nur dieser!
Klatschend fielen die Karten. Niemand beachtete Harrogate mehr, den reichen Harrogate, vor dem Tausende von Angestellten zitterten, vor dessen Geld bisher noch jeder Mensch die erforderliche Ehrfurcht gezeigt hatte. Er saß da wie ein Bettler, und er fühlte sich schlimmer als ein Bettler.
„Ha!“ rief Flannagan. „Ich habe fünfzig Cent gewonnen!“
„Ich biete Ihnen zweihunderttausend Dollar“, sagte Harrogate leise, mit schwankender Stimme.
„Du gibst jetzt Karten“, bestimmte Flannagan, ohne die Worte Harrogates weiter zu beachten.
„Wieviel wollen Sie?“ schrie Harrogate plötzlich gequält auf. „Nennen Sie Ihren Preis! Was verlangen Sie von mir für das Leben meines Kindes! Mann, so reden Sie doch!“
Flannagan sah von seinen Karten auf, unwillig abwehrend, wie man auf einen lästigen, zudringlichen Menschen blickt, den man durchaus nicht los werden kann.
„Wissen Sie was?“ sagte er ärgerlich. Dann schwieg er, denn die Tür hatte sich geöffnet, und auf der Schwelle erschien Tamara Harrogate. „He!“ rief Flannagan zornig. „Wer sind Sie? Was wollen Sie hier?“
„Ich bin Tamara Harrogate“, sagte das junge Mädchen und sah Flannagan fest ins Gesicht. „Das ist mein Vater.“
„Tamara — — —“ sagte Flannagan nachdenklich. „Tamara — — —“ Dann wandte er sich wieder Harrogate zu. „Meinen Preis wollten Sie wissen? Was ich für das Leben Ihres Kindes verlange, wünschten Sie zu hören? Nun, ich will es billig machen …“ Ein häßliches Lächeln umspielte seine Lippen: „Ich schenke Ihnen das Leben Ihres Kindes, ich schenke es Ihnen, wenn Sie und Ihre Tochter gemeinsam mit meinen drei Freunden heute zum Abendessen die Gäste von mir und meiner Braut im Pennsylvania Hotel sein wollen.“
Sekundenlang durchschwirrten das Hirn Harrogates Gedanken an das Tolle dieser Forderung, Gedanken über das Aufsehen, das dieses Abendessen im größten Hotel New Yorks erregen würde und dann wieder Gedanken darüber, daß eine Absage jetzt gleichbedeutend dem völligen Bruch mit diesem Manne sei. Ehe er aber zu einem Entschluß kommen konnte, vernahm er die ruhige Stimme seiner Tochter:
„Mein Vater und ich danken Ihnen und Ihrer Braut für die Ehre. Wir werden Ihrer Einladung gern Folge leisten.“
III.
Inspektor Reginald Bath hatte seine Frau verständigt, er würde heute zum Mittag zu Hause sein und einen Gast mitbringen. Das war nichts Ungewöhnliches, denn Mrs. Bath war es gewöhnt, daß ihr Mann seine Pläne oft sehr plötzlich änderte. Das brachte eben sein Beruf mit sich.
Als Bath mit seinem Gast das Speisezimmer betrat, war der Eßtisch schon gedeckt, und seine drei Kinder saßen bereits sauber gekleidet, mit vorgebundenen Tüchern am Tisch. Auch Mrs. Bath befand sich im Zimmer, und sie begrüßte den Gast wie einen alten Bekannten, obwohl er bis jetzt nur einmal, und das vor vielen Monaten, in ihrem Hause gewesen war.
„Bitte, nehmen Sie Platz, Mr. Strong“, forderte Bath den Besucher auf, nickte seiner Frau freundlich zu und fuhr jedem der drei Kinder zärtlich über das Haar.
Alle setzten sich, man sprach ein paar belanglose Worte, und dann breitete sich eine erwartungsvolle Stille aus.
„Wir wollen das Tischgebet sprechen“, ordnete Bath feierlich an und warf seinem ältesten Söhnchen John einen erwartungsvollen Blick zu. Sogleich faltete der kaum siebenjährige Knabe die Händchen und sprach schnell und ohne zu stocken die Worte des Gebetes.
Reginald Bath war Christ und liebte es, das zu betonen; das und auch den Umstand, er sei Amerikaner wie jeder andere. Er hielt viel auf sein eigentliches Heimatland; jedoch hatte er eine Amerikanerin geheiratet, arbeitete seit Jahren in Amerika und wünschte, daß seine Kinder ganz amerikanisch erzogen würden.
„Wie kommt es, daß du heute zum Essen frei bist?“ erkundigte sich Mrs. Bath, nachdem ein Dienstmädchen die Suppe gebracht hatte. „Du sagtest, du würdest heute ver reisen, nicht wahr?“
„Ein neuer Auftrag“, antwortete Bath freundlich und löffelte ruhig seine Suppe, die ihm vorzüglich zu schmecken schien.
Mrs. Bath hatte aus dem Ton seiner Worte, so gleichgültig sie auch klangen, doch etwas Ungewöhnliches her ausgehört.
„Du bist damit nicht zufrieden?“ forschte sie besorgt.
„Nein“, lautete seine knappe Antwort.
Sie sah ihn nur fragend an, und da ergänzte er kurz:
„Gefährlich!“
Im nächsten Augenblick wandte er sich breit lächelnd mit einer belanglosen Frage an seinen Gast, und bald war ein Gespräch über die brennendsten politischen und wirtschaftlichen Fragen im Gange. Mr. Strong sprach wenig, hörte aber aufmerksam auf das, was ihm Bath auseinandersetzte. Niemand hätte dabei gedacht, daß Strong von all dem nicht das Geringste verstand, sich aber alles Wesentliche genau einzuprägen versuchte, weil er heute abend dasselbe mit den gleichen Worten und im gleichen Tone in seinem Klub zu erzählen beabsichtigte.
Das Essen war beendet, und Bath forderte Strong auf, im Nebenzimmer eine Zigarre zu rauchen. Obwohl Mrs. Bath ebenfalls rauchte, folgte sie den Männern nicht, denn sie wußte, das Gespräch bei dieser Zigarre war der eigentliche Zweck des Besuches.
Der Raum, den Strong betrat, war Baths Arbeitszimmer. Es war vornehm, doch nicht allzu kostbar eingerichtet, und man fühlte sich darin sogleich behaglich. Strong versank in einem der tiefen Sessel, zog genießerisch an der feinen Zigarre und sah erwartungsvoll auf den Hausherrn, der mit etwas kurzen, hastigen Schritten auf dem weichen Teppich auf und ab ging.
„Welcher Fall?“ fragte Strong endlich, da Bath noch immer nichts sagte.
„Sie können es sich denken: Harrogate“, antwortete der Hausherr verstimmt.
Strong paffte eine Weile schweigend.
„Das ist unangenehm“, sagte er endlich.
„Sehr unangenehm“, bestätigte Bath.
„Wenn das Kind stirbt, wird man Sie anklagen“, äußerte Strong.
„Und umbringen“, vollendete Bath.
„Es muß etwas getan werden“, fuhr Strong fort.
„Gewiß“, meinte Bath ernst.
Eine Zeitlang schwiegen beide. Dann nahm Bath das Wort zu einer längeren Auseinandersetzung:
„Die Sache sieht folgendermaßen aus“, erklärte er und blieb vor seinem Besucher stehen. „Ich weiß, die Polizei wartet nur auf einen besonders wichtigen Fall, bei dem ich ihr nicht helfe. Hier ist dieser Fall. Die Geschichte droht, dem Hauptquartier zu einem Riesenskandal zu werden. Daher haben sie beschlossen, mich zu opfern: Entweder ich helfe ihnen oder — ich werde umgebracht. Erweise ich mich als nutzlos, so hat das Katz- und Mausspiel für die Polizei keinen Wert mehr.“
„So ist es“, bestätigte Strong bedächtig.
Wieder herrschte eine geraume Weile Schweigen. Bath hatte seine Wanderung durchs Zimmer erneut aufgenommen, und seine Schritte waren noch kürzer, noch hastiger geworden.
„Vielleicht läßt McGregor mit sich sprechen“, äußerte er plötzlich obenhin. Es war ein achtlos hingeworfener Satz, aber Strong erriet sofort, daß Bath jetzt das ausgesprochen hatte, um dessentwillen er ihn hierher bestellt hatte.
„Nein“, antwortete er ernst. „McGregor ist fest entschlossen.“
„Ich dachte es mir.“ Baths Züge waren unverändert geblieben. „Es war wirklich vorauszusehen.“
„Sie haben doch einige Gelder in England, wenn ich nicht irre“, mutmaßte Strong.
„Es reicht nicht. Leider habe ich das meiste noch hier, und schon seit einem Jahr werde ich überwacht. Hebe ich die Gelder hier ab, so weiß die Polizei sofort, es sei Zeit sich meiner zu versichern.“
„Das Geld in England reicht also nicht?“
Bath zuckte die Achseln.
„Es reicht für ein gut bürgerliches Dasein, mit Kummer und Sorgen um Schulbücher und Wintermäntel für die Kinder. Das ist nichts für mich.“
Strong schnippte die Asche von seiner Zigarre, und so ungeschickt, daß sie auf den Teppich fiel. Er bückte sich, um sie aufzusammeln, und dabei sprach er, ohne von seinen Händen aufzusehen:
„Es ist für die Wiederbeschaffung des Kindes eine Belohnung von fünfzigtausend Dollar ausgesetzt. Wenn man so bedenkt, für einen Menschen, der nicht mit voller Überzeugung bei unserer Sache ist, eine große Versuchung. Man sollte so etwas verbieten.“
Strong lachte etwas krampfhaft über seinen Witz, und auch Bath lächelte freundlich. Er hatte Strong sehr gut verstanden.
„Nun“, meinte er leichthin. „Es ist ja eigentlich nur für wenige eine Versuchung. Ich zum Beispiel könnte das Kind gar nicht wiederbeschaffen, da ich nicht weiß, wo es sich befindet.“
„Sehr richtig bemerkt“, antwortete Strong lachend. „Was für ein merkwürdiges Gespräch wir doch führen! Aber ich liebe es, theoretische Betrachtungen anzustellen, auch wenn sie nicht den geringsten praktischen Wert haben. Das schult den Geist, finden Sie nicht ebenfalls?“
„Ganz meine Meinung.“
„Sehen Sie — um in unseren theoretischen Betrachtungen fortzufahren — es ist dennoch auch für Sie eine Versuchung. Sie könnten doch die Belohnung teilen, mit einem Menschen teilen, der den Aufenthaltsort des Kindes kennt.“
Bath schüttelte den Kopf.
„Ich möchte wissen, warum dieser andere wohl mit mir teilen sollte, wenn er doch das Ganze verdienen kann“, äußerte er zweifelnd, obwohl ihm dieser Grund sehr gut bekannt war.
„Nun, zum Beispiel, weil der andere annehmen müßte, McGregor hätte ihn sofort in Verdacht, und weil dieser andere Wert darauf legt, auch der Polizei gegenüber unbekannt zu bleiben.“
„Stimmt!“ rief Bath aus, als begreife er das alles erst jetzt. „Wenn dieser andere zum Beispiel einen oder mehrere Morde auf dem Gewissen hat, so kann er nicht darauf hoffen, freies Geleit zu bekommen.“
„Das ist sehr richtig, sehr richtig“, sagte Strong und erhob sich. „Ich werde heute abend vor dem Schlafengehen noch über diesen theoretischen Teil unseres Gespräches nachdenken. Vielleicht können wir es morgen fortsetzen, vielleicht ist es auch besser, wenn ich darüber mit McGregor selbst spreche.“
„Ich will Sie nicht länger aufhalten“, erwiderte Bath sehr freundlich. Er hatte die Drohung, die in den letzten Worten lag, sehr gut verstanden. „Schade“, ergänzte er. „Schade, daß Sie alles, was Sie von mir hören, auch mit anderen Menschen besprechen müssen. Ich liebe das nicht. Wie leicht kann solch ein theoretisches Gespräch mißverstanden werden.“
Strong lachte.
„McGregor ist ein sehr kluger Mensch. Er wird es schon nicht falsch verstehen. Auf Wiedersehen.“
„Auf Wiedersehen, Mr. Strong.“
IV.
Nachdem Bath seinen Gast hinausgeleitet hatte, schloß er sich in seinem Zimmer ein und ging rasch, mit sehr kurzen Schritten, vom Schreibtisch zum Kamin, vom Kamin zum Schreibtisch, hin und her, hin und her. Er hielt den Kopf gesenkt und dachte angestrengt nach. Er dachte nach, obwohl er wußte: Es gab hier nichts zu denken. Der Fall war von vornherein ganz klar, und es war hieran nichts zu ändern, nichts mehr zu ändern.
Bath wußte, Strong würde von ihm ohne Verzug zu McGregor fahren. Strong würde ihn anzeigen. Warum, war eine Frage von untergeordneter Bedeutung. Vielleicht fürchtete sich Strong zu sehr vor einer Anzeige seinerseits vielleicht hatte er tatsächlich dieses Gespräch nur geführt, um ihn, Bath, auszuhorchen. Das war ganz unwichtig. Wesentlich war nur die Frage, was McGregor tun würde.
Eine Stunde war vergangen, als Bath lächelnd aus seinem Arbeitsraum in das sonnendurchflutete Eßzimmer trat. Am Boden spielten seine drei Kinder. Sie bauten Häuser und Gärten, sie bauten sie mit ernsten, feierlichen Mienen. Sie zankten sich nicht und schrien nicht, denn sie waren zu eiserner Selbstzucht erzogen.
Bath kniete sich nieder und baute ebenfalls Häuser und Gärten. Auch er machte dabei ein ernstes Gesicht, und es schien wirklich, als sei das Haus, das er baute, und der Garten dazu jetzt seine einzige Sorge.
Mrs. Bath trat ein und setzte sich mit einer Handarbeit ans Fenster. Ab und zu sah sie lächelnd auf die Kinder und ihren Vater, und einmal lachte sie laut auf, als das Haus — grade des Vaters Haus — durch seine Ungeschicklichkeit zusammenstürzte.
„Ein schlechtes Vorzeichen“, sagte er und stand auf.
„Mr. Strong hat dich geärgert?“ fragte sie.
Er setzte sich neben sie, und es war ihm angenehm, als sie mit der kühlen Hand über seine faltenlose, glatte Stirn strich.
„Es war ein Fehler, ihn einzuladen“, bestätigte er. „Aber sprechen wir nicht mehr davon.“
Sie stellte keine Fragen mehr. Sie wußte, sie hätte auch nichts mehr erfahren. Ihr Mann wäre mit einem leisen Lächeln über ihre amerikanische Ungezogenheit aufgestanden, hätte ihr einen verzeihenden Blick zugeworfen und wäre für lange, lange Zeit in seinem Zimmer verschwunden.
„Mir ist ein Bild angeboten worden“, erzählte Mrs. Bath heiter. „Ein wundervolles, großes Bild von Barley. Es kostet dreißig Dollar. Das soll spottbillig sein.“
Er nickte.
„Das ist möglich. Du möchtest es kaufen?“
„Nur, wenn das auch dein Wunsch ist.“
„Nun, ich …“ Er schwieg einen Augenblick nachdenklich. „Ich würde abraten.“
Ein Schatten huschte über ihr schönes Gesicht. Aber es war nur ein ganz flüchtiger Schatten, der sofort verschwand. Dennoch hatte ihn Bath bemerkt.
„Hier sind dreißig Dollar“, sagte er rasch und reichte ihr ein Päckchen Banknoten. „Ich habe es mir anders über legt.“
Sie lächelte dankbar und wollte das jüngste Kind, ein Mädchen, auf den Arm nehmen, das sich ihnen genähert hatte. Aber das Kind begehrte zum Vater.
„Papa soll ein Lied singen“, bat das Mädchen und bettelte mit den Augen. „Das Lied von der Sonne.“
Gehorsam nahm Bath das Kind auf den Schoß und begann sein trauriges Lied zu singen. Es mußte wirklich sehr traurig sein, denn er hatte zuweilen dabei geweint. Die Augen des Mädchens, das es wohl bemerkt hatte, füllten sich daher auch schon bei den ersten Klängen mit Tränen.
„Nicht weinen“, sagte der Vater in einer Pause zwischen dem Singen. Aber er hätte nie wieder dieses Lied gesungen, wäre das Kind jetzt gehorsam gewesen.
Mrs. Bath stand auf, denn der Fernsprecher hatte ein Zeichen gegeben. Bath sang ruhig weiter und blickte erst auf, als seine Frau wieder das Zimmer betrat.
„McGregor“, sagte sie kurz.
Er nickte und stand sofort auf. Er reichte ihr das Kind und ging schnell zur Tür. Diese Tür schloß er sehr sorgfältig hinter sich, dann nahm er den Hörer in die Hand.
„Hier ist Bath.“
„Hier spricht McGregor“, lautete die Antwort.
„Mr. McGregor“, sagte Bath schnell. „Ich muß Sie darauf hinweisen, daß jedes Gespräch, das ich führe, von der Polizei mitgehört wird.“
Zunächst war ein zorniges Grunzen die einzige Erwiderung.
„Das macht nichts“, sagte gleich darauf die Stimme McGregors scharf. „Ich spreche von einer angezapften Leitung aus. Mich findet die Polizei nicht. Hören Sie, Bath, eben kommt zu mir Strong und erzählt — — —“