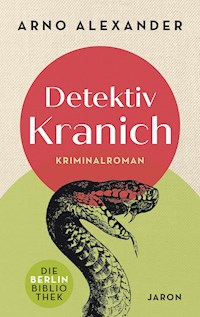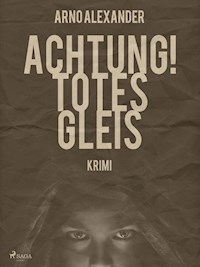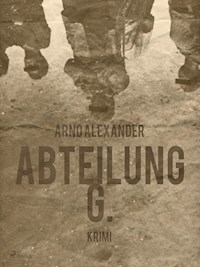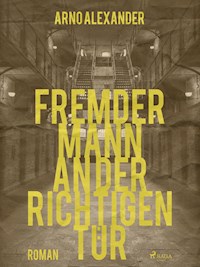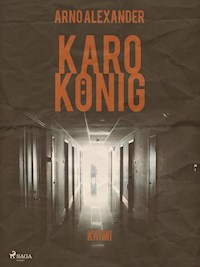
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Aus der Nervenheilanstalt Dalldorf soeben der mehrfache Raubmörder und Brandstifter Zacharias ausgebrochen. Vorsicht bei der Festnahme. Lebensgefährlich." Der "Irre" Zacharias begeht einen Mord und verschwindet spurlos. Gleichzeitig beginnt der rätselhafte "Karo König" den Schriftsteller Larsen zu erpressen. Und nicht nur ihn ... Kriminalinspektor Mac O'Kelly von der Berliner Polizei versucht, Larsen zu schützen, kann aber nicht verhindern, dass bei der Geldübergabe auf den Schriftsteller geschossen und er schwer verwundet wird. Dann findet O'Kelly heraus, dass "Karo König" neun Jahre zuvor, von 1918 bis 1921, schon einmal in Berlin sein Unwesen getrieben hat. Sein Verschwinden und Wiederauftauchen fällt also zusammen mit der Zeit der Inhaftierung von Zacharias im Irrenhaus. Aber Zacharias kann die neuen Verbrechen unmöglich allein begehen. Damals hätten die Missetaten von "Karo König" beinahe dem Kriminalinspektor Link das Amt gekostet. Jetzt ist Link jedoch O'Kellys Vorgesetzter, und gemeinsam machen sich sich daran, "Karo König" das Handwerk zu legen, assistiert vom berühmten Detektiv Herr Friede. Doch das ist mit schier undurchschaubaren Verwicklungen, vertrackten Schwierigkeiten und ungeahnten Gefahren verbunden. Zum Beispiel scheint bei alledem der Berliner Trambahnfahrplan eine ganz besondere Rolle zu spielen. Und "Karo König" schlägt schon wieder zu ... Ein unglaublich spannender, vielschichtiger und ereignisreich-turbulenter Kriminalroman aus dem Jahre 1930, der auch heute noch genauso spannend ist wie in seinem Erscheinungsjahr!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karo König
Roman
Arno Alexander
Karo König
© 1930 Arno Alexander
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711625972
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1
Der Morseapparat begann zu klappern.
Tick — — — tick — tick — tack — — — tick — tick — — —.
Wachtmeister Grün fuhr aus seinem Brüten auf. Sein sehniger Oberkörper beugte sich vor, seine Augen folgten gespannt dem dünnen Papierstreifen mit den kleinen Punkten und Strichen.
„Polizeirevier 18. Dringendes Telegramm. An das Polizeipräsidium Berlin …“
Mit der linken Hand rückte Grün ein Blatt Papier heran, die rechte umklammerte den Bleistift. Der weiße Papierstreifen kletterte weiter, einer sich windenden Schlange ähnlich.
„Aus der Nervenheilanstalt Dalldorf soeben der mehrfache Raubmörder und Brandstifter Zacharias ausgebrochen. Trägt Anstaltskleidung. Vorsicht bei Festnahme. Lebensgefährlich.“
Wachtmeister Grün nahm den Hörer vom Fernsprechapparat und ließ sich mit der Zentrale verbinden. Hastig gab er das Telegramm weiter. Kaum hatte er den Hörer eingehängt, als der Telegraph schon wieder zu klappern begann.
Tick — tick — — — tack — tack — tick — — —.
„Polizeirevier 7 an Berliner Polizeipräsidium. Aus Dalldorf entsprungener Irrer Zacharias hier gesichtet. Verfolgung aufgenommen.“
Diesmal hatte Grün keine Zeit, das Telegramm weiterzuleiten, denn gleich darauf rasselte die Telephonklingel.
„Hier Wachtmeister Anders!“ meldete sich eine Männerstimme. „Sofort Alarm schlagen. Wir haben einen Irren verfolgt, und als ihm alle Wege abgeschnitten waren, floh er in den Hof des Polizeipräsidiums. Wir halten den Ausgang besetzt.“
Grün schüttelte den Kopf. Als er das Telegramm und die aufstenographierte Meldung weitergab, spielte um seine Lippen ein nachsichtiges Lächeln.
„Der Kerl kommt uns wie gerufen“, hörte er die Stimme des diensthabenden Kommissars durch das Telephon. „Wollen mal gleich ein bißchen Jagd machen!“
„Viel Spaß!“ rief Grün heiter in den Apparat und hängte lachend ein.
Plötzlich fiel ein dunkler Schatten über den Tisch. Im selben Augenblick sprang das Fenster klirrend entzwei. Grün fuhr herum. Die Hand tastete instinktiv nach dem Revolver.
Es war bereits zu spät. Den Bruchteil einer Sekunde lang sah Grün im Fensterrahmen die schier riesenhaft erscheinende Gestalt eines Mannes in schwarz-weiß gestreifter Kleidung — dann hatte sich der Koloß mit einem einzigen gigantischen Satz auf ihn gestürzt. Bücher und Instrumente flogen krachend zu Boden. Grün lag auf dem Rücken und sah in zwei grausame, blutunterlaufene Raubtieraugen. Zwei Pranken preßten sich wie Schraubstöcke um seinen Hals, und die Sinne schwanden ihm.
Zehn Minuten später eilte ein hochgewachsener Polizist mit den Abzeichen des Telegraphendienstes durch die Gänge des Polizeipräsidiums. Er wurde von mehreren Beamten angehalten und nach den letzten den entsprungenen Irren betreffenden Telegrammen gefragt. Jedem gab er bereitwillig und höflich Auskunft.
Fünf Minuten darauf fand man den Telegraphenbeamten Grün vollkommen entkleidet, tot, erdrosselt in seinem Zimmer, und nach einer knappen Viertelstunde wußten es alle Beamten, daß jener hochgewachsene Polizist niemand anderes, als der entsprungene Irre Zacharias gewesen war. Soviel man aber auch forschte und suchte — seit dem Augenblick, als dieser das Gebäude des Polizeipräsidiums verlassen hatte, fehlte von ihm jede Spur. Es war, wie wenn ihn der Erdboden verschluckt hätte.
2
Kriminalinspektor Mac O’Kelly faltete stirnrunzelnd die ihm vom Polizeipräsidium zurückgestellte Unkostenrechnung zusammen und warf sie ärgerlich in ein Fach seines Schreibtisches.
„Wieder haben sie mir sieben Autofahrten gestrichen!“ brummte er unzufrieden. „Ein Verlust von dreizehn Mark und fünfundsechzig Pfennigen! Die alte Geschichte. Man soll überall zurecht kommen, und wenn man dabei ein paar Autofahrten riskiert, so muß man sie hernach selbst bezahlen!“
„Zu Fuß gehen ist billiger!“ bemerkte Wachtmeister Taube philosophisch und betrachtete wohlgefällig seine starken, schweren Stiefel. Er saß in O’Kellys altertümlichem Schaukelstuhl, hatte die Beine bequem übereinander geschlagen und schaukelte emsig hin und her. „Ich gehe immer zu Fuß,“ fuhr er selbstzufrieden fort. „Man kommt dabei viel rascher vorwärts. Von zwei Anwärtern auf einen höheren Posten wird immer derjenige vorgezogen, der billiger arbeitet!“
„Das stimmt!“ sagte O’Kelly ironisch. „Ich möchte aber nicht gern solche Stiefel tragen wie Sie. Das hat entschieden auch seine Nachteile.“ Die Blicke des Inspektors hingen mißbilligend mit stummem Vorwurf an der Stelle, wo Taube mit seinen unförmigen Stiefeln den Schaukelstuhl in Schwung zu bringen pflegte. Die Ölfarbe war an dieser Stelle längst abgetreten, und die nackten Holzbretter wiesen unzählige häßliche Schrammen und Kratzer auf.
Der Wachtmeister setzte umständlich einen Zigarrenstummel in Brand.
„Ich habe es Ihnen doch schon oft gesagt,“ entgegnete er ruhig, „an meinem Hochzeitstag lasse ich diesen Fleck auf meine Kosten streichen.“
„Warum eigentlich erst an Ihrem Hochzeitstag?“ erkundigte sich O’Kelly belustigt.
„Weil ich von diesem Tage an zu Hause schaukeln werde!“ erwiderte Taube würdevoll.
O’Kelly lachte laut auf.
„Bilden Sie sich keine Schwachheiten ein, Taube!“ rief er fröhlich. „Ihre Frau wird Ihnen was husten! Nie und nimmer wird sie zugeben, daß Sie ihren Fußboden derart vandalisch behandeln!“
„Meinen Sie?“ fragte Taube kleinlaut, und versank in dumpfes Brüten. O’Kelly war aufgestanden, hatte Rock und Weste abgeworfen und angelte in einem mächtigen Koffer, der bis obenauf in buntem Durcheinander mit sauberer und schmutziger Wäsche vollgepfropft war, nach einer halbwegs brauchbaren Krawatte.
„Halten Sie in Ihren Tiefbohrungen mehr nach rechts!“ riet Taube mit sachverständiger Miene. „Das Gebiet ist dort aussichtsreicher!“
„Danke!“ sagte O’Kelly kurz. Bald hatte er das Gesuchte gefunden und begann vor einem schäbigen und abgenutzten Spiegelschrank Toilette zu machen.
Man hätte sich kaum etwas Entgegengesetzteres denken können, als den immer frischen, fröhlichen, kaum achtundzwanzigjährigen O’Kelly und den behäbigen, schwerfälligen und fast fünfzehn Jahre mehr zählenden Taube. Und doch bestand zwischen den beiden schon seit Jahren ein eigenartiges Freundschaftsverhältnis. Im Kriminalamt lachte man weidlich über diese Freundschaft, die darin zu bestehen schien, daß sich die beiden ständig zankten und einander immer in den Haaren lagen. Weniger bekannt war es, daß Taube seinen Inspektor schon so manches Mal mit Todesverachtung aus einer heiklen und gefährlichen Situation herausgehauen hatte, und daß O’Kelly wiederum mehr als einmal mit stoischem Gleichmut eine scharfe Rüge seiner Vorgesetzten angehört hatte — für Schnitzer, die nicht er, sondern Taube begangen.
„Mein lieber Taube,“ sagte O’Kelly nach einer Weile, als er mit dem Umziehen fertig war, „ich gehe jetzt zu Larsens. Sie werden sich also wohl oder übel zeitweilig von meinem Schaukelstuhl trennen müssen, außer Sie ziehen es vor, die halbe Nacht hier auf mich zu warten!“
„Ich gehe nach Hause,“ erklärte Taube gähnend. Plötzlich horchte er auf: im Korridor waren Stimmen hörbar geworden und gleich darauf klopfte es.
„Herein!“ rief der Inspektor laut.
Die Tür öffnete sich langsam. Ein Dienstmann, die rote Mütze und ein kariertes Taschentuch in der einen Hand, einen Brief in der anderen, trat herein.
„Kriminalinspektor Mac O’Kelly!“ las er bedächtig und blickte fragend umher.
O’Kelly streckte die Hand vor.
„Das bin ich selbst. Lassen Sie mal sehen. Erwarten Sie Antwort?“
„Nein!“ entgegnete jener und wandte sich zum Gehen.
O’Kelly hatte den Umschlag aufgerissen und starrte mit wenig geistreichem Gesichtsausdruck auf einige kurze Schreibmaschinenzeilen.
„Halt!“ rief er plötzlich. „Bleiben Sie mal noch einen Augenblick da, guter Mann!“
Der Dienstmann drehte sich mürrisch um und kam langsam zurück.
„Wer hat Ihnen diesen Brief gegeben?“ erkundigte sich O’Kelly interessiert.
„Was weiß ich?“ lautete die in unwirschem Ton gegebene Antwort. „Ein Herr hielt mich auf der Straße an, gab mir den Auftrag, den Brief zu besorgen und bezahlte die übliche Gebühr, ohne auch nur einen Pfennig Trinkgeld zu geben. Alles andere geht mich nichts an.“
„Wie sah der Herr aus?“ fuhr O’Kelly beharrlich fort. Er hatte die Finger der rechten Hand lässig in die Westentasche versenkt und klapperte vernehmlich mit einigen Silbermünzen.
Die Mienen des Dienstmannes hellten sich auf.
„Es war ein alter Mann,“ erzählte er nun beinahe eifrig. „Er hat einen langen schneeweißen Vollbart. Trägt eine Brille. Hinkt auf einem Bein. Ist weder groß noch klein.“
„Wie war er gekleidet?“
„Habe nicht besonders darauf geachtet … Hm … Ich glaube, er trug einen grauen, bis obenauf geschlossenen Regenmantel und einen dunklen Schlapphut. Aber genau kann ich’s nicht sagen.“
„Na, gut!“ sagte O’Kelly, und reichte dem Mann eine Silbermünze. „Jetzt können Sie gehen. Es ist möglich, daß ich Sie noch einmal brauche. Ihre Nummer? 24? Gut. Alles in Ordnung.“
„Was ist los, Inspektor?“ erkundigte sich Taube ungeduldig, als sich die Tür hinter dem Dienstmann geschlossen hatte.
„Ich bin mir selbst nicht klar darüber,“ erwiderte der andere kopfschüttelnd. „Hier lesen Sie mal! Und dann sagen Sie mir, was Sie davon halten!“
Taube ergriff den Briefbogen behutsam mit zwei Fingern und begann zu lesen. Der Inhalt des Schreibens war kurz; Anrede und Unterschrift fehlten gänzlich.
„Sie werden vermutlich heute abend Gelegenheit haben, sich in meine Angelegenheiten zu mischen. In Ihrem eigensten Interesse rate ich Ihnen dringend davon ab. Am klügsten wird es sein, wenn Sie heute abend zu Hause bleiben. Sollten Sie im Zweifel darüber sein, ob diese Warnung ernst zu nehmen ist, so empfehle ich Ihnen, bei Kommissar Dr. Link anzufragen, ob er sich des Karo König entsinnt.“
„Nun, wie denken Sie darüber?“ fragte O’Kelly, als sein Kollege mit dem Lesen zu Ende war. „Wer mag dieser mysteriöse Karo König wohl sein?“
„Ich vermute,“ sagte Taube nachdenklich, „ich vermute, es ist ein Verbrecher!“
„Daß er kein hoher Regierungsbeamter ist, habe ich selber erraten!“ sagte O’Kelly bissig. Ärgerlich ballte er den Briefumschlag, den er noch immer in der Hand hielt, zusammen und warf ihn in den Papierkorb. Doch sogleich sprang er hinterher und zerrte den Umschlag wieder heraus.
„Da scheint ja noch was drin zu sein!“ Mit diesen Worten zog er aus dem Umschlag eine französische Spielkarte hervor. Es war der Karo König.
„Auch eine Visitenkarte,“ brummte Taube. „Ich würde an Ihrer Stelle nicht lange Rätselraten spielen, sondern der Weisung dieses seltsamen Königs folgen und mal bei Dr. Link anfragen.“
„Ein guter Gedanke!“ O’Kelly langte hastig nach dem Hörer des Telephons und ließ sich mit Kommissar Dr. Link verbinden. Taube horchte gespannt. Sogar das Schaukeln hatte er vergessen. Das Gespräch war kürzer, als einer von den beiden vermutet hatte. Schon nach einer knappen Minute hängte O’Kelly ein. In komischer Verzweiflung warf er die Arme in die Höhe.
„Wissen Sie, was er gesagt hat?“
„Nun?“
„Das ginge mich den Deibel was an!“
Taube riß verblüfft die Augen auf.
„Das ist grob und deutlich!“
„Allerdings!“
„Dr. Link ist doch sonst nicht so!“
„Im Gegenteil! Er ist stets sehr liebenswürdig und zuvorkommend. Es ist mir schleierhaft, womit ich ihn eben erzürnt haben mag! Denn erzürnt war er! Das ist klar.“
Taube wiegte nachdenklich den Kopf hin und her.
„Wirklich merkwürdig! Aber was wollen Sie jetzt tun? Werden Sie der Warnung Folge leisten und den Abend zu Hause verbringen?“
O’Kelly schüttelte energisch den Kopf.
„Fällt mir gar nicht ein! Entweder die ganze Geschichte ist ein dummer Witz — Bluff, oder aber der Warner weiß genau, was ich heute abend vorhabe. Dann aber ist es sehr wahrscheinlich, daß heute gerade bei Larsens etwas passieren wird, was ich vielleicht durch mein Eingreifen verhindern kann. Folglich muß ich hin!“
„Stimmt!“ erklärte Taube bedächtig. Langsam erhob er sich und fuhr in seinen Mantel. O’Kelly stand schon bei der Tür, Hut und Überzieher in der Hand. Auf der Straße verabschiedete er sich hastig von dem Wachtmeister und sprang in einen vorüberfahrenden Trambahnwagen.
„Nehmen Sie sich in acht, Inspektor!“ rief ihm Taube warnend nach.
O’Kelly nickte fröhlich. Er gestand es sich nicht ein, daß sich seiner eine von Minute zu Minute wachsende Unruhe bemächtigt hatte.
3
Aus dem Eßzimmer der Larsenschen Villa tönte leise das Klirren von Tellern und Messern. Nora, die noch junge Tochter des Hauses, warf einen letzten, prüfenden Blick über die geschmackvoll gedeckte Tafel.
„Es ist gut, Anton,“ sagte sie freundlich zu dem in respektvoller Haltung ihrer Befehle harrenden Diener. „Bitten Sie Vater zu Tisch! Oder — nein, warten Sie — ich werde ihn selbst rufen!“
Leichtfüßig lief sie durch den teppichbelegten Korridor und dann quer durch das große und elegante Gesellschaftszimmer. Dieser Saal war heute voll von Gästen, fast ausschließlich jungen Leuten in Noras Alter. Seit fünf Jahren, seit dem Tode ihrer Mutter war dies schon so. Beinahe allabendlich versammelte sich in dem gastfreien Hause eine bunte, lustige Gesellschaft, wobei es zwar sehr lärmend, aber dessenungeachtet auch immer sehr harmlos zuging. Hans Larsen gönnte seiner Tochter und einzigem Kinde jede nur erdenkliche Freude, und jeder Wunsch, den er ihr von den Augen ablesen konnte, war schon im Voraus erfüllt. Alles, was sie tat und unternahm, war ihm recht. Beschwerden der Nachbarn über nächtliche Ruhestörung, polizeilichen Strafmandaten für rücksichtsloses Autofahren, ja sogar dem wütenden Zetern und Schreien der Schneiderinnen und Hutmacherinnen, denen Nora wohl die Ware abnahm, sich aber nie um die Bezahlung dieser auch nur kümmerte — alledem begegnete Larsen stets mit demselben nachsichtig-liebenswürdigen Lächeln und stets mit derselben dick gefüllten Brieftasche. Zwei- oder dreimal war es vorgekommen, daß ältere Geschäftsfreunde ihm ernst und eindringlich das Sinnlose seiner Erziehungsmethoden klarzumachen versuchten. Auch diesen Vorhaltungen war Larsen mit demselben liebenswürdigen Lächeln entgegengetreten; nur schien es etwas wehmütiger und schuldbewußter als sonst. Genützt hatten die Vorhaltungen bestimmt nicht. Es blieb alles beim alten.
Abgesehen von einer gewissen Rücksichtslosigkeit und Verschwendungssucht, schien übrigens Noras Charakter unter diesen eigenartigen Erziehungsmethoden kaum gelitten zu haben. Ihr Benehmen war nie arrogant oder schnippisch, sondern stets durch eine ursprüngliche und zuweilen geradezu naive Natürlichkeit gekennzeichnet. Immer war sie bereit, auch den Wünschen und Neigungen ihrer Freunde und Freundinnen Rechnung zu tragen, und nie konnte man einen Unterschied in ihrem Wesen bemerken, ob sie nun mit ihrem Vetter, dem Grafen von Hayen, sprach, dessen Barvermögen auf einige hunderttausend Mark geschätzt wurde, oder aber sich mit dem jungen, hoffnungsfreudigen Reporter Elst unterhielt, dessen Einkommen genau 125 Mark monatlich betrug.
Nora klopfte leise an die Tür des Arbeitskabinetts ihres Vaters und trat auch sogleich ein. Hans Larsen saß an seinem Schreibtisch, hatte den Kopf in die Hände gestützt und die Augen geschlossen. Sein Gesicht drückte etwas Gequältes und Gespanntes aus.
„Vater, was ist dir?“ Besorgt war Nora an seinen Stuhl geeilt und umfaßte liebevoll seine Schultern. Einen Augenblick schien es, als wollte Larsen sich erschöpft gegen Noras Gestalt lehnen, doch gleich darauf stand er etwas hastig auf und drückte seiner Tochter einen flüchtigen Kuß auf die Stirn.
„Nichts, Kindchen! Was soll denn mit mir sein? Ich arbeite gerade!“
„Oh!“ machte Nora bedauernd. „Wenn ich das gewußt hätte … Nun habe ich dich gestört …“
„Macht nichts!“ Larsen lächelte müde und nachsichtig. „Die Gedanken kommen und gehen. Du hast sie verscheucht, aber sie werden schon wiederkommen.“ Er seufzte. „Ich wünschte, sie kämen nicht wieder!“
Nora verstand den Sinn dieser Worte nicht. Hans Larsen war Schriftsteller; oft genug hatte er ihr erklärt, wie wichtig gerade in diesem Beruf die Denkarbeit ist, und nun wünschte er, daß die Gedanken, die ihm Ruhm und Vermögen einbrachten, nicht wiederkommen möchten. Nora öffnete schon den Mund, um eine Frage zu stellen, als sie wieder deutlich den Ausdruck von Qual und Furcht im Gesicht ihres Vaters wahrnahm. Da unterdrückte sie jede Frage und forderte ihn energisch zum Gehen auf.
„Komm, Vater! Das Essen wird kalt. Komm nur! Es ist wieder eine ganze Menge Leute da!“
„So?“ Ein Freudenschimmer erhellte die Züge Larsens. „Hat sich mein Töchting gut amüsiert? Wer ist denn wieder alles da?“
„Ach“, plauderte Nora eifrig, indem sie mit ihrem Vater langsam nach den Gesellschaftsräumen ging, „da ist der kleine Elst — du weißt, der vom Berliner Tageblatt. Er ist wieder einmal sterblich verliebt! Diesmal eine ganz ernste Sache — sagt er! Aber das behauptet er ja immer. Dann — Inspektor O’Kelly, der heute ein bitterböses Gesicht macht. Er hat einen interessanten, neuen Fall — streng geheim zu halten! Der spukt ihm anscheinend dauernd im Kopf herum. Des weiteren sind erschienen: mein erlauchter Herr Vetter, der Graf von Hayen, ferner Assessor Mühlenthal, Erna, Agnes … Aber da siehst du sie ja alle schon vor dir!“
Während dieses Gespräches hatten die beiden den Salon erreicht. Larsen wurde mit Hallo empfangen und drückte lächelnd die vielen sich ihm entgegenstreckenden Hände.
„Sachte, sachte, Kinners!“ wehrte er ab. „Ihr reißt mich alten Mann ja noch um! Etwas mehr Maß in euren Freudenbezeugungen, wenn ich bitten darf! Und jetzt — los! Marsch ins Eßzimmer! An die Futternäpfe!“
Lachend und lärmend begab sich die junge Gesellschaft zu Tisch. Larsen nahm an dem einen Ende der Tafel Platz, ihm gegenüber saß Nora, die sich vergebens bemühte, die würdevolle Hausfrau zu spielen. Anton, das Faktotum des Hauses, lief mit den geschmackvoll garnierten Schüsseln hin und her und hatte alle Hände voll zu tun, um den ungeniert vorgebrachten Wünschen jedes einzelnen nachzukommen.
O’Kelly war ein häufiger Gast dieses Hauses. Er kannte den ungezwungenen, fast familiären Ton, der hier herrschte, zur Genüge. Es war heute nicht anders als sonst. Und gerade dieser Umstand, daß er hier keinerlei Veränderung vorfand, wunderte ihn, denn er erwartete für heute etwas Besonderes. Je alltäglicher sich das Leben und Treiben hier ausnahm, um so unerwarteter mußte dann allen dieses „Besondere“ kommen. Unerwarteter und gefährlicher … O’Kelly horchte auf. Es war ihm, als hätte er eben einige Worte gehört, die ihn instinktiv beunruhigten. Einen Augenblick saß er still da und versuchte die kurzen Worte in sich nachklingen zu lassen. Richtig! Jetzt fielen sie ihm ein … „Erwartet keine Antwort“ — so lauteten sie. Aber warum in aller Welt beunruhigte ihn das? Warum nur? Aha, jetzt wußte er auch dies! Es war eine Ideenverbindung, die sich in seinem Unterbewußtsein vollzogen hatte. Fast die gleichen Worte hatte er selbst vor einigen Stunden gesagt, als er den Brief des Karo König in der Hand hielt. Sein Unterbewußtsein brachte nach dem Klang der Worte zwei getrennte Ereignisse willkürlich miteinander in Verbindung. Vielleicht bestand aber doch ein Zusammenhang?
O’Kelly blickte rasch auf und sah gerade noch, wie Larsen mit einer achtlosen Gebärde einen Brief in seine Rocktasche steckte. Mit leisen Schritten entfernte sich ein Diener, der ein kleines silbernes Tablett in der Hand hielt.
Sofort war O’Kelly alles klar. Der Brief war von einem Dienstmann gebracht worden, und der Diener hatte Larsen erklärt, daß eine Antwort nicht erwartet würde. Der Schriftsteller hielt den Brief für so unwichtig, daß er das Lesen auf einen geeigneteren Zeitpunkt hinausschob … Doch nein — er schien sich eines anderen besonnen zu haben. O’Kelly war plötzlich die Aufmerksamkeit selbst.
Eine flüchtige Entschuldigung murmelnd, zog Larsen den Brief wieder aus der Rocktasche und öffnete ihn. Mit einem jähen Ruck sprang er auf.
Augenblicklich verstummte jedes Gespräch; aller Augen hingen erstaunt und betroffen an den schreckensbleichen Zügen des Hausherrn. In seinen Augen war ein unruhiges Flackern, auf der farblosen Stirn zeichnete sich, deutlich sichtbar, eine bläuliche Linie ab.
O’Kelly hatte sich zuerst gefaßt.
„Was ist geschehen?“ Mit einigen raschen Schritten war er an Larsens Seite geeilt.
„Lassen Sie mich! Lassen Sie mich!“ stieß jener heftig hervor. Er stand vornübergebeugt mit gesenktem Kopf da und stützte sich mit beiden Händen schwer auf den Tisch. Die Blässe begann aus seinem Gesicht zu schwinden. Grübelnd starrte er vor sich hin. Plötzlich rückte er den Teller mit dem noch unberührten Essen weit von sich, drehte sich kurz um und lief zur Tür hinaus.
O’Kelly folgte ihm auf dem Fuße. Kaum war Larsen in seinem Arbeitskabinett angelangt, als er sich mit einer gänzlich verzweifelten Gebärde in seinen Sessel fallen ließ. O’Kelly war an der Tür stehen geblieben.
„Gehen Sie! So gehen Sie doch!“ herrschte ihn Larsen an. „Ich will allein sein!“
Der Kriminalbeamte schüttelte stumm den Kopf und rührte sich nicht.
„Hören Sie denn nicht?“ zürnte Larsen. „Ich will allein sein! Verstehen Sie nicht, daß Sie mich stören?“
O’Kelly verzog sein Gesicht zu einer Grimasse.
„Nein!“ sagte er kurz. Dann holte er aus seiner Westentasche eine zur Hälfte aufgerauchte Zigarette, setzte sie in Brand und warf sich krachend in einen Ledersessel. Larsen verfolgte sein Tun mit finsteren Blicken, sprach aber kein Wort mehr.
„Sehen Sie, Herr Larsen,“ begann der Inspektor und blies den Rauch seiner Zigarette weit von sich. „Seit etwa fünf Jahren verkehre ich, und mit mir eine ganze Reihe ähnlicher Globetrotter, nun schon in Ihrem gastfreien Hause. Immer waren Sie uns ein lieber, gütiger älterer Freund und väterlicher Berater! Ich sage damit gewiß nicht zuviel!“
„Viel zu viel!“ unterbrach ihn Larsen giftig. „Wenn Sie gar nichts sagen würden, wäre es für mich gerade genug.“
O’Kelly lächelte. Er konnte unendlich liebenswürdig und gewinnend lächeln. Diese Meinung teilten sogar verschiedene rohe und recht ungemütliche Verbrecher, die durch sein kindliches, heiteres Lächeln entwaffnet, Dinge eingestanden hatten, die sie eigentlich als tiefstes und unverbrüchliches Geheimnis mit ins Jenseits hinüberzunehmen beabsichtigten. Auch auf Larsen schien dieses Lächeln seine Wirkung nicht gänzlich zu verfehlen. Seine Stimme klang nur noch leise grollend, als er fortfuhr:
„In sechs Monaten feiere ich meinen fünfzigsten Geburtstag. Die Worte, die Sie vorhin sprachen, eignen sich vorzüglich für eine Ansprache coram publico an diesem weihevollen Tage. Merken Sie sich diese Ihre Worte genau! Sie werden viel Beifall damit ernten — — in sechs Monaten! Jetzt aber, mein Herr, bitte ich Sie ganz energisch — lassen Sie mich allein!“
O’Kelly schüttelte wieder den Kopf.
„Nein, Herr Larsen! Zu Ihrem Geburtsjubiläum werde ich kein Sterbenswörtchen sagen. Bestimmt nicht! Ich bin nun einmal nicht für überflüssige Worte. Aber heute — das ist etwas ganz anderes! Also ich bitte jetzt ganz energisch — hören Sie mich an!“ Da Larsen schwieg, fuhr O’Kelly sogleich lebhaft fort: „Vielen von uns halfen Sie mit einem guten Rat, einigen durch die Tat, und einen unterstützten Sie sogar einmal mit einer beträchtlichen Summe Geldes, um ihn aus arger Verlegenheit zu retten. Es ist nur recht und billig, daß wir Ihnen nun, da Sie in der Klemme stecken, ebenfalls helfen; und weil ich mich am besten dazu eigne, stelle ich mich Ihnen hiermit zur Verfügung!“
„Warum sollten wohl gerade Sie sich am besten dazu eignen?“
O’Kelly zog die Augenbrauen hoch.
„Weil ich Kriminalbeamter bin.“
„Nun und?“ Aus der Stimme Larsens klang es wie leiser Spott.
„Nun und? Es handelt sich hier bei Ihnen nämlich um einen Kriminalfall!“
„Wo — — Woher wissen Sie denn das?“
„Ich weiß einiges,“ sagte O’Kelly unbestimmt. „Aber auch ohne mein zufälliges Wissen hätte ich hier auf einen Kriminalfall geschlossen. So, wie Sie vorhin, erschrickt man nur bei dreierlei Arten von Nachrichten. Vermögensverlust kann es nicht sein, da die Bank, die Ihnen dies anzeigen könnte, stets Briefumschläge mit Firmenbezeichnung benutzt, was hier nicht zutrifft. Die Todesanzeige eines nahen Verwandten kann es ebenfalls nicht sein und zwar aus dem sehr einfachen Grunde, weil alle Ihnen irgend nahestehenden Personen im Eßzimmer sehr lebendig anwesend waren. Bleibt also nur noch die dritte Möglichkeit …“
„Und die wäre?“
„Erpressungs- oder Drohbriefe! Einen solchen Brief haben Sie eben empfangen. Da dies in mein Fach einschlägt, bitte ich, mir den Brief zu zeigen. Daß Sie zu mir Vertrauen haben können, wissen Sie, und ich verpflichte mich auch, keine Antwort auf Fragen zu verlangen, die Sie aus irgendwelchen Gründen nicht beantworten möchten.“
„So? Dazu verpflichten Sie sich?“ Larsen war nachdenklich geworden. Nach einer Weile fuhr er sinnend fort: „Daß Sie den Inhalt des Briefes ziemlich richtig erraten haben, gebe ich zu. Sie wollen mir also helfen, einer mir drohenden Gefahr zu begegnen, ohne die näheren Umstände zu kennen? Versprechen Sie da nicht ein bißchen zu viel?“
O’Kelly zuckte die Achseln.
„Ich kann Ihnen natürlich nur versprechen, mein möglichstes zu tun, um die drohende Gefahr abzuwenden. Ob Ihnen damit gedient sein wird, hängt von den näheren Umständen ab, die ich ja leider nicht kenne. Schaden aber kann Ihnen die Unterstützung eines Kriminalbeamten jedenfalls nicht!“
„Gut!“ sagte Larsen plötzlich entschlossen. „Versuchen Sie es! Ich habe allerdings sehr wenig Hoffnung.“ Mit diesen Worten zog er aus seiner Rocktasche den bewußten Brief hervor und reichte ihn dem Inspektor. O’Kelly öffnete vorsichtig den Umschlag. Das erste, was er sah, war eine französische Spielkarte — der Karo König. Nun war der Zusammenhang dieses Briefes mit der von O’Kelly selbst empfangenen Warnung endgültig erwiesen. Die Züge des Kriminalbeamten waren gespannt, als er jetzt den ebenfalls auf einer Schreibmaschine getippten Brief auseinanderfaltete. Halblaut las er vor:
„Übermorgen, punkt 10 Uhr abends, werden Sie auf der Jannowitzbrücke sein und mir dort ein Paket, enthaltend RM. 600 000.— in Hundertmarkscheinen, übergeben. Die Scheine dürfen keine fortlaufenden Nummern tragen, und die Kriminalpolizei darf nicht verständigt werden. Die Folgen eines Ungehorsams sind Ihnen bekannt.“
O’Kelly pfiff leise durch die Zähne.
„Allerhand!“ knurrte er. „Ich habe in meiner Praxis schon manchen Erpressungsbrief in den Händen gehabt, ein solches Maß von Dreistigkeit und Unverfrorenheit ist mir aber doch noch nicht vorgekommen.“
Larsen schwieg.
„Zunächst einmal eine Frage!“ fuhr der Kriminalbeamte fort. „Wer ist der Karo König, und womit droht er Ihnen im Falle eines Ungehorsams?“
„Wer der Karo König ist, kann ich Ihnen nicht sagen …“
„Können nicht, oder wollen nicht?“ warf O’Kelly rasch dazwischen.
Der Schriftsteller seufzte.
„Das läßt sich schwer auseinanderhalten … in diesem Falle. Eines dürfte so richtig sein, wie das andere.“
„Gut. Und wie steht es mit dem zweiten Teil meiner Frage?“
„Da kann ich Ihnen eine befriedigende Auskunft geben!“ Larsen lächelte ironisch und ein wenig bitter. „Im Falle eines Ungehorsams droht mir nicht mehr und nicht weniger als der Tod!“
O’Kelly nickte.
„Ich dachte es mir. Nun aber zur Hauptfrage: halten Sie den Fall für ernst? Mit anderen Worten — wollen Sie zahlen?“
Abwartend betrachtete er Larsen. Dieser sah mit trüben Augen zu ihm auf.
„Ich will zahlen,“ sagte er in gemachter Ruhe. Dann aber warf er den Kopf zurück und sagte so eindringlich, daß O’Kelly erschrak: „Ich … ich kann aber nicht!“
„Sie können nicht?“ Der Kriminalbeamte schien betroffen.
Larsen schüttelte melancholisch den Kopf.
„Sie verkennen meine Vermögenslage. Ach, nicht Sie allein … Jedermann hält mich für reich. Warum? Weil ich vor aller Augen etwa RM. 75 000.— jährlich ausgebe. Da muß doch Kapital vorhanden sein — denken die Leute. Es würde über den Horizont dieser Leutchen gehen, wenn man ihnen erklären wollte, daß dieses Geld mein jährlicher Verdienst und nicht etwa die Zinsen von irgendeinem Kapital sind, und daß ich im Jahr genau soviel ausgebe, wie ich verdiene. Und doch ist es so. Wenn Sie mich heute fragen würden, wieviel ich besitze, so müßte die Antwort lauten: nichts! Es ist möglich, daß ich sogar Schulden habe.“
O’Kelly war sehr ernst geworden. Er hatte sein Kinn auf die Faust gestützt und starrte, ohne Larsen anzusehen, an ihm vorbei nach einer Zimmerecke.
„Es steht mir nicht zu, Kritik an Ihrer Handlungsweise zu üben,“ sagte er sachlich. „Ich will mich lediglich auf den uns interessierenden Kriminalfall beschränken. Da finde ich eines sehr, sehr sonderbar …“
„Was?“ fragte Larsen rasch.
„Daß der Erpresser, dieser Karo König, sich anscheinend ebenfalls durch den Aufwand in Ihrer Lebensweise hat täuschen lassen. Im allgemeinen pflegen Erpresser, zumal solche, die mit derart hohen Beträgen operieren, sich vorher sehr genau über die Vermögenslage des ausersehenen Opfers zu informieren.“
„Das brauchte der Karo König nicht,“ entgegnete der andere bedrückt. „Er kennt meine Vermögenslage nur zu gut.“
„Und dennoch?“ rief O’Kelly verwundert. „Und dennoch verlangt er RM. 600 000.—?“
„Ich kann Ihnen das nicht erklären,“ sagte Larsen leise.
„Ach so … Ein Teil Ihres Geheimnisses!“ Der Inspektor erhob sich. „Ich gehe jetzt. Lassen Sie mich, bitte, durch eine Seitentür hinaus — ich möchte nicht mit neugierigen Fragen belästigt werden. Und morgen werde ich Ihnen mitteilen, was wir unternehmen wollen, um dem Karo König das Handwerk zu legen.“
„Glauben Sie, daß Sie mir … mir … helfen können?“ fragte der Hausherr stockend.
O’Kellys Mienen waren undurchdringlich.
„Ich weiß nicht,“ sagte er kalt.
4
Durch eine schmale Hintertür gelangte O’Kelly in einen dunklen Hof und von da aus auf die Straße. Er wollte bereits seines Weges gehen, als ihm ein Mann in einem Torbogen des gegenüberliegenden Hauses auffiel, der sichtlich bemüht schien, verborgen zu bleiben. Den Hut hatte er tief ins Gesicht gerückt und den Kragen des Überziehers hoch aufgeschlagen. Unablässig spähte er nach den hellerleuchteten Fenstern von Larsens Wohnung. Augenscheinlich hatte er O’Kelly gesehen, denn jetzt verschwand er plötzlich im Torbogen.
Sekundenlang überlegte der Inspektor. Sollte das vielleicht gar der Mann sein, der sich Karo König nannte? Lauerte er ihm etwa hier auf? Unglaublich plump, aber schließlich nicht ganz unmöglich.
In plötzlichem Entschluß zog der Detektiv seinen Revolver aus der Tasche, entsicherte die Waffe und schlich sich leise über die Straße. Vor dem Torbogen machte er halt. Dann ein Riesensprung, und er befand sich neben der dunklen Gestalt.
„Wer sind Sie? Was treiben Sie hier?“ herrschte er den Fremden an.
Dieser hatte sich in den äußersten Winkel des Tores gepreßt. Auf des Inspektors energischen Anruf wandte er sich langsam um.
O’Kelly lachte plötzlich laut auf.
„Um Gotteswillen, Taube, was fällt denn Ihnen ein?!“
Es war tatächlich der Wachtmeister Taube. Er schien gekränkt.
„Da gibt es nichts zu lachen,“ sagte er würdevoll. „Ich wollte nur ein wenig nach dem Rechten sehen. Ich dachte, der Karo König würde Sie vielleicht totschlagen.“
„Ich bin gerührt,“ erklärte O’Kelly begeistert. „Solcher Treue und Anhänglichkeit bin ich nicht wert.“
„Unsinn! Treue und Anhänglichkeit!“ rief Taube ärgerlich. Er konnte sehr grob werden, wenn man seinen Handlungen allzu edle Motive unterschob. „Ich wollte mir nur Ihren Totschlag aus nächster Nähe mit ansehen, das ist alles.“
„Ach so! Das wäre natürlich sehr spannend gewesen,“ pflichtete O’Kelly bei. „Nun sind Sie aber doch nicht auf Ihre Rechnung gekommen!“
„Nein, es war ein großer Reinfall. Ich bildete mir ein, es wäre diesem Karo König ernst mit seiner Drohung. Anscheinend war der Brief aber doch nur Mumpitz.“
„Nein, Taube, er war nicht Mumpitz.“ O’Kelly war plötzlich wieder ernst geworden. „Da steckt schon etwas dahinter. Aber kommen Sie und begleiten Sie mich ein Stückchen.“ In knappen Worten schilderte er die Ereignisse der letzten Stunden.
„Alles in allem“, schloß er seinen Bericht, „ergibt sich für mich zunächst die Notwendigkeit, festzustellen, wer der Karo König eigentlich ist. Ich meine, was für eine Rolle in der Kriminalgeschichte er bis jetzt gespielt hat. Ich werde mal morgen in unserer Kartothek nachschlagen.“
„Das wird Ihnen wenig nützen,“ sagte Taube bedächtig. „Ich habe nämlich heute abend schon nachgesehen.“
„Sie sind ein Juwel! Nun und? Was fanden Sie dort?“
„Nichts! Nicht das Geringste. Er kann unmöglich ein großes Licht sein.“
„Das ist seltsam,“ murmelte O’Kelly.
„Wissen Sie was,“ rief Taube plötzlich lebhaft. „Gehen Sie doch zu dem Kriminologen Dr. Raymond. Er ist eine Kapazität auf dem Gebiet des Erkennungswesens. Seine private Verbrecherkartothek ist, was die letzten Jahrzehnte betrifft, in mancher Beziehung reichhaltiger und ausführlicher als unsere amtliche. Auf Grund seiner hervorragenden Fachkenntnisse wurde ihm wiederholt nahegelegt, seine Amateurarbeit mit einer leitenden Position im Kriminalamt zu vertauschen, aber er …“
O’Kelly lächelte vergnügt.
„Fügen Sie nur noch hinzu,“ unterbrach er den Wachtmeister, „daß Dr. Raymond ein sehr guter Bekannter eines gewissen Inspektors Mac O’Kelly ist, und Sie die beiden schon oft bei lebhafter Unterhaltung beobachten konnten. Übrigens,“ fuhr er fort, „ist der Gedanke, Dr. Raymond aufzusuchen, gar nicht so übel. Das machen wir!“
Sie waren inzwischen bei O’Kellys Wohnung angelangt. Mit kurzem Gruß begab sich Taube auf den Heimweg, während O’Kelly sinnend den Hausflur betrat und dann noch etwa 20 Minuten lang nachdenklich in seinem Zimmer hin- und herlief.
Am anderen Morgen war sein erster Gedanke wieder der mysteriöse Fall „Karo König“. Sogleich nach dem Frühstück machte er sich auf den Weg zu Dr. Raymond. Er verzichtete auf die Trambahn und ging zu Fuß. So mochte er etwa die Hälfte des Weges bereits zurückgelegt haben, als eine merkwürdige Gestalt seine Aufmerksamkeit auf sich lenkte.
Ein alter Mann, mit Lumpen bekleidet, unrasiert und das spärliche rötlich-gelbe Haar vom Wind und Wetter zerzaust, schlingerte langsam vor ihm auf dem Gehsteig hin und her. Er mußte eine ungeheure Menge Alkohol verkonsumiert haben, denn jedesmal, wenn er bei seinem pendelartigen Vorwärtsschreiten den Rand des Trottoirs erreichte, blieb er notgedrungen stehen und fuchtelte eine Weile windmühlenartig mit den Armen herum, bis es ihm gelang, durch einen kühnen seitlichen Vorstoß wieder in das angestrebte Geleis zu kommen. Ab und zu blieb der eine oder andere Straßenpassant kopfschüttelnd stehen und verfolgte eine Weile mit schadenfrohem Lächeln die akrobatischen Leistungen des Alten; die meisten beachteten ihn aber gar nicht und gingen ruhig ihres Weges.
Auch O’Kelly hätte ihn kaum weiter beachtet, obwohl es sogar für Groß-Berlin ein nicht ganz alltägliches Bild war. Doch war ihm ein sonderbarer Umstand aufgefallen; und wenn O’Kelly etwas auffiel, ließ er nicht eher locker, als bis er wußte, woran er war. Dieser betrunkene Alte bewegte sich nämlich trotz seines schwankenden Schrittes ziemlich rasch vorwärts. O’Kelly überlegte, daß er im Leben noch keinem schwer Angetrunkenen begegnet war, der es eilig gehabt hätte.
Seine Gedanken wurden jäh unterbrochen. Der Alte war stehen geblieben, und als O’Kelly an ihm vorbeiging, packte er ihn plötzlich bei den Rockaufschlägen.
„Tag, Herr … Herr …,“ brüllte er mit versoffener Stimme.
Der Inspektor wollte sich unwillig losreißen, doch der andere hielt ihn mit ungeahnter Kraft fest.
„O’Kelly,“ flüsterte er heiser. „Uns gegenüber verabschieden sich gerade zwei Männer. Dem, der nach rechts geht, folgen Sie unbemerkt. Kapiert?“ Als O’Kelly ihn noch immer mit verständnislosen Blicken anstarrte, fügte er zischend hinzu: „Idiot! Ich bin doch Link.“
Kaum hatte er diese Worte hervorgestoßen, als er eine scharfe Wendung nach links machte, und in seinem schwankenden Schritt, ohne im geringsten auf die Trambahnen oder Autos zu achten, die Straße zu überqueren begann.
Jetzt hatte O’Kelly begriffen. Er sah zwei einfach gekleidete Männer sich von einander trennen. Der eine nahm seinen Weg nach links, parallel dem angeblich Betrunkenen; der andere schritt rüstig in der entgegengesetzten Richtung aus. Unauffällig folgte O’Kelly diesem.
Etwa eine halbe Stunde lang ging die Verfolgung ohne sonderliche Schwierigkeiten vonstatten. Der Weg führte durch lauter belebte Straßen; auch schien der Verfolgte sich sehr sicher zu fühlen, denn er sah sich kein einziges Mal um. Dann aber kamen sie in eine entlegenere Gegend und hier bedurfte es der ganzen Geschicklichkeit des Detektivs, um dem Manne ungesehen zu folgen.
Vor den Ruinen eines abgebrochenen Hauses machte der Mann plötzlich halt, und O’Kelly hatte gerade noch Zeit, mit einem raschen Sprung im ersten besten Hauseingang zu verschwinden. Wie er richtig vermutet hatte, sah sich der Verfolgte jetzt vorsichtig nach allen Seiten um. Weit und breit war kein Mensch zu sehen.