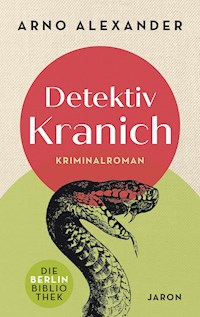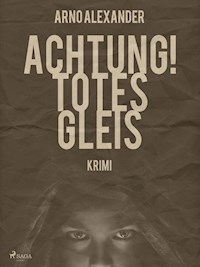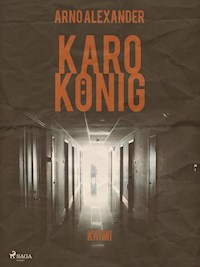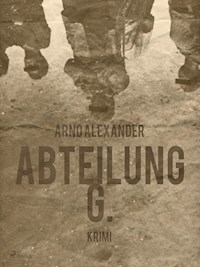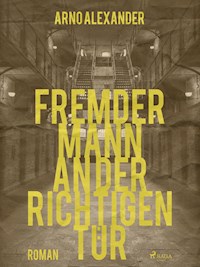Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein schwarzbärtiger Mann betritt den Laden des Waffenhändlers Raldstone im Zentrum von New York. Er kauft einen veralteten Revolver, verlässt den Laden und zerschießt das Seitenfenster eines an der 59th Avenue parkenden Wagens, ohne jedoch den gerade einsteigenden Besitzer zu treffen. Dabei handelt es sich allerdings um niemand Geringeren als Mr. Frederick Manhattan, den Multimillionär. Kapitän Hearn vom Kriminalamt, der zufällig Zeuge des Geschehens wird, nimmt sich der Sache an. Es stellt sich heraus, dass Manhattan nicht gerade den besten Leumund und entsprechend recht viele Feinde hat. Wenig später wird Manhattan in seinem Bibliothekszimmer durch Giftgas getötet. Wer war der Mörder? Jener schwarzbärtige Mann, der schon einmal auf ihn geschossen hat? Auch Detektiv Huntington beginnt nun mit seinen Ermittlungen. Immer wieder kreuzen sich seine Wege mit denen Hearns, was auch für Konfliktstoff sorgt, den ihre Ermittlungsmethoden sind sehr verschieden ... Ein packender Kriminalroman aus der Welt des New York der frühen dreißiger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts.Arno Alexander ist das Pseudonym des deutschen Schriftstellers Arnold Alexander Benjamin (1902–1937). Der in Moskau geborene Autor veröffentlichte von 1929 bis zu seinem Tod rund zwanzig Romane, die unter anderem bei Goldmann in Leipzig und Münchmeyer in Dresden erschienen sind. Alexander schrieb vorwiegend Kriminalromane, aber auch utopisch-fantastische Romane ("Doktor X", 1929) und Frauenromane wie "Fremder Mann an der richtigen Tür" (1936). Viele seiner Werke wurden nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgelegt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arno Alexander
Die verschwundene Melodie
Roman
Saga
Die verschwundene Melodie
© 1931 Arno Alexander
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711625989
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1
Fast unmittelbar hintereinander betraten zwei Männer den im Mittelpunkt New Yorks gelegenen Laden des Waffenhändlers Raldstone. Der erste, ein Mann von kleiner, gedrungener Gestalt, mit schwarzen, stechenden Augen und einem ebenfalls schwarzen Knebelbart, steuerte sogleich auf den Ladentisch zu, während der andere, der noch kleiner war und sich neben dem ersten schmächtig und unscheinbar ausnahm, bescheiden an der Tür stehen blieb.
„Geben Sie mir einen Revolver!“ sagte der Schwarzbärtige mit voller, lauter Stimme. Seine Aussprache verriet den Südländer, und die gewählte Kleidung zeugte von Wohlstand. In merkwürdigem Gegensatz dazu aber waren seine Fingernägel ungepflegt und schwarzumrandet.
Der Waffenhändler hob den Glasdeckel eines Tisches hoch und holte mehrere Revolver zur Auswahl heraus.
„Hier, bitte, dieser Browning! Er ist zwar klein, aber ...“
„Ich nehme den dort!“ unterbrach ihn der Kunde kurz entschlossen und deutete auf eine schwere Waffe mit starkem, klobigem Griff.
„Dieser Revolver ist sehr veraltet“, widersprach Raldstone. „Kein Mensch kauft mehr solche Waffen.“
„Gestatten Sie mir, Ihnen einen ganz unverbindlichen Rat zu geben“, mischte sich plötzlich der kleine Mann an der Tür ins Gespräch. Er sprach mit einer feinen, dünnen Stimme, die durchaus zu seinem unansehnlichen Äußeren paßte. „Ich kenne mich ein wenig in Schußwaffen aus. Wozu brauchen Sie eigentlich den Revolver?“
Der Schwarzbärtige drehte sich unwillig um.
„Das geht Sie gar nichts an!“ rief er unwirsch. „Nehmen Sie meinetwegen an, daß ich mit diesem Revolver einen Menschen niederknallen will!“ Er lachte über seinen rohen Scherz und wandte sich wieder dem Ladeninhaber zu: „Also, was kostet das Pistölchen?“
„Ich kann Ihnen das Ding billig ablassen. Ich sagte ja schon — heutzutage kauft niemand mehr einen solch veralteten Revolver ...“
Der Kunde knurrte wütend.
„Hummm ... Zum Deibel! Nennen Sie Ihren Preis und basta! Habe keine Zeit, Ihren Senf da anzuhören!“
Mr. Raldstone seufzte.
„Achtzehn Dollars fünfzig Cents“, sagte er nach kurzem Zögern.
Der Käufer warf einen Zwanzigdollarschein auf den Tisch.
„Soll ich die Waffe ein wenig einpacken?“ erkundigte sich Raldstone.
Der andere lachte kurz auf.
„Was soll ich mit einem eingewickelten Revolver?“ Er griff danach. „Nein, so ist er rascher zur Hand. Auf Wiedersehen!“ Mit einer achtlosen Handbewegung wies er die kleinen Münzen zurück, die Raldstone auf einen Teller zählte; dann stürmte er zur Tür hinaus.
Der Waffenhändler steckte das Kleingeld in die Westentasche und wandte sich seinem zweiten Kunden zu.
„Was darf es sein, Sir?“
Der schmächtige Mann an der Tür fuhr sich mit der Hand über sein glattrasiertes Kinn und starrte sinnend durch die Glasscheiben des Fensters.
Raldstone betrachtete mit prüfenden, abschätzenden Blicken das ein wenig schäbige, wenn auch keineswegs unordentliche Äußere seines Kunden und wiederholte etwas ungeduldig seine Frage.
Der Mann blickte auf.
„Ja, so ... Jede Waffe, die Sie verkaufen, hat doch eine bestimmte Nummer? Nicht wahr?“
„Selbstverständlich, aber warum ...“
„Nun“, fuhr der andere mit seiner dünnen, unsicheren Stimme fort. „Ich möchte gern wissen, welche Nummer der Revolver hatte, den Sie soeben verkauften?“
„Mit welchem Recht ...“ begann der Händler ungehalten.
„Ich bin Kapitän Hearn vom Kriminalamt“, sagte der kleine Mann bescheiden und legte ein Ausweispapier auf den Tisch.
Sofort änderte sich das Benehmen Raldstones.
„Oh! Verzeihung! Das wußte ich natürlich nicht. Die Nummer?“ Er sah nach einem Verzeichnis und kritzelte einige Zahlen auf einen Streifen Papier. „Hier, bitte!“ Dann beugte er sich vor: „Ist der Mann ein Verbrecher?“
Der Polizeibeamte zuckte die Achseln.
„Soviel ich weiß, nein!“ erwiderte er leise. „Aber wie schnell wird bei diesen schlechten Zeiten ein unbescholtener Mensch zum Verbrecher! Haben Sie eine Ahnung! Besonders, wenn er einen nicht eingewickelten Revolver lose in der Tasche herumträgt. — Ich möchte übrigens dieses Los kaufen!“ Mit diesen Worten nahm er eines der auf dem Tisch liegenden bunten Papierchen an sich.
„Nehmen Sie lieber das grüne dort! Mit dem roten können Sie höchstens eine Katze oder einen Papagei gewinnen. Mit dem grünen dagegen ...“
„Lassen Sie nur!“ wehrte Hearn ab und legte eine dünne, silberne Haarsträhne, die ihm beim Bücken ins Gesicht gefallen war, hinter sein rechtes Ohr. „Ich habe nichts gegen Katzen und Papageien. Ich besitze selbst ein kleines Seidenäffchen. Es heißt Sambi. Ich finde, es wäre sehr nett, wenn ich noch solch ein Tierchen hätte, das mir liebevoll in einsamen Stunden die Zeit verkürzen würde. Außerdem“, fuhr er etwas lebhafter fort, „ist auf diesem roten Los ein Fingerabdruck, den ich auf dem grünen Papierchen nicht finden könnte.“
„Ein Fingerabdruck?“ rief Raldstone erstaunt.
„Nun ja! Der Käufer von vorhin tippte mit dem Zeigefinger auf dieses Blatt, als er Sie auf den unter dem Glase liegenden Revolver aufmerksam machte.“
„Aber wozu, um Himmelswillen, brauchen Sie denn Fingerabdrücke eines unbescholtenen Bürgers?“
Hearn legte ein Fünfzigcentstück auf den Tischrand und lächelte sanft.
„Es kann zuweilen von großem Nutzen sein, wenn man bei irgendeinem neuen Verbrechen gleich die Revolvernummer und Fingerabdrücke des Täters kennt. Und der Schritt vom unbescholtenen Bürger zum Verbrecher ist, wie gesagt, sehr kurz. Zuweilen genügt ... Ha! Was war das?“
Raldstone war bleich geworden. Auch er hatte deutlich einen Schuß gehört.
Im nächsten Augenblick stürmten beide Männer zur Tür hinaus. Sie sahen Menschen wie aufgestörte Ameisen durcheinander laufen. Mehrere Polizisten bahnten sich mit Mühe den Weg zu einem am Bordrand haltenden Kraftwagen, dessen Scheiben zertrümmert waren.
Hearn trat näher und winkte einen der Ordnungswächter heran. „Was ist los?“
„Ein schwarzbärtiger Mann hat nach dem Wagen geschossen, und zwar in dem Augenblick, als der Besitzer einstieg. Getroffen hat er nicht. Leider konnten wir ihn aber auch nicht erwischen: Im Nu war er im Menschengewirr verschwunden. Nun wollen wir aus dem Wagenbesitzer herausbringen ...“
Eine knarrende, alte Männerstimme, die aus dem Wageninnern kam, übertönte die Worte des Polizisten. Ein runzliches Gesicht, dessen Stirn ohne Übergang zu einer spiegelglatten Glatze verlief, erschien am zerbrochenen Seitenfenster.
„Eine Unverschämtheit!“ schrie der Wagenbesitzer, und sein Gesicht wurde röter und röter vor Zorn. „Erst schießen Banditen, und die Polizei tut nichts dagegen! Dann lassen sie die Kerle laufen und wollen mich festhalten! Ich werde beim Innenminister Beschwerde einlegen ...“
„Kennen Sie den Herrn?“ fragte Hearn rasch.
Der Polizist nickte. „Ja ...“
„Dann lassen Sie ihn weiterfahren!“ fiel ihm der Kapitän schnell ins Wort.
Der andere gab seinen Kollegen einen Wink. Sofort traten die Polizisten beiseite. Das zornfunkelnde Antlitz am Fenster verschwand, und der Wagen setzte sich mit einem sanften Ruck in Bewegung.
Hearn blickte dem Wagen in Gedanken versunken nach.
„Wer war denn dieser Mann?“ erkundigte er sich nach einer Weile.
„Das war Mr. Frederick Manhattan, der Multimillionär“, antwortete der Beamte mit Ehrfurcht in der Stimme.
Der Kapitän pfiff leise durch die Zähne.
„Das ist wirklich sehr beachtenswert“, murmelte er und kraute sich nachdenklich am Hinterkopf.
2
Der Auftritt auf der 59th Avenue war nicht unbeachtet geblieben. Ladenbesitzer, weißgekleidete Handlungsgehilfen und Verkäuferinnen standen in den halbgeöffneten Türen; eine Menge schaulustiger Neugieriger hemmte den Straßenverkehr und leistete den Aufforderungen der Polizisten weiterzugehen nur ungern Folge.
Auch Mr. Tschuppik, der steinreiche Besitzer der „Steel Trust Company“ und Generaldirektor verschiedener anderer Trusts, war durch den Knall des Schusses aufmerksam geworden. Er war ein Mann von etwa fünfundfünfzig Jahren, sah aber für sein Alter noch sehr rüstig aus. Mittelgroß, von kräftiger, gedrungener Gestalt und kerzengerader Haltung, machte er den Eindruck eines frühzeitig in den Ruhestand versetzten Hauptmanns. Kein Augenglas beeinträchtigte den scharfen Schnitt seiner männlichen Züge, und die kurzgeschnittenen, harten Stoppeln auf der Oberlippe vermochten ebenfalls nicht, seinem Gesicht etwas Weiches zu verleihen. Wäre nicht eine gewisse Leibesfülle gewesen, hätte man sagen können, er sei ein Muster des rücksichtslosen, geschäftstüchtigen Amerikaners.
Im Augenblick allerdings tat er etwas, was einem waschechten „Yankee“ nie eingefallen wäre. Er blieb am Fenster seines im zweiten Stock gelegenen Privatbüros stehen, fuhr sich mit der Bleistiftspitze nachdenklich durch sein lichtes graues Haar und starrte minutenlang schweigend durch die Scheiben.
Doris Elmhurst, seine kaum zwanzigjährige, junge Sekretärin, sah erstaunt auf. Es kam nicht oft vor, daß Mr. Tschuppik sich durch irgend etwas mitten im Diktat eines wichtigen Briefes stören ließ. Die schlanken Finger über den Tasten der Maschine bereit haltend, blickte sie erwartungsvoll zu ihrem Vorgesetzten hinüber. Wenn sie aber meinte, nun käme endlich die Fortsetzung des Briefes, so sollte sie sich getäuscht haben.
„Unsichere Zustände das!“ brummte Mr. Tschuppik und schüttelte bekümmert den Kopf. „Am hellichten Tage schießen die Burschen auf einen Wagen. Man wird sich bald nicht mehr auf die Straße hinaustrauen dürfen!“ In plötzlichem Entschluß trat er an den Fernsprecher und verlangte den ersten Prokuristen zu sprechen.
„Heilmann, stellen Sie doch mal fest, was da unten los ist; insbesondere, auf wen geschossen wurde.“
Doris war sprachlos.
Mr. Tschuppik, der ihr Erstaunen bemerkt und richtig gedeutet zu haben schien, ließ sich zu einer Erklärung herab:
„Es war nämlich einer der teuersten Wagen. Wie leicht kann mir mal dasselbe widerfahren. Verstehen Sie?“
Das Mädchen nickte. Also das war es: Mr. Tschuppik hatte Angst, ganz einfach Angst.
„Ich finde Ihre Besorgnis sehr begreiflich“, sagte sie leise und widerstrebend, denn sie sprach nicht gern die Unwahrheit.
„Nicht wahr?“ Mr. Tschuppik wurde lebhaft. „Man könnte meine Bedenken feige finden, Miß ... Miß ...“
„Elmhurst“, fiel sie ihm ins Wort.
„Richtig! Miß Elmhurst. Sie sagten es mir heute schon einmal. — Aber es ist nicht feige, bestimmt nicht. Ich kann alles im Leben mehrere Male verlieren, nur das Leben selbst nicht. Merken Sie sich diese einfache Tatsache, Miß ... Miß ... na, ist ja gleich! — Die meisten Menschen tun so, als hätten sie ein paar Leben zu verlieren, und das nennt man dann Mut. Torheit ist es, nichts weiter! Sehen Sie das ein, Miß ...?
„Hm ...!“ machte Doris. Es klang nicht sonderlich überzeugt.
Der Fernsprecher surrte.
„Ja?“ Mr. Tschuppik war ganz Ohr. „So, so ... sehr bezeichnend! Also Mr. Manhattan, dem Schieber und Spekulanten, galt der Anschlag. Danke, Schluß! — Halt! Sorgen Sie dafür, daß die Sache richtig in die Zeitungen kommt! Sie verstehen mich doch? Etwa so: Verzweifelte Tat eines durch den Blutsauger zugrunde Gerichteten! Im Volk Erregung über die tausenden durch ihn vernichteten Existenzen! Etwas feiner natürlich, nicht so roh; Sie können das besser als ich ... Vielleicht gehen seine Aktien daraufhin ein bißchen ’runter ... Ja, dann kaufen Sie. Das ist alles. Schluß!“
Händereibend, mit kurzen, hastigen Schritten lief Mr. Tschuppik im Zimmer auf und ab. Seine Augen glänzten, und um seine Lippen spielte ein heiteres Lächeln.
„Geschäft ist Geschäft!“ erklärte er selbstzufrieden. „Ich bin nicht herzlos, aber wie gesagt — Geschäft — — — und dann: Dieser Manhattan ist ein Gauner, ein Spitzbube, ein ganz abgefeimter Schurke, der es nicht anders verdient — — —“
Doris war dunkelrot geworden.
„Mr. Manhattan ist mein Onkel“, sagte sie leise.
„Ihr — was?!“ Mr. Tschuppik schien das Wort in der Kehle stecken zu bleiben. „Ich Unmensch!“ rief er plötzlich aus und schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. „Jetzt erinnere ich mich: Sie sagten es mir, als Sie vor drei Wochen antraten. Ich habe ein so schlechtes Gedächtnis für die Kleinigkeiten des Alltags ... Peinlich, wirklich peinlich ... Aber dieser Manhattan, — Verzeihung: Ihr Onkel, — warum läßt er Sie arbeiten? Sie könnten doch statt dessen Golf oder Hockey spielen ...?“
Doris lächelte.
„Wenn mein Onkel etwas für mich tun wollte, so würde ich mein Leben bestimmt nicht mit Golf- oder Hockeyspielen zubringen“, entgegnete sie schlagfertig. „Nicht alle Mädchen sehen darin die Erfüllung ihrer geheimsten Wünsche“.
„Nicht alle? Verblüffend! Ich dachte ... aber das kommt daher, weil ich keine Kinder habe. Also — hm — so geizig ist Ihr Onkel, daß er Sie lieber sich die Finger wund schreiben läßt, ehe er die vollgespickte Brieftasche zückt ... hm ...“
„Mein Onkel ist nicht geizig“, widersprach Doris. „Er ist ein armer Sonderling. Er glaubt nämlich, die Welt und alle Menschen seien schlecht.“
„Und das nennen Sie ‚armer Sonderling‘?! Wie arm muß ich dann sein? He? Aber lassen wir das. Wieviel Gehalt bekommen Sie bei mir?“
„Fünfzig Dollars die Woche.“
„Ab heute bekommen Sie fünfundsiebzig Dollars. Und nun an die Arbeit!“
„Verzeihen Sie!“ unterbrach ihn das Mädchen hastig.
„Was denn noch?“ Der Ton klang gereizt. Bei der Arbeit durfte den Allgewaltigen niemand stören. Doris wußte es und wagte es diesmal dennoch.
„Ich möchte Sie bitten, mir auch weiterhin fünfzig Dollars die Woche zu zahlen“, sagte sie stockend.
Mr. Tschuppik runzelte die Stirn.
„Warum?“ fragte er scharf.
„Weil ...“ Doris suchte krampfhaft nach Worten. „Weil ... nun, jeden Monatsersten legt Ihnen Mr. Heilmann eine Liste der Angestellten vor, die seiner Meinung nach zu viel verdienen und durch billigere Kräfte ersetzt werden könnten. Am nächsten Ersten wäre bei fünfundsiebzig Dollars Wochenlohn auch mein Name auf dieser Liste. Sie haben bis jetzt stets sämtliche Entlassungen gutgeheißen, ohne sich darum zu kümmern, ob die zu hoch bezahlten Angestellten nicht lieber billiger arbeiten wollten, ehe sie brotlos würden.“
Mr. Tschuppik sah eine Weile finster vor sich hin. Doris bereute bereits ihre mutigen Worte; doch hatte sie so sprechen müssen, da ihre Entlassung am Ersten sonst ganz fraglos gewesen wäre. Plötzlich riß ihr Vorgesetzter wieder den Hörer vom Fernsprecher.
„Rufen Sie Heilmann!“ sagte er kurz. Als jener sich meldete, fuhr er fort: „Hören Sie mal zu, Heilmann! Die Liste der zu teueren Arbeitskräfte versehen Sie in Zukunft mit entsprechenden Vermerken über die Höhe der Gehälter, die wir zu zahlen imstande sind. Ja, und dann geben Sie die Liste meiner Sekretärin, Miß ... wie? ... ja, Miß Elmhurst.“ Er warf den Hörer auf die Gabel. „Sie, Miß Elmhurst, werden dann an Hand der Liste — nicht öffentlich natürlich — die betreffenden Leute fragen, ob sie bleiben wollen. So, jetzt schreiben Sie ... Wo waren wir doch stehengeblieben?“
Doris las den letzten Satz laut vor. Ihr Chef begann mit dem Diktat. Er saß an seinem großen Schreibtisch und öffnete nebenbei Briefe. Trotz seines schlechten Gedächtnisses für die Kleinigkeiten des Lebens, besaß er die bemerkenswerte Fähigkeit, gleichzeitig einen verwickelten Brief angeben und dabei andere lesen und mit Randbemerkungen versehen zu können.
„Augenblick mal“, unterbrach er sich und griff erneut nach dem Hörer des Fernsprechers. Er verlangte die Rufnummer der „National City Bank“ und ließ sich mit einem der Direktoren verbinden. „Hier Tschuppik selbst!“ rief er, und seine Stimme klang ärgerlich. „Bei der Durchsicht Ihrer Post fällt mir auf, daß die Empfangsbestätigung meines gedrahteten Verkaufsauftrags der Baltimore and Ohio shares fehlt. Ja, bitte sehr! ...“
Einige Minuten vergingen.
„Wie“, rief Mr. Tschuppik plötzlich, und in seinen Zügen malte sich Überraschung. „Wie? Sie haben meine Drahtnachricht erst heute vor einer knappen halben Stunde erhalten? Das ist doch ... Danke, Schluß! ... Nein, den Auftrag nicht mehr ausführen!“
Eine geraume Weile saß Mr. Tschuppik, in angestrengtes Nachdenken versunken, grübelnd da. Die Finger seiner rechten Hand hielten einen Bleistift umklammert. Flüchtig warf er eine Reihe von Zahlen aufs Papier. Plötzlich sprang er auf und schlug mit der Faust auf den Tisch.
„Ein Verlust von 257360 Dollars. Zum Verrücktwerden!“ Er begann, im Zimmer auf und ab zu rennen.
Doris beobachtete ihn mit ehrfurchtsvollem Schweigen. Plötzlich blieb er wieder dicht vor ihr stehen. Auf seiner Stirn zeichnete sich eine bläuliche Zornesader ab.
„Wie war das doch gleich, Miß ...? Vorgestern abend waren Sie mit mir in Chikago zur Verhandlung mit den Vertretern der Kanadischen Eisenwerke. Nach dem Abendessen im Hotel las ich die Zeitung ... Richtig! Ich finde eine sonderbare Nachricht, verlange Tinte und Papier ... natürlich, so war es ... sicherheitshalber lasse ich das Telegramm nicht durch Hotelbedienstete besorgen, sondern ... ehern ... sondem ...“
„Durch mich, Mr. Tschuppik“, sagte Doris und blickte voll zu ihm auf. „Sie können davon überzeugt sein, daß ich Ihren Auftrag sofort gewissenhaft erledigte.“
Mr. Tschuppik schien ratlos.
„Ja, aber dann ... zum Kuckuck! Was ist denn da los? Herrrein!!“ Es hatte geklopft. Auf Mr. Tschuppiks Aufforderung öffnete sich die Tür; ein junger Angestellter trat ein und verneigte sich ehrerbietig.
„Herr Postdirektor Hähnel und ein Detektiv wünschen Sie in dringender Angelegenheit zu sprechen“, erklärte er.
Die Augen des Stahlmagnaten funkelten.
„Ich lasse bitten!“ sagte er finster.
3
Zwei Herren betraten den Raum. Der erste war ein älterer Mann mit schlaffen, müden Gesichtszügen; der zweite dagegen schien noch jung, kaum über dreißig; seine Gestalt war von mittlerer Größe, das Gesicht männlich und zielbewußt, von rein angelsächsischem Gepräge.
„Gestatten, Postdirektor Hähnel“, stellte sich der ältere vor. „Dies hier ist Mr. Huntington, Leiter der Privatdetektei Clayvills & Huntington.“
Mr. Tschuppik hatte sich erhoben. Er nannte ebenfalls seinen Namen.
„Ich weiß“, fuhr er fort und machte eine einladende Handbewegung, auf einige Sessel deutend. „Ich arbeite selbst mit diesem Haus. Es ist ein sehr gutes und sehr teures Unternehmen. Was verschafft mir übrigens die Ehre?“
Der Postdirektor zögerte. Er hatte in einem mit kostbarem Leder bespannten Sessel Platz genommen, und seine Blicke schweiften ängstlich zu Doris hinüber. Als das Mädchen dies bemerkte, raffte sie sogleich einige Briefe zusammen und machte Anstalten, das Zimmer zu verlassen; aber eine deutliche Kopfbewegung ihres Vorgesetzten hielt sie zurück.
„Ich glaube die Angelegenheit zu kennen, in der Sie mich zu sprechen wünschen“, sagte er stirnrunzelnd. „Miß ... hm ... dingsda, weiß Bescheid. Sie können also ohne weiteres zur Sache kommen.“
„Nun ja“, meinte Hähnel unbestimmt, „wie Sie wünschen. Es handelt sich also um eine Drahtnachricht ...“
„... die gestern früh ankommen sollte und erst vierundzwanzig Stunden später eintraf, nicht wahr?“ unterbrach ihn Tschuppik. Er sprach kühl und gelassen, und nichts in seinem Benehmen erinnerte mehr an seine zornige Aufwallung vor fünf Minuten. „Was haben Sie darüber zu berichten?“
„Eine sehr unangenehme Geschichte ... wirklich sehr unangenehm ...“ Hähnel fuhr sich ein paarmal über die feuchte Stirn und rückte unruhig auf seinem Sessel hin und her. „Der Eilbote ist nämlich mit Ihrem Telegramm durchgebrannt.“
„Wa—as?“ Der Millionär war verblüfft. „Mit meinem Telegramm ... wie sagten Sie doch gleich ... durchgebrannt?“
Der andere nickte.
„Ich finde tatsächlich keinen treffenderen Ausdruck. Die Sache kam so“, erklärte er. „Der Eilbote kehrte, nachdem er drei Telegramme zur Bestellung erhalten hatte, nicht mehr zurück. Zwei der Depeschen hat er noch richtig bestellt, nur Ihre nicht. Sein Ausbleiben fiel zunächst nicht weiter auf; man nahm an, er wäre plötzlich erkrankt. Erst als er heute wieder nicht erschien, begann die Suche. Sie können sich unser Erstaunen vorstellen, als uns Mr. Huntington schon nach zwei Stunden mitteilte, daß der Mann noch gestern nacht über die Grenze nach Canada entwichen sei. Ich ließ für jeden Fall Ihr Telegramm gleich nachbestellen und dann sprach ich mit der Frau des Flüchtigen. Er hat hier nämlich Frau und fünf Kinder zurückgelassen. Und ... und ... nun, sie bat mich flehentlich, doch von einer Anzeige abzusehen. Ich habe mir natürlich die Sache lange überlegt. Schließlich bin ich aber zu der Überzeugung gelangt, daß ich tatsächlich von der strafrechtlichen Verfolgung absehen kann. Es handelt sich ja nicht um einen flüchtigen Dieb oder Betrüger: er hat keinen Cent veruntreut. Wir sind somit nicht geschädigt ...“
„Aber ich!“ warf Mr. Tschuppik dazwischen. „Ich habe einen Schaden von rund 260000 Dollars!“
Nun war es an Hähnel, verblüfft zu sein.
„Das ... das ändert die Sache allerdings“, stammelte er verwirrt. „Welch unglücklicher Zufall!“
Der Millionär hob die Schultern.
„Es muß nicht unbedingt ein Zufall sein“, erklärte er bedächtig.
„Wieso? Wie meinen Sie das?“
„Vermutlich ist es ein Verbrechen“, sagte Tschuppik trocken. „Was halten Sie davon, Mr. Huntington?“
Der junge Detektiv wiegte den Kopf sinnend hin und her. Es dauerte eine Weile, bis er mit der Sprache herausrückte.
„Ich würde in diesem Falle nicht gleich an ein Verbrechen denken“, äußerte er sich schließlich. „Ein Zufall erscheint wahrscheinlicher. Nehmen wir an, unser Mann, der Eilbote, hatte Gründe — ich denke dabei an außeramtliche Gründe — plötzlich zu verschwinden. Ob er nun vorher ein Telegramm mehr oder eins weniger bestellte, muß ihm jedenfalls recht unwesentlich erschienen sein. Daher ...“
„Der langen Rede kurzer Sinn: Sie glauben also auch an einen Zufall!“ unterbrach ihn Mr. Tschuppik ungeduldig.
„Nein!“ antwortete der Detektiv sehr bestimmt. „Ich bin sogar überzeugt davon, daß es kein Zufall ist.“
„Ah!?“ Beide Herren waren erstaunt.
„Es ist nämlich nicht der erste derartige Fall, der mir unter die Finger kommt“, erklärte Huntington. „Vor zwei Wochen erstattete einer der reichsten Männer Chikagos Anzeige wegen eines ganz ähnlichen Falles. Er hatte aus London nach Philadelphia die Bestätigung seines Kaufauftrages auf ein Gelände in Illinois gedrahtet. Das Telegramm kam nicht an. Der Bote war spurlos verschwunden, und der Kauf des Geländes kam nicht zustande. Der Mann aus Chikago hätte nämlich nur auf Grund eines Vorkaufsrechtes das Gelände zu einem verhältnismäßig billigen Preis erwerben können. Als er erfuhr, daß sein Vertreter das Kabel nicht erhalten hatte, war es bereits zu spät.“
„Das ist ja unerhört!“ rief der Postdirektor empört aus.
Mr. Tschuppik sprach kein Wort. Er hatte den Kopf gesenkt und starrte wie geistesabwesend auf eine Fliege, die an seinem Marmortintenfaß herumkletterte. Plötzlich blickte er auf.
„Was geschah mit dem Gelände?“ fragte er kurz. „Wer kaufte es?“
Huntington zuckte die Achseln.
„Bis jetzt niemand. Der Preis, den der Eigentümer verlangt, dürfte wohl zu hoch sein.“
Im gleichen Tonfall und ohne erkennbare Erregung fuhr Mr. Tschuppik zu fragen fort:
„Wieviel verlangt der Eigentümer?“
„350000 Dollars“, antwortete der Detektiv, sichtlich neugierig, worauf Tschuppik hinauswollte.
„Und wieviel war der Mann aus Chikago bereit zu bezahlen?“
„275 000 Dollars.“
Mr. Tschuppik erhob sich.
„Hören Sie zu, Mr. Huntington“, sagte er mit Nachdruck. „Sie fahren jetzt sofort mit mir nach Illinois. Ich kaufe das Gelände. Ihr Verdienst bei Zustandekommen des Geschäftes beträgt zwei vom Hundert, also siebentausend Dollars.“
Huntington sprang erregt auf.
„Sie wollen das Gelände kaufen? Ohne es je gesehen zu haben? Ohne auch nur annähernd seinen tatsächlichen Wert zu kennen? Wirklich?“
„Ich habe gesagt, daß ich es kaufe. Es genügt, wenn ich es einmal sage, Mr. Huntington“, entgegnete Tschuppik frostig. Dann wandte er sich an den gänzlich verstörten Postdirektor: „Sie entschuldigen schon, aber wie Sie sehen, bin ich jetzt beschäftigt. Daher — Sie verstehen — muß ich Sie jetzt bitten ...“ Seine Miene vollendete den Satz.
„Gewiß, gewiß“, stotterte Hähnel betroffen, „aber die Geschichte mit dem Telegramm ... Es ist doch eine höchst wichtige Angelegenheit! Das müßte doch zunächst in aller Ruhe besprochen werden ...“
„Von zwei wichtigen Sachen wähle ich stets die wichtigere“, war Tschuppiks kühle Antwort. „Das ist im Augenblick der Geländekauf. Das andere ordnen wir bei Gelegenheit.“
Mr. Tschuppik konnte blitzschnell handeln, wenn er es für nötig hielt. Fünf Minuten darauf stand der Postdirektor Hähnel auf der Straße und blickte dem davonfahrenden Wagen des Millionärs nach. Er dachte darüber nach, wie würdelos doch Mr. Tschuppiks Benehmen gewesen sei. Wie ein Lehrling war er treppauf und treppab gelaufen; wie ein kleiner Krämer hatte er mit den Armen gefuchtelt und wie ein Kutscher geflucht. Und das nannten diese Emporkömmlinge „arbeiten“?
Hähnel schüttelte mißbilligend den Kopf und machte sich auf den Weg ins Büro. Im Laufe dieses Tages bemerkten seine Untergebenen, daß er langsamer und würdevoller denn je arbeitete.
4
Mr. Frederick Manhattan frühstückte. Er hatte gerade das dritte weichgekochte Ei mit seinem kleinen, silbernen Teelöffel eingeschlagen, als sich die Tür lautlos öffnete, und sein Kammerdiener mit der Morgenpost den Raum betrat. Mit eherner Miene näherte er sich seinem Herrn und überreichte ihm auf einer goldenen Schale drei Briefe und zwei Postkarten.
„Ist das alles, Lux?“ fragte der Hausherr.
„Jawohl, Mr. Manhattan“, antwortete „Lux“, der in Wirklichkeit Jack Hunter hieß.
„Es ist wenig, Lux.“
„Sehr wenig, Mr. Manhattan“, pflichtete der getreue Diener bei.
Diese Unterhaltung bot nichts Außergewöhnliches, denn sie wiederholte sich in denselben Worten und demselben Tonfall jeden Morgen. Lux erwartete nun die nächste Frage, die sich auf das Wetter bezog, worauf er dann gewöhnlich wieder gehen durfte.
Jack Hunter hatte allen Grund sich zu wundern, denn die Frage nach dem Wetter blieb heute aus. Mr. Manhattan hatte sich vorgebeugt und starrte mit derart entsetzten Blicken nach der Schale mit den Briefen, wie sich Lux erinnerte, seinen Herrn nur einmal gesehen zu haben — als sich auf dem Butterbrot eine kleine Spinne vorfand.
„Ist da nicht wieder ein Brief ohne Marke?“ erkundigte sich Manhattan unvermittelt.
„So ist es, Mr. Manhattan“, antwortete Lux, und seine Mienen drückten Erstaunen aus. „Dieser Brief wurde vor fünf Minuten durch einen Boten abgegeben.“ Da sein Herr noch immer kein Wort sprach, fuhr er fort: „Im übrigen scheint heute die Sonne, und der Himmel ist fast unbewölkt ...“
„Scher dich zum Teufel!“ knurrte Mr. Manhattan in plötzlich erwachtem Zorn.
„Wie Sie wünschen, Mr. Manhattan“, entgegnete Lux gemessen.
Er hatte die Tür noch nicht erreicht, als Manhattan ihn schon wieder zurückrief. Seine Hand, die einen geöffneten Brief hielt, zitterte leicht.
„Rufen Sie sofort den Detektiv Huntington her!“ kreischte er. „Sofort!“
„Mr. Huntington wird sogleich hier sein. Er wartet unten.“
„Er wartet? Warum meldeten Sie ihn denn nicht an, Sie Kamel?!“
Lux zog kaum merklich die Brauen in die Höhe.
„Mr. Huntington wünschte nicht zu stören. Seit etwa acht Tagen wartet er jeden Morgen über eine Stunde hier, will aber nur dann vorgelassen werden, wenn Sie selbst nach ihm verlangen.“
„Verrückt! Das hätten Sie mir melden müssen! Ich erwarte von Ihnen, daß Sie mich über alles unterrichten, was in meinem Hause vorgeht. Verstanden?!“
Der Diener nickte ernst.
„Sehr wohl, Mr. Manhattan. Es ist mir auch lieber, wenn ich vor Ihnen keine Geheimnisse zu haben brauche. Es tat mir weh, Ihnen bis jetzt verschweigen zu müssen, daß Mr. Huntington acht Tage lang hier frühstückte und dabei jedesmal vier Eier verzehrte. Ich habe ihm gesagt, daß Sie zum Beispiel nur drei zu essen pflegen, aber er antwortete, mit weniger als vier könne er nicht gut gedeihen. Wir haben somit einen Verlust von zweiunddreißig Eiern. Sie werden verstehen ...“
„Ich verstehe, daß Sie ein Esel sind! Rufen Sie sofort Huntington. Schnell!“
Lux sollte heute aus dem Staunen nicht herauskommen. Zwei Minuten später meldete er nämlich kühl und gelassen wie immer, doch mit merklich schwankender Stimme:
„Mr. Huntington ist nicht mehr da. Es ist das erstemal, daß er gegangen ist, nachdem er erst drei Eier verzehrt ...“
Manhattan warf mit einer zornigen Gebärde den Kopf zurück.
„Ah! Zum Donnerwetter!“ knurrte er wütend. „Lassen Sie mich mit dem Kram ungeschoren!“ Nach einer Weile beruhigte er sich und fügte in verändertem Ton hinzu: „Nun, Huntington wird schon wiederkommen. Das hat auch schließlich keine Eile. Aber jetzt muß ich vor allem einen Notar haben. Ich will nämlich mein Testament machen. Wie finden Sie diesen Gedanken, Lux?“
Der Diener wiegte nachdenklich den Kopf hin und her.
„Sehr beachtenswert, Mr. Manhattan. Ich sagte dies schon, als Sie vor zwei Monaten Ihr letztes Testament machten. Jeder Mensch sollte ab und zu ein Testament machen.“
„Reden Sie kein Blech! Nur ein Mensch mit Geld kann und soll ein Testament machen. Ich habe Geld, und ich will es unter meinen Verwandten gerecht verteilen. Keinen Cent sollen sie bekommen. Ich weiß ganz genau, daß sie alle nur auf meinen Tod und mein Geld lauern ...“
„Nicht alle, Mr. Manhattan“, warf Lux dazwischen.
„Ach, Sie meinen die kleine Evelyn, die mich pflegte, als ich krank war? Sie täuschen sich: auch sie ist nicht besser als die anderen. Sie pflegte mich nur, damit ich ihr etwas vermache. Ich habe ihr jeden Morgen klargemacht, daß sie in meinem Testament mit keinem Cent bedacht ist. Sonst hätte ich den Abend nicht mehr erlebt; sie hätte mich sofort vergiftet — verlassen Sie sich darauf!“
„Nicht alle Menschen sind so schlecht“, widersprach Lux abermals traurig.
„Alle!“ schnitt Manhattan ab. „Wieviel hatte ich übrigens Ihnen vermacht, Lux?“
„Nichts“, antwortete der Diener gelassen.
„Hm ... etwas wenig ... nicht wahr ... hm ...“ meinte Manhattan unsicher.
„Oh, nicht doch!“ entgegnete Lux höflich. „Bei einiger Sparsamkeit läßt sich schon eine Zeitlang ganz nett davon leben.“
„Ich werde Sie diesmal mit achttausend Dollars bedenken!“ erklärte Manhattan gnädig.
„Ich danke Ihnen, Mr. Manhattan! Ich werde mich als reicher Mann fühlen, bis Sie Ihr übernächstes Testament machen.“
„Sie sind ein Schaf! Das Testament, das ich jetzt mache, ist mein allerletztes. Unwiderruflich! Punktum!“
Lux schickte sich an, seines Weges zu gehen.
„Ich weiß“, nickte er, „ganz so wie immer, Mr. Manhattan.“
5
Mit halber Geschwindigkeit fuhr der Expreßzug um die gefährliche Kurve bei Norwalk. Der Lokomotivführer Tom Dryer war ein gewissenhafter und vorsichtiger Mann; obwohl die Vorschrift lautete, die Kurve mit vierzig Stundenkilometer zu durchfahren, zeigte sein Tachometer hier nie mehr als dreißig.
„Das reinste Schneckentempo“, knurrte der Heizer und warf einen ungeduldigen Blick auf die Uhr. „Es wird wieder Mitternacht, bis wir nach New York kommen.“ Er saß auf einer rußbedeckten Kiste, hatte die in dicken, plumpen Stiefeln steckenden Füße weit von sich gestreckt und hielt in der einen Hand eine Kohlenschaufel, in der andern eine halbleere Whiskyflasche. Wenn es nach New York ging, konnte man es ihm nie schnell genug machen, denn in der Stammkneipe warteten seiner verbotene Genüsse. „Verrückt! Soll das ein Expreßzug sein?“ murrte er und tat einen tiefen Schluck aus seiner Flasche.
Tom Dryer ließ sich nicht beirren. Er stand breitbeinig, die kalte Pfeife zwischen den Zähnen, vor seinen Hebeln und beobachtete scharf das durch den grellen Scheinwerfer hell beleuchtete Gleis.
„Mein Vater verunglückte an dieser Stelle, obwohl er bestimmt nicht mehr als vierzig Kilometer fuhr“, sagte er gelassen. „Man hat damals versucht nachzuweisen, daß er in jener Nacht schneller gefahren ist. Sachverständige haben ein Gutachten abgegeben, wonach er mindestens eine Geschwindigkeit von sechzig Kilometern gehabt haben mußte. Ich weiß es besser — oft genug erklärte mir mein Vater, daß es heißt, mit Menschenleben spielen, wenn man auch nur einen einzigen Kilometer mehr hat, als die Vorschrift lautet. — Und darum fahre ich hier nie über dreißig Kilometer.“
Der andere brummte etwas Unverständliches.
Tom warf einen Blick auf die Strecke, dann rückte er einen Hebel weiter. Die Riesenlokomotive zog sofort an: der Geschwindigkeitsmesser stieg langsam wieder auf sechzig.
„Jetzt fahren wir gleich in den Tunnel ein“, bemerkte Tom ruhig, zog ein Feuerzeug aus der Tasche und versuchte seiner ausgegangenen Pfeife neues Leben einzuflößen. „Hier zum Beispiel kann ich mit gutem Gewissen sechzig Kilometer wagen. Das Durchfahren des Tunnels dauert drei Minuten, und die Strecke ist kerzengerade.“
Nun schien der Heizer mit der Geschwindigkeit zufrieden. Er stand langsam auf und bot Tom seine Flasche.
„Siehst du“, meinte Tom gutmütig, „sogar einen Schluck Whisky darf ich mir hier gönnen. Dieser Tunnel ist die sicherste Strecke, die es gibt. An seinen beiden Enden sind Wachen aufgestellt, damit ja kein Mensch oder Tier da hineinläuft. Daher also ...“ Er nahm sich nicht die Mühe, den Satz zu vollenden, denn das Schreien strengte ihn zu sehr an. Mit einem zufriedenen Lächeln führte er die Flasche an den Mund. Dann beugte er sich gewohnheitsmäßig vor und warf einen Blick auf die Strecke.
Im selben Augenblick lief ein Zittern durch seine stämmige Gestalt. Die Flasche fiel klirrend zu Boden. Jählings packten die klobigen Hände Toms zu und gaben Gegendampf. Ein Kreischen, ein Ruck! Der Heizer flog gegen die Kesseltür; Tom hielt sich krampfhaft an der Seitenwand fest und starrte hinaus. Ein Rütteln durchzitterte den Zug von der Lokomotive bis zum letzten Wagen. Gleich darauf heulte die Dampfpfeife schaurig durch den Tunnel. Der Zug stand still.
Sekundenlang herrschte beängstigende Stille. Erst leise, dann immer lauter hallten Schreie durch die Nacht, die vom Echo verstärkt zurückgegeben wurden. Schaffner mit bestürzten Gesichtern und erschrockenen Augen kletterten auf die Lokomotive, stellten Fragen — wirr und zusammenhanglos.
Tom lehnte jetzt mit kraftlos herabhängenden Armen in einer Ecke. Sein Gesicht war entstellt vor Entsetzen. Endlich hob er langsam die Hand und deutete mit abgewandtem Kopf auf die hell erleuchteten Schienen.
„Da ... da ...“ stammelte er und fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. Seine Angst, das unbekannte Grauenhafte sehen zu müssen, teilte sich auch den Umstehenden mit. Nur zögernd beugten sie sich vor und starrten hinaus. Da sahen es alle: Vor der Lokomotive, nur knapp zehn Meter entfernt, lag mitten auf dem Gleis eine menschliche Gestalt.
Einige Reisende hatten sie inzwischen auch bemerkt. Eine von Minute zu Minute wachsende Gruppe von Menschen sammelte sich um den leblosen Körper. Es war ein junges Mädchen von etwa zwanzig Jahren. Ihr dünnes, schwarzes Kleid war von langen, klaffenden Rissen durchzogen, und die seidenen Strümpfe wiesen große Löcher auf. Blondes, lockiges Haar bedeckte wirr das an mehreren Stellen zerschundene Gesicht, und die halbentblößten Arme waren schmutzig und blutig.
„Tot?“ fragte jemand bedrückt, als sich ein Arzt über sie neigte.
„Nein, das Herz schlägt noch“, antwortete er und tastete sorgfältig ihre Glieder ab. Als er den linken Arm berührte, lief plötzlich ein schmerzliches Zucken über das Gesicht des Mädchens, und ein leises Stöhnen wurde hörbar. Dann lag sie wieder still, wie leblos, mit geschlossenen Lidern da.
„Komplizierter Unterarmbruch und Gehirnerschütterung“, erklärte der Arzt endlich. Er ordnete die Unterbringung der Verunglückten in einem leeren Abteil an und machte sich sogleich daran, einen Notverband anzulegen.
Die Reisenden standen in kleinen Gruppen überall umher und besprachen eifrig den sonderbaren Fall.
„Sie kann nur aus dem Personenzug gestürzt sein, der vor etwa einer Stunde den Tunnel durchfuhr“, äußerte sich schließlich ein Bahnbeamter dazu.
„Was veranlaßte Sie denn, plötzlich zu halten?“ wandte sich der Zugführer an Tom. „Gesehen können Sie das Mädchen doch nicht haben.“
„Im letzten Augenblick leuchtete vor der Einfahrt in den Tunnel rotes Licht auf“, gab Tom zögernd zurück, denn er war nicht ganz davon überzeugt, daß er die Wahrheit sprach. Zwar hatte er vordem genau das grüne Licht gesehen, aber das rote konnte unter Umständen auch um einige kostbare Sekunden früher aufgeflammt sein.
Schweratmend kam plötzlich ein Bahnwärter herbeigerannt.
„Ich sah schon den Zug“, erklärte er auf die Frage des Zugführers, „als von New York die telephonische Weisung kam, die Durchfahrt zu sperren.“
Diese Erklärung schien den Zugführer zu beruhigen.
„Wir fahren weiter“, sagte er zu Tom, der blaß und stumm an seiner Maschine lehnte. „Durch Ihre Aufmerksamkeit haben Sie ein Menschenleben gerettet. Ich werde dafür Sorge tragen, daß Sie eine Belohnung bekommen.“
Der Lokomotivführer gab keine Antwort. Schweigend kletterte er auf seine Maschine und ließ den Dampf in die Zylinder strömen. Mit dumpfem Getöse setzte sich der Zug gleich darauf wieder in Bewegung.
Seit jenem Tage war Tom unter seinen Kollegen nicht mehr beliebt. Man legte ihm sogar den Spitznamen „der Streber“ bei, und kein Heizer fuhr gern mit ihm; denn mochte die Fahrt auch noch so lang sein, nie sprach Tom mehr ein überflüssiges Wort, trank nichts, rauchte nicht, und sobald er in den Händen seines Heizers eine Packung Tabak oder eine Whiskyflasche erblickte, nahm er sie ihm ohne jede Erklärung aus der Hand und beförderte sie mit einem kräftigen Schwung hinaus.
*
Auf dem Bahnhof in New York wartete eine große Menschenmenge auf den Personenzug aus Boston. Unter den Wartenden befand sich auch Doris Elmhurst, die ihre Schwester Evelyn empfangen wollte. Die beiden Schwestern hatten sich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen, da Evelyn in Boston Medizin studierte und Doris nur zweimal im Jahr während der Ferien besuchen konnte.
„Der Zug hat acht Minuten Verspätung!“ verkündete ein Bahnbeamter mit lauter Stimme.
Doris blickte nach der Uhr. „Also noch zehn Minuten warten“, dachte sie und hielt plötzlich in ihrem Auf- und Abgehen erstaunt inne. Auch die andern Leute folgten ihrem Beispiel.
Es war in der Tat ein seltenes Schauspiel, daß sich ihren Blicken bot. Etwa dreißig Polizisten traten in Gruppen von drei und vier Mann auf den Bahnsteig und blieben unweit der Wartenden stehen. Auf den andern Bahnsteigen sah man jetzt ebenfalls Polizeibeamte; nur waren es dort weniger: höchstens fünf oder sechs auf jedem.
Ein höherer Beamter in Uniform trat an die Wartenden heran.
„Ladies and gentlemen!“ sagte er höflich, aber bestimmt. „Ich bitte Sie, etwas beiseitezutreten und meinen Leuten Platz zu machen.“ Dann gab er den Polizisten mit leiser Stimme Anweisungen, worauf diese den ganzen Bahnsteig entlang eine Kette bildeten. Kaum waren sie damit fertig geworden, als auch schon zischend und fauchend der Zug in die Halle einfuhr.
„Niemand darf aussteigen!“ befahl der Polizeibeamte laut. „Papiere bereithalten!“
Erstaunte Gesichter fuhren von den Fenstern zurück. Unter den Wartenden erhob sich ein unzufriedenes Murmeln.