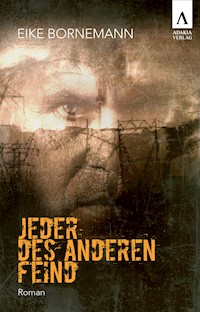Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: CRiMiNA
- Sprache: Deutsch
Carolin steht gegenwärtig nicht auf der Sonnenseite … fürs Erste verkriecht die Mittdreißigerin sich bei den Eltern und hofft, dass alles anders wird. Tatsächlich stellt ein Buch ihr Leben schon bald auf den Kopf, sie erlebt einen Überfall, kommt einem Bankraub auf die Spur und begegnet einer ziemlich schrägen Unbekannten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eike Bornemann
Im Schatzfieber
Kriminalroman
ISBN (eBook) 978-3-89741-973-5
ISBN (Print) 978-3-89741-403-7
© 2017 eBook nach der Originalausgabe in CRiMiNA.
CRiMiNA ist ein Imprint des Ulrike Helmer Verlags, Sulzbach/Taunus
© 2017 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach/Taunus
Lektorat: Ulrike Helmer
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Atelier KatarinaS / NL
unter Verwendung des Fotos »On fire«
© rabauken / photocase.de
www.ulrike-helmer-verlag.de
Für Beate, die das Fieber ausgelöst hat
»Ich will das Grabmal einergroßen Liebe errichten.«Thea von Harbou: Das Indische Grabmal
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Epilog
Ein Nachruf
Danksagung und Quellen
Über den Autor
Prolog
»Zur näheren Bezeichnung des Gewässers, in welchem Erich mit seinem Bruder die Bruchstücke der verschiedenen Schmucksachen versenkt haben wollte, ging die Fahrt über Heerstraße – Postfenn weiter zur Havel-Chaussee.«
– Strafverfahren gegen die Gebr. Sass. Landesarchiv Berlin A Rep. 358-01 (5.1)
»Wo liegt es?« Der Beifahrer hatte sich halb nach hinten umgedreht, um den hochgewachsenen dünnen Mann anzusehen. »Wo habt ihr’s versteckt?«
Die Stimme war von gleichbleibender Freundlichkeit, dennoch nahm sich der Angesprochene in Acht. Dem forschenden Blick ausweichend, sah er aus dem Seitenfenster des schwarzlackierten Horch 400.
Die Straße, über die sie fuhren, wand sich um einen Hang und verlief dann weiter geradeaus wie mit der Schnur gezogen. Linkerhand lag dichter, dunkler Wald. Zur Rechten fiel der Hang ab. Zwischen den Bäumen glitzerte Wasser.
Als die Sonne durch die Blätter brach und das Gesicht des Mannes auf dem Rücksitz mit einem wechselnden Muster dünner Lichtstreifen überzog, kam Bewegung in ihn; doch blieb sie auf seine Hände beschränkt, die er hob, um sich an der Nase zu kratzen. Er musste dazu beide Arme heben, die Handgelenke waren zusammengekettet.
Die Luft im Innern des Wagens roch stickig nach Leder und nach den Ausdünstungen der Männer. Der Gefesselte bat nicht darum, eines der Fenster herunterzukurbeln und Sauerstoff hereinzulassen, der vermischt sein würde mit dem Duft von Kiefernnadeln, Harz und Laub. Überhaupt hatte er in seinem Leben selten um etwas gebeten. Er nahm, was er wollte. Schien es unerreichbar, schlug er es sich wieder aus dem Kopf.
Im Wald spazieren gehen müsste man jetzt. Einfach nur drauflos marschieren, ohne genaues Ziel, ohne festen Weg. Auf Bäume klettern. Oder da unten, wo der Fluss breit und träge dahinströmte, ins Wasser springen, ungeachtet der Kühle. Schwimmen, soweit es die Kräfte hergaben. Schwimmen, Angeln, Klettern, Atmen, sich an dem Geruch erfreuen, durch die Wälder stromern – nie war ihm das verlockender erschienen. Wie unbedacht war er früher mit seiner reichlich frei bemessenen Zeit umgegangen. Wie wenig hatte er mit ihr anzufangen gewusst.
All das dachte der Hagere, ohne es auszusprechen. Er hatte nie viel reden können, schon früher nicht. Im Gegensatz zu den anderen in seiner Familie, den Eltern, den Brüdern. Die waren für ihr flinkes Mundwerk bekannt. Das Schweigen hatte sich bei ihm in den vergangenen Jahren noch vertieft, war zur Gewohnheit geworden. Es war der Trotz, der ihm den Mund schloss. Die Hilflosigkeit und unterdrückte Wut auf die Beschimpfungen, Drohungen und Schläge dieses Kommissars aus Kopenhagen, der sich im dänischen Gefängnis den Beinamen »Christian, der Reizbare« erworben hatte. Vier Jahre hatte der Hagere dort eingesessen, abgeurteilt zusammen mit seinem Bruder, aber getrennt eingesperrt. Sie hatte ihn verändert, diese Zeit. Er war noch schmaler geworden. Seine Augen lagen in tiefen Höhlen.
Und nun war er hier. Zurück in dem Land, in der Stadt, aus der sie damals aufgebrochen waren – jung, unternehmungslustig, die Köpfe voll ehrgeiziger Pläne. Eine dumpfe Ahnung begleitete die Rückkehr: Das Schlimmste stand ihnen noch bevor. Man hatte Geschichten munkeln hören, dort im dänischen Gefängnis, über dieses Land, in das sie nach der Haft überstellt werden sollten, über die Veränderungen, die es in den letzten Jahren durchgemacht hatte. Deshalb hatten sie sich gegen die Auslieferung gesträubt, er und sein Bruder. Umsonst.
In seinem Inneren war der wortkarge Mann auf dem Rücksitz geschwätzig wie eine Elster. Er hielt lange Monologe, stellte Fragen, gab sich Antworten, führte Rede und Widerrede, stritt mit sich selbst.
Das Jackett schlotterte um seine knochigen Schultern. Er zog sie ein, um so wenig Berührung wie möglich mit den beiden Männern zu bekommen, zwischen denen er auf der Rückbank eingepfercht saß. Schweigsam waren auch sie. Nur der Fahrer und der Beifahrer tauschten hin und wieder halblaute Worte, wenn es um die Strecke ging, die sie entlangfuhren.
Jetzt wandte der Beifahrer erneut den Kopf. Das Sonnenlicht spiegelte sich auf seiner Glatze. »Rede mit mir«, forderte er über das Brummen des 80 PS starken Achtzylinders hinweg. »Wo genau habt ihr es versteckt?«
Wie oft hatten sie ihm diese Frage schon gestellt? In diesem Winter vor beinahe zehn Jahren war es das erste Mal gewesen. Seitdem hatten sie immer und immer wieder danach gefragt. Es ließ ihnen keine Ruhe. Sie würden niemals aufhören. Sie wussten viel.
Nur eines, das wussten sie nicht.
»Das habe ich Ihnen doch alles erzählt«, sagte er leise. »In einem Keller liegt’s.«
»Da war’s aber nicht«, erwiderte der Mann auf dem Beifahrersitz. »Wir waren dort. Nichts haben wir gefunden. Du wolltest uns die Stelle zeigen, hast du gesagt. Wie lange willst du uns noch hinhalten?«
Der Gefesselte schloss die Augen. »Es ist so lange her.«
»Der Ausflug hierher war deine Idee«, blaffte es zu seiner Rechten. »Sag uns, wo ihr’s vergraben habt, und du kriegst deine Ruhe.«
»Totenruhe«, flachste der Fahrer.
»Überlassen Sie das Reden mir und konzentrieren Sie sich auf die Straße!« Ärger färbte die Stimme des Glatzköpfigen. Von den harten Bandagen, die sich seine Kollegen in den letzten Jahren zugelegt hatten, hielt er nichts. Das war nicht seine Art. Dennoch schwang bei ihm noch ein anderer Unterton in der Stimme mit. Resignation. Sie, seine Kollegen, hatten Gewinn verbuchen können, wo ihm mit seiner Gutmütigkeit der Erfolg verwehrt geblieben war. Widerstrebend musste er es zugeben.
»Du tätest gut daran, dich wieder zu erinnern«, fuhr er gereizt fort. »Du wirst entweder mit mir reden, oder du redest mit denen da.« Er nickte mit dem Kinn zu den beiden Begleitern. »Besser, du redest mit mir. – Also?«
»Friedhof«, sagte der Gefangene mürrisch. »Es liegt auf ’nem Friedhof.«
»Wo genau?«
»In Charlottenburg.«
»Nicht im …«, der Beifahrer zögerte unmerklich, »im Grunewald?«
Der Mann auf dem Rücksitz antwortete nicht mehr. Aus dem Fenster schauend, betrachtete er die Natur so konzentriert, als wollte er den Anblick mit seinen Augen für immer festhalten: das Licht auf dem Wasser dort unten, die knorrigen Stämme der Eichen und Kiefern, das Grün des Mooses und der jungen Triebe. Es war Frühling im Jahr 1938.
1. Kapitel
»Arm am Beutel, krank am Herzen
Schleppt ich meine langen Tage.
Armut ist die größte Plage,
Reichtum ist das höchste Gut!
Um zu enden meine Schmerzen,
Ging ich einen Schatz zu graben.
Meine Seele sollst du haben!
Schrieb ich hin mit eignem Blut.«
– Goethe
Fünfundsiebzig Jahre später. – Der Zug rumpelte über eine Weiche, Schneereste stäubten herab, als er die Zweige eines Baumes streifte. Ab da trat der Wald zurück und gab die Sicht frei. Der Blick ging weit über die weiß und grau gefleckte Landschaft, fing sich an vereinzelten Kiefern, an Gruppen von kahlen Birken und Sträuchern. Hoch oben im Geäst saß unbeweglich ein Raubvogel. Ein Rudel Rehe setzte in langen Sprüngen in die Deckung des Waldes. Das Spätnachmittaglicht ging in Abenddämmerung über. Die Sonne stand tief und ließ die Landschaft in allen Einzelheiten plastisch hervortreten. Baumwipfel schimmerten rotgolden, Stämme warfen lange Schatten.
Die Frau, die im einsetzenden Dämmergrau aus dem Zugfenster schaute, interessierte sich nicht für die karge Schönheit der Umgebung. Ihre Gedanken waren mit anderen Dingen beschäftigt. Als der purpurne Sonnenball hinter dem Horizont verschwunden war, begann sich ihr Spiegelbild immer stärker auf der Scheibe abzuzeichnen.
Carolina Barnim hatte einiges getan, ihr Alter zu verbergen. All die Cremes, Lotionen und Masken, von denen die Werbung versprach, sie würden die Haut glätten, die Krähenfüße an den Augen mildern – sie hatten nichts gegen die unbarmherzige Schwerkraft tun können und auch nichts gegen all das andere, was im Laufe der Jahre Spuren in ihr Gesicht gegraben hatte: Ehrgeiz, Enttäuschungen, Kränkungen, Verbitterung. Die Mundwinkel, fand sie, hingen herab, und wenn sie ihren Kopf senkte, trat ein leichtes Doppelkinn unvorteilhaft hervor. Hingegen fielen die wenigen grauen Strähnen im rotblonden Haarschopf kaum auf. Die leicht schräg stehenden, grünen Augen und hohen Wangenknochen hatten seinerzeit auf der Schule und später während der Ausbildung für nicht wenig Aufsehen gesorgt. Noch Jahrzehnte später konnten sich Klassenkameraden genau an ihr Aussehen erinnern. Doch das spielte in Caros Selbstwahrnehmung keine Rolle mehr.
Inzwischen hatte der Intercity die zerklüfteten Steinwaben der Vorstadt erreicht. Häuserquader sausten vorbei, hell erleuchtete leere Bahnhöfe, durch die der Zug raste, ohne anzuhalten.
Plötzlich überkam sie ein Gefühl der Übelkeit. Sie stürzte aus dem Abteil zur Zugtoilette. Der Pessimismus, den sie in den letzten Jahren ausreichend gepflegt hatte, erwartete halb, eine verschlossene Tür vorzufinden, doch die Kabine war frei.
Die folgenden Minuten verbrachte Caro damit, sich kaltes Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen und anschließend in den unergründlichen Tiefen ihrer Handtasche nach den Tabletten zu schürfen.
Schließlich erinnerte sie sich an die Notfallration im Portemonnaie. Die teure Geldbörse aus rotem Leder war ein Geburtstagspräsent von Henning gewesen – praktisch wie so ziemlich alles, was er verschenkte. Immer war es etwas, das einen unmittelbaren Nutzen bot; nie etwas, das sie sich wünschte, weil es ihre Sinne ansprach. Für Henning, dem nüchternen Pragmatiker, musste jeder Gegenstand einen Zweck erfüllen. Der Gedanke, Dinge könnten ihrer Schönheit wegen begehrt werden, ging ihm völlig ab.
Blanke Sentimentalität hatte sie bislang davon abgehalten, das Portemonnaie in den nächstbesten Mülleimer zu feuern. Außerdem wusste sie nicht, wohin dann mit dem Geld, den Quittungen, Kreditkarten, Ausweis, Führerschein – und natürlich den Pillen. Es war, wie sie innerlich seufzend feststellte, eben ein ganz und gar praktisches Geschenk.
Ein Schluck aus dem Flachmann, um die Tablette herunterzuspülen, ein Pfefferminz gegen die Schnapsfahne – fertig.
Als sie den Blister ins Fach zurückschob, fiel ihr Blick auf die hinter einer Folie steckende Aufnahme von Henning. Aufs Neue überkamen sie Schmerz und Wut.
Hastig zog sie das Foto heraus in der Absicht, es in kleine Schnipsel zu zerreißen und die Toilette hinunterzuspülen. Im letzten Moment besann sie sich, glättete das Bild und schob es zurück. Eine fast abergläubische Furcht hatte sie davon abgehalten, es zu zerstören, so als wäre die Fotografie eine Art VoodooPuppe und sie würde mit deren Vernichtung endgültig die letzten Verbindungen zerstören.
Nach einem letzten Blick in den Spiegel kehrte sie in ihr Abteil zurück, wo sie Jacke und Schal überzog und sich daran machte, den Koffer von der Ablage zu heben.
Der Zug fuhr in den Bahnhof ein und kam zum Halten.
Caro wuchtete den Trolley auf den Bahnsteig und schaute sich suchend um.
Dort hinten stand er. Als er auf sie zukam, spürte sie in der Herzgegend einen schmerzhaften Stich.
Ihr Vater schien in den letzten Jahren kleiner geworden zu sein. Allerdings war es nicht so sehr das Alter, das seine Schultern beugte. Von der Krankheit hatte sie auf See erfahren. Per Skype. Im Zeitalter der elektronischen Kommunikation entfiel die Notwendigkeit persönlicher Besuche, zumal sie die meiste Zeit des Jahres über ein ganzer Ozean trennte.
Wie viele Silvester- und Weihnachtsfeiern hatte sie mit den Arbeitskollegen auf hoher See verbracht? Caro wusste es nicht mehr. Fernweh hatte sie früh aus der elterlichen Wohnung getrieben, die Romantik der Seefahrt. In ihren Mädchenträumen brandete die See gegen ferne Küsten, wölbte sich ein mit Sternen übersäter dunkelblauer Himmel über gebauschten Segeln. Schon damals, während ihrer Schulzeit, hing ihr der Ruf einer Träumerin an, die selbstvergessen Palmen und Schiffe unter schwellender Takelage an die Ränder des Geografiebuches malte und heftig zusammenfuhr, wenn sie der plötzliche Aufruf eines Lehrers aus ihren Tagträumen schreckte.
Zu dumm nur, dass die Geschichten der großen Entdeckungen immer von Männern handelten. Frauen kamen darin kaum vor, und wenn, dann als Objekte männlicher Sehnsüchte, als Geliebte, selten als Gefährtinnen. Magellan, Marco Polo, James Cook, William Dampier … Wo blieben da die Frauen? War es wirklich so, wie einige Bücher immer behaupteten? Waren sie als ängstliche Bedenkenträgerinnen auf ewig dazu verdammt, zu Hause die Brut zu hüten, während die Männer seit eh und je durch die Welt reisten und Geschichte schrieben?
Später, während ihrer Lehrzeit, entdeckte sie dann endlich die weiblichen Weltreisenden: Alexandra David-Néel, die als erste Europäerin die verbotene Stadt Lhasa betrat, Jeanne Baré, die 1766 als Mann verkleidet die Welt umsegelte, Grace O’Malley, die »Seewölfin«, Jane Franklin, die auf der Suche nach ihrem Mann in der Arktis spurlos verschwand, die trinkfeste Mary Kingsley …
Das war längst Vergangenheit. Die Faszination für Seeabenteuer ging mehr und mehr im Bordalltag verloren. Nach fünfzehn Berufsjahren fragte sich Caro, was zum Teufel denn bloß so romantisch sein sollte an der ganzen Seefahrt. Die ewiggleichen Strände, die dahinter aufragenden Bettenburgen, bei denen der Blick aufs Meer im Preis inbegriffen war, die Restaurants, Spielcasinos und Ladenreihen, wo gut betuchte Touristen ihr Reisegeld lassen konnten – es begann sie zu langweilen. Und immer öfter überkam sie Ekel angesichts des Mülls, der mitunter kniehoch den Spülsaum der einstigen Paradiesstrände bedeckte: kilometerlange Reihen angeschwemmter Schuhe, Plastiktüten, Kondome, zerdrückter Bierdosen, Glühbirnen, Styropor. Hinzu kam das tägliche Einerlei auf dem Schiff, das sich nicht viel von einem Hotel auf dem Festland unterschied.
Wo waren sie, die weißen Flecken auf den Karten, die großen ungelösten Rätsel? Wo auch immer sie warteten – an Bord eines Kreuzfahrtschiffes jedenfalls nicht. Dessen Kiel durchschnitt Saison für Saison das ewiggleiche Fahrwasser. Da blieb kein Raum für Fremdes, für Faszinierendes mehr.
Dabei hatte es viele Wochen gedauert, ehe sie sich in diesem architektonischen Labyrinth zurechtgefunden hatte, das aus dreizehn Decks, vier Restaurants, drei Kinos, einem Theater und über tausendachthundert Kabinen bestand, die Platz für mehr als viertausend Menschen boten. Hin und wieder, wenn sie an ihrem Arbeitsplatz vom Laptop aufschaute, fiel ihr Blick auf zerklüftete Fjorde, Küstenstreifen und Häfen. Die meiste Zeit über sah sie jedoch durchs Fenster auf eine endlose blaue, dunkelgrüne oder graue Wasserödnis hinaus, auf gischtbesetzte Wellenkämme, auf Öltanker, Container-Frachter und Patrouillenkreuzer der Küstenwache, die in der Ferne den Kurs kreuzten.
Das Schiff war ihr zweites Zuhause geworden. Dort arbeiteten ihre Freunde, dort hatte sie ihren Partner kennengelernt.
Und nun die Rückkehr. Gestrandet an dem Ort, wo sie aufgewachsen war.
Die Umarmung ihres Vaters war so fest wie eh und je, doch seine Stimme klang etwas rauer, als Caro sie in Erinnerung hatte. »Was machst du nur für Geschichten.«
»Papa«, flüsterte sie. Gerne hätte sie ein paar Minuten so dagestanden, gestützt und gehalten von seinen Armen.
Doch er löste sich zuerst. »Komm ins Auto. Es ist kalt.«
Es waren Belanglosigkeiten, die sie während der Fahrt austauschten, über Arbeiten am Haus, die anstanden, über Bekannte, die zu Besuch gewesen waren, über das Wetter, den langen, harten Winter, den Frühling, der auf sich warten ließ. Die wirklich wichtigen Themen mieden sie, allerdings aus verschiedenen Gründen. Lars Barnim war klug genug, seiner Tochter die Entscheidung zu überlassen, wann sie davon anfangen wollte. Mit den Jahren hatte er lernen müssen, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlte, wenn er zu viele Fragen über ihr Leben stellte.
Caro dagegen wollte erst einmal zu Hause ankommen und dann mit der Mutter reden, seit Urzeiten ihre Vertraute und Trösterin – mehr als der Vater, der ohne Zweifel eine große Hilfe war, wenn es um die praktischen Dinge des Lebens ging, etwa um einen Finanzplan oder um handwerkliche Fragen, in Gefühlsdingen dagegen oft unbeholfen wirkte.
Vor ein paar Tagen am Telefon, da hatte Caro viel geredet. An die Einzelheiten ihres Gespräches konnte sie sich nicht mehr genau erinnern; sie hatte getrunken an jenem Abend, in der Einsamkeit ihres Apartments. So wie auch an den Abenden davor. Die Stille in der Wohnung erstickte sie. Die Wände schienen näher zu rücken, je länger man sie anstarrte. Irgendwann, schon spät in der Nacht, hatte Caro zum Telefon gegriffen und die Nummer der Eltern gewählt.
Ihr Vater war rangegangen. Da die Mutter außer Haus mit Freunden aus der Stadt verabredet war, hatte er sich die Endlosschleife aus Klagen und Selbstvorwürfen anhören müssen, die Litanei aus alkoholvergifteter Bitterkeit und Zynismus. Als sie irgendwann erschöpft und den Tränen nahe innehielt, hatte seine leise Antwort nur aus drei Worten bestanden. Drei einfache Worte: »Komm nach Hause.«
Nach Hause. Es hatte wundervoll geklungen, nach Heimat, Geborgenheit, Nestwärme. Und jetzt war sie also hier: ein verwundetes Wild, das sich ins Unterholz verkroch. Heimkehr, so also sah sie aus. Nicht etwa als gefeierte Abenteurerin, als Karrierefrau, die etwas aus sich, aus ihrem Leben gemacht hatte. Sondern als Verlassene, Gedemütigte, als Verliererin.
Den Rest der Fahrt über schwiegen sie.
Die Mutter musste den Wagen von weitem gehört haben, denn sie stand schon unter der Laterne in der geöffneten Haustür, als er in der Garageneinfahrt hielt.
Nach der Begrüßung brachte Caro ihre Sachen in ihr altes Zimmer unter der Dachschräge. Ungeachtet des Frühlingsanfangs hatte sich der Winter noch einmal mit Schneeschauern zurückgemeldet. Da war es gut, dass im Kachelofen die Scheite glühten. Die anderen Zimmer des Hauses waren längst an eine moderne Gasheizung angeschlossen. Nur in den beiden Dachzimmern standen noch die alten Öfen. Ein großes Bett nahm fast die gesamte Hälfte eines der Räume ein, bedeckt mit Decken, Kissen und – Caro spürte einen Kloß im Hals aufsteigen – mit ihren alten Puppen. Die Eltern hatten ihr Spielzeug aufgehoben, in der Hoffnung eine Enkelin würde es einmal benutzen.
Das Thema Kinder war ein wunder Punkt in ihrer Beziehung mit Henning gewesen. Caro wäre gerne Mutter geworden. Henning hatte jedoch bereits zwei Kinder, für die er Unterhalt zahlte. Er vertrat die Auffassung, damit seiner Verpflichtung, was das Weiterbestehen der Menschheit anging, Genüge getan zu haben. Die Spirale war seine Idee gewesen, nachdem Caro die Pille abgesetzt hatte. Das Benutzen von Kondomen empfand er als lästige Unterbrechung des Liebesaktes.
Caro nahm ihre Lieblingspuppe aus Kindertagen auf und strich ihr durchs Haar. In den letzten Jahren hatte es ihr immer öfter einen Stich versetzt, wenn sie auf Facebook die Chroniken ihrer ehemaligen Schulfreundinnen und -freunde anklickte, die Bilder von Brautkleidern, pausbäckigen Babys und niedlichen Kleinkindern zeigten. Mit einem Seufzer ließ sie die Puppe aufs Bett fallen und ging hinunter.
Während des Essens erging sie sich in einer Aufzählung von Afterreden über Henning und seine neueste Errungenschaft: Er wird bald merken, was er an der Schnepfe hat … Wer sich so schnell hingibt, der betrügt auch … Und viel zu jung ist sie! Was will er mit so einer? Was kann die ihm schon erzählen?
Am Schweigen der Eltern merkte sie, wie sie sich verlor.
Plötzlich überkam sie eine heillose Wut. Ihre Eltern würden es nie verstehen, nie ihren Schmerz und die Wut nachvollziehen können! Wie auch! Die hatten einander seit – genau wann? Waren es vierzig Jahre? Und schrieben sich immer noch Liebesbriefe! Besonders der Vater legte dabei überraschend viel Kreativität an den Tag. Soweit Caro wusste, hatte es keine Affären gegeben. Keine verräterischen Rechnungen, keinen Lippenstift am Kragen, keine heimlichen Telefonate. Sie kamen aus einer Zeit, in der man sich ganz altmodisch kennenlernte, miteinander ausging, sich verliebte, verlobte, heiratete, Kinder in die Welt setzte und so lange das Leben teilte, bis die Welt zu Staub zerfiel.
Konnten sie überhaupt nachvollziehen, wie es war, wenn man jahrelang mit einem Menschen zusammengelebt hatte, der sich am Ende als völliges Arschloch herausstellte? Und den man trotzdem nicht aus dem Kopf bekam, weil er mit der Zeit zu einem Teil der eigenen Geschichte geworden war? Wie sollte man all die Jahre so einfach vergessen, all die gemeinsamen Feste, Partys, Geburtstage, Weihnachten, die kleinen und großen Erinnerungen? Wie konnte man seine Arbeit machen, wo einem der Andere ständig über den Weg lief? Wie sollte man noch durch die Stadt gehen, ohne an jeder Ecke von Erinnerungen überfallen zu werden? Dort war ihr Lieblingsrestaurant; dort war’s, wo er mit seinen Freunden zum Kegeln hinging; dort, wo sie sich nachts im Park geliebt hatten … Wie das vergessen können? Wie?
Etliche Minuten lang herrschte betretenes Schweigen.
»Du kannst hierbleiben, so lange du willst«, sagte ihr Vater schließlich leise.
Caro quittierte es mit einem wehmütigen Lächeln. »Wolltet ihr mein Zimmer nicht vermieten?«
Mit den Finanzen der Eltern stand es nicht zum Besten. Caro wusste das. Noch kurz vor der Währungsunion hatte die Familie in der Doppelhaushälfte lediglich zur Miete gewohnt. Dann war jedoch die betagte Vorbesitzerin gestorben. Deren Erben hatten dem Ehepaar Barnim das Vorkaufsrecht eingeräumt. Die Raten für den Kredit würden nicht vor Caros fünfundvierzigsten Lebensjahr abbezahlt sein. Schon bald jedoch hatte sich die schnelle – manche Bekannte sagten, überstürzte – Entscheidung als Glücksfall herausgestellt, denn auf dem Grundstück lagen keine Ansprüche eines westdeutschen Altbesitzers.
Inzwischen hatte die Welle der Gentrifizierung auch Potsdam überrollt. Ihre einstigen Nachbarn, die sich die Mietforderungen nicht länger leisten konnten, waren längst ausgezogen. Keinen Monat lang hing im Fenster der aufgegebenen Orthopädie-Praxis das Angebot mit der Nummer des Maklers, dann hielten schon die Möbelwagen vor der Tür, hatte der Vater Caro auf der Hinfahrt erzählt. Und wo einst die Buchhandlung gewesen war, befand sich jetzt ein Feinkostgeschäft. Das Viertel hatte sich verwandelt. Kunstvolle schmiedeeiserne Gitter umgaben nun Vorgärten mit akkurat gestutzten Hecken und Leuchten an den Zufahrtswegen. In den Ausfahrten parkten PKWs der Oberklasse.
Caros Eltern, obwohl nicht zu den Ärmeren der Stadt zählend, hatten seit zehn Jahren keine großen Urlaubsreisen mehr unternommen, und der Grund dafür war nicht etwa das zunehmende Alter oder mangelnder Unternehmungsgeist. »Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen«, pflegte die Mutter zu sagen. Es war als Trost dahergeredet. Im Haushalt wurde jeder Euro zweimal herumgedreht. Die Einnahmen aus einer Vermietung an Studenten oder Feriengäste wären für die Eltern eine willkommene Entlastung gewesen, das wusste Caro.
»Das hat Zeit«, winkte ihr Vater ab. »Meine Tochter ist wichtiger.«
Sie starrte auf ihren Teller. Es waren sicherlich gut gemeinte Worte. Eigentlich hätte sie doch Dankbarkeit empfinden müssen, oder etwa nicht? Stattdessen stieg das ungute Gefühl, in jemandes Schuld zu stehen, in ihr hoch. Gefolgt von Trotz. Und Scham über den Trotz. Im Augenblick wusste sie selbst nicht, wo ihr der Kopf stand. War es vielleicht ein Reflex auf den Verrat des Partners, aufs Verlassenwerden? Oder hatte es neben dem Fernweh nicht schon immer irgendwo in ihrem Innern geschlummert, war dieses Aufbegehren gegen die Umklammerung durch elterliche Liebe nicht vielleicht einer der Auslöser für ihr frühzeitiges Abnabeln gewesen? So lange sie zurückdenken konnte, hatte sie auf eigenen Füßen stehen wollen.
Nach dem Essen stand die Frage im Raum, was sie mit dem angebrochenen Abend anfangen sollte. Caro graute vor dem Zubettgehen, der Zeit bis zum Einschlafen, wenn die Dämonen aus den Winkeln ihres Unterbewusstseins krochen.
Ziellos streifte sie durch das Haus. Fast zwanghaft führten sie im Wohnzimmer ihre Schritte zur Hausbar. Die beeindruckte mit gähnender Leere. Hinter der Klappe standen lediglich ein paar geschliffene Gläser und Karaffen. Das war alles. Nicht mal Schnaps-Pralinen lagen in dem Fach. Sie ahnte, dass es zwecklos war, im Keller den Bestand an Weinen durchgehen zu wollen. Wer vorsorglich die Hausbar leerte, hatte sicher auch den Weinkeller abgeschlossen. Ihre Eltern schienen an alles gedacht zu haben. Nur nicht daran, dass es Alkohol an jeder Tankstelle und an jedem Zeitungskiosk zu kaufen gab.
Caros Gesicht hellte sich auf, als sie sich des Vorrats erinnerte, den sie vor der Abfahrt angelegt hatte. Er lag ganz zuunterst in ihrer Reisetasche, jedes Fläschchen sorgfältig in Zeitungspapier eingewickelt und eine Socke darüber gestülpt, damit sie nicht verräterisch klirrten, wenn sie aneinanderstießen. Die Reserve war überschaubar, würde aber ausreichen, um auch diese Nacht in den Schlaf zu finden.
Irgendetwas musste an dem Klischee von den saufenden Teerjacken dran sein, sagte sie sich seufzend. Offiziell war Alkohol auf dem Schiff während der Schichten nicht gestattet. Aber außerhalb? Da galt man ganz schnell als Außenseiterin, wenn man nicht mit den Kollegen nach Feierabend in geselliger Runde einen Absacker becherte. In den letzten Jahren war das Trinken für sie zur Gewohnheit und schließlich zu einem ernsthaften Problem geworden. Doch darüber wollte sie sich jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Der Zweck heiligte schon immer die Mittel. Sie war noch keine zwei Stunden im Haus, da sehnte sie bereits das betäubende Schwindelgefühl herbei, die Entspannung und die kindliche Hilflosigkeit, die sich im Rausch einstellte. Vier, fünf der Fläschchen, die sie mitgebracht hatte – das war der Knopf, den sie nur zu drücken brauchte, um wenigstens für ein paar Stunden die Trommelstöcke in ihrem Kopf zum Ruhen zu bringen.
Bevor sie in ihrem Zimmer den Verschluss der ersten Flasche aufschraubte, dachte sie kurz daran, hinunter in die elterliche Bibliothek zu gehen und sich mit Lesestoff zu versorgen. Ihr Vater hatte für Belletristik nicht viel übrig. Es waren überwiegend Sachbücher, die in den Regalen standen. Dummerweise gehörten Ratgeber zum Thema »Wie gewinne ich meinen Ex zurück?« nicht zur Bestandsliste.
Ein einzelnes Regalbrett war den Liebesromanen der Mutter vorbehalten, aber danach stand Caro jetzt überhaupt nicht der Sinn. Alles, nur kein sentimentales Herz-Schmerz-Gesülze, davon produzierte ihr eigenes Gehirn genug. Stattdessen irgendwas Sachliches, mit dem man sich ablenken konnte, ein Geschichtsbuch vielleicht, davon gab’s viele; die Regale barsten geradezu davon.
Caro beließ es beim Vorsatz. Sie kippte wahllos drei kleine Obst-Schnäpse, einen Branntwein und einen Likör hinunter und streckte sich auf dem Bett aus. Es ging nicht so sehr um den Geschmack, da war sie nicht wählerisch. Hauptsache, das Zeug war hochprozentig. Süßes war bloß leichter zu schlucken.
Unter sich tastend, spürte Caro etwas Hartes, die Konturen der Fernbedienung. Eine Weile zappte sie durch die Programme. Bei einem Verkaufs-Sender blieb sie hängen. Schmuck wurde angepriesen, Edelsteine, die heilen sollten, Glück versprachen, Liebe, Gesundheit, Erfolg im Beruf. Alles, was sie gebrauchen konnte. Eigentlich glaubte sie nicht an diesen Hokuspokus – aber, na ja, konnte es schaden? Am Ende war doch etwas dran …
Unweigerlich begannen ihre Gedanken erneut um Henning zu kreisen. Bevor die Versuchung sie überkam und zum Telefon greifen ließ, wechselte sie rasch den Kanal.
Auf einem anderen Programm lief ein amerikanischer Spielfilm. Die Hauptfigur bewarb sich gerade um eine Stelle als Bibliothekar. Ach, die eigenen Bewerbungsunterlagen standen ja auch noch an. Sie war nie lange ohne Arbeit gewesen. Geld verdienen … Karriere machen … Das Monopoly des Lebens.
Die Jalousien waren offen. Die Dunkelheit drückte gegen die Fenster. Caro spürte die Anzeichen beginnender Trunkenheit.
Sie werden ein wunderbares Abenteuer beginnen, nach dessen Ende sie nie wieder derselbe sein werden, sagte im Fernsehen gerade eine sonore Stimme zu dem Mann, der sich als Bibliothekar beworben hatte.
Ein Abenteuer … Raus aus dem genormten, langweiligen Leben, dem Alltäglichen … Ausbrechen aus der banalen Realität … das Schiff besteigen und eine Reise machen, an deren Ende die geheimnisvolle Insel liegt, der Ort aller Sehnsüchte …
Es war das Letzte, was sie dachte, bevor sie einschlief.
2. Kapitel
»Der bei den Angeschuldigten aufgefundene Golddollar zeigt die Jahreszahl 1853 und trägt auf der einen Seite die Aufschrift »United States of America«, auf der anderen Seite ist ein Frauenkopf abgebildet. Diese Stücke kommen im einzelnen Verkehr fast nicht mehr vor. Sie befinden sich zumeist in Münzsammlungen.«
– Strafverfahren gegen die Gebr. Sass. Landesarchiv Berlin A Rep. 358-01 (5.1)
Der Morgen fand Caro in Katerstimmung. Hinter ihren Schläfen pochte es wie in den schlimmsten Tagen ihrer Erdbeerwoche, ihr war übel und sie hatte einen pelzigen Geschmack auf der Zunge.
Fröstelnd zog sie sich die Decke über die Schultern. Das Feuer im Ofen war längst ausgegangen. Die Wände der Dachschräge hielten die Wärme nicht. Ihre Eltern hatten die Isolierung immer wieder aufgeschoben und das Projekt irgendwann fallen lassen. Seit die Tochter aus dem Haus war, standen die beiden Zimmer die meiste Zeit des Jahres über leer.
Am liebsten hätte sie sich die Decke vollends über den Kopf gezogen, wie zurückgekehrt in den beschützten Zustand eines Embryos im Mutterleib. Der Blick auf den Nachttisch und auf dem Boden indes erforderte Initiative. Die geleerten Fläschchen, die überall herumlagen, zeugten von ihrem nächtlichen Gelage. Sie gab sich einen Ruck und schwang die Beine aus dem Bett. Schnell in eine Tüte mit dem Zeug und auf den Grund des Koffers damit, ehe die Eltern sie wecken kamen! Den Müll würde sie später bei einem Spaziergang klammheimlich in irgendeinen Abfalleimer entsorgen.
Im Bad ließ sie sich kaltes Wasser über die Handgelenke laufen. Das half, die Übelkeit ließ nach. Sie spülte eine Aspirin hinunter und gurgelte mit Mundwasser. Zähneklappernd zog sie sich an und ging nach unten in die Küche, wo ihr Vater über die Zeitung gebeugt saß.
Er musste früh aufgestanden sein. Der Frühstückstisch war gedeckt, der Tee in der Kanne noch warm, doch die beiden Eier waren bereits kalt.
Caro aß langsam und ohne Appetit eine Scheibe Toast. Das Wetter passte bestens zu ihrer trüben Stimmung. Über Nacht waren die letzten Schneereste geschmolzen, das Ende der Quecksilbersäule an der Außenseite des Fensters verharrte bei zehn Grad über Null. Definitiv zu wenig für den beginnenden Frühling. Der Himmel zeigte sich in düsterem Schiefergrau. Dessen ungeachtet verströmte der Vater die anstrengende gute Laune eines Morgenmoderators.
»Hast du heute schon was vor?«, erkundigte er sich unternehmungslustig, die Zeitung zusammenfaltend.
Sie zuckte unverbindlich mit den Schultern. Eigentlich wollte sie erst mal ankommen, bevor es wieder ans Aufbrechen ging.
»Willst du mich auf eine Auktion begleiten?«, setzte er nach.
»Eine Auktion?«, fragte sie ohne echtes Interesse.
»Eine Nachlass-Versteigerung, von einem Kapitän zur See. Hab mir gedacht, das könnte auch was für dich sein.«
Caro rieb sich die Schläfen. »Was macht denn ein See-Kapitän hier in unserer Streusandbüchse?«
»Ein ehemaliger Käpt’n zur See«, präzisierte er. »Danach war er lange Jahre Skipper eines Ausflugsdampfers auf den Binnengewässern. Der Marie Celes, um genau zu sein.«
Der Name des Schiffes weckte bei ihr vage Erinnerungen, angesichts der frühen Stunde und des erst allmählich abklingenden Katers verspürte sie jedoch keinen Anlass, ihr Gedächtnis weiter zu strapazieren.
Ihr Vater beugte sich über den Küchentisch und angelte nach einer Scheibe Schinken. »Wir sind vor Jahren mal bei ’nem Spaziergang daran vorbeigelaufen. Der alte Zollhafen in Berlin – erinnerst du dich?«
»Du meinst das olle Wrack?«
»Ja, das ist die Marie Celes«, bestätigte er. »Oder vielmehr, sie war es. Der Eigner hatte das Schiff nach seiner verstorbenen Frau benannt.«
Caro verzog das Gesicht. Ihr alter Herr konnte so schrecklich unsensibel sein. Paare – ob nun lebend oder tot – waren das Letzte, womit sie sich im Augenblick beschäftigen wollte.
Ihr Vater redete unbekümmert weiter. »Wenn man sie so daliegen sieht, möchte man nicht glauben, dass man sie mal Die Perle des Rheins nannte.« Er biss in die Schinkenbrotscheibe. »Aber das war sie«, fuhr er kauend fort. »Neun Kabinen für Passagiere, vier für die Crew, Fußbodenheizung, Wandtäfelung aus Mahagoni, Kapitänstisch aus Ahorn, die Möbel in den Kabinen aus heller Eiche – das Feinste vom Feinsten.«
»Wenn es die Perle des Rheins war, was sucht sie dann auf der Spree?«
»Vor der Wende machte sie Fahrten über Rhein und Mosel bis nach Frankreich rein. Danach ging’s nach Brandenburg und Mecklenburg. Die alte Dame ist ganz schön herumgekommen.«
»Du willst doch nicht etwa diesen Schrotthaufen ersteigern, Papa? Das Ding sah aus wie ein Seelenverkäufer, ein Geisterschiff.«
Caro schauderte es. Sie war schlank und fror daher schnell. Im Kollegenkreis hatten sie Witze darüber gerissen, dass sie vermutlich die Erste wäre, die bei einem Schiffsunglück erfrieren oder verhungern würde. Doch es war nicht die Raumtemperatur, die ihr Gänsehaut bereitete. Tatsächlich war sie einmal im Nordatlantik einem Geisterschiff begegnet. Ihr Skipper hatte einen großen Bogen um das treibende Wrack steuern lassen. Durch das Fernglas war deutlich die verlassene Brücke zu erkennen gewesen, der rostige Schiffskörper, die abblätternde Farbe, die kyrillischen Buchstaben.
Danach hatten Geschichten unter den Kollegen die Runde gemacht. Einer von ihnen, ein portugiesischer Maschinist, behauptete, als junger Matrose dabei gewesen zu sein, als sein Tanker auf die Angoche stieß, die mit Schlagseite südlich von Nacala trieb. Nur einen Hund und eine Katze hätten sie an Bord gefunden. Und die Zahnbürsten der verschwundenen Seeleute …
Caro verspürte erneut den Schauder, als sie sich erinnerte, wie sie damals durchs Fernglas die Aufbauten des Wracks betrachtet hatte. Ein Passagierschiff war es – nicht ganz so riesig wie das, auf dem sie fuhr, aber eben doch groß. Und sie hatte sich an Bord immer so sicher gefühlt.
Die Stimme des Vaters riss sie aus den Erinnerungen.
»Zugegeben, der Gedanke hat schon was. Das Schiff wieder herzurichten – ein Traum! Aber selbst wenn wir so viel Schotter hätten, die Gläubiger auszubezahlen, müssten noch mal Unsummen in den Ausbau gesteckt werden.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, mir geht’s nur um den Nachlass des alten Seebären. Vor allem um die Logbücher. Die muss ich haben!«
Caro kannte die Vorliebe ihres Vaters für Maritimes. Er war eine Zeit lang selbst zur See gefahren, erst bei der Marine, später als Besatzungsmitglied eines Trawlers. Das Meer hatte ihn nie losgelassen, selbst nach dem Umzug ins Binnenland nicht, das wurde jedem klar, der das Arbeitszimmer von Lars Barnim betrat. Buddelschiffe und maßstabsgetreue Seglermodelle dümpelten auf Fensterbänken, Muscheln und Seeigel paradierten auf Regalbrettern. Dicht unter der Zimmerdecke hing ein Netz, darunter wies ein Fischspeer akkurat wie eine Kompassnadel nach Norden. Ein altertümlicher Seekompass diente als Briefbeschwerer, eine Riesenmuschel als Aschenbecher. Unter der Glasplatte des wuchtigen Eichenschreibtischs lag in voller Größe eine Seekarte der Gewässer um Rügen und Hiddensee ausgebreitet. Wohl zwei Drittel des Bücherregals nahmen Bücher maritimen Inhalts in Beschlag, von der Geschichte der Seefahrt über Bildbände mit Dampf- und Segelschiffen bis hin zu Berichten über Reisen, Weltumsegelungen, Entdeckungen. All das hatte früh die Fantasie der Tochter befeuert, die schon als kleines Mädchen mit dem Finger über Seekarten gereist war.
»Hast du Lust mitzukommen?«, hörte sie ihren Vater erneut fragen. »Du musst wieder mal unter die Leute.«
Der darin anklingende Vorwurf forderte ihren Trotz heraus. »Meinst du etwa, ich finde meinen Traumprinzen ausgerechnet bei einer Auktion?«
»Hier im Haus findest du ihn jedenfalls nicht.« Der Vater goss sich Tee ein und verließ mit der Tasse in der Hand die Küche.
Caro versuchte den verärgerten Klang seiner Worte zu überhören und sich auf die Zeitung zu konzentrieren. Doch immer wieder tauchte vor ihrem inneren Auge das Gesicht Hennings auf, sein offenes Schuljungenlachen. Die Erinnerungen daran schmerzten.
Einige Minuten später trat ihre Mutter in die Küche, schloss die Tür und setzte sich zu ihr an den Tisch.
»Hast du heute etwas Bestimmtes vor?«
Ewa Barnim hatte einen leichten osteuropäischen Akzent, der sich vertiefte, wenn die Erregung sie packte. Die Grammatik war fehlerfrei, allerdings wirkte ihre Sprache mitunter ein wenig fremdartig und altmodisch, zum Beispiel wenn sie sich zu Ausdrücken wie Potzblitz oder Hundsfott verstieg oder davon sprach, wie es einem Fass den Boden ins Gesicht schlug.
»Ich könnte in die Stadt gehen oder in den Park«, erwiderte Caro ohne rechte Überzeugung.
Die Mutter schob die Teetasse über die Tischplatte. »Ich werde nicht zuschauen, wie du dich auffrisst. Wegen dieses lüsternen Tölpels.«
Caro sah hoch, Dankbarkeit im Blick. Jetzt war es heraus: Sie traf keine Schuld. Es war weder ihr Alter noch ihr Aussehen noch sonst irgendetwas, über das sie in vielen schlaflosen Nächten gegrübelt hatte. Henning war nur ein Idiot, der mit den Eiern dachte. Punkt. So einfach war das.
Sie wusste, ihre Eltern hatten ihn gemocht. Lange Zeit war er als Schwiegersohn im Gespräch gewesen. Seitdem sie wieder hier war, hatten ihre Eltern seinen Namen jedoch kein einziges Mal in den Mund genommen. Er war in der Familie zur persona non grata geworden.
»Hat dir dein Vater schon von seinem Vorhaben erzählt?«
»Du meinst die Nachlass-Versteigerung von diesem verrosteten Kahn?«
Nachdenklich drehte die Mutter die Tasse zwischen den Händen. Sie wählte ihre Worte mit Bedacht. »Es wäre gut, wenn du mit ihm fährst und ein Auge auf ihn hast.« Obwohl die Tür zum Flur geschlossen war, dämpfte sie die Stimme. »Du weißt doch, wie er ist, wenn es um diesen Seekram geht. Jemand muss auf ihn aufpassen.«
Caro wusste, worauf die Anspielung zielte. Ihr Vater musste seit einiger Zeit Medikamente nehmen. Eine der Nebenwirkungen war eine gesteigerte Bereitschaft zu riskantem Verhalten, eine Impulsivität, die sich unter anderem in Spielsucht oder Kaufsucht äußern konnte. Trotzdem fand sie es befremdlich, ihrem Vater, einem erwachsenen und recht eigensinnigen Mann, eine Nanny mitzugeben, nur weil er Arzneien nahm, die in den Dopamin-Spiegel eingriffen.
»Es war seine eigene Idee«, versetzte ihre Mutter achselzuckend, als Caro eine entsprechende Bemerkung machte. »Ist das so schwer zu verstehen? Dein Vater hat einen analytischen Verstand. Hat er schon immer gehabt. Er fürchtet die Kontrolle zu verlieren. Letztes Weihnachten – weißt du noch, wie er mir da dieses teure Geschenk gemacht hat?«
»Die Kette mit dem Anhänger? Na und ob! Du hattest mir ein Foto davon gemailt. Hab meinen Kaffee gegen den Bildschirm gehustet, als ich sie sah. Hast du sie etwa noch?«
Die Mutter verneinte. »Hab sie nach den Feiertagen zurückgebracht.« Bedauern schwang in ihrer Stimme. »Zum Glück hatte er die Rechnung nicht weggeworfen. – Versteh mich nicht falsch: Sie war wunderschön! Ich musste schlucken, als ich das Geschmeide ausgepackt habe. Aber es war einfach … nicht rechtens. Viel zu teuer. Und ich brauche kein Symbol, um daran erinnert zu werden, dass ich diesen Dickkopf immer noch liebe. Jedenfalls saß dein Vater danach den ganzen Abend über am Computer und studierte im Internet Berichte zu seinem neuen Medikament. Später sagte er zu mir: Es kann sein, dass ich mich verändere und es nicht mitbekomme. Es wäre gut, wenn du in Zukunft ein Auge drauf hättest.«
»Warum fährst du nicht mit? Ich könnte mir denken, dass er auf dich mehr hört als auf mich.«
»Ich bin heute mit meiner Schwimmgruppe verabredet. Hab schon die beiden letzten Male abgesagt. Wenn ich das weiter versäume, passe ich bald nicht mehr in den Badeanzug.«
Caro enthielt sich eines Kommentars über klassisches Understatement. Unzweifelhaft gehörte ihre Mutter in die Kategorie »In Würde gealtert«. Sicher, die Haut hing leicht in den Augenwinkeln, um den Mund und am Hals, der Busen focht seinen Kampf gegen die Schwerkraft aus, um die Hüften herum hatte sie zugelegt und die Schultern waren nicht mehr ganz so breit wie ehedem, trotzdem sah man der Sechzigjährigen die Jahre kaum an. Solange Caro zurückdenken konnte, war ihre Mutter die Sportskanone der Familie gewesen. Sie rauchte nicht, trank keinen Alkohol und ernährte sich auf eine Weise, dass sie ohne Probleme für eine Werbekampagne von Weight Watchers hätte herhalten können. Dabei war sie nicht dem Optimierungswahn der heutigen Fitness-Generation verfallen, die mit Puls-Uhr und Auswerteelektronik penibel über ihre Trainingsfortschritte Buch führte. Caros Mutter schwamm, weil sie es genoss – das Gefühl der Schwerelosigkeit, die Konzentration auf die Atmung. Das Wasser war ihr Element. Vor zehn Jahren hatte sie ihren Tauchschein gemacht. Die jährlich anfallenden Tauglichkeitsuntersuchungen bestand sie seitdem regelmäßig mit Bravour.
Seefahrt, Schiffe, Tauchen – irgendwie schien das Wasser in ihrer Familie immer eine Rolle zu spielen, sagte sich Caro. Falls sie selbst doch noch irgendwann Kinder in die Welt setzte, trügen die wahrscheinlich Schwimmhäute zwischen den Fingern.
Nun gut. Sie gab sich einen Ruck. Sollte die Mutter ihren Willen bekommen. Männer waren nun mal schwierig, da musste man unter Frauen zusammenhalten.
Als Vater und Tochter losfuhren, begann Caro den Ausflug sogar für eine recht gute Idee zu halten. Mit irgendetwas musste sie sich schließlich beschäftigen, um der Versuchung zu widerstehen, Henning anzurufen, seine vertraute Stimme hören. Denn sie wusste auch, wie das Telefonat enden würde: wie immer in gegenseitigen Vorwürfen, im Streit.
Genau deshalb würde er mit Sicherheit nicht anrufen. Warum auch, für ihn war die Welt ja in Ordnung.
Ein Gedanke blitzte auf: Vielleicht sollte sie sich das gleiche Recht herausnehmen und sich einen Liebhaber suchen, der optisch was hermachte und sie im Bett wachhielt. Nicht so sehr, um körperliche Bedürfnisse zu stillen, sondern um sich ihres Marktwertes zu vergewissern. Sie könnte Henning aus dem gemeinsamen Urlaub eine Postkarte schicken. So manch einer bemerkt den vor seiner Nase hängenden Apfel erst, wenn ein anderer die Hand danach ausstreckt.
Das Dumme war nur, dass sie keinen anderen Mann in ihrem Bett haben wollte. Hennings Körper, sein Geruch, seine Stimmungen und was er tat – das alles war ihr vertraut und hatte ihr Sicherheit gegeben. Bis – ja, bis vor zwei Monaten. Ab da war er in Gedanken woanders, das hatte sie deutlich gespürt. Sie schob es zuerst auf seine Arbeit und er – dieser Feigling! – hatte ihre Vermutung bejaht.
Doch dann hatte sie die Quittungen gefunden. Auf der Suche nach Tintenpatronen für den Drucker war sie darauf gestoßen. Die Belege lagen offen in Hennings Schreibtischschublade, wo er Bürozeug verwahrte: Rechnungen für teure Abendessen in Hamburger Restaurants, Kassenbons über teure Geschenke …
Diesmal hatte es keine Ausflüchte mehr gegeben. Ja, er hatte eine andere Frau kennengelernt. Ja, sie trafen sich regelmäßig. Und ja, sie schliefen miteinander. Alle diese Ungeheuerlichkeiten wurden in einem schuldbewussten Ton herausgebracht, wobei er den Blick vor sich auf den Boden gerichtet hielt.