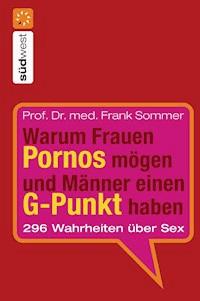Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Sturzflug nach Merkwürdistan Sehnsucht nach fernen Ländern und Begeisterung für die Fliegerei führen in vielen Fällen zu einer Karriere als Pilot. Im vorliegenden Fall lief jedoch alles ein wenig anders. Auch wenn er selbst nicht am Steuerhorn, sondern etwas weiter hinten Platz nahm, machte der Autor seine Vorlieben zum Beruf. Rastlos umkreist er den Erdball und erlebt dabei kuriose Situationen in exotischen Ländern wie Nordkorea, Irak, Angola, Ecuador oder Vanuatu. Hautnah lernt er auf diesen Reisen die Einwohner der bereisten Länder kennen und gewinnt tiefe Einblicke in Kultur, Politik und Sitten. Aber wenn man viel reist, kann auch eine Menge schief gehen. Eine ganze Sammlung von kleinen und großen Reisekatastrophen kam so – eigentlich zum Missfallen des Autors – zusammen. Das eine Mal zwang die Situation ihn zum nächtlichen Ausstieg aus einem Zug auf freier Strecke, das andere Mal wurde er wegen Spionageverdachts von der Militärpolizei verhaftet. "Im Sturzflug nach Merkwürdistan" ist eine chronologisch angeordnete Sammlung von wahren Kurzgeschichten, die überraschende, außergewöhnliche und manchmal verstörende Reiseerlebnisse des Autors in humorvoller Art und Weise darstellen. In die wunderbare Welt des Reisens und der Fliegerei checkt er als Zivildienstleistender ein. Er leistet seine Dienstzeit an einem Flughafen ab, wo sich – sozusagen per Anhalter im Cockpit – schon erste unverhoffte Reiseabenteuer ergeben. Als sein bester Freund Henry in der Karibik unter Drogenverdacht in Schwierigkeiten gerät, ist der Protagonist noch amüsiert und ahnt nicht, welche Unwegsamkeiten ihm auf der Reise durch sein eigenes Leben noch auflauern werden. Im weiteren Reiseverlauf treten immer wieder neue interessante Akteure in Erscheinung, spannende Reisebegleiter auf Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Sommer
Im Sturzflug nach Merkwürdistan
Fliegerwahn(sinn) und schräge Reisebegegnungen
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Einleitung
Früh übt sich: den Zivildienst zum Flugticket gemacht
Henry als Drogenkurier – die Urkatastrophe
Fluch(t aus) der Karibik
Rhodos: Du kommscht hier ned rein!
Fliegen per Anhalter oder der Freak vom Bahnhof Zoo
Partybekanntschaften und Chauffeurabenteuer
Das Problem mit dem Nachhauseweg
N wie Nordpol, Nachtzug oder nutzloser Nonsens
Vom Knipser zum Knasti
Japanische Zentimetermaß-Folter trifft chinesische Verwirrung
Meeting Murdoc
Liegt es in der Familie – oder an der Familie?
Nicht lustig!
Reisen skurril: die kleinen Besonderheiten
Interkulturelle Bärenfallen: wahre Herausforderungen des Reisens
Renn um dein Leben: Sicherheit unterwegs
Acai mit Krokant: Theodor dreht durch
Alzheimer und rohe Gewalt
Fliegendes Schnitzel „Well done bis knusprig“
It’s all about Sex
Löchrige Straßen, Guaven und Bier
Kava und Basket blong titi oder ganz schön weit weg!
Flugplantücken: zu spät, zurück verpasst
Menschen im Vorbeiflug
Chillout in Chile
Hello Africa!
Nordkorea: Wie schon der große Führer sagte...
Iran: Gurken statt Schurken
Schlussnote: Ein Wunschzettel
Impressum
Widmung
Einleitung
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich im Grundschulalter in so mancher Sommernacht wach in meinem Bett lag und durchs offene Fenster ganz leise die Motoren hochfliegender Langstreckenflugzeuge gehört habe. „Da oben in den Flugzeugen sitzen die glücklichsten Menschen der Welt“, dachte ich mir. Die haben doch tatsächlich das Privileg, in Flugzeugen sitzen und sich die nächtliche Welt von oben anschauen zu dürfen, aber ich musste hier unten in meinem Bett versuchen, Schäfchen zu zählen. Ein grober Irrtum, Kinder sind halt leider manchmal etwas naiv. Heute verrenke ich mir auf unzähligen Nachtflügen das Kreuz, schlafe halb im Sitzen und muss wildfremde Menschen im Sitz direkt neben mir ertragen, die mir ihren Hintern zudrehen und das tun, was Menschen tun, wenn sie sich entspannen oder das Essen nicht vertragen – wovon man aber ganz sicher nichts mitbekommen möchte. In manch solch schlafloser Nacht im Flugzeug habe ich das Fenster aufreißen und dem kleinen Jungen unten auf der Erde die Wahrheit zubrüllen wollen. Dass er einen vernünftigen Beruf ergreifen solle, bodenständig und berechenbar.
Aber zunächst zurück zum Anfang, zum kleinen Jungen in seinem Bett. Aus ungeklärter Ursache hatte ich schon in frühesten Kindesjahren eine ausgeprägte Liebe zur Fliegerei. Was viele kleine Jungen einmal als Phase durchmachen, gekennzeichnet von Modellflugzeugen in den Regalen und Flugzeugkrickeleien auf dem Malpapier, setzte sich in meiner Kindheit jedoch als monothematischer Fetisch konstant weiter fort und verstärkte sich noch stets. Die jährlichen Flugreisen mit der Familie waren für mich das, was für andere Kinder die Bescherung an Heiligabend war: das Ziel des Wegs, die Erfüllung unserer Freud’schen Träume. Schon Wochen vorher traten symptomatische Schlafprobleme auf und je näher der Abflug rückte, desto mehr herrschte freudiger Ausnahmezustand. Ein Flug ohne Fensterplatz? Absolut undenkbar. So manches Mal fragte ich mich, was für ein komischer Kerl mein Vater nur war, der ja nie am Fenster sitzen konnte, weil ich dort sitzen musste. Wie konnte er diesen heiligen Platz nur an mich abtreten? Held oder Ungläubiger? Laut hatte ich diese Frage natürlich nie gestellt, denn ich wollte ja nicht riskieren, dass er es sich doch einmal anders überlegen würde. Kaum in Spanien angekommen, begann die aufgeregte Vorfreude auf den Rückflug. Im zarten Alter von 13 Jahren saß ich dann bereits im Cockpit von Segelflugzeugen und ... fand’s irgendwie uncool. Die Bewegung im dreidimensionalen Raum war ja ganz nett, aber das wiederholte Ziehen von Kreisen wurde bei ständiger Wiederholung nicht gerade interessanter und zudem ging mir diese Vereinsmeierei unter den Mitfliegern gehörig auf den Keks. Das war’s also nicht für mich. Das vorläufige Ende meiner Liebe zur Fliegerei? Von wegen. Aber wie würde sich meine Vorliebe künftig Ausdruck verschaffen? Als ich als 15jähriger in den Schulferien zwei Wochen am Stück ohne Unterbrechung jeden Tag mit dem Fahrrad die 20 Kilometer vom Elternhaus zum Flughafen und abends wieder zurück fuhr, einfach nur um im Gras zu sitzen und die Flieger auf der Piste zu bestaunen, machten sich die ersten Beteiligten langsam größere Sorgen um meinen seelischen Gesundheitszustand. Ich hingegen war glücklich. Die großen Düsendinger interessierten mich viel mehr als Vereinsvorsteher Kalles Sportflugzeuggurken und über die reine Fliegerei hinaus ließ sich am Flughafenzaun sitzend mit dem Kerosin auch ein wenig der Duft der großen weiten Welt schnuppern. Da rollte zum Beispiel mal ein Jumbo der Iran Air an mir vorbei. Wahnsinn, Iran – wer sitzt da bloß drin? Wo genau ist der Iran und wie ist es da bloß? Ob es da anders riecht? Ist es da gefährlich? Dies jemals herauszufinden, lag jenseits meiner Vorstellungskraft. Mich plagten damals anstehende Mathearbeiten und auch Mädchen nicht ganz so sehr wie meine Altersgenossen, da ich eher auf das Anstarren von Flugzeugen abgefahren bin, dieser Umstand wurde mir ganz langsam klar.
Einmal irrte ich ziellos durchs Flughafenterminal und traf durch Zufall meine alte Klassenlehrerin aus der Grundschule. Gemeinsam blickten wir auf einen großen Ferienflieger und sie erzählte mir, dass sie damit vor ein paar Monaten nach Kanada geflogen sei, um sich das bunte Laub des Indian Summer anzusehen. In diesem Moment mutierte sie vom Erzfeind zur Göttin. Ein Langstreckenflug, so etwas durfte ich noch nie genießen. Kanada – das klang für mich weiter weg als der Mond und der Gedanke, die Fliegerei und fremde Länder zu kombinieren, hörte nicht auf, an Attraktivität zu gewinnen. Irgendwann im fortgeschrittenen Teenageralter war es dann tatsächlich soweit. Die Eltern zogen die Spendierhosen an und der erste Langstreckenflug stand auf dem Programm: im Jumbo in die USA. Ja, meine ersten Freundinnen hatte ich damals zwar trotz meines Fetischs auch schon gehabt, aber, hey, das war doch alles nicht so wichtig – jetzt rief die große weite Welt! Und es kam so, wie es kommen musste – die erste Reise wirkte auf mich wie eine ungeahnt große Dosis von der süßen Frucht, ohne die ich nicht ich gewesen wäre. Langsam kam nun auch die Zeit, in der man sich Gedanken über seine Wünsche zum beruflichen Werdegang machen musste. Ein wenig Bedenkzeit hatte ich noch während meines einjährigen Zvildienstes am Flughafen, aber dann wurde es ernst. Als Pilot zu fliegen hatte ich ja bereits dankend abgelehnt und dies sollte mich auch später nicht mehr interessieren. Was blieb also? Klare Antwort: keine Ahnung! Während dieser Orientierungslosigkeit brachte mich ein Tipp der Berufsberatung der Arbeitsagentur auf die fatale Idee, Geschichte zu studieren. Der Anfang vom Ende meiner Selbstverwirklichung in Sachen Fliegerei und weiter Welt? Würde ich nun mein Leben damit verbringen, im staubigen Kellerarchiv eines Museums Aktenschränke zu bewachen? Das Studium für sich war soweit ganz interessant und nett, aber seinen eigentlichen Wert fand ich erst im fünften Semester heraus. Das Geschichtsstudium war nämlich – anders als etwa BWL oder Jura – so aufgebaut, dass man als Student viele zeitliche Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Da ich begann, die Fliegerei zu vermissen, bewarb ich mich nebenher auf einen Job im Flughafenmanagement und siehe da, ich hatte Glück und bekam ihn. Nun hatte ich zwar das Problem, einen Vollzeitjob und ein Vollzeitstudium, welches ich nicht abbrechen wollte, zeitlich miteinander in Einklang zu bringen. Dafür konnte ich mich nun aber unerwartet beruflich voll der Fliegerei widmen und – besser noch – fand mich plötzlich auf der einen oder anderen Dienstreise per Flugzeug wieder. Wie nett, ein bezahltes Hobby neben dem Studieren! Das Studium dauerte aufgrund dieser Umstände bis zu seinem Examen zwar ein paar Semesterchen länger, aber dafür hatte ich das Privileg, etwas tun zu dürfen, was ich liebte.
Nach dem Studium arbeitete ich noch ein paar Jahre am Flughafen, bis sich die einmalige Chance auftat, dass ich mich als Trainer selbständig machen konnte, um Flughäfen in Sachen Flugsicherheit zu trainieren und zu beraten. Ein Job ausschließlich basierend auf Reisetätigkeit stand mir bevor. Ich würde ständig bequem um die Welt fliegen und mein Geld damit verdienen, neue Kulturen kennenzulernen und die süßen Seiten des Reisens kennenzulernen. Das musste das Paradies sein! War es aber nicht. Hatte ein paar Dinge übersehen. War mir leider erst später aufgefallen. Können Sie hier nachlesen. Aber lassen sich mich vorab versuchen, meine in den folgenden Jahren gewonnenen Erkenntnisse über das Leben des dauerhaft Berufsreisenden kurz und metaphorisch zu skizzieren. Es ist in etwa wie Ihr liebstes Fischgericht. Mit großem Appetit beginnen Sie, davon zu naschen, bis sie auf die erste Gräte beißen. Es schmerzt Sie sehr und für einen Moment fragen Sie sich, ob der Genuss die Schmerzen wert ist. Doch der Appetit überwiegt, Sie essen weiter und beißen bald in die nächste Gräte – diese schmerzt noch mehr und Sie hören kurz auf zu essen. Aber, verdammt, es duftet so verführerisch und Sie sind noch immer hungrig und so essen Sie weiter und immer weiter und die großen und kleinen Gräten bereiten Ihnen Schmerzen, können Sie am Ende aber nicht stoppen. Willkommen in meinem Leben! Von so mancher meiner großen und kleinen Gräten können Sie auf den folgenden Seiten lesen, aber auch von dem großen Appetit auf die duftenden Genüsse. All dies betreibe ich nicht ohne Angst, dass ich mich vielleicht doch auch mal so richtig fies an einer bösen Gräte verschlucken und daran ersticken könnte. Ein guter Kollege von mir, ein alter amerikanischer Pilotenhaudegen, staunte vor einiger Zeit nicht schlecht, als ich ihm von meinen ständigen Dienstreisen, Jetlags und Reisekatastrophen berichtete. „Es macht Spaß, aber es macht mich auch fertig. Bis ans Ende meiner Tage kann ich das so kaum durchhalten“, sagte ich ihm. „Och, das ist doch kein Problem.“, antwortete er. „Mach einfach noch zwei, drei Jahre genauso weiter, wie Du es jetzt machst und dann müsstest Du das Ende Deines Lebens auch als Enddreißiger eigentlich schon erreicht haben.“ Da war sie wieder, die gefürchtete letzte Gräte im falschen Hals.
Sie mögen sich jetzt fragen, was denn eigentlich mein Problem ist. Es scheint, als würde ich auf Kosten anderer an jedem zweiten Wochenende die Welt umrunden und dies vermutlich noch nicht einmal in der Touristenklasse. Ich würde an Orte gelangen, die in einigen Fällen kaum ein anderer aus meiner Heimat jemals bereist hat und dann beklage ich mich über ein Haar in der Suppe? Lassen Sie mich Ihnen vorab zwei kleine Fischhappen servieren und Ihnen an diesen beiden kleinen Beispielen verdeutlichen, dass wir hier tatsächlich nicht von Haaren, sondern von kapitalen Gräten im Essen sprechen:
Fischhappen Nr. 1: Ohne Pass kein Spass
Eine meiner Dienstreisen sollte mich in die Vereinigten Arabischen Emirate führen, nach Abu Dhabi, um genau zu sein. Am Morgen des Reisetages, bemerkenswerterweise ein Samstag, kitzelte mich die Sonne aus dem Bett. Eingecheckt hatte ich schon am Vortag übers Internet, so dass mir meine Ankunft am Flughafen eine Stunde vor Abflug zeitlich absolut ausreichend erschien. Ich stellte mich beim Gepäckannahmeschalter brav in die Schlange und griff in die Tasche, in der sich stets mein Reisepass befindet. VERDAMMT, leer! Es war dieses „Das-kann-doch-nicht-sein-und-der-Boden-unter-meinen-Füßen-wird-soeben-weggezogen“- Gefühl und ich wusste im selben Moment, dass etwas nicht stimmte und ich meinen Reisepass nie wieder sehen würde. Da ich ständig durch die Gegend fliege, hat mein Pass einen festen und sicheren Platz in einer kleinen Tasche meines Koffers, der mich auf jeder Reise als Handgepäck begleitet. Den Pass aus anderen Gründen als zum Zweck einer kurzen Passkontrolle von diesem Ort zu entfernen, war stets tabu, was anders herum das lästige Suchen des Passes vor jeder Reise überflüssig machte. Jedenfalls kniete ich nun dort im Terminal des Flughafens vor meinem offenen Koffer, 60 Minuten bis zum Abflug. Was tun? In diesem Moment kamen zwei Bundespolizisten an mir vorbeigestreift. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch der naiven Vermutung aufgesessen, dass es an einem Weltflughafen selbst an einem Samstagvormittag vielleicht irgendeinen Beamten geben müsste, der in der Lage sein könnte, einen Ersatzpass auszustellen. Ein Irrglaube. Während ein Kollege von mir so nett war, sofort in mein Büro zu eilen und dort radikal, aber erfolglos alle Schubladen und Schränke durchwühlte, tat meine Frau zu Hause unseren privaten Schubladen und Schränken dasselbe an. 30 Minuten vor Abflug war klar: Der Pass war weg und mein Flug war es auch. Für einen Moment stoppte ich meinen Aktionismus und kam zur Ruhe, um über einen Plan B nachzudenken. Ich fand heraus, dass es am Abend noch einen zweiten und letzten Flug nach Abu Dhabi geben würde. Damit hatte ich von diesem Zeitpunkt an knapp zehn Stunden zum Suchen. Mit dieser Notlösung würde ich wenigstens noch genau eine Stunde vor Beginn meines Einsatzes am Einsatzort in Abu Dhabi sein. Da ich nun aber quasi seit der ersten Sekunde wusste, dass der Pass auf alle Zeiten verschwunden ist – ich habe ihn bis heute tatsächlich nie wieder gesehen – hatte ich ein großes Problem. Es war ja Wochenende und damit waren alle Behörden geschlossen. Das Fazit meiner schnellen Recherche war, dass es genau zwei mögliche Ergebnisse geben konnte: Entweder würde ich nicht reisen können und hätte meine Firma damit in ein finanzielles Fiasko gestürzt oder ich hätte es schaffen müssen, am Wochenende das Einwohnermeldeamt meines Heimatortes außerplanmäßig öffnen zu lassen, damit dieses mir einen Ersatzpass ausstellt. Ambitioniert, zumal zwischen mir und dem am Wochenende fest verschlossenen Einwohnermeldeamt meines Heimatortes in diesem Moment knapp 600 Kilometer lagen, was die Sache nicht einfacher machte. Da ich mehrere reiseerfahrene Freunde in meiner Not anrief und nach Rat und Ideen fragte, erhielt ich tatsächlich einen sehr viel versprechenden Hinweis. Es gäbe angeblich eine Gemeinde in der Nähe meines Flughafens, deren Rathaus auch am Samstagvormittag bis 12 Uhr geöffnet habe. Das war meine einzige Chance und so rief ich das besagte Amt in Windeseile an, zumal es bereits kurz nach elf Uhr war. Gestresst wie ich war, empfand ich es zunächst als Wohltat, tatsächlich die freundliche Stimme einer Dame vom Amt am anderen Ende der Leitung zu hören. „Kein Problem, wenn Sie bis 12 Uhr zu uns kommen, können wir Ihnen gerne einen vorübergehenden Reisepass ausstellen“, sagte die Dame und versetzte mich in einen Zustand höchsten Glücks. Das war’s, Problem gelöst! Immerhin für kurze Zeit jedenfalls: „Sie sind doch in unserer Gemeinde mit Ihrem Hauptwohnsitz gemeldet, oder?“, fragte sie dann leider noch. Nein, verdammt, war ich nicht. Ich zog sämtliche Register, um sie von der dringenden Notwendigkeit zu überzeugen, dass sie mir auch ohne solch nebensächliche Wohnsitzmeldung einen Pass ausstellen müsste. Kamele, Goldklumpen, Myrrhe und Weihrauch wollte ich ihr aus Arabien mitbringen. Nix, keine Chance. Die Dame war freundlich, blieb aber leider flexibel wie ein Stahlrohr. Die Lösung gestaltete sich aus ihrer Sicht zum Glück total einfach: Ich brauchte nur ein Fax von meinem zuständigen Einwohnermeldeamt, welches besagen sollte, dass die Dame mir den Pass ausstellen dürfe. Mein zuständiges Amt war sehr schön - baulich attraktiv, nur nette Mitarbeiter. Das kleine Problem war aber bekanntlich, dass es 600 Kilometer weit weg lag und an einem Samstag selbstverständlich geschlossen war. Die Dame gab mir dann noch den freundlichen Rat, ob ich nicht jemandem kennen würde, der wiederum im Rathaus meiner Heimatgemeinde jemanden kennen würde. Zu diesem Zeitpunkt blieben noch 45 Minuten bis zur Schließung des am Samstagvormittag geöffneten Amtes. Ich dachte, dachte und dachte. Angestrengt grübelte ich, ob mir irgendetwas einfiele und beobachtete dabei aus dem Augenwinkel, wie der Sekundenzeiger an meinem linken Handgelenk tick-tack-tick unaufhaltsam seine Runden drehte. Da ich die meiste Zeit auf Reisen verbringe, beschränken sich die Bekanntschaften in meiner Heimatgemeinde auf meine kleine Familie, den Tankstellenshop-Verkäufer aus der Nachtschicht und den pickeligen Typ aus der Videothek. Das war’s, woher sollte ich denn „zufällig“ einen Mitarbeiter des Meldeamtes kennen? Also dachte ich weiter nach, mit Schweißperlen auf der Stirn... tick-tack-tick. Ich lehnte mich zurück und versuchte mich zu erinnern, ob ich nicht doch irgendjemanden aus meinem Heimatkaff kennen könnte, der jetzt noch in der Lage wäre, den Fall zu drehen. Und tatsächlich! Hätte ich es nicht selber erlebt, würde ich es mir an dieser Stelle vielleicht selbst nicht glauben: Meine Eltern hatten doch vor einem runden Jahrzehnt mal den Kontakt zu Freunden verloren, die in meinem Heimatort lebten. Und die hatten eine Tochter namens Kristine, die etwa in meinem Alter war. Kristine hatte ich selbst schon vor fast 20 Jahren aus den Augen und aus dem Sinn verloren. Ich erinnerte mich allerdings, einmal in irgendeinem dörfischen Käseblatt gelesen zu haben, dass sie einen in unserem Dorf kommunalpolitisch aktiven Mann geheiratet haben soll. Noch 20 Minuten blieben bis zur Schließung des Amtes. Ich entschied mich auf blauen Dunst, in ein Taxi zu springen und den Fahrer zu bitten, zum Amt zu rasen. Während der Fahrt versuchte ich unter gleichzeitiger Nutzung meiner beiden Mobiltelefone, alle abzutelefonieren, die mich zu Kristines Mann verbinden konnten, von dem ich in der Dorfzeitung gelesen hatte: meine Eltern, deren Freunde, mit denen meine Eltern vor zehn Jahren gebrochen hatten. Tatsächlich hatte ich bald Kristine am Telefon, die sich auf einer Fahrradtour durch Wald und Wiesen befand. Meine in Sekundenschnelle herunter gerasselte Problembeschreibung fand sie belustigend und in der Tat saß ihr Mann auf dem Rad neben ihr. Ich hatte richtig gelesen, er war tatsächlich in der Gemeindepolitik aktiv. Kirsten sagte, sie habe keine Ahnung, ob ihr Mann die benötigten Kontakte habe, aber sie würde da etwas versuchen. Hierfür blieben Kristine bis zum Vollzug maximal noch 15 Minuten, tick-tack-tick... . Schwitzend saß ich in meinem Anzug auf dem Beifahrersitz des Taxis. Draußen zogen Familien an mir vorbei, die das herrliche Sommerwetter auf dem Fahrrad, bei einem Spaziergang oder in einem Café genossen. Ich hingegen hielt noch immer in jeder Hand verkrampft ein Handy, wusste aber zum ersten Mal seit einer guten Stunde nicht, welcher Gesprächspartner mir im Moment noch weiterhelfen könnte. Fünf Minuten vor 12 Uhr rollte mein Taxi auf den Hof des gerade noch geöffneten Amtes. Als ich meine Hand nach der Tür des Amtes ausstreckte, klingelte mein Handy, im Display die Vorwahl meines Heimatortes: „Das Einwohnermeldeamt, schönen guten Tag! Ich hörte, Sie haben ein Problem, wie kann ich Ihnen weiterhelfen?“ Unfassbar, Kristine hatte es geschafft und mit ihrem Mann tatsächlich eine Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamtes dazu bewegen können, das Rathaus ausnahmsweise am Wochenende zu öffnen – und dies innerhalb weniger Minuten ab Eingang meines Notrufs. Dann ging alles sehr schnell und die freundlichen Damen vom Amt konnten mir meinen Ersatzpass ausstellen. Goldklumpen und Kamele hat’s dafür von mir nicht mehr gegeben, aber ein Dankeschön, wie es aufrichtiger nicht rüberzubringen war. Als kleinen Ausgleich für den ganzen Stress kam ich sogar noch in den Genuss eines sommerlichen Samstagnachmittags, bevor ich – erfrischend problemlos – mit dem Nachtflug an den Golf reiste und direkt aus dem Flugzeug ins Büro marschierte – und zwar pünktlich. Wieder einer dieser Reisetage, die mich um ein ganzes Lebensjahr altern lassen... .
Fischhappen Nr. 2: Krawatten-Kalle und der Totengräberschlips
Lebensabschnittsweise reiste ich derart häufig, dass ich im Monat gerade noch drei oder vier Tage zu Hause war und jeweils hälftig in Asien und Südamerika arbeitete. Um auf Reisen immer alles zu haben, was ich benötige, erfordert ein solcher Einsatzplan logistische Meisterleistungen. Man bedenke, nur die knappe Zeit daheim zum Wäschewaschen und das viele Zeug, das man für die zahlreichen geschäftlichen Anlässe in Übersee benötigt – insbesondere wenn eine Reise auch noch den Winter auf der Südhalbkugel und den Sommer auf der Nordhalbkugel einschließt. Gerade vor einiger Zeit wartete ich am Flughafen auf meinen Abflug nach Südamerika und schrieb derweil an einer der Geschichten für diese Sammlung, als plötzlich das Blitzen des polierten Anzugschuhs meines Sitznachbarn meine Aufmerksamkeit auf sich zog und ich schlagartig einen riesigen Schreck bekam, als ich merkte, dass ich bedauerlicherweise vergessen hatte, selbige meinem Reisegepäck hinzuzufügen. Verdammt, 15 Minuten vor dem Abflug am Flughafen passende Anzugschuhe der Größe 48 zu finden, ist etwa so unwahrscheinlich wie 15 Minuten vor dem Trauungstermin in der Fußgängerzone vor dem Standesamt noch die passende Frau kennen zu lernen. Habe immerhin Schuhe der Größe 46 gefunden. Es war eine schmerzhafte Reise, aber wenigstens sah ich dabei blendend aus. Während man mit solch gelegentlichen Lücken im Koffer dann und wann einmal rechnen muss, gibt es einige Reisen, bei denen das Vergessen von Teilen des Reisegepäcks ganz besonders peinlich ist. Eine solche führte mich ins nahe gelegene Köln. Ein wichtiger potenzieller Kunde hatte mich dorthin zu einem gemeinsamen Tag eingeladen, um Möglichkeiten einer vertieften Zusammenarbeit abzugleichen. Am zweiten Tag hatten wir dort außerdem einige Termine mit weiteren Geschäftspartnern, die wir gemeinsam wahrnehmen wollten. Natürlich hatte ich vor, den Kunden möglichst zu beeindrucken und eine gute Performance aufs Parkett zu legen. Am frühen Morgen machte ich mich auf den Weg zum heimischen Flughafen für den kurzen Hüpfer an den Rhein. In der Sicherheitskontrolle wollte ich nur noch schnell meine beiden Handys durchs Röntgengerät schieben und... meine Handys? Meine Handys, verdammt! Die lagen ja noch auf dem Nachtschrank neben meinem Bett! Oh nein, was für ein peinlicher Auftritt, ausgerechnet meine Telefone liegen zu lassen. Wenn ich es nicht einmal schaffe, diese zu einem Termin in Deutschland mitzubringen, was soll der Kunde dann von meiner Eignung halten, in weit entfernten Ländern Trainings in seinem Auftrag zu organisieren? Nun musste ich erstmal versuchen, meinen Kunden überhaupt zu treffen, ohne dass wir einen Treffpunkt noch telefonisch ausmachen konnten. Mit Müh und Not gelang dies und irgendwie schien er elegant über diesen Fauxpas hinwegzusehen. Der erste Tag diente zunächst noch dem ungezwungenen Kennenlernen, aber am zweiten Tag gab es ernsthafte Termine – dann selbstverständlich auch mit Dresscode und Krawatte. An jenem Morgen wachte ich auf und stellte mit Entsetzen fest, dass ich nicht nur meine Telefone, sondern auch sämtliche Krawatten zu Hause vergessen hatte. Was für ein Ärgernis und dabei war ausgerechnet ich es, der noch am Vortag mit dem Kunden über die Krawattenpflicht bei diesem Anlass sprach. Die fehlenden Handys hatte er mir verziehen, aber wann würde ich das Maß der Peinlichkeiten überschreiten? Da gab es keine Alternative, eine Krawatte musste her, sofort! Ich hatte noch eine Stunde bis zum Treffen am Frühstückstisch, T minus 60, sozusagen. Plan A versagte, im Hotel gab es keinen Laden, in dem man eine Krawatte hätte kaufen können. Plan B versagte ebenfalls: Auch in der belebten Straße draußen vor dem Hotel war weit und breit kein Herrenausstatter zu finden. Also blieb nur eins: Ich sprang in ein Taxi. Hinterm Steuer saß ein absolutes Kölner Original: Ein korpulenter Herr in den besten Jahren mit einer tief ins Gesicht gezogenen Wollmütze fragte mich: „Na, Jung, wo sollet hinjäähn?“ Ich gab schnell eine Kurzfassung meiner Notlage zum Besten und forderte ihn auf, zum nächsten Bekleidungsgeschäft zu rasen, sofort. Weder erhielt ich eine Antwort noch schien sich das Taxi zu bewegen. Nach einer Weile raunzte er: „Jung, wie soll isch datt maachen, wo sollnwer jätzt nä Krawaatte herbekomme? Et ies halb neun morgens, da hat doch geen Jeschäft auf!“ – „ALTER, sabbel nich, gib Gas!“, lautete meine knappe Ansage und da bewegten wir uns auch endlich... von einem geschlossenen Herrenausstatter zum nächsten. In meiner Verzweiflung, es war bereits T minus 20, bat ich den Wollmützenkalli, zum Hauptbahnhof zu fahren – vielleicht würde ich dort in einem Souvenirshop eine Krawatte bekommen. Mittlerweile wäre mir auch egal gewesen, ob sie neongelb, mit einem Bild des Kölner Doms geschmückt oder von einem großen FCK - Logo geziert gewesen wäre. Aber der Hauptbahnhof war von unserem aktuellen Ort zu weit weg, die Lage aussichtslos. „Waart ma Jung, äch will da ma watt probiere“, sagte der Fahrer plötzlich, fummelte sein Handy aus der Tasche und rief offenkundig seine Frau an. Als er sie fragte, ob sie wisse, wo „seine Krawatte sei“, brach – auch ohne Telefonlautsprecher deutlich hörbar – eine wilde Schimpforgie über den Armen herein. Die Tatsache, dass er vermutlich das erste Mal seit 40 Jahren nach „seiner Krawatte“ verlangte, verleitete seine Frau wohl zu der Vermutung, dass er sich auf einen Anlass schleichen wolle, den er ihr verschwiegen hätte. Es dauerte eine Weile, bis er sie mit seiner kölschen Gelassenheit beruhigen und über den wahren Hintergrund aufklären konnte. Es war T minus 10, als wir beim Taxifahrer zu Hause vorfuhren und er mal eben nach oben marschierte. Nach kurzer Zeit kam er zurück. Er drückte mir nur kurz eine Tüte in die Hand, sprang hinters Steuer und raste zurück zum Hotel. Ich holte die Krawatte aus der Tüte und - meine Güte - was war DAS? Was sich mir offenbarte, war eine schwarze Krawatte im schmalen Schnitt der 1950er Jahre. An ihrer breitesten Stelle war sie allenfalls zwei Finger breit und man sah ihr die Erfahrung unzähliger Beerdigungen und sonstiger Anlässe, die sie schon auf dem Buckel gehabt haben musste, unmittelbar an. Selbst nicht der Schlanksten einer, sah ich mit dem Teil aus wie ein Auftragskiller von Al Capone oder der Leibkellner der Blues Brothers. Na ja, was soll’s, ich sah zwar echt ätzend aus mit dem Ding, aber irgendwie hatte ich den Wettlauf gegen die Uhr knapp gewonnen und war einigermaßen zufrieden. Mein Kunde brach übrigens in spontanes Lachen aus, als er mich mit dem Teil sah und auch die weiteren Gesprächspartner im Laufe des Tages guckten mich während der Geschäftstermine ungläubig an. Aber vielleicht hatten sie auch einfach nur eine Rechnung mit Al Capone offen und bekamen es nun bei meinem Anblick mit der Angst zu tun...
Nach dem Genuss dieser beiden kleinen Vorspeisen lade ich Sie herzlich ein auf meine Reise. Willkommen an Bord, nehmen Sie Platz, machen Sie es sich bequem, schnallen Sie sich an. Während unseres Fluges wird man sich erstklassig um Sie kümmern, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Blick über die Wolken. Auch in kulinarischer Hinsicht werden Sie begeistert sein! Es gibt Fisch...
Nur noch ein letzter technischer Hinweis, bevor es losgeht: Am Ende einiger Geschichten befinden sich Hyperlinks zu Fotoalben und auch zu einigen kurzen Internetfilmen, die mit den jeweiligen Geschehnissen im Zusammenhang stehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Fotoalben und Filme zu öffnen: Entweder Sie installieren auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC einen kostenlosen QR Code Scanner. Mit diesem können Sie die quadratischen Codes scannen und haben so in Sekundenschnelle Fotos und Filme vor sich. Alternativ können Sie, statt einen QR Code Scanner zu nutzen, einfach die angegebenen Internetadressen in Ihren Browser eingeben. Gerade denjenigen, die lieber lesen als Bilder anzugucken, empfehle ich, wenigstens nach der Lektüre der Geschichte „Reisen skurril: die kleinen Besonderheiten“ einen Blick in die zugehörigen Fotoalben zu werfen. Sie würden etwas verpassen, wenn Sie dies ausließen.
Probieren Sie es aus! Hier finden Sie Fotos zum ersten Fischhappen „Ohne Pass kein Spaß“:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.107293879427378.13045.100004402989835&type=3&l=61454734fd
Früh übt sich: den Zivildienst zum Flugticket gemacht
Als sich das Ende der Schulzeit näherte, war mir noch nicht ganz klar, wie ich meine Begeisterung für Reisen und Fliegerei langfristig in einem erfüllten Berufsleben umsetzen könnte. Ich setzte zunächst auf ein Studium in der Hoffnung, dass mich währenddessen der Blitz der Erleuchtung treffen möge. Zunächst stand aber die Wehrpflicht an. Ich hatte mal gehört, dass man am Flughafen seinen Zivildienst verrichten könne, was für mich natürlich mehr als verlockend war. Meine Bewerbung war erfolgreich und so lagen nun 13 Monate täglicher Kerosinduft auf dem Flughafen vor mir. 90 Prozent meiner dortigen Tätigkeit machte die Beförderung gehbehinderter Fluggäste vom Check-In bis ins Flugzeug und umgekehrt aus, so dass stets ein hautnaher Umgang mit Flugzeugen gewährleistet war. Natürlich wäre diese Geschichte ohne einen richtigen Bad Guy zu einfach und zu schön gewesen. Diesen fanden wir in Form unserer Vorgesetzten, der altgedienten Schwester Marie. Sie kombinierte die äußere Erscheinung von Miss Marple mit den Charakterzügen eines Diktators und dem Charme von Dr. Evil. Für eine passende Ausbildung ihrer Schutzbefohlenen sorgte sie hingegen nicht. Die eigentliche Hauptaufgabe von uns Zivis war nämlich nicht das Schieben und Tragen von Fluggästen. In Ermangelung eines diensthabenden Arztes waren wir insbesondere auch als Ersthelfer vor Ort verantwortlich für die Erstversorgung bis zum Erscheinen des Notarztes. So mancher Zivi hatte im Laufe seiner kurzen Amtszeit mindestens einen Todesfall zu beklagen, wo seine Erste-Hilfe-Maßnahmen ohne Erfolg blieben. Dieser Kelch ging zum Glück an mir vorbei, denn statt der erforderlichen Ersthelferausbildung schickte man mich auf ein zweiwöchiges Altenpflegeseminar. So desinfizierte ich dutzenden Verletzten die offenen Wunden mit Sagrotan Spray und wunderte mich jedes Mal, warum sie nach meiner Behandlung noch größere Schmerzen hatten als vorher. Irgendwann informierte mich dann ein Patient, dass man dieses Zeug eher zum Desinfizieren von Toiletten verwendet, nicht aber für Wunden. Statt mir eine vernünftige Ausbildung angedeihen zu lassen, kleidete man mich wenigstens so, dass ich aussah wie ein Notarzt. Einige Zivis hatten dieses Outfit erhalten, das „gute Outfit“ genannt, während andere sich mit einer merkwürdig geschnittenen Jacke in Leuchtorange begnügen mussten, das „miese Outfit“ genannt. Gemeinsam mit meinem Zivi-Kollegen Henry, welcher vermutlich als „mieser Zivi“ eingestuft wurde und daher nur das miese Outfit erhielt, ging ich einmal eine Flugzeugtreppe hinauf und als letzte Gäste des soeben gelandeten Fluges kamen uns noch ein Vater und sein kleiner Sohn entgegen: „Du Papa, was wollen denn der Arzt und der Müllmann im Flugzeug?“, fragte der Kleine und brachte die Uniform-Problematik damit zu meiner großen Erheiterung auf einen Nenner. Das Hauptbestreben von uns Zivildienstleistenden war - neben der Verrichtung unserer Trage-und-Schiebe-Arbeit - das Erreichen eines ausgeglichenen Karmas und möglichst viel Erholung von all dem Stress, wobei wir auch den besonderen Touch Luftfahrt bei alledem genießen wollten. Entsprechend ergaben sich während der Dienstzeit zwei Haupterholungzentren, in denen wir uns vor allzu viel Arbeit und vor allem dem stets gefürchteten Zugriff von Miss Marple, alias Dr. Evil, entziehen konnten: Der erste Ort war die alte und schon lange verschlossene Erste-Hilfe-Wache in den Kellergewölben eines alten, längst stillgelegten Gebäudes. Ältere Zivi-Generationen hatten mutig die Verantwortung für unser Wohlbefinden übernommen und die „verlorenen“ Zugangsschlüssel für das Gebäude und die Wache an uns vererbt. In der alten Wache ergab sich die Erholung zwangsläufig, denn hier funktionierten unsere Funkgeräte nicht und Dr. Evil konnte nach uns krähen, wie sie wollte, wir hörten sie einfach nicht – verdammte Technik. Im Sommer bot sich hingegen die „Vorfeld Beachclub“ -Variante an. Hierbei stellt man den Kleinbus quasi direkt zwischen den rollenden Flugzeugen auf dem Vorfeld ab, unmittelbar neben der Landebahn. Beim Einparken ist zu beachten, dass das Heck in Richtung Sonnenuntergang auszurichten ist. Dieses wird dann hydraulisch herabgelassen und die Rampe auf das Vorfeld ausgefahren. Auf dieser Rampe verteilt man noch einige Wolldecken, um sich anschließend bequem darauf zu betten. Die Gesichter der Piloten aus den in zehn, 15 Metern vorbeirollenden Flugzeugen werde ich wohl nie vergessen. Wenn uns nicht nach Erholung zumute war, so bot das Vorfeld stets auch touristische Highlights, wie etwa die Kanzlermaschine Boeing 707 „Konrad Adenauer“, welche einmal vor Ort zu Gast war. Noch am Anfang meiner Zivi-Laufbahn, konnte ich es kaum erwarten, mir diesen Flieger von innen anzuschauen. Ich parkte unseren Bulli an der Gangway und hastete heraus. Mein erfahrener Zivi-Kollege rief mir noch laut hinterher: „Aber sag‘ denen um Gottes willen nicht, dass du…“ und schon war ich weg. Oben an der Flugzeugtür sagte ich dem wachhabenden Soldaten: „Hallo, ich bin hier Zivi und würde mir total gern mal euer Flugzeug anschauen, darf ich?“ „Hm, ein Wehrdienstverweigerer also, ja?“, entgegnete mir der Mann und plötzlich verstand ich, welchen Rat mir mein Kollege noch mit auf den Weg geben wollte. „Na ja, na gut, du darfst trotzdem mal reingucken“, frotzelte der Herr nach erstaunlich langem Nachdenken und ließ mich doch noch eintreten. Es ist aber nicht so, dass wir nicht auch mal gearbeitet hätten. Richtig ins Zeug haben wir uns für unsere Kunden so manches Mal gelegt, etwas zu sehr zuweilen. Einmal sollte ich eine alte Dame von einem landenden Flugzeug abholen und zu ihrem Anschlussflug bringen. Bei diesem handelte es sich um die Island-Maschine, die nur einmal täglich flog. Als ich die Umsteigezeit der Dame sah, traute ich meinen Augen nicht. Vom Aufsetzen ihres ankommenden Fluges bis zum Abheben ihres Anschlussfluges nach Island hatte sie gerade einmal 20 Minuten Zeit, in der sie von der Pass- bis zur Sicherheitskontrolle alles durchlaufen musste. Dieses Timing war selbst für einen Athleten kaum zu schaffen. Aber versuchen wollte ich es wenigstens. Natürlich waren die Parkpositionen beider Flugzeuge maximal weit auseinander an exakt den entgegen gesetzten Fluggastbrücken. Ich holte die Dame ab, drückte sie in den Rollstuhl und rannte so mit ihr über den Flughafen, als gäb’s keinen Morgen mehr. Alle halfen mit und unsere Chancen standen vielleicht gar nicht so schlecht. Schließlich kamen wir am Gate ihres Anschlussfluges an und alle warteten nur noch auf uns. Ich rannte die Fluggastbrücke zum Flieger herunter und an der offenen Flugzeugtür warteten schon die Flugbegleiter auf uns. Zeit zu bremsen. Leider verschärfte sich aber genau im Moment dieser Erkenntnis der Abwärts-Winkel der Fluggastbrücke und trotz einer starken Bremsung verlor die Dame vor mir im Rollstuhl kaum an Geschwindigkeit. Die dann folgende Vollbremsung entglitt jedoch leider meiner Kontrolle. Der Stuhl bremste nun, doch ich verlor bei dem Manöver die Bodenhaftung und… hob ab. In einem sauberen Bogen flog ich über den Rollstuhl, welcher zeitgleich die alte Dame wie ein Schildkrötenpanzer unter sich begrub. Nach unsanfter Landung bremste ich mit dem Kinn und kam schließlich zehn Zentimeter vor der Flugzeugtür zum Stillstand. Mit einem Video von diesem Stunt hätten die Dame und ich Luftfahrtgeschichte geschrieben, aber leider war die Videoüberwachung damals noch nicht soweit. Stille erfüllte den Raum, bis einer der Flughafenmitarbeiter anfing, böseste Schimpftiraden über mich zu ergießen, dass er mich verklagen wolle und anzeigen und überhaupt und sowieso. Der älteren Dame ging es zum Glück gut und genauso wie die Flugbegleiter war sie trotz des kleinen Malheurs überglücklich, dass sie doch noch am selben Tag nach Island weiter reisen konnte.
Henry als Drogenkurier – die Urkatastrophe
Die erste Reisekatastrophe, mit der ich in Berührung kam, traf noch nicht mich, sondern meinen Freund Henry – den ehemaligen Zivi-Kollegen in Müllmann-Uniform. Wenn ich geahnt hätte, dass sich dieses Blatt bald und dauerhaft wenden sollte, wäre ich mit unterschwelliger Häme damals vielleicht lieber etwas sparsamer gewesen.
Das Wetter auf der Karibikinsel Curacao ist herrlich und fördert fast 365 Tage im Jahr das allgemeine Wohlbefinden. Die Menschen sind gelassen, freundlich und sehr liebenswert. Hinzu kommt eine tolle Fauna mit Iguanas und Papageien ebenso wie den buntesten Lebewesen unter Wasser. Man muss kein Taucher sein, sondern kann beim einfachen Schnorcheln an fast jeder Stelle im Meer Barrakudas, Moränen, Seeigel und dicke Papageienfische bestaunen, die nicht nur phantastisch aussehen, sondern frisch gegrillt mit etwas Knoblauch, Salz und Pfeffer auch ganz hervorragend schmecken. Für mich war Curacao ein toller Anlaufpunkt, um einen Urlaub an einem exotischen Ort zu verbringen. Da dort gute Freunde von mir leben, konnte ich mit einem Urlaub das Angenehme mit dem Angenehmen verbinden. So fragte ich einmal auch meinen Freund Henry, ob er mich nicht für einen gemeinsamen Urlaub dorthin begleiten wolle. Henry war ein richtiger Globetrotter und reiste genau wie ich sehr gerne. Die Möglichkeit, mit mir gemeinsam ein paar Tage in der Sonne zu verbringen, hat bei Henry sofort spontane Begeisterung hervorgerufen. Während ich etwas länger auf der Insel blieb, wollte er nur für eine Woche bleiben. Sein Jurastudium neigte sich dem Ende entgegen und die Prüfungsvorbereitung ließ ihm leider nicht mehr Zeit für einen längeren Urlaub. Zusammen verlebten wir eine ausgelassene Woche und genossen die Insel, die Strände und den Pool in vollen Zügen. Wir experimentierten viel mit Cuba Libre und entwickelten am Pool ausgefeilte Sprung- und Arschbombentechniken. Besonders den letzten Tag verbrachten wir fast vollständig im Schwimmbecken – bei karibischen Temperaturen natürlich kein Problem. Eines Abends war es leider auch schon wieder soweit. Eine Woche Urlaub vergeht ja sowieso viel zu schnell und gerade nach dem letzten Tag im Pool war der Abschied für Henry besonders hart. Andererseits hatte sich der Streber ja dafür entschieden, in seinem kleinen Kämmerchen Jura zu pauken, statt mit mir noch eine schöne Woche am Kokosstrand zu verbringen. Also brachte ich Henry zu seinem Rückflug. Am späten Abend sollte der Nachtflug nach Europa starten. Ich setzte Henry ab, verabschiedete mich und fuhr zurück. Eine gute Stunde später klingelte plötzlich mein Telefon und mit schriller Stimme bat Henry, vor Aufregung noch ganz schnappatmig, darum, dass ich ihn wieder vom Flughafen abholen möge: „Die sind nicht ganz dicht! Nach der Sicherheitskontrolle haben mich Vertreter der Fluggesellschaft in einen Raum für Sonderuntersuchungen gezogen, mir kurz in die Augen geguckt und auf die Zunge. Dann haben sie behauptet, meine Augen seien rot, daher habe ich vermutlich Drogen genommen und sei deshalb vermutlich ein Drogenschmuggler! Die haben mich einfach aus dem Flughafen geworfen ohne Telefongeld und mein Gepäck, die wollten mich nicht mal bei dir anrufen lassen!“ Die holländische Fluggesellschaft wollte ihn nicht mitnehmen, weil sie ihn als Drogenkurier verdächtigte? Henry? Das personifizierte Gute und angehender Jurist mit Jobwunsch Richter als vermeintlicher Drogenkurier? Und wenn jemand als Drogenkurier verdächtigt wird, schickt man ihn neuerdings einfach nach Hause, anstatt die Polizei zu alarmieren? Was ist das denn für ein Blödsinn? Das klang verdammt „lustig“, wenn auch die Folgen dieser falschen Verdächtigung wohl nicht ganz so lustig waren, zumindest aus Henrys Perspektive. Ich entsprach also seinem Wunsch und holte ihn wieder vom Flughafen ab.
Ein trauriges Bild gab er ab, allein mit seinem Köfferchen und fassungsloser Mine um Mitternacht am karibischen Flughafen. Was Henry dann berichtete, sollte später zu seinem ersten beruflichen Erfolg werden. Er erzählte, wie das mit der „Sonderuntersuchung“ seiner Person genau gelaufen war. Jemand, der ganz offensichtlich Mitarbeiter eines kommerziellen Sicherheitsdienstes und keinesfalls Vertreter einer staatlichen Autorität war, „untersuchte“ Henry dort binnen weniger Sekunden. Der Vorwurf, dass Henrys vom Pool-Wasser gerötete Augen darauf hindeuteten, dass er in seinem Magen kleine Kügelchen mit Kokain schmuggeln wollte, war natürlich völlig absurd. Wäre solch ein Vorwurf nur ansatzweise fundiert beziehungsweise qualifiziert und käme er von einer adäquaten staatlichen Autorität, anstatt vom Sicherheitsdienst der Fluggesellschaft, dann wäre die natürliche Folge wohl eine Festsetzung des Verdächtigen und mindestens ein Drogentest gewesen. Da dies aber nicht der Fall war, verweigerte man Henry lediglich das Boarding seines Fluges und warf ihn aus dem Terminal. Das Problem war, dass der betroffene Flug überbucht war und die Fluggesellschaft ein unmittelbares finanzielles Interesse daran hatte, die Anzahl ihrer Fluggäste an diesem Abend auf die Anzahl der im Flugzeug vorhandenen Sitzplätze zu reduzieren. Auch seinem legitimen Wunsch, wenigstens noch einmal telefonieren zu dürfen, damit ich ihn abholen könnte, entsprach die Fluggesellschaft nicht. Stattdessen sagte man ihm, dass er „frühestens in drei Tagen wieder versuchen dürfe, mit seiner Fluggesellschaft nach Europa zu fliegen“, davor würde man ihn nicht mitnehmen. Um die Sache rund zu machen, verweigerte man Henry zu guter Letzt noch die Herausgabe seines Gepäcks. Dies sei irgendwo im System und er könne es sich am nächsten Tag vom Flughafen abholen. Beeindruckt von dieser Art „Kundenservice“ und noch immer völlig ungläubig, dass er nicht auf dem Weg nach Europa, sondern wieder auf der Terrasse in seinem Urlaubsort war, blickte Henry zunehmend sorgenvoll drein. Seine Zurückweisung vom gebuchten Flug aus nicht nachvollziehbaren Gründen kollidierte vollständig mit Henrys Rechtsverständnis und gab ihm das Gefühl, einer Willkür seiner Fluggesellschaft ausgesetzt zu sein. Während ich meine Freude daran hatte, Henry mit dem völlig irrsinnigen Vorwurf des Drogenkontakts aufzuziehen, befasste der sich den Rest des Abends mit Gedanken, wann er endlich zurück zum Lernen in Deutschland ankommen würde. Zugegeben, Curacao war zumindest damals einer der größten Umschlagpunkte für Kokain zwischen Südamerika und Europa. Und, ja, als Alleinreisender Anfang zwanzig fällt man vermutlich in ein gewisses Raster. Es war zu dieser Zeit ein offenes Geheimnis, dass einheimische Jugendliche aus Curacao sich den Magen mit Drogenkügelchen, so genannten Bolitas, vollschlugen und damit nach Holland flogen. Dort konnten sie sich dann der Drogenkügelchen entweder auf normalem Verdauungswege entledigen oder sie verstarben vorher an Bord beziehungsweise in Holland, weil ein Kügelchen sich im Magen öffnete. Das war zweifellos eine schlimme Sache. Aber darf ein privatwirtschaftliches Unternehmen auf die Nutzung vorhandener Möglichkeiten wie Drogentests oder Softscanner zur Erkennung von Bolita-Kügelchen im Magen verzichten und trotzdem solch schwere Verdächtigungen aussprechen und nicht begründen? Darf es aufgrund eines offensichtlich nicht hinreichenden Verdachts dann sogar die Mitnahme verweigern? All dies erscheint sehr zweifelhaft, insbesondere wenn dieses Unternehmen von der verweigerten Mitnahme rein zufällig auch noch einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil hat – immerhin musste man wegen des ursprünglich überbuchten Fluges keinem Fluggast Schadenersatz und Ausgleichsleistungen leisten, erschien dennoch völlig inakzeptabel.