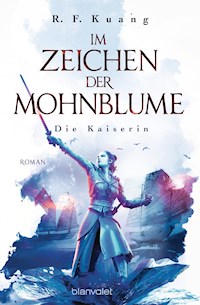
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Legende der Schamanin
- Sprache: Deutsch
Die TikTok-Sensation aus den USA! Der 2. Band der epischen Fantasy-Saga in einer Welt voller Kampfkunst, Götter und uralter Magie.
Rin ist auf der Flucht. Noch immer verfolgen sie die Gräueltaten, die sie begangen hat, um ihr Volk zu retten. Sie ist dem Opium verfallen und folgt auf Gedeih und Verderb den tödlichen Befehlen von Phoenix, dem erbarmungslosen Gott, der Rin ihre beängstigende Kraft verliehen hat. Rins einziger Grund weiterzuleben, ist der Wunsch nach Rache an der verräterischen Kaiserin, die ihre Heimat Nikan an ihre Feinde ausgeliefert hat. Rin hat keine andere Wahl, als sich mit dem mächtigen Drachenkriegsherrn zu verbünden. Dieser plant Nikan zu erobern, die Kaiserin zu stürzen und eine neue Republik zu gründen. Rin schließt sich seinem Krieg an. Denn schließlich ist kämpfen das, was sie am besten kann …
RF Kuang wurde 2020 der Astounding Award for Best New Writer verliehen, der renommiertesten Auszeichnung, die ein Fantasy-Debütautor erlangen kann. Sie wurde auf dem WorldCon als Teil der Hugo-Awards-Zeremonie verliehen.
»Im Zeichen der Mohnblume« bei Blanvalet:
1. Die Schamanin
2. Die Kaiserin
3. Die Erlöserin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1024
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Noch immer wird die Kriegerschamanin Rin von den Gräueltaten verfolgt, die sie begangen hat, um ihr Volk zu retten. Rins einziger Grund weiterzuleben ist der Wunsch nach Rache an der verräterischen Kaiserin, die ihre Heimat Nikan an ihre Feinde ausgeliefert hat. Rin hat keine andere Wahl, als sich mit dem mächtigen Drachenkriegsherrn zu verbünden. Dieser plant, Nikan zu erobern, die Kaiserin zu stürzen und eine neue Republik zu gründen. Rin schließt sich seinem Krieg an. Denn schließlich ist kämpfen das, was sie am besten kann …
Autorin
Rebecca F. Kuang wanderte im Jahr 2000 aus Guangzhou, China, in die USA aus. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in International History von Georgetown, wo sie sich auf chinesische Militärstrategien, kollektive Traumata und Kriegsdenkmäler konzentrierte. Im Jahr 2018 erhielt sie ein Stipendium und studiert seitdem an der University of Cambridge Sinologie. Rebecca F. Kuang liebt Corgis, trinkt gern guten Wein und guckt immer wieder die Fernsehserie »Das Büro«.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet undwww.twitter.com/BlanvaletVerlag
R. F. Kuang
IM
ZEICHEN
DER
MOHNBLUME
Die Kaiserin
ROMAN
Deutsch von Michaela Link
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Dragon Republic (2)« bei Harper Voyager, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2019 by Rebecca F. Kuang Published by Arrangement with Rebecca F. Kuang This work was negotiated through Literary Agency Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Sigrun Zühlke Umschlaggestaltung und – illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft HK · Herstellung: sam Satz und E-Book: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-24388-3V001 www.blanvalet.de
Für:
匡为华 (Kuāng Wéihuá)
匡萌芽 (Kuāng Méngyá)
冯海潮 (Féng Hǎicháo)
钟辉英 (Zhōng Huīyīng)
杜 华 (Dù Huá)
冯宝兰 (Féng Bǎolán)
Arlong, acht Jahre zuvor
»Komm schon«, bettelte Mingzha. »Bitte, ich will es sehen.«
Nezha fasste seinen Bruder am pummeligen Handgelenk und zog ihn aus dem flachen Wasser zurück. »Wir dürfen nur bis zu den Seerosen gehen.«
»Aber willst du es denn nicht wissen?«, jammerte Mingzha.
Nezha zögerte. Auch er wollte sehen, was sich in den Höhlen hinter der Biegung befand. Die Grotten des Flusses der neun Windungen waren für die Yin-Kinder seit ihrer Geburt ein Rätsel. Von klein auf hatte man sie vor dem dunklen Bösen gewarnt, das dort im Verborgenen schlief; vor Ungeheuern, die darin lauerten und nur darauf warteten, dass ihnen dumme Kinder ins Maul tappten.
Das allein wäre Anreiz genug für die abenteuerlustigen Yin-Kinder gewesen, aber sie hatten auch Gerüchte von großen Schätzen gehört, von Haufen von Perlen, Jade und Gold, die unter Wasser lagen. Nezhas Klassiklehrer hatte ihm einmal erzählt, dass jedes Schmuckstück, das ins Wasser fiel, unweigerlich in den Flussgrotten landete. Und manchmal, wenn Nezha an einem klaren Tag aus dem Fenster seines Zimmers sah, vermeinte er in den Eingängen der Höhlen glänzendes Metall im Sonnenlicht glitzern zu sehen.
Seit Jahren sehnte er sich danach, die Höhlen zu erkunden, und heute würde er es endlich tun, wenn alle zu beschäftigt waren, um auf die Kinder zu achten. Aber es war seine Aufgabe, Mingzha zu beschützen. Sein Bruder war ihm noch nie anvertraut worden, bis heute war er immer zu jung dafür gewesen. Aber in dieser Woche war Vater in der Hauptstadt, Jinzha an der Akademie, Muzha im fernen Hesperia in den Grauen Türmen, und der Rest des Palastes war wegen Mutters plötzlicher Krankheit derart in Aufruhr, dass die Dienstboten Nezha seinen kleinen Bruder hastig in die Arme gedrückt und beiden gesagt hatten, sie sollten keine Dummheiten machen. Nezha wollte beweisen, dass er der Aufgabe gewachsen war.
»Mingzha!«
Sein Bruder war ins seichte Wasser zurückgewandert. Nezha fluchte und eilte ihm nach. Wie konnte ein Sechsjähriger so schnell sein?
»Jetzt komm schon«, flehte Mingzha, als Nezha ihn um die Taille packte.
»Wir dürfen nicht«, sagte Nezha. »Wir kriegen Ärger.«
»Mutter liegt schon die ganze Woche im Bett. Sie wird es nicht erfahren.« Mingzha drehte sich in Nezhas Griff um und warf ihm ein lausbübisches Lächeln zu. »Ich werde es nicht verraten und die Dienstboten auch nicht. Verrätst du es?«
»Du bist ein kleiner Dämon«, sagte Nezha.
»Ich will nur den Eingang sehen.« Mingzha strahlte ihn hoffnungsvoll an. »Wir müssen gar nicht reingehen. Bitte!«
Nezha gab nach. »Aber wir gehen nur um die Biegung und sehen uns die Höhleneingänge von Weitem an. Und dann kehren wir um, hast du verstanden?«
Mingzha stieß einen Freudenschrei aus und lief platschend ins Wasser. Nezha folgte ihm und bückte sich, um seinen Bruder an die Hand zu nehmen.
Niemand hatte Mingzha je etwas abschlagen können. Er war ein vergnügt kichernder Wonnekloß, der absolute Schatz des Palastes. Vater himmelte ihn an. Jinzha und Muzha spielten mit ihm, wann immer er es wollte, und sie sagten ihm nie, er solle sich verziehen, wie Nezha es so oft zu hören bekam.
Mutter liebte ihn von allen am meisten – vielleicht, weil es ihren anderen Söhnen bestimmt war, Soldaten zu werden, aber Mingzha durfte sie ganz für sich behalten. Sie kleidete ihn in fein bestickte Seide und schmückte ihn mit so vielen Glücksamuletten aus Gold und Jade, dass er beim Gehen klimperte, belastet von der Bürde des Glücks. Die Palastdiener scherzten, dass sie Mingzha immer hören konnten, bevor sie ihn sahen. Nezha wollte Mingzha jetzt aufhalten, damit er seinen Schmuck ablegte, aus Angst, dass er ihn unter Wasser ziehen könne, das ihm bereits bis zur Brust reichte, aber Mingzha stürmte voran, als sei er schwerelos.
»Wir bleiben hier stehen«, entschied Nezha.
Sie waren näher an die Grotten herangegangen als je zuvor in ihrem Leben. Die Höhlenschlünde waren so dunkel, dass Nezha keine zwei Schritte weit hineinspähen konnte, aber die Wände sahen schön glatt aus und schimmerten wie Fischschuppen in einer Million verschiedener Farben.
»Sieh mal.« Mingzha zeigte auf etwas im Wasser. »Das ist Vaters Umhang.«
Nezha runzelte die Stirn. »Was macht Vaters Umhang am Grund des Flusses?«
Doch das schwere Kleidungsstück, das halb vergraben im Sand lag, gehörte unleugbar Yin Vaisra. Nezha konnte das mit Silberfäden gestickte Drachenwappen auf dem Himmelblau sehen, das nur Mitglieder des Hauses Yin tragen durften.
Mingzha zeigte auf die Grotte, die ihnen am nächsten war. »Er ist da rausgekommen.«
Ein unerklärliches kaltes Grauen kroch Nezha durch die Adern. »Mingzha, geh da weg.«
»Wieso?« Mingzha watete dickköpfig und furchtlos näher an die Höhle heran.
Das Wasser kräuselte sich.
Nezha streckte die Hand aus, um seinen Bruder zurückzuziehen. »Mingzha, warte …«
Etwas Riesiges schoss aus dem Wasser.
Nezha sah eine gewaltige dunkle Gestalt – muskulös und zusammengerollt wie eine Schlange –, bevor sich eine hohe Welle über ihm auftürmte und ihn mit dem Gesicht nach unten ins Wasser schleuderte.
Der Fluss hätte nicht tief sein sollen. Das Wasser war Nezha nur bis zur Taille und Mingzha bis zu den Schultern gegangen und immer flacher geworden, je näher sie der Grotte kamen. Aber als Nezha unter Wasser die Augen öffnete, schien die Oberfläche meilenweit entfernt zu sein, und der Grund der Grotte wirkte so ausgedehnt wie der Palast von Arlong.
Am Boden der Grotte schimmerte ein hellgrünes Licht. Er sah Gesichter, wunderschön, aber augenlos. Menschliche Gesichter, eingegraben in den Sand und die Korallen, und ein endloses Mosaik, das mit Silbermünzen, Porzellanvasen und Goldbarren übersät war – ein Bett aus Schätzen, das sich bis tief in die Grotte hinein erstreckte, so weit das Licht reichte.
Er erhaschte eine winzige Bewegung, dunkel vor dem Licht, die so schnell verschwand, wie sie gekommen war.
Mit dem Wasser hier stimmte etwas nicht. Irgendetwas hatte seine Dimensionen ausgedehnt und verändert. Was flach und hell sein sollte, war auf einmal tief; tief, dunkel und schrecklich still.
Durch das Schweigen hindurch hörte Nezha schwach die Schreie seines Bruders.
Er schwamm hektisch nach oben. Es schien ewig zu dauern.
Als er endlich aus dem Wasser auftauchte, waren die Untiefen wieder Untiefen.
Nezha wischte sich keuchend das Flusswasser aus den Augen. »Mingzha?«
Sein Bruder war verschwunden. Dunkelrote Streifen färbten den Fluss. Einige der Streifen bestanden aus festen klumpigen Brocken. Nezha wusste, was das war.
»Mingzha?«
Das Wasser war ruhig. Nezha stolperte auf die Knie und würgte. Erbrochenes mischte sich mit dem blutigen Wasser.
Er hörte, wie etwas gegen die Felsen klirrte.
Er schaute hin und sah ein goldenes Fußkettchen.
Dann sah er eine dunkle Gestalt, die sich vor den Grotten erhob, und hörte eine Stimme, die aus dem Nichts kam und seine Knochen erzittern ließ.
»Hallo, Kleiner.«
Nezha schrie.
TEIL 1
Kapitel 1
In der Morgendämmerung lief die Sturmvogel durch Nebelschwaden in den Hafen von Adlaga ein. Die Hafenwache war bei einem Angriff der Föderationssoldaten während des Dritten Mohnkrieges zerschlagen worden und hatte sich noch immer nicht davon erholt. Es gab sie praktisch nicht mehr – vor allem nicht für ein Vorratsschiff, das unter der Flagge der Miliz segelte. Ungehindert glitt die Sturmvogel an Adlagas Hafenbeamten vorbei und legte so dicht an der Stadtmauer an, wie es ging.
Rin stützte sich am Bug auf und versuchte, das Zittern ihrer Glieder zu verbergen und den pulsierenden Schmerz in ihren Schläfen zu ignorieren. Sie verspürte ein schreckliches Verlangen nach Opium, doch sie durfte keins nehmen. Heute brauchte sie einen klaren Verstand. Daher musste sie nüchtern sein.
Die Sturmvogel stieß gegen den Kai. Die Cike versammelten sich auf dem Oberdeck und beobachteten mit gespannter Erwartung den grauen Himmel, während die Minuten verrannen.
Ramsa trommelte mit dem Fuß auf das Deck. »Er ist jetzt schon eine Stunde weg.«
»Geduld«, mahnte Chaghan.
»Vielleicht ist Unegen ja weggelaufen«, bemerkte Baji.
»Er ist nicht weggelaufen«, widersprach Rin. »Er hat gesagt, dass er bis Mittag braucht.«
»Er wäre jedenfalls der Erste, der die Gelegenheit nutzen würde, um uns loszuwerden«, stellte Baji fest.
Damit hatte er nicht ganz unrecht. Unegen, ohnehin der Nervöseste der Cike, beschwerte sich schon seit Tagen über ihre bevorstehende Aufgabe. Rin hatte ihn über Land vorausgeschickt, um ihr Opfer in Adlaga auszuspähen, aber Unegen war noch nicht wieder zurück, und allmählich wurde es knapp.
»Das würde er nicht wagen«, sagte Rin und zuckte zusammen, als ihr die Anstrengung des Sprechens kleine Stiche durch die Schädelbasis jagte. »Er weiß, dass ich hinter ihm her sein und ihm bei lebendigem Leibe das Fell über die Ohren ziehen würde.«
»Hm«, murmelte Ramsa. »Fuchsfell. Ich könnte einen neuen Schal gebrauchen.«
Rin richtete den Blick wieder auf die Stadt. Adlaga war ein merkwürdiges Nebeneinander toter Häuser, halb lebendig und halb zerstört. Eine Seite war unversehrt aus dem Krieg hervorgegangen, die andere so heftig bombardiert worden, dass Rin nur noch Fundamente aus dem verkohlten Gras ragen sah. Die Trennlinie war so sauber, dass manche Häuser wie durchgeschnitten wirkten: eine Hälfte rußgeschwärzt und ohne Wände, die andere schwankend und stöhnend im Meereswind, ohne einzustürzen.
Rin konnte sich kaum vorstellen, dass überhaupt noch jemand in der Stadt lebte. Wenn die Föderation hier so gründlich gewesen war wie in Golyn Niis, dann sollten nur noch Leichen übrig sein.
Endlich stieg ein Rabe aus den schwarzen Ruinen auf. Er kreiste zweimal um das Schiff, dann stieß er auf die Sturmvogel hinab, als hätte er eine Beute ins Auge gefasst. Qara hob einen behandschuhten Arm. Der Rabe brach seinen Sturzflug ab und schloss die Krallen um ihr Handgelenk.
Qara strich dem Vogel mit dem Fingerrücken über den Kopf und das Gefieder. Der Rabe plusterte sich auf, während sie sich seinen Schnabel ans Ohr hielt. Mehrere Sekunden verstrichen. Qara stand reglos mit geschlossenen Augen da und lauschte aufmerksam auf etwas, das der Rest von ihnen nicht hören konnte.
»Unegen hat Yuanfu ausfindig gemacht«, berichtete Qara. »Rathaus, in zwei Stunden.«
»Tja, aus dem Schal wird wohl nichts«, bemerkte Baji zu Ramsa.
Chaghan zerrte einen Sack an Deck und leerte seinen Inhalt auf die Planken. »Zieht euch um.«
Ramsa hatte die Idee gehabt, dass sie sich mit gestohlenen Milizuniformen verkleiden sollten. Uniformen waren das Einzige, was Moag ihnen nicht hatte verkaufen können, aber sie waren nicht schwer zu finden gewesen. In jeder verlassenen Küstenstadt lagen verfaulende Leichen am Straßenrand, und es waren nur zwei Ausflüge nötig gewesen, um ausreichend nicht verbrannte oder blutgetränkte Kleidungsstücke zu erbeuten.
Rin musste die Ärmel und die Beine ihrer Uniform aufkrempeln. Es gab kaum Leichen in ihrer Größe. Als sie sich die Stiefel zuschnürte, unterdrückte sie den Drang, sich zu übergeben. Sie hatte das Hemd von einem Leichnam gezogen, der in einem halb verbrannten Scheiterhaufen steckte, und selbst nach drei Wäschen drang der Gestank von verkohltem Fleisch noch durch den Geruch des salzigen Meerwassers.
Ramsa, absurd gewandet in eine Uniform, die dreimal so groß war wie er, salutierte vor ihr. »Wie sehe ich aus?«
Sie bückte sich, um die Schnürsenkel ihrer Stiefel zu verknoten. »Warum hast du das an?«
»Rin, bitte …«
»Du kommst nicht mit.«
»Aber ich will …«
»Du kommst nicht mit«, wiederholte sie. Ramsa war ein Genie, was Munition anging, aber er war auch klein, mager und im Kampf nicht zu gebrauchen. Sie würde nicht ihren einzigen Schießpulver-Tüftler riskieren, nur weil der nicht mit einem Schwert umgehen konnte. »Zwing mich nicht, dich an den Mast zu binden.«
»Och, bitte«, quengelte Ramsa. »Wir sind jetzt schon seit Wochen auf dem Schiff, und ich bin dermaßen seekrank, dass mir schon vom Rumlaufen schlecht wird …«
»Pech.« Rin zog einen Gürtel durch die Schlaufen um ihre Taille.
Ramsa zog eine Handvoll Raketen aus der Tasche. »Schießt du dann wenigstens die hier ab?«
Rin warf ihm einen strengen Blick zu. »Du scheinst nicht zu verstehen, dass wir Adlaga nicht in die Luft jagen wollen.«
»Nein, ihr wollt nur die Stadtregierung stürzen, das ist ja auch viel besser.«
»Mit so wenig zivilen Opfern wie möglich, und das bedeutet, dass wir dich nicht brauchen.« Rin klopfte auf das Fass, das am Mast lehnte. »Aratsha, würdest du ein Auge auf ihn halten? Pass auf, dass er das Schiff nicht verlässt.«
Ein verschwommenes, grotesk durchscheinendes Gesicht tauchte aus dem Wasser auf. Aratsha verbrachte den größten Teil seiner Zeit im Wasser und beförderte die Schiffe der Cike wie von Zauberhand an ihr Ziel, und wenn er nicht seinen Gott herabrief, zog er es vor, in seinem Fass zu ruhen. Rin hatte seine ursprüngliche menschliche Gestalt noch nie gesehen. Sie war sich nicht sicher, ob er überhaupt noch eine hatte.
Luftblasen stiegen aus Aratshas Mund auf, als er sprach. »Wenn es sein muss.«
»Viel Glück«, murrte Ramsa. »Als ob ich einem verdammten Fass nicht davonlaufen könnte.«
Aratsha legte den Kopf schräg und sah ihn an. »Bitte bedenke, dass ich dich in Sekundenschnelle ertränken könnte.«
Ramsa öffnete den Mund zu einer Erwiderung, aber Chaghan kam ihm zuvor. »Sucht euch was aus.« Stahl klirrte, als er eine Kiste mit Waffen der Miliz auskippte. Baji tauschte unter lauten Beschwerden seine auffällige neunzinkige Harke gegen ein Standardschwert der Infanterie. Suni schnappte sich eine kaiserliche Hellebarde, aber Rin wusste, dass die Waffe nur dazu diente, den Schein zu wahren. Sunis Spezialität bestand darin, anderen mit seinen schildgroßen Händen den Schädel einzuschlagen. Er brauchte sonst nichts.
Rin legte sich einen gebogenen Piratensäbel um. Er entsprach zwar nicht dem Milizstandard, aber Milizschwerter waren zu schwer für sie. Moags Schmiede hatten ihr etwas Leichteres angefertigt. Der Säbel lag ihr noch ungewohnt in der Hand, aber sie rechnete auch nicht damit, dass der Tag mit einem Schwertkampf enden würde.
Wenn es so schlimm wurde, dass sie mitkämpfen musste, würde der Tag mit Feuer enden.
»Also, wiederholen wir noch mal.« Chaghan ließ den Blick seiner hellen Augen über die versammelten Cike wandern. »Wir gehen ganz gezielt vor. Wir töten nur eine Person. Dies ist ein politischer Mord, keine Schlacht. Es werden keine Zivilisten zu Schaden kommen.«
Er warf Rin einen vielsagenden Blick zu.
Sie verschränkte die Arme. »Ich weiß.«
»Auch nicht aus Versehen.«
»Ich weiß.«
»Jetzt mach aber mal halblang«, warf Baji ein. »Seit wann machst du so ein Gewese um die Opfer?«
»Wir haben deinem Volk genug Schaden zugefügt«, entgegnete Chaghan.
»Du hast ihm genug Schaden zugefügt«, sagte Baji. »Ich habe die Staudämme nicht zerstört.«
Bei diesen Worten zuckte Qara zusammen, aber Chaghan tat so, als hätte er es nicht gehört. »Zivilisten werden ab jetzt verschont. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
Rin zuckte die Achseln. Chaghan spielte gern den Kommandanten, und sie war selten in der Verfassung, sich daran zu stören. Sollte er sie doch herumkommandieren, so viel er wollte. Sie interessierte nur, dass sie diesen Auftrag erledigten.
Drei Monate. Neunundzwanzig Opfer, alle gezielt getötet. Ein weiterer Kopf in einem Sack, und dann würden sie nach Norden segeln, um die letzte Person auf ihrer Liste zu erledigen – die Kaiserin Su Daji.
Rin spürte, wie ihr bei dem Gedanken die Röte den Hals hinaufkroch. Ihre Handflächen wurden gefährlich heiß.
Nicht jetzt. Noch nicht. Sie nahm einen tiefen Atemzug. Dann noch einen, verzweifelter jetzt, als die Hitze sich nur in ihrem Leib ausbreitete.
Baji legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Alles klar bei dir?«
Sie ließ langsam die Luft ausströmen. Zwang sich, von zehn an rückwärts zu zählen und dann bis neunundvierzig in ungeraden Zahlen, und dann wieder zurück in Primzahlen. Diesen Trick hatte Altan ihr beigebracht, und meistens wirkte er auch, zumindest, wenn sie darauf achtete, dabei nicht an Altan zu denken. Die fiebrige Wärme ließ nach. »Es geht mir gut.«
»Und du bist nüchtern?«, fragte Baji.
»Ja«, bekräftigte sie steif.
Baji nahm die Hand nicht von ihrer Schulter. »Bist du dir sicher? Denn …«
»Ich habe alles im Griff«, blaffte sie. »Los, schnappen wir uns den Mistkerl.«
Vor drei Monaten, als die Cike zum ersten Mal die Insel Speer mit dem Schiff verlassen hatten, hatten sie vor einem kleinen Dilemma gestanden.
Sie konnten nirgendwohin.
Sie wussten, dass sie nicht aufs Festland zurückkehren konnten. Ramsa hatte ziemlich scharfsinnig darauf hingewiesen, dass die Kaiserin bereit gewesen war, die Cike den Wissenschaftlern der Föderation auszuliefern, und infolgedessen nicht sonderlich erfreut darüber sein dürfte, sie lebendig und frei zu sehen. Eine schnelle, heimliche Verpflegungsfahrt in ein Küstennest in der Provinz Schlange bestätigte ihren Verdacht. Ihre Gesichter klebten an der Anschlagtafel des Dorfes. Sie wurden als Kriegsverbrecher bezeichnet. Auf ihre Verhaftung war ein Kopfgeld ausgesetzt – fünfhundert kaiserliche Silberstücke tot, sechshundert lebendig.
Sie hatten so viele Vorratskisten gestohlen wie möglich und die Provinz schleunigst verlassen, bevor sie jemand sah.
Zurück in der Omonod-Bucht hatten sie über ihre Möglichkeiten diskutiert. Das Einzige, worin sich alle einig gewesen waren, war, dass sie die Kaiserin Su Daji töten mussten – die Schlange, das letzte Mitglied der Trifekta und die Verräterin, die ihre Nation der Föderation ans Messer geliefert hatte.
Aber sie waren nur neun Personen – acht ohne Kitay – gegen die mächtigste Frau des Reiches und die vereinten Streitkräfte der kaiserlichen Miliz. Sie hatten kaum Material, nur die Waffen, die sie auf dem Rücken trugen und einen gestohlenen Klipper, der so ramponiert war, dass sie die Hälfte der Zeit damit verbrachten, Wasser aus den unteren Decks zu schöpfen.
Also waren sie an der Küste entlang nach Süden gesegelt, vorbei an der Provinz Schlange in das Gebiet Hahn hinein, bis sie die Hafenstadt Ankhiluun erreicht hatten. Dort waren sie in den Dienst der Piratenkönigin Moag getreten.
Rin war noch nie einem Menschen begegnet, den sie so respektierte wie Moag – das steinerne Miststück, die verlogene Witwe und die skrupellose Herrscherin von Ankhiluun. Sie war eine zur Piratin gewordene Gemahlin, die mit der Ermordung ihres Mannes von der Dame zur Königin aufgestiegen war, und betrieb Ankhiluun schon seit Jahren als illegale Enklave des Außenhandels. Während des Zweiten Mohnkrieges hatte sie gegen die Trifekta gekämpft und wehrte seitdem die Späher der Kaiserin ab.
Sie war nur zu gern bereit, den Cike zu helfen, ihr Daji ein für alle Mal vom Hals zu schaffen.
Als Gegenleistung hatte sie dreißig Köpfe verlangt. Die Cike hatten ihr neunundzwanzig gebracht. Die meisten waren kleine Schmuggler, Kapitäne und Söldner gewesen. Moags wichtigste Einkommensquelle bildete geschmuggeltes Opium, und sie hielt immer nach Opiumhändlern Ausschau, die nicht nach ihren Regeln spielten oder ihr zumindest nicht die Taschen füllten.
Der dreißigste Kopf würde schwieriger werden. Heute hatten Rin und die Cike vor, Adlagas Regierung zu stürzen.
Moag versuchte schon seit Jahren, am Markt von Adlaga Fuß zu fassen. Die kleine Küstenstadt hatte zwar nicht viel zu bieten, aber die Bewohner – viele davon seit der Besatzung durch die Föderation süchtig nach Opiaten – würden mit Freuden ihre gesamten Ersparnisse für Importe aus Ankhiluun ausgeben. Adlaga hatte Moags aggressivem Opiumhandel während der vergangenen zwei Jahrzehnte nur dank ihres besonders wachsamen Stadtvorstehers Yang Yuanfu und seiner Verwaltung widerstanden.
Moag wollte Yang Yuanfu tot sehen. Die Cike waren auf politische Morde spezialisiert. Sie waren wie füreinander bestimmt.
Drei Monate. Neunundzwanzig Köpfe. Nur noch ein Auftrag, dann würden sie Silber, Schiffe und genug Soldaten haben, um die kaiserliche Garde so lange abzulenken, dass Rin zu Daji marschieren und ihr die flammenden Finger um den Hals legen konnte.
War die Hafensicherheit schon lasch, so war die Verteidigung der Stadtmauer praktisch nicht vorhanden. Die Cike überwanden Adlagas Mauern vollkommen unbehelligt – was nicht schwer war angesichts der Tatsache, dass die Föderation auf der ganzen Länge riesige Löcher hineingesprengt hatte, von denen keines bewacht war.
Unegen erwartete sie hinter dem Tor.
»Wir haben uns einen guten Tag für einen Mord ausgesucht«, bemerkte er, als er sie in die Gasse führte. »Yuanfu wird heute Mittag bei einer Kriegsgedenkfeier auf dem Marktplatz erscheinen. Er wird in vollem Tageslicht dastehen, und wir können ihn aus dem Schutz der Gassen heraus erledigen, ohne gesehen zu werden.«
Im Gegensatz zu Aratsha zog Unegen seine menschliche Gestalt vor, wenn er nicht gerade die Gestaltwandlerkräfte des Fuchsgeistes beschwor. Aber Rin spürte immer etwas unverkennbar Fuchsartiges in seinem Verhalten. Unegen war sowohl gerissen als auch schreckhaft, seine schmalen Augen huschten unablässig von einer Seite zur anderen und erkundeten alle möglichen Fluchtrouten.
»Dann haben wir also zwei Stunden?«, fragte Rin.
»Etwas mehr. Ein paar Blocks weiter befindet sich ein leer stehendes Lagerhaus«, berichtete er. »Da drin können wir uns verstecken und warten. Dann, äh, können wir uns leichter trennen, falls etwas schiefgeht.«
Rin drehte sich nachdenklich zu den Cike um.
»Wir werden uns an den Ecken des Platzes postieren, wenn Yuanfu kommt«, entschied sie. »Suni im Südwesten, Baji im Nordwesten, und ich nehme Nordosten.«
»Ablenkungsmanöver?«, fragte Baji.
»Nein.« Normalerweise waren Ablenkungen eine fantastische Idee, und Rin setzte Suni mit Vorliebe dafür ein, so viel Durcheinander wie nur möglich zu stiften, während sie oder Baji sich auf ihr Opfer stürzten und ihm die Kehle aufschlitzten, aber während einer öffentlichen Feier war das Risiko für die Zivilisten zu groß. »Qara wird den ersten Schuss abgeben. Wir anderen machen einen Weg frei zum Schiff, falls sie Widerstand leisten.«
»Geben wir uns immer noch als normale Söldner aus?«, wollte Suni wissen.
»Ja, warum nicht«, entgegnete Rin. Sie hatten das Ausmaß ihrer Fähigkeiten bisher erfolgreich verborgen oder zumindest jeden zum Schweigen gebracht, der Gerüchte hätte verbreiten können. Daji wusste nicht, dass die Cike es auf sie abgesehen hatten. Je länger sie sie für tot hielt, umso besser. »Wir haben diesmal jedoch einen besseren Gegner vor uns als gewöhnlich, also tut, was nötig ist. Hauptsache, wir kriegen einen Kopf in einem Sack.«
Sie holte Luft und überdachte noch einmal den Plan.
Er würde klappen. Alles würde glatt über die Bühne gehen.
Mit den Cike Strategien zu entwerfen war wie Schach mit unberechenbaren, bizarren und kraftstrotzenden Figuren zu spielen. Aratsha befehligte das Wasser. Suni und Baji waren Berserker und imstande, ganze Schwadronen auszulöschen, ohne dass ihnen der Schweiß ausbrach. Unegen konnte sich in einen Fuchs verwandeln. Qara sprach nicht nur mit Vögeln, sie konnte auch einem Pfau aus hundert Metern Entfernung ein Auge ausschießen. Und Chaghan … Sie war nicht ganz sicher, wozu Chaghan imstande war, abgesehen davon, sie auf Schritt und Tritt zu nerven, aber er schien in der Lage zu sein, Leute um den Verstand zu bringen.
Sie alle zusammen gegen einen städtischen Beamten und seine Wachen schien auf den ersten Blick übertrieben.
Aber für Yang Yuanfu, einen der letzten unbestechlichen Beamten im Reich, waren Mordversuche nichts Ungewöhnliches. Er schützte sich mit einer Schwadron der kampferprobtesten Männer der Provinz, wohin er auch ging.
Aufgrund von Moags Berichten wusste Rin, dass Yang Yuanfu im Laufe der vergangenen fünfzehn Jahre mindestens dreizehn Anschläge überlebt hatte. Seine Wachen waren an Verrat gewöhnt. Um an ihnen vorbeizukommen, brauchte man Kämpfer mit unnatürlichen Fähigkeiten. Man konnte es gar nicht genug übertreiben.
Als die Cike im Lagerhaus waren, hatten sie nichts anderes zu tun, als zu warten. Unegen hielt nervös zuckend Wache. Chaghan und Qara saßen schweigend mit dem Rücken an die Bretterwand gelehnt. Suni und Baji standen mit herabhängenden Schultern da, die Arme lässig vor der Brust verschränkt, als warteten sie nur aufs Essen.
Rin saß auf dem Boden, konzentrierte sich auf ihre Atmung und versuchte, den stechenden Schmerz in ihren Schläfen zu ignorieren.
Sie zählte dreißig Stunden, seit sie zum letzten Mal Opium genommen hatte. So lange hatte sie seit Wochen nicht mehr Verzicht geübt. Sie stand auf, ging umher und verschränkte dabei die Hände, um das Zucken zu vertreiben.
Es half nicht. Es linderte auch nicht die Kopfschmerzen.
Mist.
Zuerst hatte sie gedacht, dass sie das Opium nur brauchte, um die Trauer zu betäuben. Sie hatte gedacht, das Opiumrauchen würde ihr Erleichterung verschaffen, bis die Erinnerungen an Speer und Altan zu einem schwachen Schmerz abgeklungen waren, bis sie ohne die erdrückenden Schuldgefühle leben konnte.
Sie hatte Schuldgefühle für das richtige Wort gehalten. Das irrationale Gefühl, nicht das moralische Konzept. Sie hatte sich nämlich eingeredet, dass es ihr nicht leidtat, dass die Mugener bekommen hatten, was sie verdienten, und dass sie nicht mehr daran denken würde. Nur dass die Erinnerung sich in ihrem Kopf wie eine gähnende Schlucht auftat, in die sie jedes menschliche Gefühl hineingeworfen hatte, das sie bedrohte.
Doch der Abgrund rief nach ihr und drängte sie hinabzuschauen, hinabzustürzen.
Und der Phönix wollte sie nicht vergessen lassen. Der Phönix wollte, dass sie sich freute. Der Phönix lebte von Zorn, und Zorn war unauslöschlich mit der Vergangenheit verbunden. Also musste der Phönix die offenen Wunden in ihrer Seele aufreißen und in Brand stecken, Tag für Tag, denn das bescherte ihr Erinnerungen, und diese Erinnerungen fachten den Zorn an.
Ohne Opium blitzten die Visionen ständig vor Rins innerem Auge auf, oft lebhafter als die Wirklichkeit, die sie umgab.
Manchmal zeigten sie Altan. Meistens taten sie es nicht. Der Phönix war eine Verbindung zu Generationen von Erinnerungen. Tausende und Abertausende von Speerlys hatten in ihrer Trauer und Verzweiflung zu dem Gott gebetet, und der Gott hatte ihr Leid gesammelt, gespeichert und in Feuer verwandelt.
Die Erinnerungen konnten auch trügerisch ruhig sein. Manchmal sah Rin braunhäutige Kinder an einem makellos weißen Strand herumlaufen. Sie sah Flammen weiter oben am Ufer brennen – keine Scheiterhaufen, keine Flammen der Zerstörung, sondern Lagerfeuer. Freudenfeuer. Warme, wohltuende Herdfeuer.
Und manchmal sah sie die Speerlys, genug, um ein blühendes Dorf zu füllen. Es erstaunte sie immer wieder, wie viele es waren, ein ganzes Volk, von dem sie manchmal befürchtete, dass sie es nur erträumt hatte. Wenn der Phönix blieb, konnte Rin sogar Gesprächsfetzen in einer Sprache auffangen, die sie beinahe verstand, konnte Blicke auf Gesichter erhaschen, die sie beinahe erkannte.
Sie waren nicht die wilden Bestien nikarischer Sagen. Sie waren nicht die stumpfsinnigen Krieger, die zu sein der Rote Kaiser und jede nachfolgende Regierung sie gezwungen hatte. Sie liebten und lachten und weinten an ihren Feuern. Sie waren Menschen.
Aber jedes Mal, bevor Rin in der Erinnerung an eine Herkunft versank, die sie nicht hatte, sah sie am blassen Horizont Boote aus dem Kriegshafen der Föderation auf dem Festland heransegeln.
Was als Nächstes geschah, war ein Nebel von Farben, eine Sammlung von Perspektiven, die zu schnell wechselten, als dass Rin hätte folgen können. Rufe, Schreie, Bewegung. Reihen um Reihen bewaffneter Speerlys am Strand.
Doch es genügte nicht. Der Föderation mussten sie wie Wilde erschienen sein, die mit Stöcken gegen Götter kämpften, und das donnernde Kanonenfeuer steckte das Dorf so schnell in Brand, als hätte man einen Kienspan entzündet.
Die Turmschiffe schossen Gaskugeln mit schrecklich unschuldigen Platzgeräuschen ab. Wo sie auf den Boden trafen, setzten sie große beißende gelbe Rauchwolken frei.
Frauen fielen. Kinder zuckten. Die Reihen der Krieger lösten sich auf. Das Gas tötete nicht sofort; so freundlich waren seine Erfinder nicht gewesen.
Dann begann das Schlachten. Die Föderation feuerte ununterbrochen und wahllos. Mugenische Armbrüste konnten drei Bolzen gleichzeitig abschießen und entfesselten ein unablässiges Trommelfeuer von Metall, das Hälse, Schädel, Glieder und Herzen aufriss.
Vergossenes Blut zeichnete Marmormuster in den weißen Sand. Leichen lagen da, wo sie gefallen waren. Im Morgengrauen marschierten die Föderationsgeneräle ans Ufer. Stiefel stiegen gleichgültig über zerschmetterte Leichen hinweg, rückten vor und rammten ihre Flagge in den blutgetränkten Sand.
»Wir haben ein Problem«, verkündete Baji.
Rin war sofort hellwach. »Was?«
»Sieh selbst.«
Plötzlich hörte sie das Klingen von Glocken – ein fröhliches Geräusch, das in dieser zerstörten Stadt vollkommen fehl am Platz war. Sie drückte das Gesicht an einen Spalt zwischen den Brettern des Lagerhauses. Ein Stoffdrache, von Tänzern mit Zeltstangen hochgehalten, tanzte durch die Menge. Dahinter folgten Tänzer, die Banner und Bänder schwenkten, begleitet von Musikanten und Regierungsbeamten, die in leuchtend roten Sänften getragen wurden. Hinter ihnen war die Menge.
»Du hast gesagt, es würde eine kleine Feier«, bemerkte Rin. »Keine verdammte Parade.«
»Vor einer Stunde war noch alles ruhig«, beharrte Unegen.
»Und jetzt versammelt sich die ganze Stadt auf dem Platz.« Baji spähte zwischen den Brettern hindurch. »Gilt die Regel ›Keine zivilen Opfer‹ immer noch?«
»Ja«, sagte Chaghan, bevor Rin antworten konnte.
»Spielverderber«, maulte Baji.
»Menschenmengen erleichtern ein gezieltes Attentat«, stellte Chaghan fest. »Man kommt ganz nah heran. Schlagt zu, ohne gesehen zu werden, und verschwindet, bevor die Wachen Zeit haben zu reagieren.«
Rin öffnete den Mund, um zu erwidern: Das sind immer noch eine Menge Zeugen, aber die Entzugskrämpfe trafen sie zuerst. Eine Welle des Schmerzes schoss ihr durch die Muskeln. Sie begann in ihrem Bauch und breitete sich aus, so plötzlich, dass ihr für einen Moment schwarz vor Augen wurde und sie sich nur keuchend die Brust halten konnte.
»Alles in Ordnung?«, fragte Baji.
Galle stieg ihr in die Kehle, bevor sie antworten konnte. Sie würgte. Eine zweite Welle von Übelkeit krampfte ihren Magen zusammen, dann eine dritte.
Baji legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Rin?«
»Mir geht’s gut«, beharrte sie zum gefühlt tausendsten Mal.
Es ging ihr nicht gut. Ihr Kopf pochte wieder, und diesmal wurde der Schmerz von einer Übelkeit begleitet, die ihren Brustkorb ergriff und nicht nachließ, bis sie sich krümmte und wimmernd auf die Knie fiel.
Erbrochenes spritzte auf den Boden.
»Planänderung«, bestimmte Chaghan. »Rin, geh zurück zum Schiff.«
Sie wischte sich über den Mund. »Nein.«
»Ich sage dir, dass du in der Verfassung nicht zu gebrauchen bist.«
»Und ich bin deine Kommandantin«, gab sie zurück. »Also halt die Klappe und tu, was ich sage.«
Chaghans Augen wurden schmal. Stille senkte sich über das Lagerhaus.
Rin lieferte sich schon seit Monaten einen Machtkampf mit Chaghan um die Führung der Cike. Er stellte ihre Entscheidungen auf Schritt und Tritt infrage und nutzte jede Gelegenheit, um unmissverständlich klarzumachen, dass Altan seiner Meinung nach eine dumme Entscheidung getroffen hatte, als er sie zur Kommandantin ernannt hatte.
Und Rin wusste, dass er recht hatte.
Sie war eine schreckliche Anführerin. Die meisten ihrer Angriffspläne der letzten drei Monate liefen darauf hinaus, dass alle gleichzeitig angriffen und zusahen, dass sie heil davonkamen.
Aber von ihren Fähigkeiten als Kommandantin einmal abgesehen, musste sie hier sein. Sie musste Adlaga durchziehen. Seit sie Speer verlassen hatten, waren ihre Entzugserscheinungen immer schlimmer geworden. Die ersten Aufträge für Moag hatte sie noch bewältigen können. Dann entfachten die endlosen Morde, die Schreie, die Erinnerungsfetzen an das Schlachtfeld wieder und wieder ihren Zorn, bis sie jeden Tag länger berauscht als nüchtern war, und selbst dann hatte sie das Gefühl, am Rande des Wahnsinns zu stehen, weil der verdammte Phönix einfach keine Ruhe gab.
Sie musste sich selbst aus diesem Sumpf herausziehen. Wenn sie diese grundlegende, einfache Aufgabe nicht lösen konnte, wenn sie einen Stadtvorsteher nicht töten konnte, der noch nicht mal ein Schamane war, dann würde sie wohl kaum der Kaiserin die Stirn bieten können.
Und sie durfte nicht ihre Gelegenheit auf Rache verlieren. Rache war das Einzige, was sie hatte.
»Wage es nicht, diesen Auftrag zu gefährden«, sagte Chaghan.
»Wage es nicht, mich zu bevormunden«, gab sie zurück.
Chaghan seufzte und wandte sich an Unegen. »Kannst du sie im Auge behalten? Ich gebe dir Laudanum.«
»Ich dachte, ich soll zum Schiff zurück«, sagte Unegen.
»Planänderung.«
»Meinetwegen.« Unegen zog eine Schulter hoch. »Wenn es sein muss.«
»Komm schon«, schaltete Rin sich ein. »Ich brauche kein Kindermädchen.«
»Du wirst in der Ecke warten«, befahl Chaghan, ohne darauf einzugehen. »Du wirst Unegen nicht von der Seite weichen. Ihr werdet beide als Verstärkung dienen, und das nur im äußersten Notfall.«
Sie machte ein finsteres Gesicht. »Chaghan …«
»Im äußersten Notfall«, wiederholte er. »Du hast genug Unschuldige getötet.«
Die Stunde kam. Die Cike huschten einer nach dem anderen aus dem Lagerhaus, um sich unter die sich langsam vorbeischiebende Menge zu mischen.
Rin und Unegen gingen mühelos in Adlagas Masse auf. In den Hauptstraßen drängten sich die Zivilisten, alle in ihre eigenen Sorgen vertieft, und es drangen von überallher so viele Geräusche und Bilder auf Rin ein, dass sie nicht wusste, wo sie hinschauen sollte und eine leichte Panik empfand.
Ein wilder Klangbrei aus Gongs und Kriegstrommeln übertönte die Lautenmusik von der Spitze der Parade. Händler priesen ihre Waren an, wann immer sie um eine Ecke bogen, und schrien Preise mit einer Dringlichkeit, die Rin mit Evakuierungswarnungen in Verbindung brachte. Rotes Feierkonfetti übersäte die Straßen, händeweise von Kindern und Gauklern geworfen, ein Regen roter Papierschnipsel, die jede Oberfläche bedeckten.
»Woher haben sie das Geld dafür?«, murmelte Rin. »Die Föderation lässt sie hungern.«
»Hilfe aus Sinegard«, vermutete Unegen. »Mittel zur Feier des Kriegsendes. Hält sie bei Laune und bei der Stange.«
Wohin Rin auch sah, sah sie Essen. Große Wassermelonenwürfel am Spieß. Brötchen mit Rote-Bohnen-Füllung. Stände, die vor Sojasauce triefende Teigtaschen und Lotossamenküchlein verkauften, säumten die Straßen. Händler wendeten Eierkuchen mit geschickten Würfen in der Luft, und das brutzelnde Öl hätte sie unter anderen Umständen hungrig gemacht, aber jetzt drehte sich ihr bei den starken Gerüchen nur der Magen um.
Diese Überfülle an Nahrung schien ebenso ungerecht wie unmöglich zu sein. Noch vor wenigen Tagen waren sie an Leuten vorbeigesegelt, die ihre Kinder im Flussschlamm ertränkten, weil das ein schnellerer und barmherzigerer Tod war, als sie langsam verhungern zu lassen.
Wenn dieses ganze Essen aus Sinegard kam, dann musste die kaiserliche Bürokratie die ganze Zeit über große Lebensmittelvorräte verfügt haben. Warum hatte sie sie der Bevölkerung während des Krieges vorenthalten?
Falls die Bewohner von Adlaga sich die gleiche Frage stellten, so ließen sie es sich nicht anmerken. Alle wirkten so glücklich. Die Gesichter waren entspannt aus schlichter Erleichterung darüber, dass der Krieg zu Ende war, dass das Reich siegreich daraus hervorgegangen war und dass sie in Sicherheit waren.
Und das machte Rin fuchsteufelswild.
Sie hatte immer schon Probleme mit Zorn gehabt, das wusste sie. In Sinegard hatte sie sich ständig zu impulsiven Wutausbrüchen hinreißen lassen und sich um die Folgen später gekümmert. Aber jetzt war Zorn ein Dauerzustand, eine unsägliche Wut, die ihr auferlegt worden war und die sie weder beherrschen noch steuern konnte.
Aber sie wollte auch nicht, dass es aufhörte. Der Zorn war ein Schild. Der Zorn hinderte sie daran, sich an das zu erinnern, was sie getan hatte. Denn solange sie zornig war, war es in Ordnung – sie hatte angemessen gehandelt. Der Zorn hielt sie zusammen. Wenn sie aufhörte, zornig zu sein, würde sie auseinanderbrechen.
Sie versuchte, sich abzulenken, indem sie in der Menge nach Yang Yuanfu und seinen Wachen Ausschau hielt und versuchte, sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren.
Aber ihr Gott ließ sie nicht.
Töte sie, spornte der Phönix sie an. Sie verdienen ihr Glück nicht. Sie haben nicht gekämpft.
Plötzlich sah sie den Marktplatz vor sich in Flammen stehen. Hektisch schüttelte sie den Kopf und versuchte, die Stimme des Phönix auszublenden. »Nein, hört auf …«
Lass sie brennen.
Hitze loderte in ihren Handflächen auf. Ihr Magen krampfte sich zusammen. Nein – nicht hier, nicht jetzt. Sie presste die Augen zu.
Verwandle sie in Asche.
Ihr Herzschlag beschleunigte sich; ihre Sicht verengte sich zu einem stecknadelgroßen Punkt und dehnte sich wieder aus. Sie fühlte sich fiebrig. Die Menge schien plötzlich voller Feinde zu sein. In einem Augenblick waren die Menschen alle bewaffnete Föderationssoldaten in blauer Uniform; im nächsten waren sie wieder Zivilisten. Rin tat einen tiefen, würgenden Atemzug und versuchte, Luft in ihre Lunge zu zwingen. Sie kniff die Augen fest zusammen und gab dem roten Neben den Befehl, sich zu verziehen.
Diesmal tat er es nicht.
Bei dem Gelächter, der Musik und den lächelnden Gesichtern ringsum wollte sie am liebsten nur noch schreien.
Wie konnten sie es wagen zu leben, wenn Altan tot war? Es schien schrecklich ungerecht, dass das Leben weitergehen und dass diese Leute einen Krieg feiern konnten, den sie nicht selbst gewonnen hatten, für den sie nicht gelitten hatten …
Die Hitze in ihren Händen wurde stärker.
Unegen packte sie an den Schultern. »Ich dachte, du hättest deinen Scheiß im Griff.«
Sie zuckte zusammen und wirbelte herum. »Das habe ich auch!«, zischte sie. Zu laut. Die Leute wichen vor ihr zurück.
Unegen zog sie an den Rand der Menge, in die Sicherheit der Schatten unter Adlagas Ruinen. »Du erregst Aufmerksamkeit.«
»Es geht mir gut, Unegen, lass mich einfach los …«
Er tat es nicht. »Du musst dich beruhigen.«
»Ich weiß …«
»Nein. Ich meine, jetzt sofort.« Er deutete mit dem Kopf hinter sie. »Sie ist hier.«
Rin drehte sich um.
Und da saß die Kaiserin, getragen wie eine Braut in einer Sänfte aus roter Seide.
Kapitel 2
Als Rin Kaiserin Su Daji das letzte Mal begegnet war, hatte sie förmlich vor Fieber gekocht und in ihrem Wahn nichts anderes gesehen als Dajis Gesicht – schön, hypnotisch, mit Haut wie Porzellan und Augen wie Mottenflügeln.
Die Kaiserin war so fesselnd wie immer. Jeder, den Rin kannte, war nach der mugenischen Invasion um ein Jahrzehnt gealtert, abgestumpft und vernarbt, nur die Kaiserin war so blass und alterslos wie je, als lebte sie auf einer transzendenten Ebene, die für Sterbliche unberührbar war.
Rins Atmung beschleunigte sich.
Daji sollte nicht hier sein.
Es sollte nicht so geschehen.
Bilder von Dajis Leichnam blitzten vor ihrem inneren Auge auf. Der Kopf gegen weißen Marmor geschmettert. Der bleiche Hals aufgeschlitzt. Der Leib zu einem Nichts verkohlt – aber sie sollte nicht sofort brennen. Rin wollte es langsam tun, wollte es auskosten.
Zögerlicher Jubel erhob sich aus der Menge.
Die Kaiserin beugte sich durch die Vorhänge der Sänfte und hob eine Hand, die so weiß war, dass sie im Sonnenlicht beinahe schimmerte. Sie lächelte.
»Wir haben gesiegt«, rief sie. »Wir haben überlebt.«
Zorn loderte in Rin auf, so stark, dass sie fast daran erstickte. Sie hatte das Gefühl, als sei ihr Körper mit Ameisenbissen übersät, die sie nicht kratzen konnte – eine Frustration, die in ihr kochte und sie anflehte, sie aus ihr herausbrechen zu lassen.
Wie konnte die Kaiserin am Leben sein? Der schiere Widerspruch erzürnte sie, die Tatsache, dass Altan, Meister Irjah und so viele andere tot waren und Daji aussah, als sei ihr nie ein Haar gekrümmt worden. Sie war das Oberhaupt einer Nation, deren sinnlose Invasion – die sie persönlich veranlasst hatte – Millionen verschlungen hatte, und sie sah aus, als sei sie gerade zu einem Festmahl erschienen.
Rin stürmte los.
Unegen zog sie sofort zurück. »Was hast du vor?«
»Was denkst du denn?« Rin riss sich los. »Ich mach sie kalt. Geh und hol die anderen, ich brauche Verstärkung …«
»Bist du übergeschnappt?«
»Sie ist hier! So eine gute Gelegenheit kriegen wir nie wieder!«
»Dann lass Qara das machen.«
»Qara hat kein freies Schussfeld«, zischte Rin. Qaras Position in dem zerstörten Glockenturm war zu hoch. Es war unmöglich, von dort einen Pfeil an der Menge vorbei durchs Fenster der Sänfte zu schießen, in der Daji von allen Seiten geschützt war; Schüsse von vorn würden von den Wachen unmittelbar vor ihr abgefangen werden.
Rin machte sich mehr Sorgen, dass Qara nicht schießen würde. Sie musste die Kaiserin inzwischen gesehen haben, scheute sich aber vielleicht, in eine Menge Zivilisten zu feuern oder hatte Angst, die Anwesenheit der Cike zu verraten, bevor einer von ihnen ein freies Schussfeld hatte. Qara hatte vielleicht beschlossen, klug zu sein.
Rin scherte sich nicht um Klugheit. Das Universum hatte ihr diese Gelegenheit geboten. Sie konnte das Ganze binnen Minuten beenden.
Der Phönix zerrte eifrig und ungeduldig an ihrem Bewusstsein. Na los, Kleine … Lass mich …
Sie bohrte sich die Fingernägel in die Handflächen. Noch nicht.
Der Abstand zwischen ihr und der Kaiserin war zu groß. Wenn sie jetzt in Flammen ausbrach, würden alle auf dem Platz sterben.
Sie wünschte sich verzweifelt, das Feuer besser beherrschen zu können. Oder es überhaupt zu beherrschen. Aber der Phönix stand jeder Beherrschung entgegen. Der Phoenix wollte eine wild lodernde Feuersbrunst, die alles ringsum verzehrte, so weit das Auge reichte.
Und wenn sie den Gott rief, konnte sie ihren eigenen Wunsch nicht mehr von dem des Phönix unterscheiden. Sein Wunsch und ihr Wunsch waren ein Todestrieb, der immer mehr verlangte, um sein Feuer zu nähren.
Sie versuchte, an etwas anderes zu denken, an irgendetwas anderes als an Zorn und Rache. Aber wenn sie die Kaiserin anschaute, sah sie nichts als Flammen.
Daji sah auf. Ihr Blick traf den von Rin. Sie hob die Hand und winkte.
Rin erstarrte. Sie konnte nicht wegsehen. Dajis Augen wurden Fenster, wurden Erinnerungen, wurden Rauch, Feuer, Leichen und Knochen, und Rin spürte, dass sie fiel, fiel in ein schwarzes Meer, in dem sie nichts weiter sah als Altan, wie er sich als menschlicher Leuchtturm auf einem Pier selbst entzündete.
Daji verzog die Lippen zu einem grausamen Lächeln.
Dann gingen ohne Vorwarnung hinter Rin die Knallkörper los – popp-popp-popp –, und Rin wäre fast das Herz aus der Brust gesprungen.
Sie schrie auf und hielt sich am ganzen Leib zitternd die Ohren zu.
»Es ist nur Feuerwerk!«, zischte Unegen. Er riss ihr die Hände vom Kopf. »Nur Feuerwerk.«
Aber das bedeutete nichts – sie wusste selbst, dass es nur Feuerwerk war, aber das war ein rationaler Gedanke, und rationale Gedanken waren ohne Belang, wenn sie die Augen schloss und mit jedem lauten Krachen hinter den Lidern Explosionen sah, rudernde Arme, schreiende Kinder …
Sie sah einen Mann von den Bodendielen eines zerstörten Gebäudes baumeln. Er versuchte mit glitschigen Fingern, sich an schrägen Brettern festzuhalten, um nicht in das zerborstene Holz zu stürzen, das unten wie brennende Speere aufragte. Sie sah Männer und Frauen an den Mauern kleben, mit einem feinen weißen Pulver bestäubt, sodass man sie für Statuen hätte halten können, wenn da nicht der dunkle Umriss des Blutschattens gewesen wäre, der sie umgab …
Zu viele Menschen. Sie war von zu vielen Menschen eingeschlossen. Sie ließ sich auf die Knie sinken und begrub das Gesicht in den Händen. Als sie das letzte Mal in einer solchen Menschenmenge gewesen war, waren die Leute vor dem Grauen in der Innenstadt von Khurdalain geflohen – ihr Blick schoss hoch und suchte hektisch nach Fluchtwegen, doch sie fand keinen, nur endlose, dichtgepackte Mauern aus Leibern.
Zu viel. Zu viele Bilder, die Information – ihr Verstand setzte aus; Flammen brachen zuckend aus ihren Schultern hervor und zerstoben über ihr in der Luft, wodurch sie nur noch heftiger zitterte.
Da waren immer noch so viele Menschen – sie waren zusammengepresst, eine wogende Masse ausgestreckter Arme, eine namenlose, gesichtslose Wesenheit, die Rin in Stücke reißen wollte …
Tausende, Hunderttausende – und du hast sie ausgelöscht, hast sie in ihren Betten verbrannt …
»Rin, hör auf!«, schrie Unegen.
Aber es spielte keine Rolle. Die Menge war vor ihr zurückgewichen. Mütter zerrten ihre Kinder weg. Veteranen zeigten laut rufend mit der Hand auf sie.
Sie schaute an sich hinab. Überall drangen Rauchkringel aus ihr hervor.
Dajis Sänfte war verschwunden. Zweifellos hatte man sie rasch in Sicherheit gebracht; Rins Anwesenheit war ein grelles Warnsignal gewesen. Eine Reihe kaiserlicher Wachen drängte sich durch die überfüllte Straße auf sie zu, die Schilde erhoben, die Speere direkt auf Rin gerichtet.
»Oh Scheiße«, fluchte Unegen.
Rin trat unsicher zurück, die Handflächen ausgestreckt, als gehörten sie einer Fremden. Fremde Finger, die Funken sprühten. Fremder Wille, der den Phönix in diese Welt zog.
Verbrenne sie.
Feuer pulsierte in ihr. Sie spürte, wie sich die Adern hinter ihren Augen dehnten. Durch den Druck schoss ihr ein stechender Schmerz in den Hinterkopf und bescherte ihr ein Feuerwerk vor Augen.
Töte sie.
Der Hauptmann der Garde schrie einen Befehl. Die Miliz stürmte auf sie zu. Dann setzte ihr Verteidigungsinstinkt ein, und sie verlor jede Selbstbeherrschung. Ihr Geist war kurz von ohrenbetäubender Stille erfüllt, dann hörte sie ein hohes Heulen, das siegreiche Lachen eines Gottes, der wusste, dass er gewonnen hatte.
Als sie endlich Unegen anschaute, sah sie keinen Mann, sie sah einen verkohlten Leichnam, ein weiß glänzendes Skelett, von dem sich das Fleisch abschälte; sie sah, wie er zu Asche zerfiel, zu schöner, sauberer Asche, die viel besser war als das komplizierte Durcheinander aus Knochen und Fleisch, aus dem er jetzt bestand …
»Hör auf!«
Sie hörte keinen Schrei, sondern ein wimmerndes Flehen. Für den Bruchteil einer Sekunde flackerte Unegens Gesicht durch die Asche.
Sie war dabei, ihn zu töten. Sie wusste, dass sie ihn umbrachte, und sie konnte nicht damit aufhören.
Sie konnte nicht einmal ihre Arme und Beine bewegen. Sie stand reglos da, Feuer toste aus ihren Gliedmaßen und hielt sie fest, als sei sie in Stein gehüllt.
Verbrenne ihn, sagte der Phönix.
»Nein, halt …«
Du willst es.
Sie wollte es nicht. Aber es hörte nicht auf. Warum sollte die Gabe des Phoenix auch nur die leiseste Andeutung von Kontrolle ermöglichen? Es war ein Appetit, der sich nur verstärkte; das Feuer verzehrte und wollte noch mehr verzehren, und Mai’rinnen Tearza hatte sie einmal davor gewarnt, aber Rin hatte nicht auf sie gehört, und jetzt würde Unegen sterben …
Etwas Schweres legte sich auf ihren Mund. Sie schmeckte Laudanum. Dick, süß und klebrig. Panik und Erleichterung rangen in ihrem Kopf miteinander, während sie würgte und sich wehrte, aber Chaghan presste ihr das getränkte Tuch nur noch fester aufs Gesicht, während ihre Brust sich hob und senkte.
Der Boden schwankte unter ihren Füßen. Sie stieß einen gedämpften Schrei aus.
»Atmen«, befahl Chaghan. »Sei still. Einfach nur atmen.«
Sie würgte an dem widerwärtigen und vertrauten Geruch. Enki hatte es schon so oft für sie hergestellt. Sie gab sich große Mühe, sich nicht zur Wehr zu setzen, unterdrückte ihre natürlichen Instinkte – sie hatte ihnen befohlen, es zu tun, es war so geplant.
Das machte es nicht erträglicher.
Ihre Beine knickten unter ihr ein, und ihre Schultern fielen herab. Sie sank gegen Chaghan.
Er zog sie hoch, legte sich ihren Arm über die Schulter und half ihr zur Treppe. Rauch quoll ihnen in den Weg; die Hitze hatte keine Wirkung auf Rin, aber sie sah, dass die Spitzen von Chaghans weißem Haar sich schwarz färbten und sich kräuselten.
»Verdammt«, stieß er leise aus.
»Wo ist Unegen?«, murmelte sie.
»Es geht ihm gut, er wird schon wieder …«
Sie wollte darauf bestehen, ihn zu sehen, aber ihre Zunge fühlte sich zu schwer an, um Worte zu bilden. Ihre Knie gaben endgültig nach, aber sie spürte nicht, dass sie fiel. Als das Beruhigungsmittel in ihren Blutkreislauf gelangte, wurde alles hell und luftig, das Reich einer Fee. Sie hörte jemanden brüllen, spürte, wie man sie hochhob und auf den Boden des Sampans setzte.
Es gelang ihr, einen letzten Blick über die Schulter zu werfen.
Am Horizont war die ganze Hafenstadt erleuchtet wie ein Signalfeuer – Lampen brannten auf jedem Deck, Glockenläuten und Rauchzeichen drangen durch die glühende Luft.
Jeder kaiserliche Wachposten konnte diese Warnung sehen.
Rin hatte die Standardcodes der Miliz gelernt. Sie wusste, was die Zeichen bedeuteten. Sie hatten eine Fahndung nach den Thronverrätern angekündigt.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte Chaghan. »Du hast uns die ganze Miliz auf den Hals gehetzt.«
»Was werden wir …« Die Zunge lag ihr schwer im Mund. Sie hatte die Fähigkeit verloren, Worte zu bilden.
Er legte ihr eine Hand auf die Schulter und versetzte ihr einen Stoß. »Runter mit dir.«
Sie fiel ungeschickt in den Hohlraum unter den Sitzen. Als sie die Augen aufriss, sah sie dicht vor ihrer Nase den Holzboden des Bootes, so nah, dass sie die Jahresringe zählen konnte. Die Linien des Holzes verwirbelten sich zu Tintenbildern, in die sie eintauchte, und dann nahm die Tinte Farbe an und wurde zu einer Welt aus Rot und Schwarz und Orange.
Der Abgrund tat sich auf. Das war nur dann möglich, wenn Rin berauscht war, wenn sie vollkommen die Gewalt über sich verloren hatte und sich nicht mehr gegen die Erinnerung an das Ereignis wehren konnte, an das zu denken sie sich weigerte.
Sie flog über die Langbogeninsel und beobachtete, wie der Feuerberg ausbrach, wie Ströme geschmolzener Lava über den Gipfel quollen und in Bächen zu den Städten hinabströmten.
Sie sah, wie das Leben der Menschen ausgelöscht wurde, wie sie im Nu verbrannten und umfielen und in Rauch verwandelt wurden. Und es war so leicht, als würde man eine Kerze ausblasen oder eine Motte zerquetschen; sie wollte es, und es geschah; sie hatte es kraft ihrer Gedanken getan wie ein Gott.
So lange sie sich aus der unbeteiligten Vogelperspektive daran erinnerte, verspürte sie kein Schuldgefühl. Sie empfand eine schwache Neugier, als hätte sie einen Ameisenhügel in Brand gesteckt oder einen Käfer mit einem Messer aufgespießt.
Es gab keine Schuld, wenn man Insekten tötete, nur die schöne, kindliche Neugier zu beobachten, wie sie sich in ihren Todeskrämpfen wanden.
Dies war keine Erinnerung, keine Vision; es war eine Illusion, die sie für sich selbst beschworen hatte, die Illusion, zu der sie jedes Mal zurückkehrte, wenn sie die Beherrschung verlor und die anderen ihr ein Beruhigungsmittel verabreichten.
Sie wollte es sehen – sie musste am Rand dieser Erinnerung tanzen, die sie nicht besaß, musste zwischen der gottgleichen kalten Gleichgültigkeit einer Mörderin und der vernichtenden Schuld der Tat lavieren. Sie spielte mit ihren Schuldgefühlen wie ein Kind, das die Hand gerade so dicht über eine Kerze hielt, dass es den stechenden Schmerz spürte.
Es war seelische Selbstgeißelung, als würde man einen Nagel in eine offene Wunde bohren. Natürlich kannte sie die Antwort, sie konnte es nur niemandem gegenüber zugeben – dass sie es in dem Moment, in dem sie die Insel versenkt hatte und zur Mörderin geworden war, gewollt hatte.
»Ist alles in Ordnung mit ihr?« Ramsas Stimme. »Warum lacht sie?«
Chaghans Stimme. »Sie wird schon wieder.«
Ja, wollte Rin rufen, ja, es ging ihr gut; sie träumte nur, war nur zwischen dieser Welt und der nächsten gefangen, nur verzückt von den Illusionen dessen, was sie getan hatte. Sie rollte über den Boden des Sampans und kicherte, bis das Lachen sich in lautes, raues Schluchzen verwandelte, und dann weinte sie, bis sie nichts mehr sehen konnte.
Kapitel 3
»Wach auf.«
Jemand kniff sie fest in den Arm. Rin fuhr hoch. Mit der rechten Hand griff sie nach einem Gürtel, der nicht da war, nach einem Messer, das sich im Nebenraum befand, und ihre linke Hand krachte blind seitwärts in …
»Scheiße!«, schrie Chaghan.
Sie hatte Mühe, sein Gesicht scharf zu sehen. Er wich zurück und streckte ihr die Hände hin zum Zeichen, dass er keine Waffen hielt, sondern nur einen Waschlappen.
Rin fuhr sich hektisch über den Hals und die Handgelenke. Sie wusste, dass sie nicht gefesselt war, aber sie musste sich trotzdem davon überzeugen.
Chaghan rieb sich mit reuiger Miene die sich schnell verfärbende Wange.
Rin entschuldigte sich nicht dafür, dass sie ihn geschlagen hatte. Er hätte es besser wissen müssen. Sie alle wussten es besser. Sie wussten, dass sie sie nicht, ohne zu fragen, berühren durften, dass sie sich ihr nicht von hinten nähern durften und dass sie in ihrer Gegenwart keine plötzlichen Bewegungen oder Geräusche machen durften, wenn sie nicht als ein Stück Kohle enden wollten, das auf den Grund der Omonod-Bucht sank.
»Wie lange war ich bewusstlos?« Sie würgte. Ihr Mund schmeckte nach Verwesung, und ihre Zunge war so trocken, als hätte sie stundenlang an einem Holzbrett geleckt.
»Zwei Tage«, antwortete Chaghan. »Schön, dass du jetzt aufstehst.«
»Zwei Tage?«
Er zuckte die Achseln. »Ich muss wohl falsch dosiert haben. Wenigstens hat es dich nicht umgebracht.«
Rin rieb sich die trockenen Augen. Klümpchen verhärteten Schleims lösten sich aus ihren Augenwinkeln. Sie erhaschte einen Blick auf ihr Gesicht in dem Nachttischspiegel. Ihre Pupillen waren nicht rot – es dauerte immer eine Weile, bis sie wieder normal waren, wenn sie Opiate genommen hatte –, aber das Weiß ihrer Augen war blutunterlaufen, voller dicker, roter Adern, die sich wie Spinnweben ausbreiteten.
Langsam drangen Erinnerungen in ihr Bewusstsein, kämpften sich durch den Laudanumnebel und ordneten sich. Rin kniff die Augen zusammen und versuchte, das Geschehene von dem Geträumten zu trennen. Mit einem unguten Gefühl im Magen formten ihre Gedanken sich langsam zu Fragen. »Wo ist Unegen …?«
»Du hast mehr als die Hälfte seines Körpers verbrannt. Du hättest ihn fast umgebracht«, antwortete Chaghan barsch. Er hatte kein Mitleid für sie übrig. »Wir konnten ihn nicht mitnehmen, daher ist Enki bei ihm geblieben. Sie, äh, kommen nicht zurück.«
Rin blinzelte mehrmals, um klarer sehen zu können. Ihr drehte sich alles, sodass jede Bewegung sie schrecklich verwirrte. »Was? Warum?«
»Weil sie die Cike verlassen haben.«
Es dauerte mehrere Augenblicke, bis das bei ihr ankam.
»Aber – aber das können sie doch nicht machen!« Panik stieg in ihr auf und schnürte ihr die Brust zusammen. Enki war ihr einziger Arzt und Unegen ihr bester Spion. Ohne sie blieben von den Cike nur noch sechs übrig.
Sie konnte die Kaiserin nicht mit sechs Leuten töten.
»Du kannst ihnen wirklich keinen Vorwurf machen«, sagte Chaghan.
»Aber sie haben es geschworen!«
»Sie haben es Tyr geschworen. Sie haben es Altan geschworen. Sie haben keine Verpflichtung gegenüber jemand Unfähigem wie dir.« Chaghan legte den Kopf schräg. »Ich muss dir wohl nicht sagen, dass Daji davongekommen ist.«
Rin funkelte ihn an. »Ich dachte, du wärst auf meiner Seite.«
»Ich habe gesagt, dass ich dir helfe, Su Daji zu töten«, entgegnete er. »Ich habe nicht gesagt, dass ich dir die Hand halten werde, während du das Leben aller auf diesem Schiff in Gefahr bringst.«
»Aber die anderen …« Eine plötzliche Furcht packte sie. »Sie halten doch noch zu mir, oder? Sie sind loyal?«
»Es hat nichts mit Loyalität zu tun«, sagte er. »Sie haben Angst.«
»Vor mir?«
»Du kannst wirklich nicht über dich selbst hinaussehen, was?« Chaghan verzog den Mund. »Sie haben Angst vor sich selbst. Als Schamane ist man in diesem Reich sehr einsam, vor allem, wenn man nicht weiß, wann man den Verstand verliert.«
»Ich weiß. Das verstehe ich.«
»Du verstehst überhaupt nichts. Sie haben keine Angst davor, verrückt zu werden, weil sie wissen, dass das passiert und dass sie bald wie Feylen Gefangene in ihrem eigenen Körper sein werden. Und wenn dieser Tag kommt, wollen sie bei den einzigen anderen Menschen sein, die dem ein Ende machen können. Das ist der Grund, warum sie noch hier sind.«
Die Cike merzen die Cike aus, hatte Altan ihr einmal gesagt. Die Cike kümmern sich um sich selbst.
Das bedeutete, dass sie einander verteidigen würden. Es bedeutete außerdem, dass sie die Welt voreinander schützen würden. Die Cike waren wie Kinder, die Zirkus spielten und eine wacklige menschliche Pyramide bauten; sie verließen sich auf die anderen, dass sie sie hielten und nicht in den Abgrund stürzen ließen.
»Es ist deine Pflicht als Kommandantin, sie zu beschützen«, fuhr Chaghan fort. »Sie sind bei dir, weil sie Angst haben und nicht wissen, wo sie sonst hinsollen. Aber mit jeder dummen Entscheidung, die du triffst und deinem völligen Mangel an Selbstbeherrschung bringst du sie in Gefahr.«
Rin stöhnte und hielt sich den Kopf. Jedes Wort war wie ein Dolch in ihren Trommelfellen. Sie wusste, dass sie es vermasselt hatte, aber Chaghan schien es eine außerordentliche Freude zu bereiten, es ihr unter die Nase zu reiben. »Lass mich einfach allein.«
»Nein. Los, raus aus dem Bett und hör auf, dich wie eine verzogene Göre aufzuführen.«
»Chaghan, bitte …«
»Du bist ein Wrack.«
»Das weiß ich.«
»Ja, du weißt es seit Speer, aber es wird nicht besser mit dir, sondern schlimmer. Du versuchst, deine Probleme mit Opium zu lösen, und das macht dich kaputt.«
»Ich weiß«, flüsterte sie. »Es ist nur – er ist immer da, er schreit in meinem Kopf …«
»Dann beherrsche ihn.«
»Ich kann nicht.«
»Warum nicht?« Er stieß einen angewiderten Laut aus. »Altan konnte es.«
»Ich bin aber nicht Altan.« Sie konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. »Ist es das, was du mir sagen wolltest? Ich bin nicht so stark wie er, ich bin nicht so klug wie er, ich habe nicht die gleichen Fähigkeiten wie er …«
Er lachte rau. »Ja, das ist klar.«
»Dann übernimm du doch das Kommando. Du benimmst dich ja ohnehin schon so, als hättest du das Sagen, also warum übernimmst du nicht einfach den Posten? Mir ist das scheißegal.«
»Weil Altan dich zur Kommandantin bestimmt hat«, antwortete er schlicht. »Und unter uns gesagt, zumindest ich weiß, wie ich sein Vermächtnis zu respektieren habe.«
Das brachte sie zum Schweigen.
Er beugte sich vor. »Das ist die Bürde, die du tragen musst. Also wirst du lernen, dich zu beherrschen, und anfangen, sie zu beschützen.«
»Aber was ist, wenn das nicht möglich ist?«, fragte sie.
Er sah sie ohne Wimpernschlag mit seinen bleichen Augen an. »Ehrlich? Dann solltest du dich umbringen.«
Rin hatte keine Ahnung, was sie darauf antworten sollte.
»Wenn du denkst, dass du ihn nicht besiegen kannst, dann solltest du sterben«, sagte Chaghan. »Denn er wird dich zersetzen. Er wird deinen Körper als Leitung nutzen, und er wird alles niederbrennen, bis es nicht nur Zivilisten und Unegen sind, sondern alle in deiner Nähe, alles, was du je geliebt hast oder was dir wichtig war. Und wenn du deine Welt in Asche verwandelt hast, wirst du dir wünschen, du könntest sterben.«
Als sie endlich ihre körperliche Koordination wiedererlangt hatte und den Flur durchqueren konnte, ohne zu stolpern, ging sie zu den anderen in die Messe.
»Was ist das?« Ramsa spuckte etwas auf den Tisch. »Vogelscheiße?«
»Gojibeeren«, antwortete Baji. »Magst du sie nicht in deinem Haferbrei?«
»Da ist Schimmel drauf.«
»Hier ist überall Schimmel drauf.«
»Aber ich dachte, wir würden neue Vorräte bekommen«, jammerte Ramsa.
»Von welchem Geld?«, fragte Suni.
»Wir sind die Cike!«, rief Ramsa aus. »Wir hätten etwas stehlen können!«
»Na ja, es ist nicht so …« Baji brach ab, als er Rin in der Tür stehen sah. Ramsa und Suni folgten seinem Blick und verstummten.
Sie starrte sie sprachlos an. Sie hatte gedacht, sie wüsste, was sie ihnen sagen wollte, aber jetzt wollte sie nur noch weinen.
»Na, auch schon wach?«, sagte Ramsa schließlich. Er schob mit dem Fuß einen Stuhl unter dem Tisch hervor, damit sie sich setzen konnte. »Hast du Hunger? Du siehst grauenhaft aus.«
Sie blinzelte ihn an. Ihre Worte kamen als ein heiseres Flüstern heraus. »Ich wollte nur sagen …«
»Lass es«, unterbrach Baji sie.
»Aber ich wollte …«
»Lass es«, wiederholte Baji. »Ich weiß, dass es schwer ist. Irgendwann schaffst du es. Altan hat es geschafft.«
Suni nickte in stummer Zustimmung.
Rins Drang zu weinen wurde stärker.
»Setz dich«, lud Ramsa sie sanft ein. »Iss etwas.«
Sie schlurfte zur Theke und versuchte unbeholfen, eine Schale zu füllen. Haferbrei schwappte aus der Kelle aufs Deck. Sie ging zum Tisch, aber der Boden schwankte weiter. Schwer atmend fiel sie auf den Stuhl.
Niemand sagte etwas.
Sie warf einen Blick durch das Bullauge. Sie fuhren mit verblüffender Geschwindigkeit über kabbeliges Wasser. Die Küstenlinie war nirgendwo in Sicht. Eine Welle rollte unter den Planken, und Rin unterdrückte die dazugehörige Übelkeit.
»Haben wir wenigstens Yang Yuanfu erwischt?«, fragte sie nach einer Pause.





























