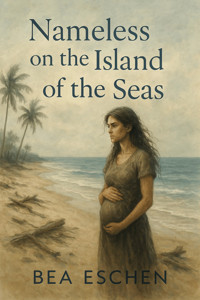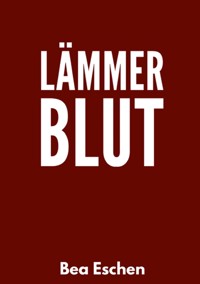Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
'Im Zeichen des Koru' erzählt eine fesselnde Saga von Generationen eines Maori-Stammes, von ihren Prüfungen, Triumphen und unzerstörbaren Bindungen, die die Zeit überdauern. Das Bündnis zwischen Amiri und Hahana lässt ein mächtiges Dorf entstehen, das jedoch durch die Ankunft europäischer Siedler dem Untergang geweiht ist. Hau, ein kühner Maori-Krieger, gründet daraufhin ein neues Dorf. Versteckt im dichten Dickicht an einer lebensspendenden Quelle wird es für den Stamm zu einem sicheren Ort unter der Kolonialherrschaft. Die Erzählung überquert Kontinente und folgt Waioras Suche nach den enthaupteten Köpfen seiner Vorfahren. Es führt ihn nach London, wo er eine einzigartige Freundschaft schließt, die die Kulturen der Maori und der Pakeha verbindet. Während sich die Geschichte über die Zeit hinweg entfaltet, erzählt sie von den Lieben, Verlusten und Erbschaften von Nachkommen wie Tāne, Manu Manuka, Ihaka und Connor. Sie erleben Ungerechtigkeiten, Weltkriege, verfolgen künstlerische Ambitionen und zeigen eine rührende Großzügigkeit gegenüber denen in Not. Das Buch ist geprägt von Liebe und dem stetigen Geist der Menschlichkeit, der allen Widrigkeiten trotzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Zeichen des Koru
Das Erbe einer Maori-Familie
Bea Eschen
Copyright © 2024 Bea Eschen
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung der Autorin in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen elektronischen oder mechanischen Mitteln, einschließlich Datenspeicherungs- und Abrufsystemen, reproduziert werden.
Cover-Design: #oronesq
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin: tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg
Inhalt
Vorwort
1. Hahana und Amiri
…
2. Manaia und Hau
…
3. Waiora
…
4. Hinewai und Tāne
…
5. Manu Manuka
…
6. Ihaka und Pare
…
7. Kindertransport
…
8. Evas Erinnerungen
9. Der Koru
10. Stammbaum
Weitere Bücher und Kurzgeschichten von Bea Eschen
Vorwort
Es handelt sich hierbei um ein fiktives Werk. Namen, Charaktere, Orte, Ereignisse und Vorfälle sind entweder das Ergebnis der Phantasie der Autorin oder werden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebendig oder tot, oder tatsächlichen Ereignissen, ist rein zufällig.
Die Einschübe zwischen den Kapiteln dienen dazu, den historischen Kontext mit der sich entfaltenden Erzählung zu verbinden.
Hahana und Amiri
Der Tag begann gut. Seitdem die beiden Maori-Stämme gemeinsam fischten, waren sie fast immer erfolgreich. Sie tauschten ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus, und nur die besten Fischer und die geeignetsten Kanus fuhren bei Flut hinaus, um ihre Netze auszuwerfen.
„Wie war das Fischen?“, rief Hahana über den schmalen Sandstreifen in Richtung des jungen Mannes, der gerade die letzten Reste des riesigen Wadennetzes in sein Kanu zog. Hahanas Begleiterinnen tauschten Blicke aus; unter ihnen galt es als respektlos, einen jungen Maori-Krieger des Nachbarstammes so anzusprechen.
Amiri blickte kurz auf. Ein Lächeln umspielte seine mit blauen Linien tätowierten Lippen. Wer ihn kannte, wusste, dass er Hahanas forsche Art mochte. Er antwortete nicht, denn er wusste, dass sie seine Reaktion bemerkt hatte. Die aufgeweckte junge Frau verstand es, seine Körpersprache, so dezent sie auch sein mochte, auch aus der Ferne zu lesen. Stattdessen wies er seine Männer an, die schweren Holzkisten mit dem morgendlichen Fang aus dem Boot zu tragen und dann das Kanu an den Sandstrand zu schleppen, wo es in einem langen, schmalen Schuppen bis zum nächsten Fang gelagert werden sollte.
Hahana war es egal, was ihre weiblichen Gefährten über sie dachten. Sie war die älteste Tochter des Stammesführers und seiner ersten Frau Ataahua und benahm sich auch so.
An diesem Tag trug sie einen ihrer schönsten Umhänge, den sie selbst aus Ngaro-Flachs gewebt hatte. Sie hatte den Stoff geschabt, geklopft und gewaschen, bis er wie Seide aussah. Das Kleidungsstück bestand aus zwei Teilen, von denen sie einen um die Taille und den anderen als Umhang um die Schultern trug. Hahana hatte langes, dichtes Haar, das sie am Hinterkopf scheitelte, so dass die beiden zusammengebundenen Strähnen ihre Brüste vollständig bedeckten. Da sie in ihrem Stamm ein hohes Ansehen genoss, trug sie eine Reihe von Halsketten aus Tierzähnen, bunten Vogelfedern, Streifen von Tierhäuten und getrockneten, bemalten Samen. Die Halsketten hielten das feine Gewand und die Haarsträhnen eng am Körper. Nur die teilweise entblößten Beine und das Gesicht zeigten die glatte, leicht olivfarbene Haut.
Das war das Erste, was Amiri bemerkte, als er aufschaute. Er wusste, dass sie ihr schönstes Kleid und die besten Ketten für ihn trug und ihm damit bestätigte, dass sie ein Auge auf ihn als zukünftigen Ehemann geworfen hatte.
Amiri selbst hatte keinen schlechten Ruf. Sein Vater war der älteste Krieger, der in jungen Jahren einen angreifenden Stamm besiegte, indem er die Männer als Sklaven und die Frauen als Arbeiterinnen nahm. Seitdem war sein Stamm wohlhabend. Die Siedlung hatte viele Hütten, ein großes Versammlungshaus und mehrere Vorratshäuser. Die Krieger waren gut mit Speeren ausgerüstet, die Frauen stellten die feinsten Fischernetze her und brachten gesunde Kinder zur Welt.
Bei den befreundeten Stämmen war es die Aufgabe der Frauen, an den Sandstrand zu gehen, den Fisch zu sammeln und ihn zum Räuchern und Trocknen in das Kochhaus zu bringen. Es war auch eine Gelegenheit für die jungen Leute, sich auszutauschen, denn normalerweise waren die Geschlechter mit ihren täglichen Aufgaben beschäftigt und blieben getrennt.
Als sich Hahana und ihre Begleiterinnen Amiri näherten, signalisierte er ihr, dass er etwas zu sagen habe. Neugierig ging sie auf ihn zu. Er sah sie mit lächelnden Augen an, bevor er sprach. „Ich werde unsere Väter bitten, Neuigkeiten über uns auszutauschen.“
Hahanas Herz erwärmte sich. Endlich sprach er sie formell an. Sie nickte, während ihr Blick über seine Gestalt wanderte. Er war ein hervorragender Krieger und Fischer. Seine Bauchmuskeln zeichneten sich durch ihre Festigkeit aus. Er hatte eine breite Brust, starke tätowierte Schultern und Arme und kräftige Unterschenkel; Beine, die ihn zu einem ausgezeichneten Krieger machten. Sein Gesicht war breit mit einem markanten Kinn, was ihm ein entschlossenes Aussehen verlieh. Sie mochte die Ruhe, die sich in seinen Augen spiegelte, und seine Freundlichkeit gegenüber allen, die ihn umgaben, seien es Sklaven, Familienmitglieder, Gleichaltrige oder Ältere.
Er war auch nicht unempfänglich für ihr Aussehen. Ihre wohlgeformten weiblichen Konturen entgingen ihm und den Männern seines Stammes nicht. Viele leckten sich die Lippen, wenn ihr Name in Gesprächen über mögliche Heiratsvereinbarungen fiel. Was Amiri betraf, so hatten schon viele, meist Frauen niederen Standes, versucht, sich bei ihm einzuschmeicheln. Er machte sich nichts aus ihnen und benutzte sie, um seine sexuellen Gelüste zu befriedigen.
Hahana war etwas Besonderes. Sie war die älteste Tochter des Stammesführers und ihr Moko-Kauae, die heilige weibliche Lippen- und Kinntätowierung, war aufwendig. Amiri glaubte fest daran, dass jede Frau ihr Moko-Kauae in der Nähe ihres Herzens trug und dass der Tätowierer es an die Oberfläche brachte, sobald die Frau dazu bereit war, normalerweise nach ihrer ersten Blutung.
Hahanas Kinntätowierung bestand aus einem komplizierten Muster verschiedener Spiralen und Linien, das sich bis zu ihrem Hals erstreckte und dort mit einem einzigartigen Zeichen endete, das die Schnitztradition ihres Stammes repräsentierte. Amiri konnte nicht anders, als stolz zu sein auf seine Zukunft mit dieser Frau von Rang und Schönheit und auf die Kinder, die sie ihm schenken würde.
Ihre Blicke trafen sich so leidenschaftlich, dass sie sich ineinander verkeilten. Keiner von ihnen wollte sich aus diesem schönen Moment lösen, bis Hahanas engste Freundin Irirangi an ihrem Kleid zupfte. „Lass uns anfangen, sonst schaffen wir heute unsere Aufgaben nicht.“
Hahana riss sich von Amiri los, der immer noch wie angewurzelt dastand und sie bewunderte.
„Geht“, rief er der sich entfernenden Gruppe junger Frauen nach, „Matariki, die Zeit der Besinnung und der Hoffnung naht. Unsere Stämme werden sich zum Hangi-Festmahl versammeln und das Essen aus dem Erdofen teilen. Dann werden wir uns wiedersehen.“
Matariki, das Erscheinen einer bestimmten Sterngruppe, bedeutete ihnen viel. Es war das Fest der Naturelemente, der Ernte und des geistigen und körperlichen Wohlbefindens der Stamm-Mitglieder. Matariki läutete auch eine Zeit des Gedenkens ein, in der sie die Geister ihrer Toten zu Sternen werden ließen.
Irirangi, Hahanas Kindheits- und Seelenfreundin, zuckte leicht zusammen, als Amiri Matariki erwähnte. Irirangi war die Spirituellste von Hahanas Begleiterinnen, und vor und während der Matariki-Zeremonien zog sie sich meist in sich zurück und sprach kaum ein Wort. Ihre Mutter war im vergangenen Winter gestorben. Bei dieser Gelegenheit würde sie um sie trauern, und das würde sie für die anderen noch unzugänglicher machen, als sie es ohnehin schon war.
Hahana nahm ihre Hand und drückte sie sanft. „Ich lasse dich nicht von meiner Seite.“
„Es ist nicht so, wie du denkst“, erwiderte Irirangi leise.
Hahana blieb wie angewurzelt stehen. „Wie meinst du das?“
„Lass mich dir heute Abend das Haar bürsten“, schlug Irirangi vor. Es war ihre Art, Hahana ein Gefühl von Verbundenheit zu vermitteln, eine Zeit, die sie nutzen würde, um ein Geheimnis oder tiefe Gefühle mitzuteilen.
Irirangi hatte papuanisches Blut, was ihrer Haut einen dunkleren Ton verlieh und ihre Gesichtszüge flacher erscheinen ließ als die der Maori polynesischer Abstammung. Trotz ihrer Herkunft sah Hahana nie einen Grund, sie abzuwerten. Dennoch unterschied sich Irirangis Denkweise deutlich von der ihrer Altersgenossinnen, was Hahana eher gefiel als missfiel, denn es machte ihre beste Freundin interessant. Irirangi war sehr einfühlsam und Hahana gegenüber immer loyal.
Der Abend kam schnell näher, während die Frauen mit der Zubereitung des Fisches beschäftigt waren. Die Wände des Kochhauses waren aus den krumm gewachsenen Stämmen von Farn-Bäumen gebaut, so dass der Rauch zwischen den Lücken entweichen konnte. Der köstliche Geruch von geräuchertem Fisch zog durch das Dorf und sorgte für Entspannung, denn alle wussten, dass es genug zu essen für die nahe Zukunft gab.
Müde machte sich Irirangi auf den Weg zu Hahanas Hütte. Den ganzen Tag hatte sie den Fisch vom Strand zum Kochhaus getragen. Dazu benutzte sie einen Korb, der mit zwei langen Riemen, die durch ein Querstück miteinander verbunden waren, auf ihrem Rücken befestigt war. Das Scheuern der Querstange hatte eine wunde Stelle an ihrer Wirbelsäule hinterlassen. Sie wusste, dass sie den nächsten Tag hauptsächlich mit Hahana verbringen würde, wenn sie sich erholen konnte. Ihre Freundin war immer gerecht und entgegenkommend. Dafür war sie Hahana dankbar.
Voller Spannung begrüßte Hahana ihre Freundin. Irirangi holte die Wildschweinborstenbürste, stellte sich hinter Hahana und begann, ihren Haarschopf so zu ordnen, dass sie ihn bürsten konnte. Sanft fuhr sie mit den Fingern durch das dichte Haar ihrer Freundin und legte es ihr auf den Rücken. Als sie die Bürste zum ersten Mal ansetzte, sagte sie: „Sei gewarnt, es könnte dir nicht gefallen, was ich dir erzählen werde.“
„Deine Worte sind wie immer von einer geheimnisvollen Wolke umgeben“, bemerkte Hahana, während sie die sanfte Berührung ihrer Freundin auf dem Rücken spürte.
Irirangi schluckte, bevor sie begann. „In meinem Traum, der kein Traum war, weil ich nicht aus ihm erwachte, sondern mich mitten im Wald wiederfand, sah ich eine Quelle aus den Wurzeln eines riesigen Baumes entspringen.“
„Warum sprichst du von einem Traum, wenn es keiner war?“, unterbrach Hahana.
„Weil es sich wie ein Erwachen anfühlte, als ich mich plötzlich im Wald in der Nähe der Quelle wiederfand.“
Das verwirrte Hahana. Aber sie nickte, um ihre Freundin nicht aufzuhalten.
„Die Quelle war ungewöhnlich, denn sie sprudelte aus mehreren Öffnungen rund um den unteren Teil des Baumes, dort, wo die teilweise freiliegenden Wurzeln im Boden verschwanden.“ Sie hielt einen Moment inne, um sich auf das Bürsten zu konzentrieren. „Als ich näher kam, kniete ich mich hin und berührte das Quellwasser. Es war sehr weich, fast wie die Daunen eines frisch geschlüpften Vogels. Es war auch warm und floss ganz langsam über meine Hand, nicht so flüssig wie Wasser, sondern eher wie Honig.“
Was hat das alles zu bedeuten? fragte sich Hahana und döste bei den Erzählungen ihrer Freundin ein. Das sanfte Streicheln über ihr Haar machte sie schläfrig.
„Und als ich dasaß und die seltsame Quelle bestaunte, erinnerte ich mich daran, warum ich an diesen Ort gekommen war“, fuhr Irirangi fort.
Hahana spürte ein Ziehen. Ein Knoten in ihrem so gepflegten Haar? „Warum warst du an diesem Ort?“, fragte sie, ein wenig verärgert über den schmerzhaften Moment.
„Ich habe dich gesucht. Du warst aus dem Dorf verschwunden und ich habe mir Sorgen gemacht.“
Hahana spürte, wie das Bürsten härter wurde.
„Weißt du, wann das alles passiert ist?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr Irirangi fort. „Es war Matariki und ich irrte in der Dunkelheit umher!“
Hahana drehte sich um und sah ihre Freundin erwartungsvoll an. „Aber ... hast du mich gefunden? Wo war ich?“
Ohne auf Hahanas Frage zu achten, fuhr Irirangi fort. „Der Mond kam hinter einer Wolke hervor und leuchtete mir hell entgegen. Über mir hörte ich einen Vogel zwitschern. Als ich aufblickte, breitete er seine Flügel aus und flog davon. Ich blickte ihm nach, um zu sehen, wohin er flog, aber der Vogel löste sich in Luft auf.“ Versunken in ihre Erinnerungen fuhr sie fort. „Als ich an mir herunterblickte, war ich mit den Schwanzfedern des Huias bedeckt. Das verwirrte mich, denn die seltenen Federn des Huias sind heilig und nur für unsere Ältesten bestimmt. Ich fragte mich, warum ich sie trug?“
„Ich weiß es nicht, Irirangi. Ich weiß nicht, warum du das Federkleid des Huias trugst“, flüsterte Hahana mit großen Augen.
„Aber das Schlimmste kam erst noch“, fuhr Irirangi fort. „Ich hörte ein Gurgeln aus den Wurzeln und sah, wie sich das Wasser in Blut verwandelte.“
„Der Geist des Taniwha“, schlussfolgerte Hahana ängstlich. „Du warst am Ort des Wasserdämons.“
Nein, ich werde mir mein Fest nicht von ihrer Vision verderben lassen, dachte Hahana, während sie sich innerlich auf die Vereinigungszeremonie vorbereitete. Irirangi hatte sie mehrmals gewarnt, dass ihr während Matariki etwas Schreckliches zustoßen würde, aber Hahana verdrängte es. Matariki war vorbei. Ihr war nichts passiert und sie wollte ihre Ängste vergessen. Außerdem, so hatten es die Ältesten der beiden Stämme beschlossen, sollten aufregende Dinge geschehen. Die Vereinigung von Hahana und Amiri würde die bereits befreundeten Stämme noch näher zusammenbringen. Man beschloss, die Befestigungen der beiden Dörfer zu erweitern, um sie gemeinsam zu umschließen. Diese Veränderung markierte nicht nur eine physische Einheit, sondern symbolisierte auch die Vereinigung der beiden Stämme. Gemeinsam waren sie eine unüberwindliche Macht.
Auch verbreitete sich die Nachricht von einem feindlichen Stamm, der von Süden nach Norden zog und auf seinem Weg alles mitnahm, was er begehrte: Frauen, Kinder, Lebensmittel, Kanus und Waffen. Die Vorbereitungen für den bevorstehenden Angriff mussten beschleunigt werden.
Als Hahana an ihrem besonderen Tag ihre Hütte verließ, wurde sie von ihren wartenden Gefährtinnen empfangen. Sie sollten sie zum Versammlungshaus begleiten, wo die Zeremonie stattfand.
„Wo ist Irirangi?“, fragte Hahana, irritiert.
„Sie ist gegangen, um die Blätter der Kawa-Kawa zu sammeln“, erklärte eine der Frauen.
Hahana blickte zu dem Pfad, der zu einer Baumgruppe führte, von der sie Irirangi zurückerwartete. Als sie sie kommen sah, entspannte sie sich.
„Das ist ein Glücksbringer, um schwanger zu werden und schlechte Energie zu vertreiben“, erklärte Irirangi und legte Hahana eine Handvoll Blätter, eines nach dem anderen, auf die Schultern.
Hahana ließ es geduldig über sich ergehen. „Meine Liebe, warum bist du immer so abergläubisch?“
„Es ist ein Teil von mir“, lächelte Irirangi.
Das seltene Lächeln ihrer Freundin ließ Hahanas Herz vor Freude hüpfen. Sie schloss daraus, dass Irirangi ihre unheilvolle Vision überwunden hatte. Nun konnte sie beruhigt ihre Gedanken auf das bevorstehende Fest lenken.
Zu diesem Anlass hatte ihre Mutter Ataahua eine Krone aus feinen Graswurzeln geflochten. Sie schmückte sie mit ausgefallenen Muscheln, Samen und Vogelfedern, die sie in den letzten Wochen gesammelt hatte. Die Krone war der schönste Kopfschmuck, den Hahana je besessen hatte, und sie saß fest auf ihrem Kopf. Passend zur Krone flocht Ataahua das Haar ihrer Tochter zu Zöpfen, die sie ebenfalls mit bunten Vogelfedern und Muscheln dekorierte.
Hahana trug an diesem Tag einen Mantel aus Kuri, einem kostbaren Hundefell. Dieses Kleidungsstück war ein Erbstück, das seit Generationen in ihrer Familie weitergegeben wurde. Ihre Mutter trug es bei der Vereinigung mit dem Stammeshäuptling, und auch Hahanas Großmutter soll es bei feierlichen Anlässen getragen haben. Hahana schätzte die besondere Qualität des Mantels, von dem man glaubte, dass er eine Energiequelle der Vorväter übertrug: Autorität, Macht, Ansehen, Status, Integrität — die Macht der Ahnen, die die Menschen und ihre Ländereien, von denen sie abhängig waren, umgab.
Als die Gruppe am Versammlungshaus ankam, sangen die Frauen beider Stämme in traditioneller Aufmachung mit kräftigen Stimmen. Sie unterstrichen die Bedeutung ihrer Worte, indem sie ihre flatternden Hände vor sich hielten. Es sollte die Hitzewellen symbolisieren, die die glühende Leidenschaft zwischen den Liebenden ausdrückte. Singend und tanzend stellten sie sich in einer Reihe auf und bildeten einen Korridor, durch den Hahana auf Amiri zuging, der am Ende groß, prächtig und lächelnd dastand.
Mit einer Gruppe von Ältesten beider Stämme war Amiri durch die heilige, lange, dunkelgrüne Feder des Moas, eines riesigen, ausgestorbenen Laufvogels, verbunden, die an seinem Gürtel hing. Am anderen Ende hielten ihn die Ältesten fest. Jeder berührte sie, und als Hahana schließlich Amiri erreicht hatte, ließen sie die Feder los.
In diesem Moment änderten die Frauen ihren Gesang. Er klang nun lauter und fröhlicher und signalisierte die bevorstehende Veränderung. Amiri streckte seine starken Arme aus, hob Hahana hoch und ging zwischen den laut singenden Frauen den Gang entlang zurück. Am Ende standen ihre beiden Mütter und begrüßten sie mit einem feierlichen Hongi. Tränen liefen Ataahua über die Wangen, als sie ihre Nase und Stirn an die von Hahana und Amiri drückte. Amiris Mutter ertrug den Moment gefasster, denn es schickte sich nicht, Gefühle zu zeigen, wenn man einen Sohn in die Vereinigung mit einer Frau entließ.
Die Formalitäten waren erledigt und das Festmahl begann. Die Erdöfen waren schon seit Tagen in Betrieb. Die Männer hatten dafür tassenförmige Löcher in den Boden gegraben und sie mit Brennholz gefüllt. Sie schichteten Steine auf das brennende Holz, und wenn sie glühten, harkten sie den nicht verbrannten Teil des Holzes heraus und gossen Wasser über die Glut. Dann legten sie Flachsmatten auf die heißen Steine und gossen noch mehr Wasser darüber. Nachdem der Fisch, der Silberaal, die Süßkartoffeln, das Gemüse und das Fleisch auf die Matten gelegt wurden, legten sie eine zweite Schicht aus Flachsmatten darüber. Dann bedeckten sie die Öfen mit Erde, und wenn der Dampf aufhörte zu entweichen, war das Essen fertig.
Zu den gebackenen Speisen gab es reichlich Brot aus sonnengetrockneten Farnwurzeln, die die Frauen Stück für Stück mit einem Handhammer auf einem Block zerhackten, in einem Mörser zu Mehl zerrieben, mit Wasser vermischten und in Scheiben über der Glut der vielen Feuer rösteten.
Das Fest war großartig. Die Atmosphäre war lebhaft, die Menschen mischten sich und lachten. Das köstliche Essen wurde in Körben in kleinen Gruppen herumgereicht. Hahana und Amiri saßen auf ihren geschmückten Matten, umgeben von ihren Familien und engsten Freunden. Sie wurden mit geflochtenen Körben, fein geschnitzten Waffen und kostbarem Schmuck aus grüner Jade beschenkt. Die Stammesältesten erzählten Geschichten von ihren Vorfahren und sprachen von der glänzenden Zukunft, die den vereinten Stämmen bevorstand. Es war ein Tag des Feiern, der Einheit und der Hoffnung für eine gute Zukunft. Als die Sonne unterging und die Sterne aufgingen, saßen die Menschen der beiden Stämme zufrieden und erfüllt zusammen. Sie waren zu einer Familie zusammengewachsen. Eine Zeit purer Freude, die sie für den Rest ihres Lebens in sich tragen würden.
Amiri hatte ein Zuhause für sie gebaut. Es stand abseits von den anderen, nahe dem Dorfeingang, gleich hinter der ersten Reihe der neuen Befestigungsanlagen. Da er der oberste Krieger war, war die Position seiner Hütte wichtig, denn er würde im Falle eines Überraschungsangriffs als einer der Ersten das Dorf verteidigen. Das Gerüst bestand aus langen Stöcken, an denen flachgedrückte Rupo-Bündel befestigt waren, um die Wände wind- und wasserdicht zu machen. Das Dach wurde mit sorgfältig zusammengenähten Blütenstängeln eines riesigen Grasbüschels gedeckt. Diese Materialien sorgten für Kühle im Sommer und Wärme im Winter.
Innen war die Hütte in zwei Räume unterteilt. Der erste diente als Wohn- und Arbeitsraum, in dem das Paar Gäste empfing und in dem Hahana an ihrer Weberei arbeitete. Das zweite Zimmer war ihr Schlafzimmer. Hier war der Boden mit einer weichen Schicht Farn bedeckt, und das Bettzeug bestand aus feinsten Flachsmatten. Die Wände waren mit kunstvollen Schnitzereien verziert, die die Geschichten ihrer Vorfahren und die Geschichte ihres Stammes darstellten. An der Seite befand sich ein kleiner Vorratsraum für Lebensmittel und Wertsachen. Insgesamt spiegelte die Hütte den Status von Amiri und Hahana und ihre Liebe zu Tradition und Kultur wider. Sie war ein Symbol für die Einheit und Stärke ihres Stammes und ihrer zukünftigen Familie.
Als sie ihre neue Hütte betraten, erfüllte sie Stolz und Erfüllung. Sie hatten gerade in einer traditionellen Maori-Zeremonie geheiratet und waren nun endlich allein, als Mann und Frau.
In der Mitte brannte ein kleines Feuer, das ein warmes, einladendes Licht verbreitete. Sie zogen ihre Kleider aus und legten sich einander gegenüber auf die Matten.
Amiri nahm Hahanas Hand, sah ihr in die Augen und spürte tiefe Liebe und Verbundenheit. Hahana lächelte ihn an und spürte, wie ihr Herz vor Rührung anschwoll. Sie begannen miteinander zu sprechen und teilten ihre Hoffnungen und Träume für die Zukunft. Während sie sprachen, spürten sie, wie die Energie zwischen ihnen stärker wurde.
„Ich möchte viele Kinder mit dir haben“, sagte er leise.
„Ich werde sie dir schenken. Wir werden unsere Ahnen stolz machen.“
Amiri nickte und verstummte, als er ihren schönen Körper betrachtete. Er beugte sich vor, um sie zu küssen, und als sich ihre Lippen trafen, spürten sie beide, wie ein Funke der Leidenschaft aufflammte. Sie hofften, dass dies erst der Anfang einer lebenslangen Liebe und des Glücks war.
Während sie sich liebten, fühlten sie eine tiefe Verbundenheit mit ihren Vorfahren und dem Land. Sie waren dankbar, dass sie die Traditionen ihres Volkes fortführen und gemeinsam ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen konnten.
Als sie sich später in den Armen lagen, fühlten sie sich gesegnet, einander gefunden zu haben. Zufrieden und glücklich schliefen sie ein.
* * *
Die Jahreszeit wechselte und das Wetter wurde kühler. Irirangis Segen manifestierte sich. Hahana stellte fest, dass sie schwanger war. Amiri war überglücklich und strahlte vor Stolz. Das ganze Dorf war von Freude erfüllt, als sie Hahanas strahlendes Gesicht sahen, das ihr Glück und ihre Liebe zu ihrem ungeborenen Kind widerspiegelte.
Doch alle sahen einer ungewissen Zukunft entgegen. Das Dorf war dem Angriff des wilden Stammes aus dem Süden ausgesetzt. Trotz der Bemühungen, die Siedlung mit einem tiefen Graben und einer Palisadenmauer zu schützen, waren die Wilden für ihre Gnadenlosigkeit bekannt und schreckten vor nichts zurück, um ihre Opfer bis aufs Letzte auszubeuten. Sie brannten ganze Dörfer nieder und richteten große Verwüstungen an.
Um sich auf den bevorstehenden Angriff vorzubereiten, versammelte Amiri seine Männer und bereitete sich auf den Kampf vor. Sie fertigten Hunderte von Speeren aus Manukaholz und Schwerter aus Walknochen mit rasiermesserscharfen Schneiden an. Die Frauen schneiderten Kriegsumhänge, die so dick und eng gewebt waren, dass die Spitze eines Speeres sie nicht durchdringen konnte. Amiri wusste, dass sie mit aller Kraft und Geschicklichkeit kämpfen mussten, um das Dorf zu verteidigen.
In einer kühlen, regnerischen Nacht wurde Amiri von einem seltsamen Geräusch geweckt, das von außerhalb des Dorfeingangs kam. Sofort alarmierte er seine Krieger, indem er den Ruf der Ruru nachahmte, einer Waldeule, die nachts oft zu hören ist. Dann weckte er Hahana, warf eine Decke über sie und brachte sie ins Versammlungshaus, wo sich die Ältesten, Frauen und Kinder zusammenfanden. Irirangi war auch dort und ging sofort auf Hahana zu. Hahanas Bauch war inzwischen auf eine beachtliche Größe angewachsen. Unbeholfen setzte sie sich auf den Boden und spreizte die Beine vor sich.
„Hier sind wir sicher“, versuchte Irirangi ihre Freundin zu beruhigen.
„Ich vertraue auf Amiris Fähigkeiten“, erwiderte Hahana und verfolgte, wie er eilig nach draußen verschwand.
Amiri rechnete damit, dass die Angreifer wild und unkontrollierbar sein würden. Sie würden die Festung umzingeln und von allen Seiten angreifen. Da er wusste, dass diese Männer keinen fairen Kampf schätzten, positionierte er seine Krieger rund um die Siedlung und befahl ihnen, jeden Eindringling zu töten.
Amiri und alle Männer seines Stammes trugen ihr ganzes Leben lang einen Speer. Die Waffe war nicht nur Teil ihrer Identität, sondern auch Symbol ihrer Kriegskultur. Ein Maori-Krieger wurde sogar mit seinem Speer begraben. Daher empfanden die Krieger weder Reue noch Bedauern, wenn sie ihre Waffen mit der Absicht zu töten einsetzten.
Sobald die Angreifer hinter der letzten Barriere auftauchten, fingen Amiris Krieger sie ein und durchbohrten ihnen ohne zu zögern das Herz. Die Krieger waren tapfer und stark im Kampf. Ihr Ansehen innerhalb des Stammes hing direkt von der Anzahl der Feinde ab, die sie im Kampf töteten. Deshalb war es ein Wettkampf unter ihnen, die Wilden zu überrumpeln und ihnen den Todesschlag zu geben.
Während seine Krieger an der Dorfgrenze kämpften, standen Amiri und seine schwer tätowierten Elitekämpfer am Eingang und führten den Haka auf, einen Kriegstanz. Dabei machten sie kraftvolle Bewegungen, rissen die Augen weit auf, streckten die Zungen heraus und stampften mit den Füßen. Zusammen mit dem rhythmischen und lauten Gesang versetzten sie die eingeschüchterten Angreifer in Angst und Schrecken. Mit dieser Entschlossenheit hatten die Wilden nicht gerechnet. Jeder, der versuchte, an Amiri und seinen Männern vorbeizukommen, wurde sofort getötet.
Keinem der Angreifer gelang es, in das Dorf einzudringen. Stattdessen vervielfachte sich die Zahl der Toten, die nach dem Angriff unter großem Jubel und Triumphgesängen außerhalb des Dorfes aufgestapelt und verbrannt wurden. Eine dichte Rauchwolke stieg in den Himmel und wurde vom Wind über das Land getragen. Der Geruch brennender Leichen lag in der Luft und erinnerte an die Stärke und Entschlossenheit der Krieger von Amiri.
* * *
Hahana wollte sich gerade hinlegen, als sie einen Schmerz in ihrem Unterleib spürte. Das ist der Beginn der Geburt meines ersten Kindes, dachte sie stolz und griff in den Beutel, den sie eigens dafür gewebt hatte, um zu sehen, ob alles drin war. Morgen früh bei Sonnenaufgang werde ich in den Wald aufbrechen, überlegte sie und fügte ein weiches Tuch hinzu, in das sie das Neugeborene für den Rückweg ins Dorf wickeln würde.
Obwohl Hahana die Tochter des Stammesführers war, wollte sie nicht mit der Tradition brechen und allein im Wald gebären, wie es alle anderen seit Generationen getan hatten. Sie hatte schon viele Frauen mit ihren Neugeborenen zurückkehren sehen, und als Frau ihres Standes freute sie sich auf den Moment, wenn sich die Frauen des Dorfes versammeln würden, um ihr Neugeborenes bei ihrer Rückkehr willkommen zu heißen.
Sie weinte eine unruhige Nacht lang und sehnte sich nach Amiri. Er war mit den Kriegern auf der Suche nach neuen Fischgründen. Warum hatte er gerade diese Zeit gewählt? Er hatte ihr erklärt, dass die Jahreszeit Strömungen verursachte, die die Fischschwärme in neue Richtungen trieben. Aber warum ausgerechnet zur Geburt ihres ersten Kindes?
Der ständige Schmerz überraschte sie, denn er war ungewöhnlich. Ihre Mutter hatte nichts davon gesagt, als sie sie auf die Geburt vorbereitete. Sollte sie zu ihr gehen und sie um Rat fragen? Aber nein, es war schon spät. Ataahua war krank und wollte schlafen. Hahana wollte niemanden stören und beschloss, sich allein darum zu kümmern. Das würde sie in den Augen der anderen stark machen.
Als es dämmerte, stand sie mühsam auf, nahm ihre Tasche und verließ leise das Dorf. Jeder Schritt tat ihr weh. Sie umklammerte ihren geschwollenen Bauch, um die zunehmenden Schmerzen zu ertragen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit fand Hahana einen abgelegenen Platz unter einem großen, alten Baum. Dort ließ sie sich nieder und bereitete sich auf die Geburt ihres Kindes vor. Doch als die ständigen Schmerzen in starke Wehen übergingen, wusste sie, dass etwas nicht stimmte. Die Schmerzen wurden unerträglich. Sie schrie, zuerst nach ihrer Mutter, dann nach Amiri, dann nach Irirangi. „Wo seid ihr, meine Lieben? Hört ihr mich nicht? Spürt ihr nicht meine Not?“ Zwischen Krämpfen und Wimmern erinnerte sie sich plötzlich an Irirangis Vision. Ihr wurde bewusst, dass dies ihre unmittelbare Wirklichkeit sein würde. Ein Weinkrampf überkam sie. „Es ist hoffnungslos, es ist vorherbestimmt. Es wird geschehen!“, schrie sie in die Leere des Waldes. „Ich werde sterben!“
Dann kam das Blut. In kürzester Zeit hatte sie alle Tücher verbraucht, die für diesen Zweck bestimmt waren. In Panik leerte sie ihren Beutel aus, um etwas zu finden, das die Blutung stillen konnte. Sie begann zu schwitzen, dann bekam sie Schüttelfrost. Die Kraft verließ sie schnell. Willenlos legte sie sich hin. „Wasser!“, rief sie, aber niemand brachte es ihr. „Wasser!“, schrie sie immer wieder, während das Blut weiter aus ihr herausströmte. Alles um sie herum war blutgetränkt. Sogar der Baum schien auf ihre verzweifelte Lage zu reagieren. Die welken Blätter fielen auf sie herab und saugten die rote Masse in sich auf. Sie verstand es als ein Zeichen ihrer aussichtslosen Lage. Ihr Kind musste geboren werden, sonst würde es in ihr sterben. Sie spürte, wie es strampelte, sich bewegte, sich drehte. Schneidende Wehen fuhren ihr durch den Bauch. „Was kann ich tun? Ich muss handeln - jetzt! Ich muss mein Kind retten - auch wenn ich sterbe, muss es leben!“ schrie sie zwischen heftigen Schmerzkrämpfen in sich hinein. Unfähig, sich aufzurichten, tastete sie um sich. „Da ist er“, flüsterte sie atemlos und griff nach dem spitzen Stein, den sie mitgebracht hatte, um die Nabelschnur ihres ersten Kindes zu durchtrennen.
Sie griff mit der rechten Hand nach dem Stein und setzte die Spitze ohne nachzudenken irgendwo an. Aber wo sollte sie anfangen? Mit der linken Hand tastete sie nach ihrem Nabel. Darunter stach sie zu. Erst vorsichtig, dann härter. Sie stöhnte unter dem stechenden Schmerz, der sie ohnmächtig zu machen drohte. Nein, nicht so! Ich muss hart zustechen und dann die Klinge nach unten ziehen. Nicht mein Kind erstechen. Wach bleiben! Mein Körpergefühl ausschalten! Mit einer blutigen Hand schlug sie sich ins Gesicht, schaute in die Baumkrone und zwang sich, sich zu konzentrieren. Beim zweiten Mal stach sie härter zu. Sie spürte, wie ihr das Blut den Bauch hinunterlief. Jetzt war sie drin. Sie schrie, keuchte, stöhnte, brüllte, als sie sich mit unmenschlicher Kraft aufschnitt. Etwas löste sich in ihr und quoll aus ihr heraus. Sie versuchte hinzusehen, aber es gelang ihr nicht, sich aufzurichten. Nicht einmal den Kopf konnte sie heben. Sie ließ den Stein fallen und griff in sich hinein. In der warmen Masse ihrer Eingeweide und Organe tastete sie, bis sie etwas Hartes spürte. Die Gebärmutter! Plötzlich hörte der Schmerz auf. Als wäre ihr Körper gelähmt. Ich sterbe