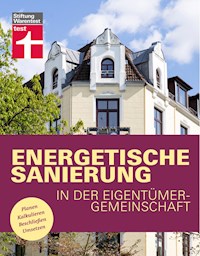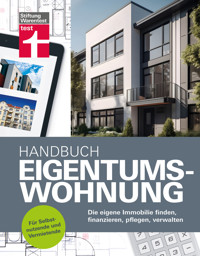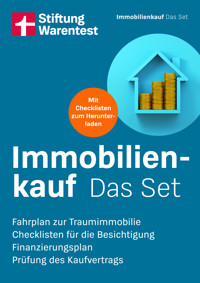
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der Immobilienkauf zählt zu den wichtigsten finanziellen Entscheidungen im Leben. Ob Immobilie kaufen als Kapitalanlage oder zur Eigennutzung – dieser Ratgeber beantwortet alle Fragen rund um den Erwerb von Haus oder Wohnung. Von der ersten Immobiliensuche über die Immobilienfinanzierung bis hin zur Schlüsselübergabe: Hier finden Kaufinteressenten alle relevanten Informationen verständlich und praxisnah aufbereitet. Das Buch bietet Orientierung im komplexen Marktumfeld und ist ein verlässlicher Begleiter beim Kauf von Wohnimmobilien. Es erklärt Schritt für Schritt den gesamten Kaufprozess – von der Besichtigung und Bewertung eines Objekts, über rechtliche Aspekte beim Kaufvertrag, bis hin zu Nebenkosten beim Immobilienkauf, steuerlichen Fragen (Steuern Immobilien) und Fördermöglichkeiten. Besonders hilfreich: der umfangreiche Praxisteil mit Checklisten für den Immobilienkauf, Tipps zum notwendigen Eigenkapital, Musterformularen und selbstrechnenden Tabellen. Damit behalten Sie den Überblick über alle Kosten und Planungsschritte. Ob als Handbuchzur Eigentumswohnung, Ratgeber für die erste Immobilieninvestition oder Nachschlagewerk zu Immobilienbüchern – dieses Werk zeigt, wie Sie erfolgreich in Immobilien investieren und den Traum vom Eigenheim oder die richtige Kapitalanlage verwirklichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eva Kafke
ImmobilienkaufDas Set
Fahrplan zur Traumimmobilie
Checklisten für die Besichtigung
Finanzierungsplan
Prüfung des Kaufvertrags
Inhalt
Kurzratgeber
Antworten auf zehn wichtige Fragen
Suchen und finden
Bedürfnisse und Wünsche
Finanzielle Möglichkeiten
Suchstrategie
Maklerbeauftragung
Immobilien vom Bauträger
Prüfen und besichtigen
Vorauswahl
Besichtigungstermin
Vorgehen bei Mietverhältnissen
Besonderheiten in Eigentümergemeinschaften
Kaufpreis bewerten und verhandeln
Finanzieren
Budgetplanung
Förderkredite und andere Darlehen
Vergleich von Kreditangeboten
Kreditvertrag
Kaufen
Notarin
Kaufvertrag
Kaufpreiszahlung und Eigentumsübergang
Erste Schritte als Eigentümer
Service
Adressen und hilfreiche Links
Register
Formulare, Checklisten und Vorlagen
ABedarfsanalyse
BKassensturz
CKaufnebenkosten
DMakler-Suchauftrag
EExposé und Grundriss prüfen
FUmfeld-Check
GBesichtigung
HWohnungseigentümergemeinschaft
IFinanzierungskonzept
JUnterlagen für das Kreditgespräch
KVergleich Kreditkonditionen
LÜbergabeprotokoll
Sie können die Formulare kostenlos online ausfüllen. Den Link finden Sie im Impressum.
Kurzratgeber
Von der Suche bis zum Kauf der eigenen Immobilie müssen Sie sich mit zahlreichen Themen auseinandersetzen, die Ihnen womöglich völlig fremd sind – beispielsweise mit Energieeffizienz-Werten, Grundbucheinträgen und Tilgungsplänen. In diesem Kurzratgeber können Sie sich einen ersten Überblick verschaffen. Sie bekommen kurze Antworten auf zehn wichtige Fragen, mit denen alle Hauskäufer konfrontiert sind.
Antworten auf zehn wichtige Fragen
Gut vorbereitet ist der Immobilienkauf kein Hexenwerk. Erste Fragen beantworten wir in diesem Kapitel zum Einstieg kurz und knapp.
Frage 1:Wie gehe ich die Immobiliensuche strategisch an?
Zuerst müssen Sie sich darüber im Klaren sein, was genau Sie suchen – Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung? Bestandsimmobilie oder Neubau vom Bauträger? Am besten erstellen Sie ein Suchprofil (siehe „Bedürfnisse und Wünsche“, ab S. 14). Darin halten Sie alle Bedürfnisse und Wünsche fest und notieren, welche Anforderungen das künftige Zuhause und das Umfeld erfüllen sollen. Dann loten Sie Ihre finanziellen Möglichkeiten aus, um eine Orientierung für den maximalen Kaufpreis zu haben. Auch terminliche Vorgaben wie beispielsweise ein bevorstehender Wechsel des Beschäftigungsortes sind zu berücksichtigen. Damit haben Sie alle Parameter, um gezielt Internetplattformen, Kleinanzeigen und Webseiten von Maklern zu durchforsten. Auch ein Kaufgesuch ist eine Überlegung wert (siehe „Suchstrategie“, ab S. 24).
Frage 2:Wie beurteile ich den energetischen Zustand eines Hauses?
Die energetische Qualität des Gebäudes bestimmt die Höhe der künftigen Betriebs-, aber auch Sanierungskosten und eventuelle Pflichten. Schon bei der Vorauswahl sollte dieser Faktor deshalb ein Kriterium sein. Einen Überblick über den Energiebedarf oder -verbrauch sowie die Treibhausgasemissionen liefert der Energieausweis. Spätestens bei der Besichtigung muss der Alt-Eigentümer diesen standardisierten Steckbrief vorlegen.
Die wichtigsten Kennwerte müssen bereits in der Verkaufsanzeige stehen. Hilfreich sind auch die durchschnittlichen Strom- und Heizenergieverbräuche der bisherigen Bewohner. Im Idealfall hat der Eigentümer in der jüngeren Vergangenheit eine Energieberatung in Anspruch genommen. Aus dem Bericht des Experten erkennen Sie den anstehenden Sanierungsbedarf (siehe „Vorauswahl“, ab S. 34).
Frage 3:Wie stelle ich sicher, dass ich kein Objekt mit verborgenen Schäden kaufe?
Der Kauf einer Bestandsimmobilie ist immer mit Risiken behaftet. Laien können beispielsweise erkennen, dass Putz abblättert. Aber sie können kaum einschätzen, ob eine unsachgemäße Installation des Putzes, die dauerhafte Durchfeuchtung der Wand dank einer fehlenden Abdichtung oder Setzungen im Gebäude die Ursache sind. Und sie können auch nicht beurteilen, mit welchen Kosten eine Sanierung verbunden ist. Sobald Sie ernsthaft Interesse an einem Altbau haben, ist es daher unbedingt ratsam, einen Besichtigungstermin mit einer unabhängigen Bauherrenberatung zu vereinbaren. Diese weiß und sieht mehr als Sie und haftet zudem für Mängel, die sie hätte erkennen müssen. Und sie kann – unabhängig von Mängeln – grob beziffern, mit welchen Sanierungskosten Sie rechnen müssen (siehe „Besichtigungstermin“, ab S. 44).
Frage 4:Was muss ich beim Erwerb einer vermieteten Immobilie beachten?
Wenn Sie das Objekt – zumindest zunächst – weiter vermieten und etwa zur Ergänzung der Altersvorsorge nutzen wollen, ist eine stabil vermietete Immobilie Gold wert. Lassen Sie sich vom Eigentümer den Mietvertrag zeigen und die regelmäßige Mietzahlung belegen. In einem Gespräch mit den Mietern bekommen Sie ein Gefühl dafür, ob auch das Miteinander stimmt. Wollen Sie hingegen selbst einziehen, kann ein bestehendes Mietverhältnis zum Problem werden. Sie können zwar wegen Eigenbedarf kündigen, sobald Sie Eigentümer sind. Doch das kostet Zeit, Geld und Nerven. Besser ist es, vor dem Kauf eine Einigung zu erzielen (siehe „Vorgehen bei Mietverhältnissen“, ab S. 48).
Frage 5:Wie erkenne ich, ob ein verlangter Preis angemessen ist?
Um das herauszufinden, müssen Sie sich ein wenig mit dem Immobilienmarkt vor Ort beschäftigen. Marktberichte und Preisspiegel, aber auch das regelmäßige Scannen von Onlineportalen hilft dabei, das Preisniveau einzuschätzen (siehe „Kaufpreis bewerten und verhandeln“, ab S. 54). Allerdings dürfen Sie dabei Ihren finanziellen Rahmen nicht aus dem Blick verlieren: Der verlangte Preis kann noch so angemessen sein – wenn er über Ihren Möglichkeiten liegt (siehe „Budgetplanung“, ab S. 60), schließt das den Kauf schnell aus.
Frage 6Mit welchen Kosten muss ich zusätzlich zum Kaufpreis rechnen?
Die Kaufnebenkosten sind ein erheblicher Posten: Grunderwerbsteuer und Notar- und Grundbuchkosten summieren sich – je nach Bundesland – auf 5 bis 8,5 Prozent des Kaufpreises. Notarund Grundbuchkosten addieren sich auf 1,5 bis 2 Prozent. Wird der Eigentümerwechsel von einer Maklerin vermittelt, kommen im Schnitt weitere 3,57 Prozentpunkte dazu (siehe „Finanzielle Möglichkeiten“, ab S. 19). Diese Kosten können und sollten Sie bereits berücksichtigen, wenn Sie den für Sie maximal verträglichen Kaufpreis festlegen. Bei einer Bestandsimmobilie entstehen weitere Kosten für eine Renovierung, oft gar für eine umfangreiche Sanierung. Laien können diese kaum realistisch einschätzen. Empfehlenswert ist daher immer, eine unabhängige Bauherrenberatung hinzuziehen, sobald eine Immobilie in die engere Wahl kommt.
Frage 7Wie viel Eigenkapital brauche ich?
Hauskäufer müssen in aller Regel einen Großteil des Kaufpreises fremdfinanzieren. Doch ohne Eigenkapital geht es nicht. Banken empfehlen einen Anteil von 20 bis 30 Prozent. Manch ein Institut macht sogar eine bestimmte Quote zur Bedingung. Der Grund: Das Eigenkapital dient der Bank als Sicherheit für das Darlehen. Je höher der Anteil des Eigenkapitals an den zu finanzierenden Kosten ist, desto besser fallen deshalb auch die Konditionen für den Kredit aus. Es lohnt sich also, möglichst alle kurz- oder mittelfristig verfügbaren Mittel einzusetzen. Verschaffen Sie sich dazu möglichst frühzeitig einen Überblick (siehe „Finanzielle Möglichkeiten“, ab S. 19).
Frage 8Wie finde ich ein passendes Darlehen?
Der Kaufpreis und Ihr Eigenkapital bestimmen den Finanzierungsbedarf und damit die Darlehenssumme. Als nächstes ermitteln Sie Ihre monatliche Belastbarkeit, also die potenzielle Kreditrate (siehe „Budgetplanung“, ab S. 60). Dann müssen Sie sich ein wenig mit den unterschiedlichen Formaten von Immobilienkrediten befassen und entscheiden, ob ein Annuitätendarlehen mit monatlich gleich bleibenden Raten aus Zinsen und Tilgung oder ein endfälliges Darlehen besser zu Ihnen passt. Auch über die Laufzeit sollten Sie sich Gedanken machen. Und zuletzt geht es darum, möglichst günstige Konditionen zu finden.
Der erste Blick gilt dabei den Förderkrediten der staatlichen KfW-Bank. Ergänzend oder auch alternativ kommt ein Darlehen der Hausbank infrage. Ratsam ist immer der Vergleich von mehreren Angeboten. Achten Sie darauf, den Banken dafür jeweils übereinstimmende Vorgaben zu machen (siehe „Förderkredite und andere Darlehen“, ab S. 62).
Frage 9Was macht die Notarin und wie finde ich die richtige?
Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt vor, dass ein Vertrag, durch den das Eigentum an einem Grundstück übertragen beziehungsweise erworben wird, von einer Notarin beurkundet wird. Die Notarin ist hoheitlich im Auftrag ihres Bundeslandes tätig. Ihre Aufgabe ist es, durch den gesamten Verkaufsprozess zu führen und beide Vertragspartner zu beraten. Dabei ist sie zu Unabhängigkeit verpflichtet. Die Notarin setzt den Kaufvertrag auf, beglaubigt ihn und kümmert sich um zahlreiche Formalien wie etwa um die Auflassungsvormerkung im Grundbuch, die Veräußerungsanzeige an das Finanzamt und die Abwicklung der Kaufpreiszahlung. Käufer und Verkäufer müssen sich darüber einigen, welche Notarin sie beauftragen. Häufig übernimmt das der Käufer, denn er muss in der Regel die Notarkosten zahlen (siehe „Notarin“, ab S. 72).
Frage 10Was sollte auf jeden Fall im Kaufvertrag stehen und was nicht?
Alle Angaben zum Objekt, dem Käufer und dem Verkäufer müssen genau und korrekt sein. Wichtig sind detaillierte Regeln zur Zahlweise und Fälligkeit des Kaufpreises. Die Auszahlung sollte erst erfolgen, wenn für Sie eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch steht. Darüber hinaus müssen Regelungen zum Zeitpunkt und zu den Bedingungen der Übergabe getroffen werden. Auch eine Auflistung bestehender Belastungen im Grundbuch gehört in den Kaufvertrag, etwaige Nebenabreden wie etwa die Übernahme einer Küche ebenfalls. Nicht im Kaufvertrag sollten hingegen die Maklerin mit ihrem Provisionsanspruch stehen, ferner eine Bemerkung der Notarin, sie habe das Grundbuch nicht eingesehen, oder die Behauptung von Mängelfreiheit oder die Freistellung des Verkäufers von allen Mängeln (siehe „Kaufvertrag“, ab S. 74).
Suchen und finden
Der Weg zum Eigenheim beginnt mit einer Analyse: Wie sehen Ihre Wünsche, Vorlieben und Abneigungen bezüglich des Gebäudes und seiner Lage aus? Welche finanziellen Möglichkeiten haben Sie? Es lohnt sich, Zeit zu investieren und ein individuelles Suchprofil zu entwickeln. Denn das dient bei der Suche, aber auch bei Besichtigungen und bei der Entscheidung für oder gegen einzelne Immobilien als Richtschnur.
Bedürfnisse und Wünsche
Wer auf Immobilienportalen unterwegs ist, kennt die gängige Struktur von Suchmaschinen: Gefragt werden Zimmer- und Quadratmeterzahl sowie ein regionaler Radius. Allein mit diesen Parametern erhält man jedoch eine Vielzahl von Treffern. Manch einer davon wird nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen.
Doch was sind die eigenen Wünsche und Bedürfnisse? Sie zu definieren, ist der erste Schritt, die Vorstufe zur Suche. Eine solche systematische Bedarfsanalyse hat gleich mehrere Vorteile: Zum einen treffen Sie in diesem Prozess manch eine richtungweisende Vorentscheidung. Zum anderen haben Sie ein einheitliches Suchraster und können gezielt die Filtermöglichkeiten in Portalen nutzen oder einer Maklerin Details nennen. Und schließlich haben Sie eine Schablone, um infrage kommende Objekte zu beurteilen. Am Anfang stehen zwei Grundsatzfragen: Einfamilienhaus oder Wohnung? Altbau oder Neubau? Dann geht es an die Details.
Einfamilienhaus oder Wohnung?
Der Traum vom Eigenheim ist für viele gleichbedeutend mit dem Traum von einem freistehenden Einfamilienhaus, einem Reihenhaus oder einer Doppelhaushälfte. Dort kann man als Eigentümer das Gebäude, die Wohnräume und das Grundstück nach Belieben nutzen, gestalten und auch umbauen. Als Eigentümer einer Wohnung hingegen ist man Teil einer sogenannten Eigentümergemeinschaft. Man verfügt nur bedingt über ein „eigenes Reich“. Das endet schon an der Wohnungstür. Alles, was im Gemeinschaftseigentum steht, müssen die Eigentümer mit ihren Miteigentümern und Wohnungsnachbarn teilen, und alle Entscheidungen dazu gemeinsam treffen. Das bringt Einschränkungen in der eigenen Freiheit mit sich und erfordert immer wieder Kompromisse. Manchen Kaufinteressenten wird das erst bewusst, wenn sie die Wohnung übernommen haben. Dann kann die Pflicht zum Miteinander zum Dauerärgernis werden. Besser ist es, vorher zu wissen, auf was man sich einlässt. So kann man sich entweder gegen diese Form des Eigentums entscheiden oder auch Fallstricke schon bei der Suche oder Besichtigung erkennen.
Bei der Entscheidung für die eine oder andere Eigentumsform spielen auch die persönlichen Lebensumstände und die weitere Lebensplanung eine große Rolle. Schon der gewünschte Standort kann die Richtung vorgeben. So gibt es etwa in zentralen Lagen in aller Regel nur wenige Einfamilienhäuser und wenn, dann meist auf handtuchkleinen Grundstücken. Junge Familien, die sich einen Garten zum Toben wünschen, finden ihr künftiges Haus leichter am Stadtrand oder im ländlichen Raum. Wer hingegen in der Innenstadt arbeitet oder dort seinen Lebensmittelpunkt hat und Wert auf kurze Wege legt oder ganz auf ein Auto verzichten möchte, hat dort zumeist eine größere Auswahl an Eigentumswohnungen.
Altbau oder Neubau?
Die zweite Richtungsentscheidung ist, ob ein bestehendes Haus bzw. eine Altbauwohnung oder aber ein Neubau anvisiert wird. Diese Entscheidung wirkt sich auf die Suchmöglichkeiten und Ansprechpartner, aber auch auf die eigene Zeit- und Budgetplanung aus.
Bestandsimmobilien punkten oft mit einer zentralen Lage, einem gewachsenen Wohnumfeld und einer ausgeprägten Infrastruktur. Umfangreiche künftige Veränderungen in der Nachbarschaft sind hier eher die Ausnahme. Das Gebäude ist real und nicht nur in einem Projektexposé vorhanden. Man kann die Immobilie erstens besichtigen und zweitens oft in einem überschaubaren Zeitraum übernehmen. Besonders beliebt sind sanierte Gründerzeitvillen oder Altbauwohnungen. Wer nach einem solchen Objekt sucht, wünscht sich das Flair gediegener Bürgerlichkeit kombiniert mit Komfortmerkmalen des 21. Jahrhunderts. Nachteilig kann jedoch bei diesen und allen anderen Altbauten der Zustand der Bausubstanz sein. Den gilt es auf jeden Fall vor dem Kauf genau zu prüfen. Bei einer sanierten Immobilie geht es dabei weniger um sichtbare Schäden und Abnutzungen wie etwa undichte Fenster oder eine veraltete Heizungsanlage, sondern vielmehr um jene Mängel, die man nicht sofort erkennt wie beispielsweise Wärmebrücken durch Balkone oder Loggien. Für Laien ist es nahezu unmöglich, bei einer Objektbesichtigung alle kritischen Punkte zu sehen. In einer unsanierten Immobilie ist immerhin manch eine Macke sichtbar, die in frisch gestrichenem Zustand möglicherweise verdeckt ist. Ein Sanierungsstau bedeutet in der Regel immer ein großes Kostenpaket und oft auch über Jahre verteilte Bautätigkeit. Das ist allerdings zugleich die Chance, eigene Vorstellungen einzubringen.
Neubauten entstehen manchmal in Baulücken, vor allem jedoch im Speckgürtel von Städten oder am Rande bereits bestehender Bebauung. Sie haben ein modernes Erscheinungsbild und einen hohen energetischen und sonstigen technischen Standard. Umfangreiche Sanierungen stehen damit in den kommenden Jahren nicht an. In neu erschlossenen Bebauungsgebieten finden Baufamilien schnell Anschluss und Kinder Spielgefährten.
Denkmalschutz
Ein Sonderfall unter den Bestandsimmobilien sind denkmalgeschützte Altbauten, also Gebäude, deren Erhalt aufgrund ihrer historischen, wissenschaftlichen, künstlerischen, technischen, städtebaulichen oder kulturlandschaftlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. Wer eine solche Immobilie kauft, verpflichtet sich für die Zukunft. Das Amt für Denkmalschutz der jeweiligen Gemeinde überwacht die Einhaltung des Denkmalschutzgesetzes. Die Behörde muss alle baulichen Veränderungen an der Denkmalimmobilie genehmigen; sie kann auch Maßnahmen untersagen oder Auflagen erteilen.
Der Staat unterstützt selbstnutzende Eigentümer von denkmalgeschützten Immobilien durch teils höhere Fördersätze und durch die Möglichkeit, 90 Prozent der Kosten für Sanierungen und Instandhaltungen verteilt über zehn Jahre mit jährlich 9 Prozent steuerlich geltend zu machen. Voraussetzung ist, dass der Käufer das Objekt erworben hat, bevor die Sanierung beginnt. Der Haken der Steuervergünstigungen ist: Erwerb und Sanierung müssen vorfinanziert werden. Wer sich auf ein solches Unterfangen einlässt, braucht also Geduld mit den Behörden, Kompromissbereitschaft bei der Umsetzung von baulichen Maßnahmen und ein gutes Finanzpolster.
Wer ein Grundstück erwirbt und ein Bauunternehmen mit dem Hausbau beauftragt, kann diesen nach seinen eigenen Vorstellungen planen. Ein solches Vorhaben ist ein derart umfangreiches Thema, dass es den Rahmen dieser Publikation sprengen würde. Alles, was Sie bei der Errichtung eines Wohnhauses beachten müssen, erfahren Sie in unserem Bauherren-Handbuch. Dort werden auch unterschiedliche Herangehensweisen und Eigentumsformen wie etwa Baugemeinschaften, auch Bauherrengemeinschaft genannt, erörtert.
In unserem Zusammenhang spielt eine andere Art von Neubauten eine Rolle, nämlich projektierte, im Bau befindliche oder gerade fertig gestellte Neubauten von einem Bauträger. Im Unterschied zum Bauunternehmen, das im Auftrag des Bauherrn auf dessen Grundstück tätig wird, ist ein Bauträger ein gewerbsmäßig tätiges Unternehmen, das auf eigenem Grund und Boden Gebäude errichtet und den Vertrieb dieser Immobilien organisiert. Meist veräußern Bauträger das Haus oder die Wohnungen samt Grundstück schlüsselfertig nach Fertigstellung. Doch der Vertrieb beginnt oft viel früher, mit Hilfe von Exposés und Hochglanzprospekten. Wenn Erwerbende frühzeitig involviert sind, können sie noch Einfluss auf bestimmte Details und Ausstattungsmerkmale nehmen. Wird die Immobilie erst dann zum Verkauf angeboten, wenn sie fertiggestellt ist, dann sind Änderungen nicht mehr ohne Weiteres möglich. Ein solches Objekt birgt für den Käufer ähnliche Risiken wie ein sanierter Altbau: Man sieht nur noch, was die Oberflächengewerke hinterlassen haben. Es ist zwar nützlich, sich das Exposé und die Baubeschreibung genau anzuschauen und die vorgefundenen Details der Wohnung damit zu vergleichen. Aber Laien entdecken bei diesem Abgleich nicht unbedingt, worauf es wirklich ankommt. Bei solchen Projekten ist eine fachkundige Begleitung unbedingt empfehlenswert.
Immobilie vom Bauträger
Der Kauf einer Bauträger-Immobilie hat viele Ähnlichkeiten mit dem einer Bestandsimmobilie, unterscheidet sich aber auch in wesentlichen Punkten. Deshalb gibt es in unserer Publikation mehrere Kapitel, die sich speziell mit der Suche nach einer Bauträger-Immobilie und mit Besonderheiten bei der Vertragsgestaltung befassen (siehe Kapitel „Immobilien vom Bauträger“, ab S. 31 sowie auf den folgenden Seiten: 52, 74ff. und 81.
Raumbedarf
Das künftige Zuhause soll ausreichend Platz für alle Bewohnerinnen und für alle gewünschten Nutzungen bieten. Das bedeutet nicht nur, dass die Wohnfläche insgesamt groß genug sein muss. Auch der Zuschnitt muss passen. Mit einem Raumprogramm stecken Sie den Rahmen ab.
Zuerst geht es an die Wohnräume: Wie viele Wohn-, Schlaf-, Kinder- und Arbeitsräume werden benötigt – heute, aber auch in 10 oder 20 Jahren? Ist ein separates Gästezimmer gewünscht? Soll die Küche vom Wohnbereich getrennt oder offen sein? Reicht ein Badezimmer aus, oder soll es ein Gäste-WC geben, womöglich mit Dusche? Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, den Raumbedarf mit Partnern, Familie und anderen Beteiligten zu besprechen, vor der Suche, aber auch immer wieder im Such- und Entscheidungsprozess. Sie werden vermutlich nicht sofort eine Immobilie finden, die all Ihren Wünschen ohne Abstriche gerecht wird. Dann müssen Sie Ihr ursprüngliches Raumprogramm anpassen.
Das Gebäude
Manche Kaufinteressenten konzentrieren sich bei der Suche auf die eigenen vier Wände und vernachlässigen dabei das Gebäude. Dabei spielt das mit seinen architektonischen und baulichen Besonderheiten eine wichtige Rolle für das Wohngefühl. In einem freistehenden Gründerzeithaus lebt es sich anders als in einem Reihenhaus aus den 70er-Jahren oder einem Bungalow. Eine Wohnung in einem Dreifamilienhaus unterscheidet sich enorm von einer Einheit in einem Block mit 30 Wohnungen. Hinzu kommt: Als Eigentümer wird man verantwortlich für das Gebäude samt seiner Außenanlagen. Dazu gehört auch, dass man im Laufe der Jahre notwendige Reparaturen und Sanierungen durchführen und bezahlen muss. Es ist also durchaus ratsam, sich bereits vor der konkreten Suche auch über Anforderungen an das Alter und die Konstruktion des Gebäudes Gedanken zu machen.
AUSFÜLLHINWEIS
Formular A: Bedarfsanalyse
Nutzen Sie unsere Checklisten als Gedankenstützen und Vorlage, um Ihr individuelles Suchprofil zu erarbeiten. Unter Umständen werden Sie im Laufe der Suche feststellen, dass wichtige Aspekte nicht berücksichtigt oder einzelne Vorgaben kaum realisierbar sind. Dann sollten Sie Ihre Checklisten überarbeiten.
Im ersten Block können Sie Ihr eigenes Raumprogramm entwickeln. In der ersten Spalte haben wir die häufigsten Raum- und Nutzungsarten aufgelistet. Hier finden Sie auch Alternativoptionen beispielsweise für die Aufteilung von Kochen und Wohnen. Wenn für Sie feststeht: Die Küche und ein Wohnraum mit Essplatz sollen voneinander getrennt sein, können Sie die Zeilen „Küche mit Essplatz“ und „Wohnen/Küche“ streichen. Damit schränken Sie allerdings von vornherein die Auswahl ein. Wenn Sie sich im Vorfeld über alle denkbaren Raumkonstellationen Gedanken gemacht haben, sind Sie flexibler. In der zweiten Spalte ordnen Sie den gewünschten Räumen einen Größenkorridor zu. Statistiken zu durchschnittlichen Raumgrößen gibt es nicht. Für Schlafräume ist eine Fläche von 11 bis 15 Quadratmetern üblich. Bei allen anderen Räumen hängt die erforderliche Größe stark von der oder den Nutzungen ab. Sie benötigen ein häusliches Arbeitszimmer, wollen aber auch gelegentlich Übernachtungsgäste unterbringen? Dann lassen sich diese beiden Nutzungen auf zwei Räume à 10 oder 12 Quadratmeter verteilen oder auch zusammen in einem 15 Quadratmeter großen Raum unterbringen. Das Portal fertighaus.de hat Richtwerte für Bauherren von Einfamilienhäusern zusammengetragen. Hilfreich ist auch ein Blick auf nullbarriere.de. Dort erfahren Sie, welche Raumgrößen DIN-Normen für ältere Menschen oder Rollstuhlfahrer vorsehen. Zu bedenken sind auch Räume und Flächen, die sich außerhalb des Wohnbereichs befinden, wie etwa Abstellplätze für Fahrzeuge, und natürlich die Grundstücksfläche. In der dritten Spalte unserer Checkliste ist Platz für Anmerkungen. Auch Prioritäten können hier notiert werden, etwa zur Himmelsausrichtung oder zur Lage der Räume zueinander.
Der zweite Block dient dazu, Anforderungen an das Gebäude, seine Architektur und technische Ausstattung festzuhalten.
Im dritten Block definieren Sie maximale Entfernungen zu Zielen, die für Sie wichtig sind. In der dritten Spalte können Sie beispielsweise eine Priorisierung vornehmen.
Der vierte und letzte Block erfasst Wünsche und Abneigungen bezüglich des Wohnumfeldes.
Viel Augenmerk verdient dabei die Haustechnik. Das Beispiel Heizung macht das besonders deutlich: Der Wohnkomfort, die Betriebskosten, die künftigen Sanierungskosten und die Wertentwicklung des Gebäudes hängen maßgeblich vom vorhandenen Wärmeerzeuger ab, natürlich in Kombination mit den Heizflächen und den Thermostaten in der Wohnung. Eine Wärmepumpe sorgt für Raumwärme? Prima. Auch mit einem Fernwärmeanschluss ist das Haus gut für die Wärmewende in den kommenden Jahren gewappnet. Steht hingegen ein betagter Gaskessel im Keller, dann ist die Heizungserneuerung aufgrund der Auflagen durch das Gebäudeenergiegesetz in Sichtweite.