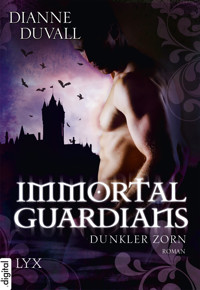
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Immortal-Guardians-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die junge Sterbliche Ami rettet dem achthundert Jahre alten Krieger Marcus im Kampf gegen Vampire das Leben. Obwohl Marcus ein notorischer Einzelgänger ist, weckt die hübsche Ami erstaunlich tiefe Gefühle in ihm. Doch Ami ist nicht, was sie zu sein scheint ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
DIANNE DUVALL
Immortal Guardians
Dunkler Zorn
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Frauke Lengermann
Für meine Familie
1
Nicht der kalte Wind war schuld daran, dass sich die Härchen in Amis Nacken aufstellten, sondern das leise, animalische Knurren, das er mit sich trug.
Ami erstarrte mit ausgestrecktem Arm, und ihre Finger umklammerten unwillkürlich die DVD-Hülle, die sie schon halb in den Rückgabeschlitz der Videothek gesteckt hatte. Gänsehaut breitete sich auf ihren Armen aus, und ihr Herz schlug schneller, während Adrenalin durch ihre Venen schoss.
Sie wirbelte herum, um den Verursacher des Warnrufs zur Rede zu stellen, und suchte mit den Augen den Parkplatz ab, der abgesehen von ihrem glänzenden schwarzen Tesla Roadster leer war. Orangefarbene und braune Blätter tanzten über den löchrigen Asphalt, der an einigen Stellen immer noch von einem mitternächtlichen Regenschauer glitzerte. Der Whole-Foods-Supermarkt, die Videothek und die anderen Geschäfte des Einkaufszentrums waren längst geschlossen.
Sie sah nach rechts. Die East Franklin Street lag verlassen da … alles war so, wie es sein sollte. Chapel Hill in North Carolina war eine Universitätsstadt. Es war ungefähr halb vier Uhr, Sonntagnacht (oder Montagmorgen), und die meisten Studenten und Professoren lagen friedlich schlummernd in ihren Betten, um fit zu sein für den nächsten Arbeitstag.
Ami entspannte ihre Finger, die immer noch die DVD-Hülle umklammerten, und ließ den Film mit einem kleinen Knall auf den Berg zurückgegebener Filme und Videospiele fallen. Sie machte einen Schritt auf ihr Auto zu.
Das Knurren erklang erneut – dieses Mal traf es sie wie ein Schlag und zerzauste ihr zusammen mit dem Nordwind die Ponyfransen. Kehlig und bedrohlich klingend, hatte dieser Laut nichts mit der Klage eines gereizten Schoßhündchens gemein, das zu lange den Elementen überlassen worden war. Kein Hund brachte solch ein Geräusch zustande. Es musste von einem größeren Tier stammen, der Stimmlage und dem Volumen nach von einem Löwen oder Tiger.
Etwas anderes antwortete mit einem Knurren, und auch wenn die Antwort nicht so beeindruckend klang wie der erste Laut, war er dennoch beunruhigend. Dann war noch ein Knurren zu hören. Und noch eins. Und noch eins.
Stirnrunzelnd griff Ami in ihre Jacke und zog die Neun-Millimeter-Glock heraus, die sie – Seth hatte darauf bestanden –, immer bei sich trug. Vorsichtig näherte sie sich der East Franklin Street.
Die Tierlaute kamen definitiv aus nördlicher Richtung. Nicht von den abgedunkelten Geschäften auf der gegenüberliegenden Straßenseite, sondern von dem Fahrradweg rechts davon, der sich zu ihrer Linken zwischen den Bäumen hindurchschlängelte. Das Knurren vibrierte inzwischen derart vor Aggression und Wut, dass man hätte meinen können, Zeuge eines Kampfs zwischen einem Löwen und einem Wolfsrudel zu werden.
Als sie das Ende des Parkplatzes erreichte, wurden die Knurrlaute von seltsamen Boing-, Pling- und Klonk-Geräuschen untermalt.
Ami sprintete über die Straße und rannte den Fahrradweg entlang. Zu ihrer Rechten ragten hochgewachsene Bäume wie Felsnadeln auf. Links von ihr gab es eine kleine Wiese mit einem Funkturm, doch das Gras ging schnell in Wald über. Als sie die Bäume erreichte, verlangsamte Ami ihre Schritte und tauchte in die Schatten ein. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. In der Nähe hörte sie das Plätschern eines in der Dunkelheit unsichtbaren Bachs.
Nachdem sie etwa fünfzehn Meter gegangen war, verließ sie den Pfad und schlängelte sich zwischen den Bäumen hindurch, wobei sie sich den Weg durch Unterholz bahnen musste. Zum Glück hatte es geregnet. Die Herbstblätter, die den Boden bedeckten, waren noch feucht und dämpften ihre Schritte.
Über ihr in der Luft flimmerten kleine Lichter, die sie an Glühwürmchen erinnerten. Bernsteinfarben. Grün. Blau. Silbern. Manche allein. Manche in Paaren. Sie flirrten und verschoben sich permanent, als wären sie unablässig in Bewegung.
Ami schluckte und fragte sich, ob sie den Verstand verloren hatte, als sich die Bäume plötzlich lichteten. Sie blieb stehen, die dichten Blätter verbargen sie vor neugierigen Blicken.
Vor ihr im Wald lag eine kleine Wiese, die die Bezeichnung Lichtung kaum verdiente, da sie kaum größer war als eine Autogarage. In der Mitte der kleinen Lichtung spielte sich eine Szene ab, die so unglaublich war, dass die meisten Menschen ihren Augen nicht getraut hätten.
Die flirrenden Lichter, die ihr zuvor im Wald aufgefallen waren, blitzten immer nur kurz in ihrem Gesichtsfeld auf, weil sich die dazugehörigen Gesichter so schnell bewegten, dass ihre Gestalten verschwammen. Männer, die ganz offensichtlich keine Sterblichen waren, fochten einen surrealen Kampf aus, der ihre spontane Phantasie vom Kampf des Löwen mit dem Wolfsrudel wieder auferstehen ließ.
Der Löwe – eine dunkle, bedrohliche Gestalt im Auge des Sturms –, hatte leuchtende, bernsteinfarbene Augen und langes, schwarzes Haar, das ihn wie Rauchtentakel umzüngelte, während er um die eigene Achse wirbelnd kämpfte. Er schlitzte seine Angreifer mit einer Geschwindigkeit auf, die sie an den Tasmanischen Teufel erinnerten, den sie in Darnells Warner-Brothers-Cartoons gesehen hatte.
Ein Unsterblicher Wächter.
Keine andere Kreatur hatte solche Reflexe.
Die Wölfe – mit ihrem Knurren machten sie ihren Namensvettern alle Ehre – hatten ebenfalls leuchtende Augen, die grün, blau und silbern funkelten. Wie der Unsterbliche steckten sie in dunklen Klamotten, hatten jedoch unterschiedliche Haarfarben. Blond. Braun. Kastanienbraun. Lang. Kurz. Geschoren. Stachelig. Zum Pferdeschwanz zusammengebunden.
Sie bewegten sich ebenfalls viel schneller als ein Mensch, schossen urplötzlich nach vorn und griffen den Unsterblichen mit Bewegungen an, die für das bloße Auge kaum wahrnehmbar waren. Dann wichen sie zurück, begutachteten ihre Verletzungen und gaben gleichzeitig ihren Kameraden Gelegenheit, den Gegner ebenfalls zu attackieren, während blutrote Flüssigkeit von ihren Klingen tropfte.
Vampire.
Auch wenn sie mit der Schnelligkeit und Stärke des Unsterblichen nicht mithalten konnten, waren die Vampire in der Überzahl … Acht gegen einen, falls sie richtig zählte. Das genaue Aussehen der einzelnen Vampire konnte Ami nur zwischen den Angriffspausen ausmachen.
Die äußerlichen Merkmale des Unsterblichen konnte sie nicht erkennen, da er ständig in Bewegung war und sein Schwert oder seine Saigabel schwang, um sich vor den aus allen Himmelsrichtungen kommenden Angriffen zu schützen.
Mit schwitzenden Handflächen griff Ami in die Hosentasche und zog den zylindrischen Aluminiumschalldämpfer heraus, der länger als die Glock selbst war. Ohne das Gefecht vor sich aus den Auge zu lassen, schraubte sie den Schalldämpfer auf den Pistolenlauf. Der erstklassige Dämpfer würde die Schallemissionen der Hohlspitzgeschosse zu einem dezenten Klick abmildern, sodass die Menschen, die jenseits des Waldes in ihren Häusern schlummerten, nicht geweckt wurden.
Sie hob die rechte Hand mit der Glock, stützte sie mit der linken Hand ab und wartete.
Eine in blitzschneller Bewegung verschwimmende Gestalt manifestierte sich zu einem blonden, blauäugigen Vampir, der mit bluttriefenden Bowiemessern am Rand des Kampfschauplatzes innehielt.
Ami feuerte zwei Schüsse ab.
Blut spritzte ihr aus der Halsschlagader und der Oberschenkelarterie des Vampirs entgegen. Der Blutsauger ließ seine Waffen fallen, stieß einen gurgelnden Laut aus und versuchte vergeblich, mit den Händen den Blutfluss aus seiner Halsschlagader zu stoppen.
Neben ihm tauchte ein Vampir mit zotteligem braunen Haar auf.
Ami feuerte drei weitere Schüsse ab und verletzte Zottelhaar an Hals-, Oberarm- und Oberschenkelarterie.
Die sechs übrigen Vampire stutzten und musterten ihre verletzten Kameraden, die schneller ausbluteten, als sie das Virus, mit dem alle Vampire infiziert waren, heilen konnte.
Der Unsterbliche Wächter erstarrte ebenfalls und sah Ami direkt in die Augen.
Für den Bruchteil einer Sekunde setzte ihr Herzschlag aus, und alles um sie herum versank in Dunkelheit. Alles – außer dem Unsterblichen.
Sein Haar war zur Ruhe gekommen und umfloss in wilder Unordnung seine Brust und den Rücken, wobei es einen Großteil seines Gesichts verdeckte. Seine Augen, die durch das dunkle Gewirr gerade noch zu sehen waren, glühten unter rabenschwarzen Augenbrauen in einem durchdringenden Bernsteinton. Dunkle Bartstoppeln bedeckten ein kräftiges Kinn, das von Blutflecken und Schrammen überzogen war. Seine vollen Lippen öffneten sich, er keuchte und stieß Knurrlaute aus, rang nach Luft und entblößte dabei weiße, schimmernde Reißzähne.
Dieser Augenblick war möglicherweise einer der seltsamsten in Marcus’ Leben.
Na ja, seltsam war vielleicht nicht das richtige Wort. Dass sich die Vampire neuerdings zu größeren Gruppen zusammenrotteten – das war seltsam. Dass sie clever genug waren, einen erfolgreichen Hinterhalt zu planen – das war seltsam. So etwas war ihm seit eineinhalb Jahren nicht mehr passiert.
Aber das hier …
War eine Überraschung.
Und es gab nicht viele Dinge, die Marcus Grayden überraschten.
Keuchend und aus unzähligen Wunden blutend, die noch keine Zeit zum Heilen gehabt hatten, starrte er die Ursache der unverhofften Kampfpause an.
Er hatte erwartet, einen Sekundanten in schwarzer Vampirjäger-Kluft zu sehen. Stattdessen richtete sich sein faszinierter Blick auf ein hübsches, eindeutig weibliches Gesicht, das von kupferfarbenen Locken umrahmt wurde. Große grüne, wie Smaragde funkelnde Augen lugten zwischen dem Blattwerk hervor und begegneten seinem Blick.
Sie war hübsch. Und klein. Und strahlte zumindest auf den ersten Blick Unschuld aus. Wäre da nicht die Pistole in ihrer ausgestreckten Hand, hätte er sich ernsthaft gefragt, ob ihm seine Einbildung einen Streich spielte.
Wer war diese Frau? Und was hatte sie hier zu suchen?
Den Klamotten nach war sie Zivilistin, sie trug eine bequeme Jeans, einen weiten Pullover und eine dunkle Jacke – aber warum schrie sie dann nicht um Hilfe? Warum schoss sie nicht auf ihn? Warum half sie ihm, statt zu flüchten oder auf ihn zu schießen?
Marcus hatte keine Zeit, länger über diese Fragen nachzudenken. Er spürte, dass die übrigen Vampire die zierliche Angreiferin geortet hatten, und holte mit dem Schwert aus.
Ami beobachtete, wie der Unsterbliche mit seinem glänzenden Kurzschwert auf den nächststehenden Vampir losging, während die Blutsauger die Baumreihen nach ihr absuchten. Der Kopf eines dritten Vampirs rollte in dem Moment zu Boden, als Ami klar wurde, dass seine Kumpane sie entdeckt hatten.
Vor Angst begann ihr Herz so wild zu schlagen, dass es ihr fast den Brustkorb sprengte. Drei der fünf verbliebenen Vampire nahmen den Kampf mit dem Unsterblichen wieder auf. Die anderen beiden nahmen sie aufs Korn.
Hektisch betätigte Ami den Abzug ihrer Pistole und feuerte blind auf die verschwimmenden Gestalten, die auf sie zustürmten. Zumindest versuchten sie, auf sie zuzustürmen. Hohlspitzgeschosse richteten eine Menge Schaden in Vampirkörpern an, wenn sie sich unter der Wucht des Aufschlags wie Blütenblätter öffneten. Und eine halbautomatische Waffe konnte in einem kurzen Zeitraum eine Unmenge Kugeln abfeuern.
Ami leerte das Magazin, indem sie die zehn verbleibenden Schüsse auf die Oberkörper ihrer Angreifer abfeuerte. Als die beiden Vampire stolpernd zum Stehen kamen, zog sie das Magazin heraus und ersetzte es durch ein neues.
Der Blutsauger mit dem kahlgeschorenen Schädel erholte sich schneller als seine Kumpane und stürzte sich mit einem animalischen Wutschrei auf sie, während sie das neue Magazin in das Griffstück der Glock schob.
In diesem Moment schob sich eine schemenhafte Gestalt zwischen sie und die Angreifer: Der Unsterbliche war so schnell, dass der Luftzug, den seine Bewegungen verursachten, ihr die Haarsträhnen aus dem Gesicht fegte. Der Vampir, der sie fast erreicht hatte, prallte zurück, als wäre er gegen eine Mauer gerannt. Tiefe Schnitte öffneten sich in seinem Fleisch, als das Kurzschwert des Unsterblichen aufblitzte.
Zitternd ließ Ami das Magazin einrasten, lud durch und legte an.
Zwei der drei Vampire, mit denen der Unsterbliche gekämpft hatte, waren gefallen. Und als dieser innehielt, gingen auch ihre beiden Angreifer wie Gummipuppen zu Boden. Der einzige Überlebende warf einen Blick auf die sich bereits zersetzenden Körper seiner Kameraden und floh.
Der Unsterbliche Wächter drehte sich zu ihr um.
Ami schluckte schwer, blickte zu ihm auf und verrenkte sich dabei fast den Nacken. Mit mehr als einem Meter achtzig überragte er ihre ein Meter fünfzig um mehrere Haupteslängen. Obwohl sie wusste, dass sie keine Angst zu haben brauchte, fürchtete sie sich immer noch. Dabei gehörten die Unsterblichen zu den Guten. Unsterbliche hatten sie vor den Monstern gerettet, die sie in einer eigens für sie geschaffenen Hölle gefangen gehalten hatten. Unsterbliche hatten sie aufgenommen und ihr geholfen, ihre geistige Gesundheit wiederzuerlangen, sie beschützt und ihr ein Zuhause gegeben.
Doch in der Zwischenzeit hatten jene Monster ihrer Psyche bereits irreparable Schäden zugefügt.
Ami zwang sich, die Pistole sinken zu lassen, aber sie schaffte es nicht, den Griff um die Waffe zu lockern oder mit dem Zittern aufzuhören.
Der Unsterbliche musterte sie schweigend. Seine Klamotten waren an unzähligen Stellen zerrissen und blutgetränkt, sowohl von seinem eigenen Blut als auch von dem seiner Angreifer. Obwohl er immer noch mehrere Kurzschwerter lässig in den Händen hielt, war der eine Arm eigenartig verdreht.
»Sind Sie verletzt?«, fragte er mit sanfter dunkler Stimme, in der ein britischer Akzent mitschwang.
Unfähig, auch nur ein Wort herauszubringen, schüttelte sie den Kopf.
»Sie wissen, was ich bin und was die da sind«, stellte er fest und deutete mit einer Kopfbewegung auf die toten Vampire.
»Ja«, krächzte sie, ihre Kehle war wie zugeschnürt. »Sind Sie … sind Sie in Ordnung?«
Er nickte und warf einen Blick in die Richtung, in die der flüchtende Vampir gerannt war. »Da ist noch einer, um den ich mich kümmern muss.«
»Wollen Sie, dass ich Verstärkung rufe?«
Ein grimmiges Lächeln ließ seine Mundwinkel nach oben wandern, während er ein paar Schritte in die Richtung machte, in die der Vampir verschwunden war. »Damit die anderen mir den Spaß verderben? Nein, danke.«
Irgendetwas an seinem Lächeln, an der düsteren Erwartung, die sich in seinen attraktiven Gesichtszügen spiegelte, bewirkte, dass sich Schmetterlinge in ihrem Bauch regten.
»Irre ich mich, oder sind Sie eine Sekundantin?«
Sie öffnete den Mund, um zu verneinen.
Sogenannte Sekundanten waren Menschen, die mit Unsterblichen zusammenarbeiteten und diese tagsüber beschützten, wenn das Sonnenlicht eine Gefahr für sie darstellte. Sie wurden sorgfältig auf ihre Loyalität hin geprüft und mussten ein umfangreiches Kampfsport- und Waffentraining absolvieren. Sie erinnerten ziemlich stark an Geheimdienstagenten und schreckten nicht davor zurück, für ihren Wächter ihr Leben zu opfern … was auch der Grund war, warum sie meistens männlich waren. Offenbar waren die meisten Unsterblichen ziemlich altmodisch und fanden den Gedanken unerträglich, dass eine Frau ihr Leben für sie gab.
Das plötzliche Klingeln ihres Handys ließ Ami zusammenzucken, und sie schloss den Mund, ohne die Frage zu beantworten.
Der Unsterbliche spähte über die Schulter in die Dunkelheit, und seine Ungeduld, endlich die Verfolgung aufzunehmen, war offensichtlich.
Als sie sah, wer der Anrufer war, unterdrückte Ami nur mühsam ein Stöhnen. »Gehen Sie schon«, ermutigte sie den Unsterblichen und deutete auf die in sich zusammenschrumpelnden Körper der Vampire. Das parasitäre Virus, mit dem alle Vampire infiziert waren, fraß ihre Körper von innen auf – Ausdruck des verzweifelten Versuchs, am Leben zu bleiben. »Um die hier kümmere ich mich.«
Er zögerte.
Ami hob das Handy ans Ohr und versuchte trotz ihrer Aufgewühltheit, so normal wie möglich zu klingen. »Hi, Seth.«
»Hallo, Süße.«
Der Unsterbliche zog eine Augenbraue in die Höhe. Dank seines übernatürlich scharfen Gehörs hatte er garantiert gehört, mit welchen Worten der Anführer der Unsterblichen Wächter sie begrüßt hatte … und auch sein liebevoller Unterton war ihm wahrscheinlich nicht entgangen.
»Du bist spät dran. Wo bleibst du?«, fragte Seth.
»Ich, äh …« Ami warf einen schnellen Blick auf die blutbespritzte Lichtung, als ihr einfiel, wie schnell sich Seth um sie sorgte und entschied, ihn lieber nicht zu beunruhigen. »Ich … habe nur kurz einen Zwischenstopp eingelegt, um die Filme zurückzugeben, die Darnell und ich uns letzte Nacht ausgeliehen haben.«
Das unvermittelte Grinsen, das sich auf dem Gesicht des Unsterblichen ausbreitete, stand ihm so gut, dass es Ami die Sprache verschlug.
Die Tatsache, dass sie Seth und Darnell – den Sekundanten eines der mächtigsten Unsterblichen – kannte, schien ihn zu beruhigen. Offenbar amüsiert darüber, dass sie Seths Frage ausgewichen war, zwinkerte er ihr zu, hob großspurig mit dem unverletzten Arm das Schwert zum Gruß und löste sich dann, dem flüchtigen Vampir nachsetzend, schlagartig in Luft auf.
Die unwillkürliche Anspannung, die jeden Muskel ihres Körpers in Alarmbereitschaft versetzt hatte, ließ nach, und sie fühlte sich leicht benommen.
»Alles in Ordnung, Ami?«
»Ja, mir geht’s gut«, erwiderte sie und meinte es so.
Sie hatte es geschafft, einem Fremden gegenüberzutreten – einem fremden Mann –, ohne von der Panik überwältigt zu werden, die sie in solchen Situationen normalerweise überfiel. Sie war weder schreiend davongelaufen, noch hatte sie sich in ein zitterndes Häufchen Elend verwandelt. Und nicht nur das – sie hatte besagtem Fremden auch noch geholfen, eine Gruppe angreifender Vampire unschädlich zu machen.
Freude und Erleichterung durchströmten sie. Seth hatte recht behalten. Sie befand sich wirklich auf dem Weg der Besserung. Die Monster hatten sie nicht brechen können.
»Mir geht’s gut«, wiederholte sie, und sie war so glücklich, dass sie am liebsten ein Freudentänzchen aufgeführt hätte. »Tut mir leid, dass ich spät dran bin. Ich komme so schnell wie möglich.«
»Alles klar. Sei vorsichtig.«
»Das werde ich«, flötete sie und schob das Handy mit einem Grinsen zurück in die Hosentasche. Dann schraubte sie den Schalldämpfer ab, steckte ihn weg und ließ die Glock zurück ins Holster gleiten.
Als sie den Schatten der Bäume verließ, um sich den verrottenden Vampirleichen zu nähern, verwandelte sich ihr Grinsen in eine Grimasse. Igitt. Sie hatte noch nie zuvor mit eigenen Augen gesehen, was mit einem Vampir passierte, wenn er getötet wurde. Der Geruch erinnerte an einen überquellenden Müllcontainer im Hochsommer. Die Vampire, die sie erschossen hatte, hatten sich inzwischen vollständig aufgelöst und nur blutbefleckte Kleidung und ihre Waffen hinterlassen. Die Übrigen waren dabei, im Rekordtempo zu zerfallen, sie schrumpften ein wie Mumien und fielen dann in sich zusammen wie Ballons, aus denen die Luft herausgelassen worden war.
Sie erschauderte.
Geschah mit einem Unsterblichen dasselbe, wenn er getötet wurde?
Vampire und Unsterbliche waren beide mit demselben seltenen Virus infiziert, das ihr Immunsystem zuerst überwältigt und schließlich ersetzt hatte. Durch das Virus waren sie nicht nur stärker und schneller, sondern lebten auch länger, ihre Wunden verheilten in Rekordtempo, und sie alterten nicht. Alles gute Dinge. Doch leider hatte die Infektion auch zur Folge, dass sie lichtempfindlicher waren und unter schwerer Anämie litten.
Wie auch immer, in einer Sache unterschieden sich Unsterbliche und Vampire grundsätzlich voneinander: Im Gegensatz zu Vampiren waren Unsterbliche schon zu Lebzeiten außergewöhnlich gewesen, bevor sie mit dem Virus infiziert worden waren.
Sie waren mit einer höher entwickelten und komplexeren DNA geboren worden als Sterbliche und nannten sich selbst die Begabten … zumindest vor ihrer Infektion. Den Grund für ihre genetische Andersartigkeit kannten sie nicht. Sie wussten nur, dass die Menge zusätzlicher DNA-Informationen, die sie besaßen, sie mit wundersamen Fähigkeiten und Begabungen ausstatteten und ihre Körper befähigten, das Virus so zu verändern, dass die negativen Eigenschaften ausgeschaltet wurden.
Deshalb fielen die Unsterblichen auch nicht dem Wahnsinn zum Opfer, an dem die Vampire erkrankten, wenn ihre Gehirne von den fortwährenden Angriffen des Virus zerstört wurden. Von dem tiefen, komaähnlichen Schlaf, der die Vampire überkam, sobald die Sonne aufging, blieben sie ebenfalls verschont.
Mit gerümpfter Nase und spitzen Fingern hob Ami eins der blutigen Hemden auf. Unsterbliche überstanden auch extreme Blutverluste, und statt zu sterben, fielen sie – ähnlich wie Bärtierchen – in eine Art Starre oder Winterschlaf, bis eine Blutquelle ihren Weg kreuzte.
»Es führt wohl kein Weg dran vorbei«, brummte sie. Da sie keine Handschuhe dabeihatte, musste sie sich wohl oder übel die Hände schmutzig machen. Die Klamotten würde sie unauffällig in den Müllcontainern des Einkaufszentrums entsorgen. Die klebrigen, blutverkrusteten Waffen würde sie einsammeln und in den Kofferraum ihres Roadsters packen. Nur an der blutgetränkten Erde auf der Lichtung konnte sie nichts ändern. Hoffentlich regnete es bald, damit das Blut weggewaschen wurde.
Sie kniete sich auf den Boden und begann damit, die Kleider zu einem stinkenden Haufen aufzutürmen.
Zum Glück hatte sie Hygienetücher im Auto.
Marcus stolperte durch die Eingangstür seines zweistöckigen Hauses, warf die Tür hinter sich ins Schloss und lehnte sich gegen das kühle Holz.
Acht. Acht Vampire hatten zusammengearbeitet und ihn in einer überraschend wohldurchdachten Offensive angegriffen. Keine Spur von dem üblichen plumpen, wild um sich schlagenden Kampfstil, den ihresgleichen sonst an den Tag legte. Tatsächlich hatten diese Blutsauger gewirkt, als hätte sie jemand trainiert.
Er schnaubte. Nicht dass ihre armseligen Fähigkeiten sich mit den seinen hätten messen können. Er war immerhin von einem Meister des Schwertkampfs ausgebildet worden. Kein reißzahnbewehrter Nichtsnutz mit einer Machete konnte es ernsthaft mit ihm aufnehmen.
Erschöpft ließ er den Kopf gegen die Tür sinken.
Der Blutsauger, den er nach der Begegnung mit der rothaarigen Elfe gejagt hatte, hatte ihn zu zwei weiteren Vertretern seiner Art geführt. Zwei von ihnen hatten sich ihm dreist entgegengestellt. Der dritte war abgehauen, während Marcus seinen beiden Kumpanen den Garaus gemacht hatte.
Marcus hätte die Verfolgung aufnehmen können … schon wieder … doch in Anbetracht seiner schmerzenden Wunden hatte er beschlossen, es für diese Nacht gut sein zu lassen. Er würde sich den Dreckskerl morgen schnappen. Oder in der Nacht danach.
Ein stetiges Plop Plop Plop erregte seine Aufmerksamkeit. Suchend sah er an sich hinunter und entdeckte mehrere dunkelrote Pfützen, die sich zu seinen Füßen bildeten.
Mit einem Stöhnen marschierte er Richtung Küche, schälte sich aus seinem langen Mantel und ließ ihn auf den Bambusboden fallen. Sein dunkles T-Shirt und die Jeans waren voller Löcher und Risse. Wie die meisten Unsterblichen trug er bei der Jagd schwarze Kleidung, damit unter Schlaflosigkeit leidende oder neugierige Nachbarn nicht das Blut auf seinen Klamotten bemerkten, wenn er in der Morgendämmerung nach Hause zurückkehrte.
Und in dieser Nacht gab es jede Menge davon.
Verletzungen, die schon längst hätten verheilen müssen und es nur deshalb noch nicht getan hatten, weil der Blutverlust zu groß gewesen war, bedeckten seinen ganzen Körper. Einer der Blutsauger hatte ihm die Schulter ausgekugelt. Und das heftige Pochen in seinem linken Bein legte nahe, dass sein Wadenbein gebrochen war.
Marcus brauchte eine gefühlte halbe Stunde, um humpelnd die Kücheninsel seiner geräumigen Küche zu umrunden. Er öffnete den Kühlschrank, beugte sich ächzend vor, zog das speziell für diese Zwecke konstruierte Fleischfach auf und fluchte wüst.
Leer.
Er schloss das Fach, warf die Kühlschranktür zu und dachte über die Alternativen nach.
Er könnte nach draußen gehen und seinen Hunger auf althergebrachte Art stillen – oder klein beigeben und sich eingestehen, dass er Hilfe brauchte.
Marcus hinkte zurück ins Wohnzimmer, wobei er den Eingangsbereich ein weiteres Mal durchqueren musste.
Sobald er neue Kraft gesammelt hatte, würde er sich noch einmal auf die Socken machen.
Vorsichtig ließ er sich auf sein gemütliches cremefarbenes Sofa sinken, schloss die Augen und seufzte schwer.
Ding dong.
Sofort riss er die Augen wieder auf. Wer zum Henker klingelte morgens um – er warf einen Blick auf die Uhr, die auf dem Kaminsims stand – 04:31 an seiner Haustür? Und warum hatte er nicht bemerkt, dass sich jemand seinem Haus näherte? War er wirklich so erschöpft?
Ding dong.
Da er keinen Besuch erwartete, konnte das nichts Gutes bedeuten.
Ding dong.
Falls sich der Fremde entschloss, von der Türklingel abzulassen und stattdessen einen Einbruchsversuch zu starten, würde er sein blaues Wunder erleben.
Der Gedanke ließ Marcus aufleben. Vielleicht musste er gar nicht mehr raus. Er könnte seine Reißzähne einfach in den Einbrecher schlagen.
Ding dong.
Warum schritt dieser behämmerte Einbrecher nicht endlich zur Tat und versuchte, ins Haus einzudringen?
Ding dong ding dong ding dong.
Marcus erhob sich knurrend vom Sofa und schlich zur Tür.
Okay, von Schleichen konnte keine Rede sein. Es war mehr ein gequältes Stolpern, das er ohne Zweifel noch bereuen würde, aber seine Schmerzen und die Türklingel trieben ihn zur Weißglut.
Bereit, seinem Peiniger die Meinung zu sagen, riss er die Tür auf und hielt verblüfft inne. »Oh«, brummte er. »Du bist das.«
Unbeeindruckt von Marcus’ mürrischer Begrüßung hob der Besucher eine dunkle Augenbraue. »Ist wohl heute nicht dein bester Tag, wie?«
Mit einem missmutigen Knurren drehte sich Marcus um und schleppte sich zurück zur Couch.
Seth kam herein und schloss die Tür hinter sich. »Wie wär’s, wenn du mir erzählst, was heute Nacht passiert ist?«
»Gib mir eine Minute«, stöhnte Marcus und knirschte vor Schmerzen mit den Zähnen. Oh ja. Sein Bein war definitiv gebrochen.
»Wie du meinst«, erwiderte Seth mit einem Akzent, den Marcus nie genau einordnen konnte. Russland? Mittlerer Osten? Südafrika? Nein, nichts davon schien richtig hinzuhauen.
Er beobachtete, wie Seth an ihm vorbeischlenderte, wobei er die Hände hinter dem Rücken verschränkte. Mit einem Meter fünfundachtzig war Marcus schon ziemlich groß, aber Seth überragte ihn noch einmal um eine Kopflänge. Sein welliges, rabenschwarzes Haar, das er zum Pferdeschwanz zusammengebunden trug, reichte ihm fast bist zum Hintern. Er hatte eine gerade Nase, ein kräftiges Kinn und Augen, die so dunkel waren, dass sie fast schwarz wirkten.
Wie Marcus trug er dunkle Kleidung: schwarze Hosen und einen schwarzen Pulli mit angedeutetem Rollkragen. Einen langen schwarzen Mantel. Alles von erstklassiger Qualität und maßgeschneidert. Was von seiner Haut zu sehen war, war braun gebrannt und makellos.
Marcus musterte ihn grimmig. Seth hätte ihm wenigstens Hilfe anbieten können.
»Ich will dir etwas vor Augen führen«, erklärte Seth.
Na toll. »Hör’ auf, meine Gedanken zu lesen.«
»Sobald du sie in den Griff bekommen hast.«
Ohne zu antworten, humpelte Marcus weiter in Richtung Wohnzimmer.
Seth war der selbsternannte Anführer der Unsterblichen Wächter. Er war ihr Mentor und derjenige, der sie bestrafte, wenn sie die Grenzen verletzten, die er ihnen setzte.
Er hatte sie – einen nach dem anderen – ausfindig gemacht, als sie noch frischgebackene Unsterbliche waren. Die meisten waren gegen ihren Willen mit dem Virus infiziert worden, und Seth war derjenige gewesen, der ihnen den Weg in ein neues Leben gezeigt hatte. Er hatte ihnen erklärt, was Vampirismus war: Das Resultat eines parasitären – oder, wie er es ausdrückte, symbiotischen – Virus, das ihre Körper auf wundersame Weise veränderte. Der Nachteil war, dass sie ihn regelmäßig mit Blut versorgen mussten. Er zeigte ihnen, wie sie es schafften, ihre Blutgier zu kontrollieren.
Er brachte ihnen alles bei, was er wusste. Er trainierte sie. Er führte sie an.
Er war der Erste ihrer Art und der Älteste (auch wenn er keinen Tag älter als dreißig aussah), und er besaß die größte Macht von allen. Seine Macht war so groß, dass er sich als einziger Unsterblicher unbeschadet im Sonnenlicht bewegen konnte.
Marcus ließ sich mit einem Ächzen auf die Sofakissen fallen und schnitt eine Grimasse, als ihm klar wurde, dass er alles mit Blut beschmierte. »Du hast nicht zufälligerweise eine Blutkonserve dabei?«
Mit einem sanften Lächeln lehnte sich Seth gegen den Kaminsims. »Keine, die ich dir geben möchte.«
Natürlich nicht. Allmählich musste sich Marcus wirklich etwas einfallen lassen. Er blutete immer noch aus mehreren Wunden und wurde allmählich schwächer. Da gerade kein hochwillkommener Einbrecher zur Hand war, würde er das Haus verlassen müssen, um zu trinken.
»Warum bist du noch mal hier?«
Seths Lächeln wurde berechnend, und Marcus verspürte leichtes Unbehagen. »Es gibt da jemanden, den ich dir gern vorstellen würde.«
Ungeduldig an ihrer Unterlippe nagend, wartete Ami darauf, dass Seth sie zu sich rief. Als sie bei einem Blick auf ihr Handgelenk entdeckte, dass auf dem dunkelblauen Untergrund ihres Pullis kein Metall glänzte, fluchte sie leise. Sie hatte schon wieder vergessen, ihre Armbanduhr anzulegen.
Wie viel Zeit war vergangen, seit Seth das hübsche zweistöckige Haus betreten hatte? Zehn Minuten? Zwanzig? Fünfzig?
Sie verließ die Veranda, marschierte den langen Fußweg hinunter bis zur Einfahrt und wieder zurück. Das Haus lag mehrere Kilometer außerhalb von Greensboro am Stadtrand, wo es nur noch vereinzelt Häuser gab und die Nachbarn weit genug weg wohnten, sodass man von ihnen weder viel sah noch hörte.
Das Haus, vor dem Ami stand, war aus rotem Backstein und besaß eine große Garage. Die glänzende schwarze Tür wurde von einem Trittschutz aus Messing geziert. Der Garten … hatte dringend etwas Pflege nötig. Der Boden war mit Blättern und Kiefernnadeln bedeckt. Was vom Rasen übrig war, musste dringend in Form gebracht und von Unkraut befreit werden. Sich selbst überlassene Graswurzeln wucherten über den Gehweg und waren auf dem besten Weg, die Asphaltdecke unter sich zu begraben. Geistesabwesend trat Ami nach einem Grasbüschel, als sie das vierzigste oder fünfzigste Mal an derselben Stelle vorbeitigerte.
In der kühlen Nachtluft kondensierte ihr Atem zu weißen Wölkchen. Zitternd wünschte sie sich, dass sie ihre Jacke nicht hätte ausziehen müssen, damit Seth die Blutflecken nicht sah.
Endlich erklang Seths warme Stimme in ihrem Kopf. Würdest du uns Gesellschaft leisten, Ami?
Sie wischte sich ihre plötzlich feuchten Handflächen an der Jeans ab und griff nach ihrem lockigen, roten Haar, um sich zu vergewissern, dass ihrem akkuraten Pferdeschwanz, der ihr kaum bis zu den Schultern reichte, keine Strähne entwischt war. Dann griff sie nach der kleinen Kühlbox, die Seth auf der Veranda zurückgelassen hatte, und marschierte entschlossen zur Vordertür.
Sie hob die Hand, um zu klopfen, und erstarrte, als das unverkennbare Ding dong einer Türklingel ertönte. Blinzelnd musterte sie den kleinen leuchtenden Knopf, den sie nicht berührt hatte. Aber die Türklingel hatte gebimmelt, oder nicht?
Ding dong.
Wenn er gewollt hatte, dass sie klingelte, warum hatte er es ihr dann nicht einfach gesagt?
Ding dong. Ding dong.
Und warum öffnete ihr niemand die Tür? Das penetrante Klingelgeräusch zermürbte ihre ohnehin blank liegenden Nerven. Obwohl Seth sich bereits seit eineinhalb Jahren um sie kümmerte, überkam sie jedes Mal Panik, wenn sie jemand Neues kennenlernte. So wie bei der Begegnung mit dem Unsterblichen, auch wenn sich diese letzten Endes nicht als unangenehm herausgestellt hatte.
Die Haustür schwang nach innen auf.
Ami hob den Blick … und ihre Mundwinkel begannen unwillkürlich zu zucken, als sie die hochgewachsene Gestalt musterte, die die Türöffnung verdunkelte. Zum zweiten Mal in dieser Nacht kam ihr der Gedanke, dass der Unsterbliche unglaublich gut aussehen würde, wenn sein Gesicht nicht zu einer schmerzverzerrten Grimasse verzogen und sein Körper nicht völlig zerschunden und blutüberströmt wäre.
Schwarzes, zerzaustes Haar umrahmte sein Gesicht und fiel ihm in Wellen bis zur Mitte des Rückens. Gesicht, Arme und Oberkörper waren bedeckt mit tiefen, klaffenden Wunden, sodass er aussah, als ob er mit echten Wölfen gekämpft hätte und nicht mit Vampiren, die von einer finsteren Rudelmentalität zusammengehalten wurden. Sein rechter Arm war noch nicht verheilt. Er hing in einem so merkwürdigen Winkel herab, dass es nahelag, dass er ausgekugelt war. (Da ihr einmal beide Arme ausgekugelt worden waren, wusste sie, wie schmerzhaft das sein konnte.) Außerdem achtete er darauf, das linke Bein nicht zu belasten. Ob es gebrochen war?
Da er seinen Mantel abgelegt hatte, bot sich nun eine verlockende Aussicht auf seine breiten Schultern, die muskulösen Arme und Beine und auf seine schmale Taille und Hüfte.
Ami war schon wieder sprachlos, doch dieses Mal hatte ihre Stummheit nichts mit Angst oder Besorgnis zu tun. Insbesondere dann nicht, wenn seine Augen (war das etwa Freude?) bei ihrem Anblick aufleuchteten.
Sie lehnte sich zur Seite, um an ihm vorbeizulinsen, und sah Seth im Nebenzimmer gegen einen Kaminsims gelehnt dastehen. »Hast du ihn etwa gezwungen, mir die Tür zu öffnen?«, wollte sie wissen. Seth war eigentlich keiner von denen, die andere leiden ließen, ohne ihre Hilfe anzubieten.
»Ja.«
Sie riskierte einen kurzen Blick auf die mürrische Miene des Unsterblichen und sah wieder zu Seth. »Warum?«
»Um ihm etwas vor Augen zu führen.«
»Seth! Wie kannst du nur!« Stirnrunzelnd betrat sie das Haus und stellte die Kühltasche ab. »Lassen Sie mich Ihnen helfen.«
Marcus schloss die Tür, blieb jedoch reglos stehen. Ami hatte den Verdacht, dass er sich nur mit Hilfe des Türknaufs auf den Beinen hielt.
Sie trat zu ihm, schlang ihren rechten Arm um seine Taille und platzierte seinen linken Arm über ihren Schultern.
Als sie aufsah, stellte sie fest, dass er sie mit durchdringenden braunen Augen musterte.
Leicht verlegen senkte sie den Blick.
Selbst blutbeschmiert und ramponiert war er höllisch sexy. Außerdem besaß er die perfekte Größe – er war ungefähr dreißig Zentimeter größer als sie –, sodass sich ihr Kopf auf Schulterhöhe und nicht unter seiner Achselhöhle befand. Ständig mit Seth und David abzuhängen – die beide über zwei Meter groß waren –, sorgte gelegentlich dafür, dass sie einen Muskelkrampf im Nacken bekam.
»Wer sind Sie?«, fragte der Unsterbliche.
»Ami.«
»Ami, das ist Marcus«, sagte Seth im selben Moment. »Marcus, darf ich dir Amiriska vorstellen.«
»Schön, Sie kennenzulernen, Marcus«, sagte Ami und starrte den Unsterblichen eindringlich an, in der Hoffnung, dass er sie nicht verriet. »Wollen Sie sich nicht lieber setzen?«
Sie bildete sich ein, einen Funken Belustigung in seinen Augen aufglimmen zu sehen, der jedoch sofort von Schmerzen erstickt wurde. »Ja, sehr gern.«
»In Ihrem Zustand würde mir das auch so gehen. Gemeinsam schaffen wir es hoffentlich bis zur Couch.«
Sie ließen es ruhig angehen. Der arme Kerl musste mit seinen Kräften völlig am Ende sein. Sie verstand nicht, warum Seth ihm keine Hilfe anbot.
»Ich gehe davon aus, dass Sie einer der Unsterblichen Wächter sind?«, fragte sie, um den Eindruck aufrechtzuerhalten, dass sie sich zum ersten Mal begegneten.
Er nickte nur, seine Kiefermuskeln zuckten.
»Müssten Ihre Wunden nicht schon längst verheilt sein?«
Er ächzte, als sie ihm half, sich vorsichtig auf die blutbesudelten Sofakissen zu hieven. »Ich habe nicht getrunken.«
Als sein Blick zu ihrer Halsschlagader wanderte, zuckte Ami unwillkürlich zurück.
»Ami steht nicht auf der Speisekarte«, sagte Seth, der hinter ihr stand. »Niemals. Ist das klar?«
»Kristallklar.«
Ami sah über die Schulter zu Seth. »Warum hast du ihm kein Blut gegeben?«
»Weil er keins im Haus hat.«
»Wir haben eine ganze Kühltasche voll dabei. Warum hast du ihm nichts davon angeboten?« Sie durchquerte das Wohnzimmer (ein wirklich schöner Raum, groß und geschmackvoll eingerichtet), holte die Kühltasche und stellte sie auf den Couchtisch. Mit einer schnellen Bewegung klappte sie den Deckel auf und reichte Marcus einen Blutbeutel.
»Vielen Dank.«
Sie sah zu, wie er seine Reißzähne ausfuhr und in den Beutel schlug. Als das Blut durch seine Reißzähne direkt in die Blutbahn gelangte, entspannten sich seine Gesichtszüge.
Ami stemmte die Hände in die Hüften und drehte sich zu Seth herum. »Nun?«
Er zuckte mit den Achseln. »Ich hab’ nur versucht, ihm etwas zu verdeutlichen.«
»Und was?«
»Ja«, sprang Marcus ihr bei, der den Blutbeutel bereits geleert hatte. »Was?«
Ami reichte ihm einen weiteren Beutel.
»Vielen Dank.«
Sie lächelte.
»Er braucht einen Sekundanten«, stellte Seth fest.
Überrascht drehte sich Ami zu Marcus um. »Sie haben keinen Sekundanten?«
Alle Unsterblichen hatten Sekundanten. Seth bestand darauf.
Na ja, alle außer Roland Warbrook, der für seinen Jähzorn bekannt war.
Marcus sah Seth wütend an. »Ich brauche keinen Sekundanten.«
»Und ob du einen brauchst«, erwiderte Seth unerbittlich.
»Ich habe einen.«
»Slim ist kein Sekundant.«
Ami runzelte die Stirn. Sie hatte sehr viele Sekundanten kennengelernt, seit Seth sie unter seine Fittiche genommen hatte. Mit den meisten hatte sie per Telefon oder Internet kommuniziert, und keiner von ihnen hatte den Spitznamen Slim gehabt. »Wer ist Slim?«
Seth sah demonstrativ zu dem Erkerfenster auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers. Ami folgte seinem Blick zu einem Weidenkorb, der vor dem Fenster auf dem Boden stand. Eine kleine schwarze Katze, die vermutlich nicht mal vier Kilo wog und sich offenbar gerade den Wanst vollgeschlagen hatte, erwiderte ihren Blick mit einer warnend in die Luft gestreckten schwarzen Pfote.
»Ähem … warum ist das Tier so kahl?«
Slim hatte überall am Körper große, kahle Stellen … über den Augen … auf dem Schädel … zwischen den Schulterblättern … an einem Knie …
»Ist er nicht«, erwiderte Marcus defensiv. »Er ist nicht kahl. Er hat … einfach Narben, weil er immer mit Tieren kämpft, die doppelt so groß sind wie er.«
»Oh. Der arme kleine Kerl.« Ami hasste Schlägertypen, egal ob es sich um Menschen oder Tiere handelte. Und seinem Aussehen nach zu urteilen, hatte dieser Kater die gleiche Wirkung auf solche Typen wie vergammeltes Fleisch auf einen Fliegenschwarm.
»Er braucht dir nicht leidzutun«, schnarrte Seth. »Slim ist derjenige, der die Kämpfe anzettelt.«
Skeptisch beäugte Ami den Kater. »Ehrlich? Und hat er jemals einen gewonnen?«
Seths dunkle Augen funkelten vor Vergnügen, während er und Ami auf Marcus’ Antwort warteten.
Als sie schließlich kam, klang es, als kostete ihn jedes Wort große Mühe. »Ich glaube, einer endete unentschieden.«
Ami biss sich auf die Lippen, um nicht loszuprusten.
Slim putzte sich weiter.
Marcus seufzte und wünschte sich insgeheim, dass diese Nacht endlich vorüber wäre. Vor Schmerzen mit den Zähnen knirschend, hievte er sich in eine aufrechte Position. Der gebrochene Knochen in seinem Bein fing an wieder zusammenzuwachsen, und die Verletzungen hatten endlich aufgehört zu bluten und heilten.
»Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Arm?«, fragte Ami.
Marcus sah hoch und stellte fest, dass ihre sanften grünen Augen seine ausgekugelte Schulter musterten. »Ja, das wäre nett.«
Sie war sehr hübsch … sie hatte das jugendlich-frische Aussehen des typischen Mädchens von nebenan. Ihre blasse, makellose Haut war ungeschminkt. Ihre langen Wimpern hatten denselben Kupferton wie ihr Haar. Ein kesse Stupsnase. Schön geschwungene, volle Lippen, die aber völlig natürlich und nicht aufgespritzt wirkten. Wenn man ihn gefragt hätte, hätte er sie auf Anfang zwanzig geschätzt. Eindeutig menschlich. Soweit er wusste, besaßen alle Unsterblichen – außer einem – schwarzes Haar und braune Augen.
Obwohl sie klein war, war sie erstaunlich kräftig – sie hatte überraschend mühelos sein Gewicht gestemmt, als sie ihm auf die Couch geholfen hatte. Außerdem war sie schlank, auch wenn er nicht umhin konnte, ihre wohlgerundeten Hüften und vollen Brüste zu bewundern, als sie sich nach vorn gelehnt und ihm geholfen hatte. Durch die Bewegung hatte der Ausschnitt ihres Pullovers den Blick freigegeben auf das Tal zwischen ihren Brüsten und auf ihren weißen Spitzen-BH.
Er atmete tief ein und schloss die Augen. Und gut riechen tat sie auch noch.
Eine ihrer schmalen Hände griff vorsichtig nach seiner Schulter. Mit der anderen umfasste sie sein Handgelenk.
»Bereit?«, fragte sie.
Er nickte und dachte, dass ihre Stimme – leise und warm – ebenso anziehend war wie der Rest von ihr.
Sie machte eine schnelle Bewegung. Schmerz schoss durch seinen Arm und seine Schulter.
»Besser?«
»Super«, presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Sie trat einen Schritt zurück, zog einen weiteren Blutbeutel aus der Kühlbox und reichte ihn ihm.
»Vielen Dank.«
Sie lächelte.
Sie hatte ein hübsches Lächeln. Ein Lächeln, das man einfach erwidern musste.
Zumindest er konnte nicht widerstehen und spürte, wie seine Mundwinkel nach oben wanderten, während er in den Beutel biss.
Er sah Seth an, und als er den Glanz in den Augen des Älteren bemerkte, konnte er ein neuerliches, unbehagliches Schaudern nicht unterdrücken.
»Marcus«, schnarrte Seth, »hiermit stelle ich dir deine neue Sekundantin vor.«
Marcus ließ den halb leeren Beutel sinken und folgte Seths Blick zu Ami.
Neugier funkelte in ihrem Blick, und sie sah sich um, als erwarte sie, dass eine Unbekannte den Raum betreten würde. Als das nicht geschah, erstarrte sie und sah plötzlich aus wie ein Reh, das erschrocken im Scheinwerferlicht verharrt. Ihr Blick schoss zu Seth. Genau wie der von Marcus.
»Ami«, sagte Seth sanft. »Ich bitte dich darum, Marcus als Sekundantin zu dienen.«
Vor Überraschung blieb ihr der Mund offen stehen. »Ich?«, flüsterte sie ungläubig.
»Oh nein«, platzte Marcus heraus. »Zur Hölle, nein! Ich will keine Sekundantin.«
Seths Ton wurde eisig. »Mir ist egal, was du willst. Du brauchst einen Sekundanten. Das hat diese Nacht wieder einmal eindeutig gezeigt. Und du kennst die Regeln. Jeder Unsterbliche hat einen.«
»Roland nicht.«
»Gerade du weißt am besten, dass Roland Schwierigkeiten damit hat, anderen zu vertrauen, und du weißt auch, wie er in der Vergangenheit auf die Sekundanten, die ich ihm geschickt habe, reagiert hat.«
Marcus’ nachdenklicher Blick glitt zu Ami. Hm. Vielleicht könnte er ja …
»Falls du daran denkst, dir ein Beispiel an Roland zu nehmen und sie einzuschüchtern«, fuhr Seth fort, »dann denk noch mal darüber nach. Sie ist zäher, als sie aussieht.« Wenn du ihr auch nur ein Haar krümmst, warnte er Marcus telepathisch, bringe ich dich ohne mit der Wimper zu zucken um.
An Ami gewandt sagte er: »Wir bleiben in Kontakt.« Eine Sekunde später war Seth verschwunden.
Lastende Stille machte sich im Zimmer breit.
Ami biss sich auf die Unterlippe und runzelte die Stirn. »Glauben Sie, dass er zurückkommt?«
Womm!
Beide zuckten zusammen, als drei Koffer und mehrere weiße Kartons, von denen Marcus annahm, dass sie Amis Besitztümer enthielten, plötzlich mitten im Wohnzimmer auftauchten.
Marcus seufzte schwer. »Ich schätze nicht.«
2
Schwer atmend und am ganzen Körper in kalten Schweiß gebadet, spähte Eddie Kapansky immer wieder über die Schulter, während er durch den Wald sprintete.
Nichts.
Er sah wieder nach vorn und wäre beinahe in einen tief herabhängenden Zweig gerannt. Indem er sich blitzschnell zur Seite duckte, schaffte er es gerade noch, dem Zusammenstoß zu entgehen.
»Komm schon, Eddie. Reiß dich endlich zusammen«, brummte er. Sich mit übernatürlicher Geschwindigkeit zu bewegen erforderte extreme Wachsamkeit. Tief hängende Zweige wie jener, der gerade sein dunkelblondes Haar gestreift hatte, konnten einen Vampir leicht den Kopf kosten.
Immer noch mit dem bitteren Angstgeschmack im Mund, warf er wieder einen Blick zurück über die Schulter und suchte nach Anzeichen dafür, dass der Unsterbliche ihm folgte. Als er schließlich wieder nach vorn sah, wurden seine Augen groß, und er schrie laut auf, da er beinahe von einem Zweig geköpft worden wäre.
Eddie drosselte seine Geschwindigkeit auf das Lauftempo eines Sterblichen, dann zu einem leichten Joggen und schließlich zum Spaziertempo. Dann blieb er stehen.
Als die Atemluft aus ihm herausschoss wie aus einem Blasebalg, bildeten sich kleine Nebelwölkchen. Wäre er etwas cleverer gewesen, hätte er vielleicht die Ironie zu schätzen gewusst, die darin lag, dass sein Vampirherz – von dem die Menschen irrtümlich glaubten, dass es nicht schlug –, so wild hämmerte, dass es beinahe seinen Brustkorb sprengte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























