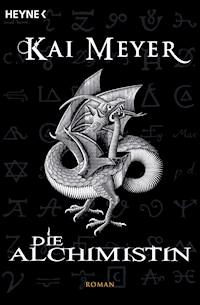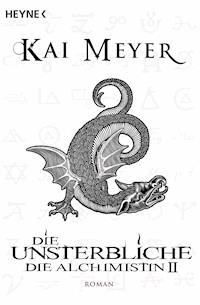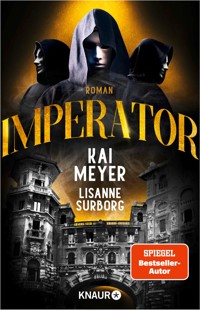
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Imperator
- Sprache: Deutsch
Rom in den Swinging Sixties – eine Stadt der Filmstars und Verbrecher, der Geisterbeschwörer, des alten Adels und der korrupten Politik. Die Studentin Anna schließt sich einer Gruppe Paparazzi an, um inkognito den Mörder ihrer Mutter zu jagen. Zugleich soll der Privatdetektiv Gennaro Palladino den Tod eines wahnsinnigen Malers aufklären. Ihre Suche führt Anna und den jungen Fotografen Spartaco durch Paläste und verlassene Villen, durch Filmstudios und verruchte Jazzclubs. Während die High Society im Champagner badet und Regierungsgegner die Revolution planen, ziehen finstere Mächte die Fäden. Sie wollen die Auferstehung des antiken Roms – koste es, was es wolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kai Meyer / Lisanne Surborg
Imperator
RomanBasierend auf einer Hörspielserievon Kai Meyer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Rom in den Swinging Sixties – eine Stadt der Filmstars und Verbrecher, der Geisterbeschwörer, des alten Adels und der korrupten Politik. Die Studentin Anna schließt sich einer Gruppe Paparazzi an, um inkognito den Mörder ihrer Mutter zu jagen. Zugleich soll der Privatdetektiv Gennaro Palladino den Tod eines wahnsinnigen Malers aufklären. Ihre Suche führt Anna und den jungen Fotografen Spartaco durch Paläste und verlassene Villen, durch Filmstudios und verruchte Jazzclubs. Während die High Society im Champagner badet und Regierungsgegner die Revolution planen, ziehen finstere Mächte die Fäden. Sie wollen die Auferstehung des antiken Roms – koste es, was es wolle.
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
Epilog
Nachwort
Prolog
London, 1965
Ein Türglöckchen läutete, als Anna den unscheinbaren Laden betrat. Sie wischte sich mit dem Ärmel den Nieselregen aus dem Gesicht und strich sich eine nasse Strähne hinters Ohr.
Keine Auslage, kein Schaufenster, dafür ein Schild in psychedelischen Farben. Darunter eine schmale, dunkle Tür in einer schmalen, dunklen Gasse in Soho. Jemand hatte ein Plakat daraufgeklebt, das für den Ausverkauf einer Boutique warb. Das Datum lag eine Woche zurück, das wellige Papier wölbte sich ihr in der feuchten Luft entgegen.
Sie behielt die Klinke in der Hand, während sie sich umsah und zwischen Kisten und Regalen einen jungen Mann mit langem, rotem Haar entdeckte. Er ignorierte das Glöckchen und untersuchte mit skeptischem Blick die Nadel eines Plattenspielers.
»Hi«, sagte sie. »Bin ich hier richtig bei Pete?«
Er sah kurz zu ihr auf. »Ich bin Pete.« Routiniert setzte er hinzu: »Bring nichts mit rein als Liebe.«
Er verschwand hinter einem schmalen Tresen und tauchte mit einer Schallplatte wieder auf, deren Cover schon bessere Tage gesehen hatte. So wie der Rest des Ladens. Die Regale hatten sich unter Last und Feuchtigkeit verzogen, dahinter schälte sich die Tapete von der Wand. In den Fugen zwischen den Fliesen sammelten sich Dreck und Staub.
»Wegen Liebe bin ich nicht hier«, sagte Anna, bevor sie die Tür hinter sich schloss. Augenblicklich versank der Raum in schummrigem Zwielicht.
»Was auch immer dein Ding ist.« Pete zuckte mit den Achseln und widmete sich wieder dem alten Plattenspieler neben seiner Kasse. Sein rotes Haar reichte ihm fast bis zur Hüfte, und sein Gesicht war so sommersprossig, dass es im Halbdunkel braun gebrannt wirkte. Er trug eine zweireihige Kette mit Holzperlen und ein Hemd, von dessen Muster Anna schwindelig wurde. Wie seine übrige Kleidung war es drei Nummern zu groß für seine schmale Statur.
Sein winziger Laden lag abseits der Carnaby Street. Es war keiner, vor dem sich die Beatles fotografieren ließen, aber jemand hatte Anna erzählt, Keith und Mick kämen manchmal her. Beim Blick durch Rauchschwaden in das Chaos aus Kartons mit gebrauchten Schallplatten, Regalen mit Buddha-Nepp und Posterrollen fiel es ihr schwer, sich die beiden hier vorzustellen. Sicher hatten sie nicht nach Musik gesucht.
Ihr Blick glitt über die fleckige Plattenhülle in Petes Hand, ohne zu erkennen, worum es sich handelte. Als wabernde Klänge aus dem Lautsprecher drangen, wandte sie sich ab und betrachtete die Regale mit Duftkerzen und Fläschchen ätherischer Öle. Früher hätte sie sofort die Platten im nächstbesten Karton durchstöbert, heute ließ sie es bleiben. Über ihrem Kopf drehte sich träge ein Traumfänger.
»Das sind ’ne Menge Platten. Und hier riecht’s gut.«
»Räucherstäbchen«, sagte Pete mit Unschuldsmiene.
»Klar.« Anna drehte sich um. Die Federn des Traumfängers streiften sanft ihr Haar. »Aber die bekomme ich auch anderswo.«
Die Langeweile auf Petes Gesicht wandelte sich zu geschäftsmäßigem Interesse. Er löste sich von seinem Plattenspieler, legte die Unterarme auf dem Tresen ab und lehnte sich vor. »Was genau suchst du denn?«
»Man hat mir gesagt, du vermittelst Trips … Ich meine, Trips nach Süden.«
»Ich vermittele dir jede Reise, die du brauchst.« Er legte den Kopf schräg und zählte Orte auf, als blätterte er in einem Reisekatalog. »Indien? Marokko? Bisschen näher, Ibiza, vielleicht?«
»Nach Rom.« Anna hatte überlegt, wie es sich anfühlen würde, es auszusprechen. Ob es wie das Ablegen einer Last wäre oder wie eine folgenschwere Unterschrift. Sie war eher enttäuscht als überrascht, dass sie gar nichts dabei fühlte.
»Rom …« Nachdenklich knetete er sein Kinn. Sein Blick schien sich in der Drehung des Traumfängers zu verlieren. Das Schweigen zog sich.
Als Anna gerade etwas sagen wollte, schnipste er mit den Fingern und nahm einen vergilbten Notizblock unter dem Tresen hervor. »Schreib mir deinen Namen auf. Ich kenn wen, der dich bis zur italienischen Grenze mitnehmen kann. Er kutschiert mit seinem Bus ’n paar Leute nach Kathmandu. Die können dich irgendwo hinter den Alpen absetzen, den Rest schaffst du per Anhalter. Das sind nette Jungs und Mädchen. Alle voller Liebe.«
»Okay.« Sie griff zum Bleistift und schrieb. »Wie auch immer.«
Pete drehte den Block zu sich herum und runzelte die Stirn. Als er ihren Nachnamen vorlas, sprach er ihn englisch aus. Natürlich. So wie die meisten.
»Anna Savarese«, korrigierte sie ihn. »Ist Italienisch.«
»Ich mach das für dich klar. Sonntag früh, sechs Uhr, geht’s los. Macht ein Pfund für die Vermittlung. Den Rest musst du mit dem Fahrer klären.« Er musterte sie. »Spielst du ’n Instrument? Manchmal wird’s dann billiger.«
»Ich mach Fotos. Hilft das?«
»Nee, eher nicht.« Er riss das Blatt mit ihrem Namen vom Block und ließ es unter dem Tresen verschwinden, bevor er nach dem Stift griff. Anna sah zu, wie er eine Adresse aufschrieb. »Hier, das ist der Treffpunkt. Bring Wasser mit. Und was dich sonst noch glücklich macht.«
Anna konnte sich kaum daran erinnern, wann sie zuletzt etwas glücklich gemacht hatte. Das, was sie in Rom suchte, würde daran vielleicht nichts ändern. Im Gegenteil: Das Risiko, alles nur noch schlimmer zu machen, fühlte sich gewaltig an. Die Aussicht auf Antworten, auf Genugtuung, auf Rache sogar – im Augenblick war das nichts als eine diffuse Hoffnung. Aber, immerhin, zum ersten Mal seit einem Jahr fühlte sie überhaupt etwas, das den Namen Hoffnung verdiente.
Sie zwang sich zu einem Gesichtsausdruck, der für Pete vielleicht als flüchtiges Lächeln durchging. Als sie ihm das Pfundstück in die Hand legte, senkte er die Stimme, obwohl niemand sonst im Laden war.
»Falls du Proviant für die Reise brauchst, das gibt’s hier auch. Nur vom Allerbesten.« Sachte klopfte er zweimal mit der flachen Hand auf den Tresen.
Für einen Augenblick klang Petes Angebot verlockend. Nach einer Pause von dem Albtraum, den sie jetzt lebte. Nach ein paar Stunden Unbeschwertheit. Doch dann schaltete sich ihre Vernunft ein. Sie würde sich in den nächsten Wochen keine Aussetzer leisten können – dafür stand zu viel auf dem Spiel. Auch ohne Drogen kam es ihr vor, als lägen die vergangenen Monate hinter einem Schleier aus Trauer und Panik und schierem Entsetzen.
Als Pete sie erwartungsvoll ansah, schüttelte sie den Kopf.
Er zuckte abermals die Achseln, bevor er hinter dem Tresen hervortrat und einen der unzähligen Kartons aufklappte.
Ohne Petes farbenfrohe Gestalt hinter der Kasse fiel Annas Blick ungehindert auf die Rückwand des Ladens, auf den schweren, roten Samtvorhang und das handgeschriebene Schild daneben.
Madame Shivani. Handlesen, Kartenlegen und –
»Mystische Ölungen?«, fragte sie amüsiert.
Pete schreckte von seinem Karton hoch, als hätte er sich am Papier geschnitten. »Das ist nichts für dich.«
»Wie gut ist sie?«
Er richtete sich auf, presste die Lippen zusammen und schien einen Moment lang zu überlegen, ob er antworten wollte. »Angeblich gut in manchen Dingen«, sagte er widerwillig. »Nicht so gut im Wahrsagen.«
Annas Blick glitt vom Schild zurück auf den Vorhang. »Ich will zu ihr.«
Pete schüttelte seufzend den Kopf und machte Anstalten, weiter Posterrollen ins Regal zu stapeln. Sein langes Haar rutschte ihm ins Gesicht, und er strich es sich über die Schulter. »Ich sag doch, das ist nix für dich.« Als sie den Vorhang zur Seite schlug, wurde seine Stimme schriller. »Hey!«
Aber Anna ging bereits die enge, knarrende Treppe hinauf. Sie streckte die Hände nach beiden Seiten aus und berührte speckige Tapete. Im schwachen Licht konnte sie am oberen Absatz die Umrisse einer Tür erkennen.
»Warte! Du kannst da nicht einfach hochgehen!« Hinter ihr polterte nun auch Pete die Stufen herauf.
Mit knirschenden Angeln schwang über Anna die Tür auf.
»Pete, lass sie raufkommen.« Die Frau im Rahmen sprach mit ebenjener rauen Stimme, die ein Blick in ihr Gesicht erwarten ließ. Obwohl sie vermutlich um die vierzig war, hatte sie die Tränensäcke einer Greisin.
Pete hob ergeben die Arme. »Wie du meinst. Sei nett zu ihr.« Er drehte sich um und ging die Treppe wieder hinunter. Bevor er den Vorhang erreichte, wandte er sich noch einmal an Anna. »Denk dran, Sonntag, sechs Uhr. Die warten auf niemanden.«
»Alles klar.« Sie stieg die letzten Stufen hinauf.
Madame Shivani trug einen langen Morgenmantel mit asiatischen Schriftzeichen. Ihr blond gefärbtes Haar hatte einen dunklen Ansatz so breit wie Annas Oberschenkel, und ihre Füße steckten in plüschigen Pantoffeln.
Anna ahnte, dass dies hier keine gute Idee war, aber in ihr regte sich etwas, das sie die letzten Stufen hinauftrieb. Keine Neugier. Vielleicht die Suche nach einem Funken Gewissheit.
»Ich bin –«
»Anna Savarese.« Madame Shivani zeigte ein geheimnisvolles Lächeln. »Ich hab dich in meiner Kristallkugel gesehen.«
»Ja, klar.«
Madame Shivanis Mundwinkel zuckten. »Die Decken sind dünn. Hab deinen Namen gehört. Komm rein.«
Anna gab sich einen Ruck und trat an ihr vorbei in einen stickigen Raum. Die dunklen Vorhänge waren zugezogen. Durch die Dielen konnte sie dumpf die Musik von unten hören.
Am Pfosten eines großen Metallbetts hing ein Gewirr aus Lederriemen. Außerdem waren da ein breiter Sessel, ein Waschbecken mit tropfendem Hahn und ein kleiner, runder Tisch. Es roch nach billigem Parfüm, Kernseife und dem Zeug, das Pete unter der Ladentheke verkaufte.
»Was kann ich für dich tun?«
»Ich könnte gerade jemanden brauchen, der mir sagt, dass meine Zukunft ganz wunderbar wird. Kriegen Sie das hin?«
Madame Shivani schloss die Tür und betrachtete Anna aufmerksam. »Bisschen Pech gehabt in letzter Zeit?«
Innerhalb eines Jahres war Annas Leben komplett umgekrempelt worden. Man hätte es Schicksal oder Unglück nennen oder irgendein anderes Wort für die Katastrophe finden können – aber Pech hatte gewiss nichts damit zu tun. Und etwas im Tonfall der Wahrsagerin verriet Anna, dass sie das bereits ahnte.
»Manches hätte besser laufen können.«
Madame Shivani lächelte. »Ja, das dachte ich mir.«
Anna machte ein paar Schritte in den Raum hinein. In einem Spiegel mit abblätterndem Goldrahmen sah sie sich neben der Frau stehen, einen halben Kopf kleiner als sie, das dunkelbraune Haar zum Pferdeschwanz gebunden und vom Regen in Strähnen geteilt. Eine helle Leinenhose, das Batikhemd mit weiten Ärmeln, darüber eine Weste. In Rom würde sie sich andere Sachen besorgen müssen, aber während der Fahrt im Love-Express nach Kathmandu würden alle so aussehen wie sie. Sie würden Folksongs singen, sich gegenseitig mit Henna bemalen und unaufhörlich über Siddhartha reden. Anna würde noch vor Maidstone übel werden und ihnen spätestens in Ashford den Bus vollkotzen.
Die vergangenen Monate hatten ihre Schultern nach unten gezogen, und sie wog noch weniger als früher. Es hatte eine Zeit für diese Kleidung an ihrem Körper gegeben, aber die neigte sich dem Ende zu. Mit einem Mal konnte sie es kaum erwarten, die Klamotten endlich loszuwerden.
Im Spiegel wanderte ihre Aufmerksamkeit wieder zu der Wahrsagerin, die ihren Blick aus blauen Augen erwiderte.
»Besonders indisch sehen Sie nicht aus«, sagte Anna.
»Der Name war Petes Idee. Er ist mein kleiner Bruder. Die meisten, die herkommen, interessieren sich nicht für meine Geburtsurkunde.« Madame Shivani wandte sich vom Spiegel ab. »Setz dich.«
Anna machte Anstalten, ihr zu gehorchen.
»Nein, an den Tisch da! Der Sessel ist nicht zum Sitzen.«
»Wo ist nun die Kristallkugel?«, fragte Anna, als sie sich an dem kleinen Tisch gegenübersaßen. Durch die Wand hinter Madame Shivani zog sich ein feiner Riss, der die Tapete von der Decke bis zum Boden spaltete.
»Ich hatte mal eine«, sagte die Wahrsagerin. »Pete hat sie an die Scheißtouristen verkauft.« Sie verdrehte die Augen und winkte ab. »Aber ich kann dir aus der Hand lesen. Kartenlegen geht auch. Oder wir sparen uns das und reden einfach. Darauf läuft es eh hinaus.«
Anna drehte sich auf ihrem Stuhl um und beäugte die Lederriemen am Bettgestell. Im schwachen Licht sahen sie aus wie schlafende Schlangen. »Sonst wird hier nicht so viel geredet, oder?«
Die Wahrsagerin lachte leise. »Du würdest dich wundern. Zuhören ist inklusive. Aber ich nehme mal an, dass wir zwei sonst nichts treiben werden, also bist du mit zehn Schilling dabei.«
Anna angelte in ihrer Tasche nach den richtigen Münzen und schob sie über die Tischplatte. Während sie zusah, wie die Wahrsagerin sie auflas und in ihrem Morgenmantel verschwinden ließ, konnte sie kaum fassen, dass sie gerade jemanden dafür bezahlt hatte, ihr zu erzählen, was sie hören wollte.
Madame Shivani lehnte sich gelassen auf ihrem Stuhl zurück. Dabei schlug die Tasche des Morgenmantels gegen ein Stuhlbein. Das Geld klimperte zum Abschied.
»Also, was ist passiert?«
Anna schob die Hände unter die Oberschenkel und starrte auf die Kratzer in der Tischplatte. Das hier war ein neuer Tiefpunkt: der Tag, an dem sie sich von einer Wildfremden so etwas wie Aufmunterung erkaufte.
Am Anfang, vor einem Jahr, hatte jeden Tag jemand an ihrer Tür geklingelt. Aber mit den Monaten war es stiller geworden. Die meiste Zeit über fühlte sie sich wie ausgestopft. Äußerlich halbwegs intakt, innen nur Watte. Wenn sie sich zum Lachen zwang, klang es hohl. Gespräche überforderten sie und Fragen erst recht. Sie konnte Unterhaltungen oft nicht folgen und driftete in Gedanken ab, ohne es zu bemerken. Ihre Ohren schalteten auf taub, und ihr Gegenüber sprach ins Leere.
Sie bemerkte, dass die Frau sie unter ihren aufgemalten Augenbrauen beobachtete. Immerhin konnte es nach dem hier nur bergauf gehen. Und damit hatte die Vorstellung seltsamerweise etwas Beruhigendes. Vielleicht hatten auch die Dämpfe damit zu tun, die durch die Bodenbretter aufstiegen.
»Mein Vater hat meine Mutter ermordet.« Anna hatte den Satz so oft gedacht und gesagt, dass er ihr völlig emotionslos über die Lippen kam. »Jedenfalls sagt das die Polizei.«
Madame Shivani, die in Wahrheit wahrscheinlich Sheila oder Mary hieß, nickte so bedächtig, als hörte sie ähnliche Geschichten täglich. Vielleicht waren Keith und Mick ja wirklich hier gewesen. »Wie lang ist das her?«
»Ein Jahr. Seit sechs Monaten sitzt er in Wandsworth. Einmal die Woche ruf ich ihn an.«
Die aufgemalten Bögen rutschten fast in den Haaransatz. »Du redest noch mit dem Kerl?«
Anna hob die Schultern. »Weil er sich an nichts erinnern kann. Keiner kann mir sagen, warum meine Mutter tot ist. Nicht mal er.«
Madame Shivani beugte sich mit einem Seufzen vor. »Vergiss ihn.« Ihre Stimme klang jetzt weicher als zuvor. »Meinem alten Herrn gehört das Haus. Der Drecksack weiß genau, womit hier Geld verdient wird. Er sitzt in seinem verdammten Altersheim draußen in Stratford, spielt Bingo und streicht die Miete ein. Aber wenigstens muss ich nicht mit ihm reden.«
»Ich will erst mal weg aus London«, sagte Anna. »Ich muss was rausfinden.«
»Über deine Mutter?«
Anna öffnete den Mund, hielt aber einen Augenblick inne. »Ich hab gedacht, Sie erzählen mir was«, sagte sie dann. »Dafür hab ich Ihnen mein letztes Geld gegeben.«
»Erst mal muss ich dich kennenlernen. Du hast Pete nach einer Reise in den Süden gefragt?«
»Mein Vater hat einen Bruder in Rom. Bruno. Er nimmt mich fürs Erste bei sich auf.«
Die Wahrsagerin runzelte die Stirn. »Dann gib lieber gut auf dich acht.«
»Bruno ist in Ordnung. Er ist Pressefotograf. Vielleicht kann er mir was beibringen.«
Madame Shivani nickte wissend. »Du machst selbst Fotos.«
Anna stellte sich vor, dass die Frau mit einem Ohr am Boden gelegen hatte, während sie im Laden mit Pete gesprochen hatte. Die Vorstellung fand sie ein wenig unheimlich.
»Bruno hat mir seine alte Kamera geschenkt«, sagte sie, »gleich nach … der Sache mit Mum. Er hat gesagt, die Welt ist schöner, als sie mir vorkommt. Wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen sehen würde, dann eben durch die Kamera. Und er hat recht. Vielleicht nicht schöner. Aber anders.«
Madame Shivani tippte mit dem Zeigefinger auf Holz. »Gib mir jetzt doch mal deine Hand.« Ihre eigene legte sie geöffnet auf die Tischplatte.
Skeptisch betrachtete Anna die rauen Finger der Frau und den abgesplitterten roten Nagellack. »Sicher?«
»Kostet dich keinen Penny extra.«
Anna zögerte einen Moment, dann zog sie ihre rechte Hand unter ihrem Oberschenkel hervor und reichte sie der Wahrsagerin.
»Du hast schöne Finger.« Madame Shivani hatte sie nicht einmal angesehen. Stattdessen blickte sie Anna über den Tisch hinweg in die Augen. »Warum sind deine Eltern nach England gekommen?«
»Wegen der Arbeit, ’45, kurz nach dem Krieg.«
»Und nun gehst du zurück nach Italien, um mit deinem Onkel zu arbeiten.« Es war keine Frage. Eher schien Madame Shivani die Fakten für sich selbst zusammenzufassen.
Anna schüttelte den Kopf. »Nicht nur deswegen. Ich sag doch –«
Die fremden Finger schlossen sich um ihr Handgelenk. »Und wenn es bei deinen Eltern genauso war? Vieleicht hatten sie in Wahrheit ganz andere Gründe, um aus ihrer Heimat fortzugehen. Geheime Gründe.«
Annas Puls beschleunigte sich ein wenig, in ihrer Brust stieg Hitze auf. Sie wollte ihren Arm zurückziehen, doch Madame Shivani ließ ihn nicht los. Mit gerunzelter Stirn beugte die Frau sich vor und betrachtete Annas Hand aus der Nähe. Ihre Augen lagen im Schatten. Als sie sprach, kamen die Worte heiser über ihre Lippen:
»Ich sehe Masken – und Geheimnisse. Ich spüre etwas sehr, sehr Altes. Etwas sehr Gefährliches … Vergangenheit, die sich als Gegenwart tarnt … Da ist ein Mann mit einem schwarzen Zylinder … Und ein Mädchen auf einem Altar … Ein Feuer. Ein Feuer so groß wie eine ganze Stadt.« Als sie aufschaute, schienen ihre Augen eingetrübt, fast milchig. »Nimm dich in Acht, Anna Savarese. Wo du hingehst, erwartet dich eine Welt aus Lüge und Illusion.«
Sie legte einen Finger auf Annas Lebenslinie, fuhr sanft daran entlang – und begann leise zu weinen.
Rom
Eine Woche später
1
Vor dem Autofenster zogen barocke Paläste und antike Ruinen vorüber, aus dem Radio ertönten italienische Schlager. Anna hatte beide Arme um die Reisetasche auf ihrem Schoß geschlungen. Mit dem Fingernagel kratzte sie gedankenverloren an einem Hennafleck auf dem hellen Stoff.
Ihr Blick sprang von einem Torbogen zu einer Formation verwitterter Säulen. Die Überreste einer hohen, sandfarbenen Mauer zogen vorüber, davor hatte sich eine Gruppe Touristen versammelt. Dann rollte der Wagen aus dem chaotischen Verkehr einer Kreuzung durch ein altes Stadttor.
Anna ließ von ihrer Tasche ab, als sich vor ihr eine belebte, mehrspurige Straße auftat. Auf den breiten Gehwegen hielten die livrierten Portiers der Luxushotels Ausschau nach Limousinen mit Gästen. Unter den farbigen Markisen reihten sich runde Kaffeehaustische aneinander. Dort studierten Herren in teuren Sakkos rauchend ihre Zeitungen und nippten an Kaffeetassen, während ein paar Damen winzige Hunde spazieren führten oder einander in den Fensterscheiben beobachteten.
Die altehrwürdigen Straßenzüge Roms schlugen Anna derart in ihren Bann, dass ihr die amüsierten Blicke, die Bruno ihr vom Fahrersitz aus zuwarf, beinahe entgingen. Nicht zum ersten Mal fummelte ihr Onkel am Radio herum und entschuldigte sich dafür, dass alle anderen Sender entweder rauschten oder schwiegen.
Mit jedem Meter, den Brunos Fiat zurücklegte, wuchs Annas Verständnis für das, was ihre Mutter an dieser Stadt geliebt hatte. Zugleich fiel es ihr schwerer, zu verstehen, weshalb ihre Eltern Italien nach dem Krieg den Rücken gekehrt hatten.
Anna hatte heute zum ersten Mal in ihrem Leben einen Fuß auf römischen Boden gesetzt. Sie löste ihren Zopf und stellte fest, dass in ihrem Haar nicht nur der Geruch von Räucherstäbchen hing, sondern auch der vom Gras ihrer Mitreisenden, mit denen sie eingepfercht in einem Bus von London bis Italien gefahren war.
Die gute Laune, das Gefasel von Glück und Frieden und nicht zuletzt ihr eigenes Maskenlächeln hatten die Fahrt zu genau jener Tortur gemacht, die sie erwartet hatte. Folksongs hatten sich in quälender Endlosschleife in ihrem Kopf eingenistet. Und dass sich in einem rumpelnden Bus weder Hände noch Gesichter geschickt mit Henna bemalen ließen, war außer Anna niemandem aufgefallen.
Die rauchgeschwängerte Luft und das stete Brummen des Motors hatten sie die meiste Zeit dösen lassen. Irgendwo in Frankreich hatten ihre Mitreisenden begonnen, die stille Begleiterin mit neugierigen Fragen zu löchern. Sie war heilfroh gewesen, als sie an der italienischen Grenze endlich vom Bus in einen Zug umgestiegen war.
Vor dem Fiat scherte ein roter Sportwagen aus, und Bruno ergriff die Gelegenheit, seinen Wagen in die Parklücke zu setzen.
Wenn sie ehrlich zu sich war, war auch Bruno ein Fremder für sie. Aber er wusste Bescheid und stellte keine Fragen. Während der ganzen Fahrt vom Hauptbahnhof Roma Termini bis hierher hatte er kein einziges Mal ihren Vater erwähnt. Bruno war damals zur Urteilsverkündung nach London gekommen. Kurz darauf musste er beschlossen haben, dass sein Bruder Tigano für ihn nicht mehr existierte.
Er stieg aus, schlug die Autotür zu und stemmte stolz die Hände in die Hüften. Auf seinem Gesicht lag eine Begeisterung, die Annas Reisegruppe nicht einmal beim Singen zu klimpernder Gitarre gezeigt hatte.
»Da wären wir«, verkündete er, als sie neben ihm stand. »Das ist die Via Veneto, die Straße der Reichen und Schönen von Rom – und aus dem Rest der Welt. Hier werden du und ich eine Menge Zeit verbringen.«
Aus seiner Jackentasche kramte er eine Packung Zigaretten. Bruno Savarese war Mitte vierzig, kaum größer als Anna und überaus drahtig. Er redete gern, viel und schnell. Dabei unterstrich er seine Worte mit ausladenden Gesten, schon am Steuer und nun erst recht auf dem Bürgersteig. Er erschien ihr so anders als sein Bruder. Annas Vater war ruhig und ernst, fast verschlossen – ganz sicher niemand, dem irgendwer einen Mord zugetraut hätte. Ihre Mutter hatte oft gesagt, Anna sei ihm ähnlich.
»Anfang der Fünfziger, als die ersten Hollywoodleute in Rom aufgeschlagen sind, da war die Via Veneto einfach irgendeine Straße mit ein paar Hotels. Aber danach konnte es zehn Jahre lang keine andere mit ihr aufnehmen.« Bruno zählte die berühmten Straßen an den Fingern ab. »Nicht die Champs-Élysées, nicht die Fifth Avenue, nicht die –« Er hielt inne und suchte ihren Blick. »Hörst du mir zu?«
»Ja«, sagte Anna. »Ich hab nur daran gedacht, wie anders hier alles ist als in London.«
Gedankenverloren blickte sie an einer Fassade hinauf, in die eine Heiligenstatue eingelassen war. Direkt daneben warb ein Aufsteller in grellen Farben für den Jazzmusiker, der heute im benachbarten Club spielen würde. Eine Papierserviette aus einem amerikanischen Restaurant trieb über den Gehweg. Ein Stück die Straße hinauf umrahmten klobige Werbetafeln Balkone mit filigranen Geländern.
Wenn Anna die Augen schloss, tanzten all die neuen Eindrücke wie Traumbilder hinter ihren Lidern. Rom erschien ihr so unwirklich, eine Stadt, in der monumentale Geschichte und heruntergekommene Gegenwart in einer der unzähligen Bars zusammen Kaffee tranken – und niemand wunderte sich darüber.
»Anders trifft es gut.« Vergnügt bot Bruno Anna eine Zigarette an, aber sie lehnte ab. Er entzündete sich selbst eine, bevor er den Faden wieder aufnahm. »Vor zwei, drei Jahren sind die ganz großen Stars abgereist. Mittlerweile kommt eher die zweite und dritte Garnitur aus den Staaten. Alle, die ihre Karriere aus irgendwelchen Gründen vor die Wand gefahren haben, landen hier bei uns in Rom. Und sie hoffen, dass die Filme, die sie hier drehen, zu Hause keiner sieht.« Schmunzelnd schwadronierte Bruno von billigen Agentenfilmen, die derzeit in Rom wie am Fließband entstanden und deren Helden nicht 007, sondern 006 oder 008 hießen.
»Und das guckt sich irgendwer an?«, fragte sie.
»Den Leuten in den Vorstadtkinos reicht das. Jetzt fangen sie auch noch mit Western an. Und dann sind da immer noch die Sandalenfilme. Hercules. Ursus. Maciste.«
Anna lächelte beschämt. »Nie davon gehört.«
»Cleopatra? Ben Hur?«
»Ja, klar, von denen schon.«
Bruno sah zufrieden aus. »Das waren zwei von den großen amerikanischen Kostümschinken, die sie hier bei uns gedreht haben. Clevere Studiochefs haben all die Kulissen und Kostüme eingelagert, und damit fabrizieren sie jetzt einen Film nach dem anderen über irgendwelche antiken Muskelmänner und ihre halb nackten Sklavinnen.« Sein beschwingter Tonfall verschwand, als er sachlicher hinzufügte: »Für uns Fotografen ist eigentlich nur wichtig, dass die Via Veneto der Ort ist, wo die ganze Bagage nach Drehschluss auftaucht. Erst in den Cafés, im Strega, im Paris oder dem Doney.«
Er deutete auf einen Laden mit mächtigen Glastüren und ausladenden Markisen auf der anderen Straßenseite. Üppige Blumenrabatten und hohe Platanen trennten die Tischreihen auf dem Bürgersteig von der Straße. Anna ließ den Blick über die Gesichter der Gäste wandern, erkannte aber kein einziges. Zumindest waren unter den Frauen mit ihren eleganten Hochsteckfrisuren, Seidenschals und roten Lippen einige, die sie sich als Filmdiven vorstellen konnte.
»Sind gerade irgendwelche Prominenten hier?«
Bruno sah nur flüchtig zu den Gästen im Café Doney hinüber und schüttelte lächelnd den Kopf. »Die kommen frühestens in ein paar Stunden. Danach ziehen sie weiter in die Nachtclubs in den Seitenstraßen. Und in ein paar Etablissements, die du auf keinen Fall von innen sehen wirst.«
»Ich bin fast zwanzig«, sagte sie, während sie an den Tischen vorüberschlenderten.
»Du bist meine Nichte. Ich bin jetzt für dich verantwortlich, und hier wird nichts passieren, das deiner armen Mutter nicht gefallen hätte. Die Heilige Maria sei mein Zeuge.«
»Halleluja«, sagte sie leise, aber natürlich hörte er es trotzdem und schien sich ein Lächeln zu verkneifen.
Als sie beschlossen hatte, nach Rom zu gehen, war sie nicht sicher gewesen, was genau sie hier suchte. Ein Teil von ihr hatte sich darauf verlassen, dass die Erkenntnis sie wie ein Blitzschlag treffen würde, wenn sie erst einmal angekommen war. Womöglich ein Trugschluss. Aber was es auch war, eine Gouvernante brauchte sie dabei bestimmt nicht.
Bruno bedeutete ihr, die Straße zu überqueren. »Wir werden diese Leute fotografieren, wo sie uns vor die Kameras laufen, aber ansonsten hältst du dich von denen fern, okay? Die sind nichts für ein anständiges Mädchen und –«
Der Rest seines Satzes ging im monumentalen Getöse von Kirchenglocken unter.
Anna unterdrückte den Reflex, sich die Hände auf die Ohren zu pressen. Jeder Glockenschlag hallte als zitterndes Echo in ihr nach. »Shit, was ist das denn?«
Es war, als hätten sich mit einem Mal alle Kirchen Roms unbemerkt herangeschlichen. Während Anna sich staunend im Kreis drehte, erwartete sie fast, dass sich Turmspitzen wie Riesen über die Dächer beugten und argwöhnisch auf sie herabblickten. Aber das Glockenspektakel schien direkt aus dem blauen Himmel über den Palazzi und Wohnhäusern zu beiden Seiten der Straße zu kommen.
»Wart’s nur ab!« Bruno nahm mit gelassenem Lächeln einen Zug von seiner Zigarette.
Ein Stück weit die Straße hinunter stürmte der Besitzer eines Kiosks ins Freie und schimpfte zu den Dächern hinauf. Autos stauten sich auf der Via Veneto, als neugierige Fahrer anhielten und die Köpfe aus den Fenstern reckten.
Nach einer Minute, vielleicht zweien, brach das Glockengeläut so abrupt ab, wie es begonnen hatte. Zu dem leisen Pfeifen in Annas Ohren gesellte sich vereinzeltes Autohupen.
Gleich darauf donnerte eine majestätische Stimme von den Dächern auf die Straße herab. Irgendwo musste jemand alle Regler für Echo und Hall auf Anschlag gezogen haben.
»Meine Kinder, ich segne euch!«, erklang es tief und gebieterisch. »Von meinem Thron in den höchsten Himmeln blicke ich auf euch nieder, und ich sehe, wie ihr darbt in schwerer Arbeit und schweren Gedanken. Das Leben, das ich euch schenkte, die Welt, die ich euch schuf … auf alldem lastet die Bürde eines grauen Alltags.«
»Heilige Scheiße«, entfuhr es Anna, als sie ahnte, was hinter dem Spektakel steckte.
»Darum höret meinen Rat!«, rief die Stimme. »Ist die Last eurer Sorgen zu groß, ist euch zu warm, die Sonne zu grell? So suchet ein klimatisiertes Filmtheater auf und fraget nach dem neuen gewaltigen Epos Als Gott den Menschen schuf! Eine Schöpfung so makellos, dass nicht einmal ich sie in sieben Tagen hätte vollbringen können.«
Anna fand Brunos Blick. Grinsend deutete er auf die Gebäude gegenüber. »Da sind Lautsprecher auf den Dächern. Gestern war die Piazza Navona dran. An der Spanischen Treppe waren sie auch schon.«
»Merket euch meine Worte und folget dem Willen des Allmächtigen!«, befahl die Stimme. »Als Gott den Menschen schuf! Sehet und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch glücklich machen. Als Gott den Menschen schuf! Amen. Amen. Amen!« Das letzte Amen brüllte er so inbrünstig, dass es blechern über die Straße schallte.
Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch glücklich machen.
Die Autos fuhren langsam wieder an. Einige Leute in den Cafés lachten, ehe sie ihre Gespräche wieder aufnahmen. Andere zeigten sich entrüstet. »Die schrecken vor nichts zurück«, sagte ein Mann im Vorbeigehen. Ein weiterer schüttelte verständnislos den Kopf. Hinter Anna widmete ein Portier sich neuen Gästen, und die Veneto kehrte zum Tagesgeschäft zurück.
Bruno schnippte seinen Zigarettenstummel in die Rabatten. »Willkommen in der Stadt des Herrn, Anna. Willkommen in Rom.«
2
Eine Stunde später verstaute Bruno Tüten mit Hosenanzügen, zwei Kleidern, Wollhosen und einer Seidenmischbluse in seinem Fiat 500. Im Schlussverkauf hatte Anna sich außerdem für einen Haarreif und eine Sonnenbrille entschieden, die ihr halbes Gesicht bedeckte. Bruno hatte zuvor darauf bestanden, alle ihre Einkäufe zu bezahlen, und ihr war keine andere Wahl geblieben, als das Angebot zögernd, wenn auch dankbar, anzunehmen. Mit dem wenigen Geld, das sie noch besaß, hätte sie sich gerade mal den Haarreif leisten können.
Auf dem Weg aus der Innenstadt wurden sie abermals von Schlagermusik aus dem Radio begleitet. An der langen Ausfahrtstraße reihten sich die berüchtigten Betonbunker der sozialen Bauprojekte aneinander. Gigantische Bienenwaben für die verarmte Landbevölkerung, die seit Jahrzehnten aus dem Süden nach Rom strömte. Noch schlimmer sei es in den neuen Vorstädten, erklärte Bruno, von denen solle sie sich um Himmels willen fernhalten. Und an die illegalen Hüttensiedlungen am Aquädukt Aqua Felice möge sie am besten nicht mal denken.
Plappernd trug er ihr die Tüten durch das Labyrinth der beigefarbenen Apartmentblöcke an der Via Portuense. Auch hier im Viertel könne es nicht schaden, einmal zu oft über die Schulter zu blicken, sobald sie die Wohnung verließ. Anna konnte ihm ansehen, dass er ihr gern etwas Besseres geboten hätte. Dabei bot er ihr Rom, und das war besser als alles, was sie in London zurückgelassen hatte.
Sie war außer Puste, als er endlich vor einer Wohnungstür stehen blieb und aufschloss. Ein kleiner Flur führte in eine Küche mit schlichten Armaturen und einem Ecktisch mit zwei Stühlen. Der schwere Kühlschrank kam ihr vor wie ein Tresor. Das ganze Apartment roch ein wenig nach feuchter Wäsche, auch wenn Anna keine entdecken konnte.
Bruno stellte ihre Tüten auf dem Tisch ab und führte sie wieder hinaus auf den Flur.
»Ich hab nicht vor, ewig hier zu wohnen«, sagte er. »Irgendwann werde ich ein kleines Haus haben, mit einem Garten und meinem eigenen Orangenbaum. Aber bis es so weit ist, müssen wir uns hiermit begnügen … Hier, sieh dir das mal an!«
Er blieb vor einer schmalen Tür stehen und legte die Hand auf die Klinke, wartete bedeutungsschwanger einige Augenblicke und drückte sie schließlich nach unten. Im Inneren war es stockfinster.
Verwirrt runzelte Anna die Stirn und drehte sich halb zu ihm um. Er strahlte erwartungsvoll über das ganze Gesicht.
»Die Dunkelkammer«, sagte er und schob einen dicken, schwarzen Vorhang zur Seite.
Der Raum maß nur wenige Quadratmeter. Jede der vier Wände war vom Boden bis zur Decke mit weißen Fliesen beklebt, ein Fenster gab es nicht. Hinter Anna knipste Bruno das Licht an, die Kammer wurde in rötlichen Schein getaucht.
Außer einem schiefen Metallschrank und einem Tisch gab es keine Möbel, dafür allerhand Gerätschaften und Utensilien, die sich auf der Platte häuften. Da waren Glas- und Plastikfläschchen mit verschiedenen Chemikalien, Messbecher und einige Fotozangen. Mehrere Entwicklerschalen stapelten sich um ein hohes Gerät, das empfindlich und sehr teuer aussah. Den Fuß der Apparatur bildete ein rechteckiger Rahmen. Daran führte eine lange Metallskala senkrecht zu einem kompakten Kopfstück mit Schrauben und Reglern.
»Das ist ein Vergrößerer. Damit projizierst du dein Filmnegativ auf Fotopapier, das du dann entwickelst. Hast du schon mal mit einem gearbeitet?«
»Nicht mit so einem.«
An straff gespannten Leinen hingen endlose Reihen von entwickelten Fotos: Männer und Frauen in Abendgarderobe, die aus Nachtclubs und Hotels in den Schein der Blitzlichter traten, grell genug, um sie alle aussehen zu lassen, als wären sie bei einem Verbrechen ertappt worden.
»Wie suchst du aus so vielen Bildern das eine richtige aus?«
Im roten Licht konnte sie ihn wieder schmunzeln sehen. »Man weiß es, wenn man es sieht.«
Anna wurde neugieriger, als sie eine Bilderreihe entdeckte, die schnell hintereinander geknipst worden war. Hätte sie die Fotos übereinandergelegt und wie ein Daumenkino durchgeblättert, wäre die Szene in ihrer Hand zum Leben erwacht.
Die Bilder zeigten eine Rangelei zwischen einem Bodybuilder im Anzug und einem Fotografen, der sich – wie ein Bankräuber in einem Western – ein schwarzes Tuch über Mund und Nase gezogen hatte. Bruno war bis auf eine Armlänge an die beiden herangerückt, und eines der letzten Fotos verriet, dass der Koloss auch auf ihn losgegangen war.
»Sieht gefährlich aus«, sagte Anna und wunderte sich selbst ein wenig über die Faszination in ihrer Stimme.
»Das hier war sogar echt.« Vorsichtig legte Bruno zwei Finger hinter eines der Bilder und hob es an, um es eingehender zu betrachten. »Mit anderen, die lange nicht mehr in der Zeitung waren, sprechen wir uns vorher ab.«
Sie sah irritiert zu ihm auf. »Ihr stellt solche Szenen?«
Bruno ließ das Bild los und zuckte mit den Schultern, während es träge an der Leine schaukelte. »Tut doch keinem weh. Wir verdienen an dem Foto und die Schauspieler an der Publicity. Jedenfalls hoffen sie das.«
Sie lehnte sich gegen den Metallschrank. »Wie genau läuft das ab? Wartet ihr den ganzen Abend, bis irgendwer auf die Straße kommt, mit der falschen Frau oder dem falschen Kerl am Arm?«
»So einfach ist das nur selten. Wir sind ständig unterwegs und fahren mit den Vespas die Clubs und Bars und Cafés ab. Meistens sind mehrere von uns zusammen auf der Jagd. Es gibt so eine Art Ehrenkodex. Jeder versucht, das beste Foto zu schießen, aber wir helfen einander, wenn es hart auf hart kommt.«
Wieder wanderte Annas Blick zu der ungestellten Bilderreihe. »Also, dem hier mit dem Tuch vorm Gesicht hast du nicht geholfen – du hast ihn nur fotografiert.«
Bruno winkte ab. »Das ist Spartaco. Der weiß genau, wie weit er gehen kann. So was passiert ihm nicht zufällig.«
Spartaco. Sie gab ein Schnaufen von sich, das zu einer anderen Zeit vielleicht ein Lachen geworden wäre. Spartaco der Gladiator. Der Aufrührer. Der einsame Rebell gegen das römische Establishment. Der alberne Name passte zu dem Theater mit dem Tuch.
»Jeder macht für sich das Beste draus«, sagte Bruno. »Im Grunde ist es so was wie ein, sagen wir, sportlicher Wettbewerb. Jeder kämpft mit seinen eigenen Waffen, aber das macht uns nicht zu Gegnern. Spartaco ist einer der Besten, und wenn er dafür seine Maskerade braucht … Soll er doch. Mich interessiert’s nicht.«
Der Schrank gab ein blechernes Ploppen von sich, als Anna sich davon abstieß und die dünne Metalltür zurück in ihre Form sprang. Sie schob die Hände in die Taschen ihrer Leinenhose und löste ihren Blick von den Fotos. »Am Ende geht’s aber doch ums Geld, oder?«
Bruno seufzte. »Sicher. Für ein normales Pressefoto zahlt mir die Repubblica dreitausend Lire. Ich müsste zwanzig oder dreißig davon im Monat verkaufen, um auf das Gehalt eines Arbeiters zu kommen. Dagegen kann ich vom Specchio oder der Ore für ein anständiges Skandalfoto zweihunderttausend Lire kassieren. Drei oder vier solcher Bilder sind so viel wert wie ein neuer Fiat.«
Anna stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Also jagen wir nur Skandale?«
Brunos Lächeln kehrte zurück. »Heute Abend lernst du erst mal die anderen kennen. Und dann probieren wir was aus, falls du das wirklich willst.«
Damit führte er sie aus der Dunkelkammer, knipste das Licht aus, schloss erst sorgfältig den Vorhang und dann die Tür.
Der Rest der Wohnung bestand aus einem Wohnzimmer mit fleckigem Teppich, einem Bad mit winzigem Fenster und zwei Schlafzimmern.
»Ich schlafe im hinteren Zimmer«, sagte Bruno. »Du kannst das mit dem Balkon haben. Die Aussicht macht nicht viel her, aber abends kann man die Sterne sehen, weil in der Richtung keine Fabriken liegen.«
In einem Anflug von Dankbarkeit machte sie einen Schritt nach vorn und umarmte ihn. Wieder fiel ihr auf, wie schmal und drahtig er war. »Das ist lieb von dir. Nicht nur das Zimmer, überhaupt alles. Dass ich hier sein darf.«
»Wir sind eine Familie.« Er lächelte. »Hier in Italien bedeutet das noch was.«
Das Zimmer war heller als der Rest der Wohnung. Neben dem schlichten Bett gab es ein Nachttischchen mit Lampe, einen alten Kleiderschrank, einen Sessel und ein Regalbrett mit einigen Büchern und Krimskrams. Über dem Bett hing der verblichene Druck eines Landschaftsgemäldes.
»Du kannst bleiben, so lange du willst. Valeria hätte das so gewollt. Sie hat Rom immer geliebt.«
Anna hatte schon die Hand nach der Balkontür ausgestreckt, als Bruno noch etwas hinzufügte. Ihre Hand verharrte am Griff.
»Tigano hat sich immer geweigert, zurückzukommen«, sagte er leise, als würde das die Worte sanfter machen. »Kein Tag vergeht, an dem ich mir keine Vorwürfe mache. Ich hab nicht geahnt, dass so was passieren könnte. Tigano ist mein Bruder, aber dass er zu so was fähig wäre …«
»Niemand hat das kommen sehen.« Anna spürte einen Kloß im Hals, der ihr für einen Augenblick die Luft nahm. Sie räusperte sich, als sie die Sorge in Brunos Blick erkannte. »Er hat Mum nie ein Haar gekrümmt, das hätte ich gemerkt. Sie haben gestritten, aber nicht mehr als andere.« Allmählich konnte sie wieder atmen. »Ich würde alles geben, um zu erfahren, was passiert ist. Wirklich passiert, meine ich. Worüber sie geredet haben. Was ihnen durch den Kopf gegangen ist.«
Von der anderen Seite des Raumes sah Bruno sie verblüfft an. »Du glaubst noch immer nicht, dass er es war?«
Die Übelkeit kehrte schlagartig zurück. Annas Hand glitt vom Griff der Balkontür. »Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Die Beweise sprechen gegen ihn. Aber er sagt, er erinnert sich an nichts.«
»Telefonierst du noch mit ihm?«
Sie wollte den missbilligenden Ausdruck auf seinem Gesicht nicht sehen und wandte sich dem Fenster zu, ohne die Aussicht wahrzunehmen. »Manchmal«, sagte sie leise.
»Das ist nicht gut, Anna.«
»Das ist das Einzige, was ich tun kann.«
»Ich würde ihn umbringen, wenn ich könnte.« Bruno verstummte. Sie hörte, wie er hinter ihr einen zögernden Schritt in ihre Richtung machte. Kleidung raschelte, als er sich die Handflächen am Hemd abwischte. »Tut mir leid«, sagte er dann. »Ich sollte so was nicht über meinen eigenen Bruder sagen.«
»Es gab Tage, da habe ich das Gleiche gedacht.« Es hatte auch Tage gegeben, da hatte sie sich für diese Gedanken gehasst.
»Du bist ein starkes Mädchen geworden.« Er räusperte sich unbeholfen. »Eine starke Frau.«
Sie schüttelte den Kopf und streckte die Hand wieder nach der Tür zum Balkon aus. »Ich weiß nicht mal, was das ist – Starksein. Seit Mum tot ist, reagiere ich nur noch auf die Dinge. Irgendwas passiert, und ich tue daraufhin irgendwas anderes und … Ich weiß nicht, ob das Stärke ist.«
Mit einem leichten Ruck drehte sie den Griff zur Seite. Die Scharniere quietschten. Der Balkon bot gerade mal genug Platz für einen Stuhl und einen Klapptisch.
Von unten drang vielstimmiges Kindergebrüll herauf. Vor dem Haus drosch eine alte Frau den Staub aus ihren Teppichen, und irgendwo ließ jemand immer wieder den Motor eines kaputten Autos aufheulen.
»Ich mag die Aussicht«, sagte Anna und betrachtete die Wäscheleinen auf der Rasenfläche.
»Nie im Leben.« In Brunos Stimme schwang ein Lächeln mit, als er näher herantrat.
»Das ist Rom«, sagte sie. »Mum ist so gern hier gewesen. Ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen.«
3
Der einzige Einheimische unter den Touristen, die am Vormittag das Café de Paris besetzten, hielt seine aufgeschlagene Zeitung wie einen Sichtschirm. Er trug einen grauen Anzug und handgemachte Schuhe, nicht mehr ganz neu, aber sauber poliert. Hinter der Corriere della Serra kräuselte sich eine dünne Rauchfahne am Sonnenschirm vorbei zum wolkenlosen Himmel empor. Zwischen dem Cinzano-Aschenbecher und der leeren Kaffeetasse lag ein La- Stampa-Exemplar, frisch vom internationalen Kiosk nur wenige Schritte den Gehweg hinunter.
Das Café de Paris war eines von mehreren großen Kaffeehäusern, die sich zwischen den Grand Hotels am oberen Ende der Via Veneto auf den Bürgersteigen breitgemacht hatten. Sie hatten nicht nur die blau-roten Sonnenschirme und Markisen gemein, sondern auch die unverschämt hohen Preise.
Der High Society, die hier an den Abenden einkehrte, taten die hohen Rechnungen nicht weh. Und die Touristen wussten nicht, dass Stars und Sternchen am Vormittag entweder zu beschäftigt oder zu erschöpft waren, um sich auf der Via Veneto blicken zu lassen. Aber der Hauch des berüchtigten Dolce Vita und die Hoffnung auf alten Adel, junge Schauspielerinnen, Filmproduzenten, Politiker oder millionenschwere Geschäftsleute am Nebentisch schien es den meisten Besuchern wert zu sein, zumindest ein paar Stunden auf der Veneto zu verbringen.
Gennaro Palladino interessierte sich für bekannte Gesichter allein aus beruflichen Gründen. Auch deshalb saß er Morgen für Morgen im Café de Paris und studierte die Zeitungen.
»Alles zu Ihrer Zufriedenheit, Signor Palladino? Wünschen Sie jetzt Ihren zweiten Kaffee?« Der Kellner, der auf leisen Sohlen herangetreten war, zog mit einer eleganten Handbewegung die leere Tasse von der Tischdecke.
»Ja, danke, Enzo. Irgendwas Neues, das ich wissen sollte?«
Für Palladinos Beruf war es unverzichtbar, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Die Presse gab einen passablen Überblick, aber sie war nichts gegen die aufmerksamen Barkeeper und Kellner der Via Veneto. Er ließ seine Zeitung sinken und legte die Stirn in Falten, als er zu Enzo aufblickte.
»Großer Gott, Enzo … was ist mit Ihrem Auge passiert?«
Der Kellner war wie immer tadellos gekleidet und sorgfältig rasiert. Rund um sein rechtes Auge aber war die Haut dunkelblau angelaufen, Lid und Tränensack dick angeschwollen. »Eine Unannehmlichkeit auf dem Nachhauseweg«, sagte er diskret.
Palladino verzog das Gesicht. »Wohnen Sie noch immer draußen in Magliana?«
»Es gibt noch schlimmere Gegenden in Rom.« Enzos feines Lächeln war heute nicht ganz so überzeugend wie sonst.
»Erzählen Sie schon.«
Der Kellner zuckte die Achseln. »Das Übliche: Ein paar Kommunisten, ein paar Faschisten, ein paar harmlose alte Leute in der Mitte – und jemand, der ihnen zu Hilfe gekommen ist.«
»Dann sind Sie also jetzt ein Held?«
Enzo schlug die Augen nieder, als wäre ihm allein der Gedanke unangenehm. »So steht’s zumindest in der Zeitung.« Hastig fügte er hinzu: »Nicht mein Name, natürlich. Nur, was passiert ist. Aber sie lassen es so aussehen, als wären es ein paar betrunkene Jugendliche gewesen, die aufeinander eingeschlagen haben … So läuft das eben, seit Moro die Kommunisten in die Regierung holen will.«
Palladino klemmte sich seine Zigarette zwischen die Lippen und breitete die Zeitung auf dem Tisch aus. Mit lautem Geraschel blätterte er zum Lokalteil. »Irgendwer hat gesagt, dass es zwei Arten von Faschisten gibt: die Faschisten und die Antifaschisten. Die einen sind keinen Deut besser als die anderen.«
»Ich weiß nicht mal, welcher Sorte ich das blaue Auge verdanke«, sagte Enzo.
»Hier ist es.« Palladino überflog den Artikel und warf einen Blick auf das Foto daneben. Eine Momentaufnahme von kräftigen Männern, die mit bloßen Fäusten und hassverzerrten Visagen aufeinander einschlugen. »Himmel, man sieht sogar auf dem Foto, dass das keine besoffenen Halbstarken waren.« Er seufzte und schlug die Zeitung zu. »Noch andere Verletzungen?«
»Nein, alles in Ordnung.« Enzos Gesicht bot eindrucksvolle Farbnuancen. Das Spiel von Rot, Violett und Schwarz, die gespannte Haut wie nach einem Wespenstich – zuletzt hatte Palladino so etwas im Spiegel gesehen. Ein Teil von ihm erinnerte sich ein wenig zu gut daran, und sein eigenes Auge begann zu jucken und zu pochen.
Der Kellner senkte die Stimme. »Haben Sie schon das von Jack Denning gehört?«
Denning war ein mittelmäßiger Schauspieler, der sich großspurig zum »amerikanischen Bürgermeister von Rom« ernannt hatte. Er gehörte zu jener illustren Gemeinde von Filmleuten, die in den letzten zehn Jahren aus Amerika nach Rom immigriert waren, weil sie in Hollywood keine Jobs mehr bekamen. Mit ihren Familien, Geliebten, Agenten und Managern bewohnten sie schicke Apartmentanlagen im Parioli-Viertel und im Stadtteil Vigna Clara. Die Einheimischen sprachen naserümpfend vom Amerikanischen Getto, aus dem allmorgendlich eine Flotte von Ferraris und Alfa Romeos aufbrach. In Cinecittà und den kleineren Studios an der Via Tiburtina spielten ihre Besitzer in dritt- oder viertklassigen Produktionen und polierten die Patina ihrer gescheiterten Karrieren.
Palladino hatte für einige von ihnen gearbeitet – und genauso oft auch gegen sie. Meist ging es um Scheidungssachen: Dann lag er vor Schlafzimmerfenstern auf der Lauer und besorgte Beweise, die betrogenen Gattinnen und gehörnten Ehemännern die Tränen in die Augen und die Scheckbücher in die Hände trieben.
»Was hat der Drecksack denn diesmal angestellt?«
Enzo rümpfte die Nase. »Sie wissen es wirklich noch nicht?«
»Herrje, Enzo – rücken Sie schon raus mit der Sprache.«
Im Ringen nach vornehmen Worten, um die Sache treffend zu beschreiben, ließ der Kellner zu, dass der Löffel auf der Untertasse klimperte.
»Wir sind doch unter uns«, raunte Palladino ihm zu. Manchmal brauchte Enzo eine gewisse Aufmunterung, nicht nur finanzieller Natur.
Der Kellner drehte dem Nachbartisch den Rücken zu. »Vorgestern, im Jicky«, flüsterte er, »da hat Denning einer gewissen jungen Dame ans Hinterteil gefasst.«
»Und?«
Das Jicky war einer der Nachtclubs an der Via Veneto – wenn man das Wort denn derart strapazieren wollte. Genau genommen war es das schlichte Hinterzimmer eines Restaurants. Zu etwas Außergewöhnlichem machte es einzig die Art von Menschen, die es in den frühen Morgenstunden dorthin verschlug. Der Griff an Hinterteile war nichts, womit man dort nicht rechnen musste.
Nun konnte sich selbst Enzo ein süffisantes Grinsen nicht verkneifen. »Die junge Dame gehört zum Privatbesitz von Carmine Ascolese.«
Palladino horchte auf. »Don Ascolese?«
Enzo nickte eifrig. »Dottore Ascolese war nicht erfreut, als er von dem Vorfall hörte, und so hat er zwei seiner Mitarbeiter gebeten, Mister Denning einen Besuch abzustatten. Wie man hört, haben sie ihm die rechte Hand … nun …«
»Gebrochen?«, schlug Palladino vor.
Enzos Stimme war jetzt kaum mehr als ein Wispern. »An den eigenen Arsch genäht. Jeden einzelnen Finger!« Vor Schadenfreude rutschten die letzten Silben in eine höhere Tonlage.
»In vielen Drehbüchern muss er ja eh nicht mehr blättern.« Palladino zog genüsslich an seiner Zigarette.
Ascolese also. Für derart dämlich hätte er selbst Jack Denning nicht gehalten.
Enzo unterdrückte ein Lachen und hielt vorsichtshalber den kleinen Löffel auf der Untertasse fest. Palladinos Blick streifte das verletzte Auge, und erneut begann sein eigenes zu schmerzen. Er schloss die Lider und massierte sie mit den Fingerspitzen, bis das Pochen langsam nachließ.
Als er die Augen wieder öffnete, stand ein Fremder vor seinem Tisch.
»Signor Palladino? Gennaro Palladino?«
Der Mann trug die schwarze Uniform und Schirmmütze eines Chauffeurs. Er mochte sich noch so große Mühe geben, mit artikulierter Stimme zu sprechen – Palladino kannte Gesichter wie seines. Eine Spur zu hart, eine Spur zu erfahren, mit einem Anflug von resignierter Melancholie.
Palladino hob eine Braue. »Was kann ich für Sie tun?«
Enzo verschwand bereits im Inneren des Cafés. Aus dem Augenwinkel sah Palladino seine weiße Jacke im Halbschatten hinter der Scheibe verharren. Immer die Augen und Ohren offen, dachte er amüsiert. Auch deshalb schätzte er Enzo so viel mehr als die meisten anderen Kellner der Via Veneto. Seine Informationen machten den Aufpreis, den Palladino hier für den Kaffee zahlte, mehr als wett.
»Verzeihen Sie die Störung, Signor Palladino«, sagte der Fremde. »Ich bin im Auftrag der Contessa Amarante hier. Sie würde sich freuen, wenn Sie ein wenig Zeit für sie hätten.«
Palladino drückte seine Zigarette aus, ohne den Fremden aus den Augen zu lassen. Dann blies er langsam den Rauch aus und lehnte sich zurück. »Ich hab einiges zu tun im Moment. Viele Damen misstrauen ihren Ehemännern und –«
»Die Contessa Amarante ist verwitwet«, unterbrach ihn der Mann und bestätigte Palladinos Vermutung, dass er es nicht mit einem einfachen Fahrer zu tun hatte. Wahrscheinlich verteidigte er die gute Contessa nicht nur mit Worten. »Ich bin befugt, Ihre Honorarvorstellungen zu akzeptieren, falls Sie sofort verfügbar wären.«
»Sie kennen meinen üblichen Satz?«
»Selbstverständlich. Darüber hinaus bietet Ihnen die Contessa einen Bonus von dreißig Prozent, falls Sie die Angelegenheit übernehmen. Weitere zwanzig Prozent, sollten Sie mich umgehend begleiten.«
Palladino ordnete in Ruhe seine Zeitung und faltete sie zusammen. Dann schob er geräuschvoll seinen Stuhl zurück und erhob sich.
»Der Schlitten da ist Ihrer?« Mit dem Kinn deutete er grob in die Richtung einer schwarzen Luxuskarosse auf der anderen Straßenseite.
»Der Mercedes gehört zum Fuhrpark des Palazzo Amarante«, sagte der Mann steif.
»Ich vermute mal, Sie können mir nicht einfach sagen, um was es geht?«
»Nein. Ich wurde beauftragt, Ihnen etwas zu zeigen. Danach wird die Contessa persönlich mit Ihnen sprechen.«
Der Name Amarante war Palladino vertraut, aber er konnte sich nicht erinnern, der Contessa je persönlich begegnet zu sein. Zehn Jahre in seinem Job – und fast zwanzig in dem davor – hatten ihn gelehrt, dass hinter jeder Fassade voller lächelnder Steinengel Abgründe klafften. Der Palazzo Amarante bildete da gewiss keine Ausnahme.
Der Chauffeur zog ein Bündel Scheine aus seiner Jackentasche und reichte sie Palladino. »Ist das genug für eine Stunde Ihrer Aufmerksamkeit?«
»Fürs Erste, ja.« Palladino steckte das Geld ein und ließ einen Schein für Enzo auf dem Tisch zurück.
»Haben Sie noch eine andere Krawatte?«, fragte der Chauffeur, als Palladino ihm zur Limousine folgte.
»Haben Sie einen Namen?« Palladino richtete seinen roten Schlips und fragte sich, was dem Lakaien der Contessa daran nicht passte.
»Sandro.« Mit der Hand am Türgriff hielt der Chauffeur inne und fügte mit ernster Miene hinzu: »Die Krawatte ist dem Anlass nicht angemessen.« Er öffnete die Tür und ließ Palladino auf der Rückbank Platz nehmen. Dann trat er um den Wagen, setzte sich hinters Steuer und startete den Motor.
Palladino streckte die Beine im großzügigen Fußraum aus, strich mit einer Hand über die Ledergarnitur und atmete den Geruch ein. Im Rückspiegel beobachtete er Sandros Augen. »Die Contessa legt also Wert auf Mode?«
»Die Contessa legt Wert auf Pietät«, entgegnete Sandro. »Sie hat den Toten sehr geschätzt.«
Palladinos Oberkörper federte nach vorn. »Warten Sie. Welcher Tote?«
Statt zu antworten, fuhr Sandro los. Als er den Wagen in den Verkehr Richtung Piazza Barberini eingereiht hatte, löste er die Rechte vom Lenkrad, um etwas aus dem Handschuhfach zu ziehen.
»Probieren Sie die hier«, sagte er, ohne den Blick von der Straße zu nehmen.
Palladino rang einen Moment mit sich, ehe er die schwarze Krawatte entgegennahm. »Von was für einem Toten reden wir hier?«
Die Mimik des Fahrers blieb unbewegt. »Sie erfahren alles Nötige, wenn wir da sind.«
Palladino sank zurück in den Ledersitz. Während er umständlich den Krawattenknoten löste, registrierte er alle Straßen, die am Fenster vorüberzogen.
Schließlich bogen sie in eine Gasse mit vielen farbigen Türen und Fensterläden. Die Via Margutta war die Straße der Künstlerateliers und Galerien, eine schmale, schnurgerade Schlucht zwischen hohen Häusern. Manche waren vom Pflaster bis zum Dach bunt angestrichen, andere grau vom Kohlestaub der Öfen.
Die schwarze Limousine fuhr jetzt im Schritttempo. Obwohl die Gasse gerade breit genug für den Mercedes war, saßen am Straßenrand Musiker mit Akkordeons oder Celli neben Malern, die lautstark ihre Werke anpriesen.
Palladino atmete tief durch, als der Wagen vor einer Fassade voller Efeuranken anhielt.
Sandro zog den Zündschlüssel ab. »Wir sind da, Signore. Hier ist es.«
»Das ist keine Adresse für eine Contessa. Hier gibt’s zu viele Sozialisten.« Zwei davon schoben sich gerade zwischen Wand und Wagen vorbei, nicht ohne argwöhnische Blicke auf Sandro und Palladino zu werfen.
»Sie werden der Contessa Amarante später begegnen, nicht hier«, sagte der Chauffeur und stieg aus.
Widerwillig öffnete Palladino die hintere Tür und fluchte, als der Fassadenputz am schwarzen Lack kratzte. Er warf die Tür zu und folgte Sandro die Steinstufen des Treppenhauses hinauf in den dritten Stock.
Wie an allen anderen Wohnungstüren im Haus fehlte auch an jener, vor der Sandro schließlich stehen blieb, das Namensschild. Der Chauffeur griff in seine Jackentasche und beförderte einen Schlüsselbund ans trübe Tageslicht im Treppenhaus.
»Signor Fausto war oft so sehr in seine Arbeit im Atelier vertieft, dass er die Klingel nicht gehört hat. Oder nicht hören wollte. Ich war dann befugt, einzutreten und ihn an seine Verabredung mit der Contessa zu erinnern.«
Aus einem langen Flur schlug ihnen beißender Gestank entgegen. Der Geruch von offenen Wunden war so penetrant, dass Palladinos Augen schon nach wenigen Schritten tränten.
Er hatte nicht zum ersten Mal beruflich mit dem Tod zu tun. In zwei Jahrzehnten Polizeiarbeit hatte er Dutzende Leichen gesehen. Das Schlimmste daran waren weder die faulenden Körper noch die Maden und Fliegen. Es war dieser ganz eigene Geruch von Gewalt. Leichengestank war übel genug, aber der von Mordopfern blieb tagelang an einem haften.
»Ist die Leiche noch hier?«
Hinter ihm schloss Sandro die Tür zum Hausflur, bevor er ungerührt erklärte: »Die Contessa hielt es für klüger, keine Polizei zu verständigen. Wenn Sie hier fertig sind, wird sich jemand um alles Nötige kümmern.« Er ging an Palladino vorüber auf die Tür am Ende des Flurs zu. Durch den offenen Spalt warf das Tageslicht einen hellen Streifen auf den Steinboden.
»Er ist im Atelier«, sagte Sandro. »Da war er immer, wenn ich hergeschickt wurde, um ihn abzuholen.«
»Ihre Chefin hat ihn hier gar nicht besucht?«
Im hohen Flur drehte Sandro sich um. »Wie ich schon sagte, Signor Palladino: Die Contessa ist Witwe, noch dazu besitzt sie ein beträchtliches Vermögen. Es gibt keinen Grund, warum sie einen guten Bekannten nicht im Palazzo Amarante empfangen sollte.« Mit einer Hand drückte er die Tür auf und betrat einen weiten Raum.
Palladino folgte ihm langsam. Hier war der Gestank fast unerträglich. Fluchend zog er die Hand in seinen Jackenärmel und eilte durch den Raum, um eines der großen Fenster aufzureißen.
»Tun Sie das nicht!«, sagte Sandro. »Wir wollen nicht, dass einer der Nachbarn etwas bemerkt.«
Mit der umhüllten Hand über dem Fenstergriff blieb Palladino stehen und drehte sich um. »Und das Treppenhaus? Es wird nicht lange dauern, bis man ihn im ganzen Haus riechen kann.«
»Die übrigen Etagen sind unbewohnt.«
»In der Via Margutta? Wir sind gerade mal einen Block von der Piazza di Spagna entfernt. Wer lässt im historischen Zentrum ein Haus leer stehen?«
»Das Gebäude gehörte Signor Fausto. Er hat keinen Wert auf Gesellschaft gelegt. Und er hat nicht viel Platz gebraucht. Nur das Nötigste zum Leben – und Raum für seine Kunst.«
Um diese Tageszeit fiel durch die Vorhänge des Ateliers ein diffuses Licht. An einer hellen Wand prangten Farbspritzer, die ihr Ziel verfehlt hatten.
»Als hätte er gewusst, dass er gehen würde«, sagte Sandro mit Blick auf das Dutzend Staffeleien und Leinwände, die wie alte Möbelstücke mit weißen Laken verhängt waren.
Viele weitere Bilder lehnten stapelweise an den Wänden, die unbemalten Rückseiten nach vorn gewandt. Dazu kamen sieben oder acht mannshohe Skulpturen, so gründlich verhüllt, dass nicht einmal die Sockel unter den Laken hervorschauten. Das Zentrum des Raumes bildete eine quadratische Metallplatte, offenbar die Unterlage, auf der Faustos Plastiken entstanden waren.
»Und wo ist nun die Leiche?«, fragte Palladino.
Der Chauffeur deutete nach oben. »Wenn Sie den Blick zur Decke heben …«
Hoch über der Metallplatte am Boden befand sich ein Seilzug, um die schweren Skulpturen anzuheben. Statt Marmor oder Granit waren zwei über Kreuz genagelte Bretter waagerecht hinauf zur Decke gezogen worden. Von dort aus starrten Faustos tote Augen auf sie herab. Der Künstler war mit dem Bauch nach unten am Kreuz fixiert worden. Seine Lippen in dem eingefallenen Gesicht standen ein Stück weit offen. Langes, graues Haar umrahmte seinen Kopf als strähniger Kranz. Um Hand- und Fußgelenke waren die Stricke so fest gewickelt, dass die Haut sich dunkel verfärbt hatte. In wenigen Tagen wären die Fesseln vermutlich durchgefault.
Palladino tauschte einen Blick mit Sandro, der noch immer an der Tür zum Flur stand. Dann trat er einige Schritte näher an die Plattform heran, legte den Kopf in den Nacken und betrachtete den tiefen Schnitt an der Kehle des Toten. Darunter auf der Metallplatte befanden sich nur wenige Blutspritzer, die sich kaum von den Farbsprenkeln an der Wand unterschieden.
»Sie selbst haben ihn so gefunden?«, fragte er.
»Vor gut zwei Stunden.«
»Wo ist er getötet worden?«
»Im Badezimmer ist eine Menge Blut.«
Palladino ging hinüber in das fensterlose Bad. Auf dem Boden waren nur vereinzelte Tropfen und ein paar Schmierflecken zu sehen wie Wegweiser einer makaberen Schnitzeljagd. Er riss Toilettenpapier von der Rolle und schob damit vorsichtig den Plastikvorhang der Wanne beiseite. Schlieren von leuchtend rotem Blut zogen sich die weiße Emaille hinab und vereinten sich zu einer Pfütze.
Sandro betrat hinter Palladino den Raum. »Hier haben sie ihn ausbluten lassen wie ein Schwein.«
4
Durch Schwaden aus Zigarettenrauch folgten ihr zahllose Blicke. Im hinteren Teil der engen Bar dirigierte Bruno Anna zu einem Tisch, gleich neben einem Flipper und der Tür zur Toilette. Die meisten Männer, an denen Anna vorüberging, musterten sie belustigt, andere starrten sie feindselig an. Sie entdeckte keine weitere Frau inmitten all der Paparazzi, die sich hier vor ihren nächtlichen Streifzügen trafen.
Anna hatte ihr Batikhemd ganz unten in die Reisetasche gestopft, bevor sie losgefahren waren. Stattdessen trug sie jetzt einen dunklen Hosenanzug, dazu einen weißen Schal. Ihr Haar hatte sie mit dem Reif zurückgeschoben und ihre Augenwinkel mit Kajal nach außen verlängert, wie es hier in der Stadt die meisten Frauen machten. Bruno hatte sie begutachtet und befunden, dass sie sich derart ausstaffiert bestens in die abendliche Partygesellschaft der Via Veneto einfügen würde. Allerdings wäre in Anbetracht ihrer gegenwärtigen Umgebung etwas weniger Auffälliges zweckdienlicher gewesen.
Ihr Onkel erreichte den Tisch als Erster. Die vier Männer, die dort saßen, begrüßten ihn mit freundschaftlichen Rufen, während sie Anna neugierig musterten.
»Darf ich vorstellen, die Herren: meine Nichte, Anna Savarese. Ich hab euch von ihr erzählt. Dass ihr euch ja von eurer besten Seite zeigt!«
»Du hast nicht erzählt, dass sie aussieht wie Jane Fonda!« Der Jüngste am Tisch strahlte Anna an. Mit einer Hand spielte er nervös an seiner Kamera, die andere versuchte, den Wirbel auf seinem Kopf zu glätten.
»Jane Fonda ist blond«, sagte Anna. »Aber du machst ja auch nur Schwarz-Weiß-Fotos, oder?«
Während die anderen Männer grinsten, sagte Bruno: »Der vorlaute Kleine ist Michele.«
»Hi, Anna«, sagte Michele. Als er aufstand, um ihr die Hand zu reichen, konnte sie sehen, dass er als Einziger am Tisch Turnschuhe trug.
Der Reihe nach deutete Bruno auf die anderen Fotografen und nannte Anna ihre Namen.
Gianni wirkte nur wenige Jahre älter als Michele, aber um seine freundlichen Augen sammelten sich so viele Lachfalten, dass sein wahres Alter schwer zu schätzen war. Renato nickte ihr mit stummem Lächeln hinter seiner runden Brille zu, ehe er sich wieder seinem Bier widmete.
»Der da mit dem finsteren Blick ist Saverio«, sagte Bruno.
»Der da!«, wiederholte Saverio empört. Er lehnte sich zurück und richtete seine Jacke. »Dein Onkel und ich sind zusammen zur Schule gegangen.«
»Ja, die ganzen vier Jahre.« Michele grinste frech, aber Saverio ignorierte ihn. Er hatte den Kopf gedreht, sodass Anna ihn nur im Profil sehen konnte. Die Lippen verengten sich zu einer schmalen Linie, ansonsten blieb sein Gesicht bewegungslos. Seine Aufmerksamkeit galt dem Nachbartisch, irgendwo hinter ihr. Saverios Zigarette war bis auf den Stumpf heruntergebrannt und würde ihm jeden Moment die Fingerspitzen versengen. Trotzdem fixierte er einen seiner Kollegen durch den Rauch, ohne auch nur zu blinzeln.