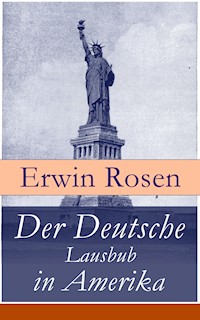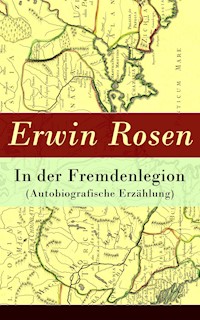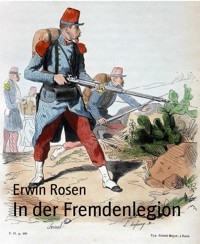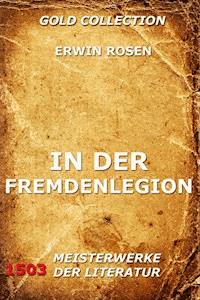
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der deutsche Schriftstellers schildert hier wie er nach einer glücklosen Beziehung zu einer Fraz über Nacht verschwindet und sich in der Fremdenlegion anwerben lässt. Inhalt: Wie ich Legionär wurde. Nach Afrika! Legionär Nummer 17 89. In der Kaserne. Die militärische Tüchtigkeit der Fremdenregimenter. "Legionär nix Geld." Die Stadt der Fremdenlegion. Hunderttausend Helden - Hunderttausend Opfer. "Marschier oder verreck!" Legionärsmarotten, Legionswahnsinn. Das Desertionsfieber. Das Kapitel der Strafen. Vom typischen Laster. Meine Flucht. J'accuse ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In der Fremdenlegion
Erinnerungen und Eindrücke von Erwin Rosen
Inhalt:
Erwin Rosen – Biografie und Bibliografie
In der Fremdenlegion
Wie ich Legionär wurde.
Nach Afrika!
Legionär Nummer 17 89.
In der Kaserne.
Die militärische Tüchtigkeit der Fremdenregimenter.
»Legionär nix Geld.«
Die Stadt der Fremdenlegion.
Hunderttausend Helden – Hunderttausend Opfer.
»Marschier oder verreck!«
Legionärsmarotten, Legionswahnsinn.
Das Desertionsfieber.
Das Kapitel der Strafen.
Vom typischen Laster.
Meine Flucht.
J'accuse ...
In der Fremdenlegion, Erwin Rosen
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849624422
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Erwin Rosen – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller und Journalist, geb. am7. Juni 1876 in Karlsruhe, gest. 21. Februar 1923 in Hamburg. Nach einem abgebrochenen Studium wanderte Rosen bereits mit 19 Jahren in die USA aus und verdingte sich mit Arbeiten für eine texanische Farm, die Western Post und begleitete die US-Armee als Journalist beim Kampf um Signal Hill auf Kuba. Später trat er für zwei Jahre der Fremdenlegion bei.
Wichtige Werke:
Der deutsche Lausbub in Amerika(3 Teile)In der FremdenlegionIn der Fremdenlegion
Quosque tandem?
Der französischen Nation gewidmet.
Ueber allem im Leben steht die Frau ...
Es war einmal ein Mann, der das Glück fand – in jungen Jahren, aber nach einem wilden Leben. Vom Häusermeer Neuyorks bis zum Goldenen Tor des Pazifischen Ozeans hatte er die Neue Welt durchstreift in seiner gedankenlosen Jugend; hatte den Kampf der Amerikaner auf Kuba mitgemacht und seine junge Nase in kleine zentralamerikanische Republiken gesteckt. Hatte sich von den Zeitungskönigen Amerikas lehren lassen, wie man ein guter Journalist wird. Abenteuerzeiten waren es gewesen, in denen sich die Erlebnisse und der Werdegang von Jahren in Monate zusammendrängten. Dann kam er in die deutsche Heimat zurück und wurde deutscher Journalist, Redakteur, Schriftsteller, bis eine Art Erfolg und eine Art Seßhaftigkeit kam und – das Glück.
Ueber allem im Leben steht die Frau.
Der Schriftsteller verstand es nicht, sein Glück zu halten. Nach seinem amerikanischen Leben voller Auf und Nieder, voller Wechsel und Daseinskampf, war er noch nicht reif für die Seßhaftigkeit. Kluge Menschen schüttelten die Köpfe über ihn, der die Werte seiner Begabung durch die Folgen seines Leichtsinns zerstörte; neue Erfolge wurden immer wieder durch neuen Leichtsinn vernichtet, bis die Frau, die ihn liebte, nicht mehr an ihn glauben konnte.
Und das Glück zerbrach ...
Er wußte, was er verloren hatte – – er schlich sich aus Hamburg fort in stumpfer Hoffnungslosigkeit und wollte untergehen, wollte sich das Leben nehmen. Da wallte in einer verzweifelten Stunde das Abenteurerblut in ihm auf, der Drang nach dem wildesten Leben, das es geben – in dem er vergessen konnte.
Er ließ sich anwerben für die französische Fremdenlegion.
*
Der Mann war ich. Ich hatte alle Brücken hinter mir niedergerissen. Niemand wußte, wo ich war. Für die Menschen, die mich liebten, wollte ich ein Toter sein. Ich vergaß alle Hoffnungen, allen Ehrgeiz, alle Persönlichkeit und lebte das rohe Legionärsleben wie die anderen Legionäre. Arbeitete und marschierte, schlief und aß, tat das, was mir anbefohlen wurde, stöhnte, wenn die Strapazen für meine Kräfte zu viel wurden, schimpfte, wenn man mich schlecht behandelte. Nur in schweren Nächten dachte ich dann und wann an das, was gewesen war.
Etliche fünfhundert Jahre lang mochte ich Legionär gewesen sein. So lange wenigstens dünkte es mich. Da brachte eines glutheißen Tages die algerische Militärpost einen Brief auch für mich. Die Liebe hatte mich gefunden.
Ich las und las und las wieder ...
In dieser Stunde erwachte das gestorbene Glück zu größerem und tieferem und gewaltigerem Sein.
Die alte Energie kam. Ich sprengte meine Fesseln; aus dem Söldner wurde ein freier Mann, der sich sein Glück und sein Arbeitsfeld wieder eroberte.
Hamburg, im März 1909.
Wie ich Legionär wurde.
In Belfort. – Von Sonnenstrahlen und der Angst in der Kehle. – Madame und der Oberkellner. – Der französische Leutnant. – »In d' Leschion willscht?« – Die Untersuchung im Werbebureau. – Ungewaschene Menschlichkeit. – Der Stabsarzt mit der unempfindlichen Nase. – Officier allmand. – Herr von Rader und der deutsche Deserteur. – Der französische Oberstleutnant. – Die bitteren Tränen der ersten Nacht.
Ein anderer hätte sich vielleicht erschossen. Ich ging in die Fremdenlegion ...
Abends war ich in der alten Festungsstadt Belfort angekommen, um mich anwerben zu lassen. Wie in Selbstverhöhnung hatte ich die Nacht im elegantesten Hotel Belforts verbracht.
Das Erwachen war häßlich. Die Sonnenstrahlen spielten auf den weißen Spitzen des Bettes, kletterten umher, wanderten empor, beleuchteten jeden Winkel der weißen Stuckdecke, senkten sich wieder und gaben der schablonenmäßigen Eleganz des Zimmers etwas Warmes. Im Halbtraum guckte ich dem Sonnenspiel zu. Schläfrig wunderte ich mich über das riesengroße Bett mit den vielen weißen Spitzen, über die fremdartigen Möbel, über den schönen Perserteppich, der einen so scharfen Gegensatz zu den übrigen Geschmacklosigkeiten bildete. Dann wurde ich wach. Wie Blei lag es mir in den Gliedern. Tausend Gedanken, tausend Vorstellungen wirbelten mir durch den Kopf. Dazwischen klang es wie Frauenweinen und Liebesflüstern und mahnende Mutterstimme. Und irgendein Teufel trommelte in ewig gleichem Takt: Vorbei – vorbei!
Zum zweitenmal in meinem Leben saß mir die große Angst in der Kehle. Ein unbeschreibliches Gefühl. Als ob ein harter Gegenstand in der Luftröhre stäke, als ob einem der Hals zugeschnürt wäre, als ob man nie wieder würde atmen können. Damals, das erstemal, als ich die Angst in der Kehle kennen lernte, war die erste spanische Granate vom San Juanhügel her dicht neben mir krepiert. Diesmal wars schlimmer.
Ah, man muß sich zusammennehmen! Irgendein Vers fiel mir ein:
Sei fröhlich, lieber Wandersmann! Nun fängt ein neues Leben an.
Hu, wie ironisch das klang! Wie ich nur gerade auf diese lustigen zwei Zeilen gekommen sein mochte ...
Mit lächerlicher Sorgfalt kleidete ich mich an und brachte es sogar fertig, mich krampfhaft über den Schwarzbefrackten zu amüsieren, der die silbernen Kaffeegeräte so hübsch umständlich und zierlich zurecht stellte. Dann bezahlte ich unten im Bureau die Rechnung und erntete für mein Goldstück ein liebenswürdiges Lächeln von Madame und ein ganz leises Aufblitzen in den hübschen Augen. Der Oberkellner stand an der Tür, ein bißchen katzenbuckelnd, sehr erwartungsvoll.
Ich griff in die Westentasche und gab ihm ein großes Silberstück:
»Siehst du, mein Sohn, du bist der letzte Mensch auf dieser niederträchtigen Welt, dem ich ein Trinkgeld gebe. Das ist doch traurig, nicht wahr?«
Der Oberkellner machte ein dummes Gesicht.
» Je ne parle pas...«
»Ist schon gut,« sagte ich.
Langsam schlenderte ich durch die winkeligen Gassen Belforts. Da reihte sich Laden an Laden, und vor jedem Laden standen, weit die Hälfte des Trottoirs einnehmend, kleine Tische, auf denen allerhand Sachen verlockend ausgebreitet lagen. Wie bequem für Diebe! dachte ich – und mußte gleich darauf lachen. Wie kam ich Verzweifelter dazu, an Belforter Ladenbesitzer und Belforter Diebe zu denken! Mechanisch überschaute ich die Umgebung. Von einem weiten freien Platz schimmerte es blau herüber: die Belforter hatten das Riesendach ihrer neuen Markthalle aus saphirblauem Glas erbaut, und Frau Sonne ließ sich häuslich darin nieder, um aus dem prosaischen Gehäuse für Kohlköpfe und Kartoffeln die allerschönsten Farbenspiele hervorzuzaubern. Lebhafte Franzosen und Französinnen eilten hin und her, und auf den Straßen herrschte ein Gewimmel und ein Gedränge ... Kinder, krabbelt doch nicht so umher – dies Leben ist der Plage gar nicht wert!
Nein, es will nicht gehen mit dem Spott, und das große Vergessen will gar nicht kommen. Ich rappele mich zusammen. Machen wir Schluß!
Ein blutjunger Leutnant kam die Straße herauf. Ich suchte mühsam mein holperiges Gymnasial-Französisch zusammen und lüftete den Hut.
»Würden Sie so liebenswürdig sein, mir zu sagen, wo das Werbebureau der Fremdenlegion ist?«
Der Offizier griff an die Mütze und blieb verwundert stehen.
»Sie können mich begleiten, mein Herr. Ich bin sowieso auf dem Wege zu den Festungsbureaus.«
Wir schritten nebeneinander her.
»Sie scheinen ein Deutscher zu sein?« fragte der Leutnant in recht gutem Deutsch. »Falls Sie auf dem Legionsbureau irgendwelche Erkundigungen einziehen wollen, kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein. Ich bin der Adjutant des Festungskommandanten.«
»Ich bin Deutscher und gedenke mich für die Fremdenlegion anwerben zu lassen,« murmelte ich. Wie fürchterlich schwer doch dieser erste Schritt war! Ich glaubte, ersticken zu müssen an den paar Worten.
»Oh la, la ...«sagte der Offizier verblüfft.
Noch einmal glitt sein prüfender Blick über meinen äußeren Menschen. Dann plauderte er (der Junge war ein prächtiges Exemplar französischer Liebenswürdigkeit) unbefangen weiter. Die Legion sei ein ungemein interessantes Korps. Er selbst hoffe, einmal auf ein paar Jahre zu den »étrangers« versetzt zu werden. Da unten sei doch immer etwas los.
»Nirgends ist das Kreuz der Ehrenlegion so leicht zu haben wie im algerischen Süden. Brillante Karrieren da unten. Oh la, la! Eh bien – mein Herr, Sie werden bald die französische Uniform tragen. Wünschen Sie, mir irgend etwas Besonderes zu sagen?«
Wieder der prüfende Blick.
Ich verneinte.
»Wirklich nichts?« fragte der Leutnant ernst.
»Nein, durchaus nicht! Ich dachte, die Fremdenlegion lege ein ausschließliches Gewicht auf körperliche Tauglichkeit, ohne sich für das Vorleben der Rekruten zu interessieren.«
Der Leutnant nickte: »Ah, das ist ganz richtig. Ich fragte nur in Ihrem eigenen Interesse. Wenn Sie zum Beispiel besondere militärische Kenntnisse hätten, so könnte Ihnen Ihr Weg in der Legion sehr leicht gemacht werden.«
Was er meinte, verstand ich erst später. Ich antwortete, ich hätte gedient, wie jeder Deutsche.
Da standen wir auch schon vor dem niedrigen Bureaugebäude. Der Leutnant ging voran, eine steile schmutzige Treppe empor, öffnete die Türe zu dem Bureauzimmer und sagte ein paar Worte zu dem Korporal. Dann nickte er mir zu und ging ins Nebenzimmer.
»In d' Leschion willscht?« fragte der Korporal, der irgendwo von der elsässischen Grenze her sein mochte. »Du siehscht aber fein aus für an Leschionsrekrute. Votre nom?«
Ich überlegte blitzschnell. Schließlich gab ich den richtigen Namen. Es war ja wirklich so gleichgültig.
»S–scho! Venez avec moi zu de' andere.Der médecin major wird glei' komme.« Das Zimmer, in das mich der Korporal hineinschob, strömte einen Menschengeruch aus, vor dem ich geekelt zurückprallte. Von Schweiß und Schmutz und alten Kleidern und ungewaschener Menschlichkeit. Auf langen Bänken an den Wänden des großen Zimmers saßen Männer, die sich für die Fremdenlegion anwerben lassen wollten und auf den Arzt warteten, der sie untersuchen sollte, ob ihr Körper die fünf Centimes Tagessold noch wert sei. Der eine saß nackt da; seine schmutzigen Beine zitterten in der kühlen Oktoberluft. Man brauchte wahrhaftig kein Arzt zu sein, um ihm den Hunger anzusehen. Ein anderer legte mit rührender Sorgfalt seine Hosen zusammen, die so oft geflickt waren, daß sie des Dienstes überdrüssig wurden und endgültig streikten. Sie hatten in einem wichtigen Bestandteil ein unheilbares, riesengroßes Loch. Vielleicht waren diese Hose und dieses Loch der letzte Grund, der ihren Besitzer in die Legion trieb.
Ein Dritter, ein kräftiger Junge, hatte sich sein Hemd über den Körper gelegt – er schämte sich seiner Männlichkeit. Arme Menschen, denen der nackte Körper etwas Häßliches war, weil sie in ihrem Hungerleben den Begriff der Reinlichkeit verlernt hatten! Jede Bewegung verriet das. Dort in der Ecke schob einer verstohlen seine Stiefel weit unter die Bank, damit man die Löcher nicht sehen sollte, und ein anderer versteckte die schmutzigen Strümpfe unter seinem Kleiderbündel.
Es waren ein Dutzend Menschen. Knabengesichter darunter, mit dem lichten Bartflaum des Achtzehnjährigen; Jünglinge mit tiefliegenden Hungeraugen und harten Entbehrungslinien um den Mund; Männer mit verfallenen, abgelebten Zügen, deren Falten die alte Historie vom Trinken zum Hören deutlich erzählten. Niemand sprach ein lautes Wort. Nur hie und da ein Flüstern. Der Mann neben mir sah mich an und sagte leise, mit wirklicher Angst in seiner Stimme:
»Ich hab' Krampfadern. Wenn sie mich nur nehmen. ...«
Herrgott, diesem Menschen bedeutete die Fremdenlegion eine Hoffnung – die Hoffnung auf regelmäßiges Futter! Die fünf Centimes im Tag mußten ihm erstrebenswert erscheinen!
Ich ekelte mich vor dem Dunst, ich starrte den Schmutz und das Elend an. Ich kam mir vor wie ein Verbrecher, der auf der Armensünderbank sitzt. Meine Kleider erschienen mir wie ein Hohn. ...
Die Offiziere kamen. Ein dicker Stabsarzt, den ich in meinem Ekel zu gern gefragt hätte, warum Rekruten der Fremdenlegion vor der Untersuchung nicht Gelegenheit zu einem Bad bekämen. Ein Assistent war bei ihm und der Leutnant von vorhin. Der Stabsarzt deutete auf mich.
»Ziehen Sie sich aus.«
Während ich meine Kleider abstreifte, flüsterten die Offiziere miteinander, und ich hörte, so leise es auch gesagt wurde, wie der Leutnant irgend etwas über mich sprach. »Officier allemand.«
Trotz allem mußte ich lächeln. Man hielt mich für einen ehemaligen deutschen Offizier, für einen Deserteur vielleicht. Es mußte den Herren ja auch schwer genug fallen, eine Erklärung dafür zu finden, daß ein Mensch mit gutsitzenden Kleidern zur Legion kam.
Der komische Mensch mit den gutsitzenden Kleidern empfand die Neugierde, das offenbare Mitleid als eine ungeheure Beleidigung. Die ganze Prozedur war eine Qual. Die dünne Uhrkette mit dem Goldbehälter, der von der Westentasche losgelöst werden mußte, ehe ich die Weste ausziehen konnte – wie lächerlich war das! Dieses Betrachtetwerden! Die Blicke der Aerzte sagten so deutlich:
»Wahrhaftig, der Mensch trägt feine Wäsche!«
Weshalb mußte man mich beäugeln? Hatte ich nicht genau das gleiche Recht wie die anderen armen Teufel, das Recht, auf meine eigene Façon in die Verdammnis zu gehen? Warum mußte man es gerade mir so schwer machen? Und dann fühlte ich, wie selbstverständlich diese Neugierde war, und wie lächerlich meine Empfindlichkeit. Der erste Schritt war überwunden. Ich fing ganz langsam an, zu begreifen, was es bedeutete, in der Fremdenlegion die letzte Zuflucht zu suchen.
Nackt stand ich vor dem Stabsarzt. Der setzte umständlich seinen Kneifer auf und betrachtete mich von oben bis unten. Ich sah ihm ruhig in die Augen. Sieh mich doch an, dachte ich, du dicker, komischer Mann mit der unempfindlichen Nase. Du wirst dich doch nicht unterstehen, an meinem Körper etwas auszusetzen?
»Bon!«sagte der Militärarzt. »Der nächste!«
Ein Schreiber, der unterdessen hereingekommen war, schrieb irgend etwas in ein Buch. Damit war die Zeremonie beendet. Kein Beklopfen, keine Lungenuntersuchung, keine Herzprüfung, kein Feststellen von Sehkraft und Hörschärfe.
Die Uebrigen kamen daran. Auch hier entschied der Militärarzt mit einem kurzen Blick. Drei wurden zurückgewiesen. Bei denen hätte aber auch ein altes Weib die Diagnose stellen können, daß sie fürs Spital reif waren und nicht für den Truppendienst. Der Mann mit den Krampfadern jedoch wurde mit dem stereotypen flüchtigen » bon!« als tauglich erklärt. Man konnte es ihm förmlich ansehen, wie er sich über dieses Glück freute, und ich beneidete ihn.
Er hatte noch Hoffnungen!
*
Mitten in der Wand des weißgetünchten Korridors war ein Schiebefenster, vor dem wir neun Rekruten warten mußten.
Eine halbe Stunde lang, eine Stunde lang. Endlich schob eine Hand das Fenster zurück, und der Korporal steckte seinen Kopf heraus.
»Schüstör!« rief er.
Niemand meldete sich.
»Schüstör!!« schrie der Korporal.
Keine Antwort.
Da trat der Leutnant neben den Korporal und sah in das Blatt Papier, das dieser in der Hand hielt.
»Oh,« meinte er, »der Mann versteht nicht. Schuster!«
Sofort meldete sich einer meiner neuen Kameraden.
»Sie heißen Schuster?« fragte der Leutnant.
»Zu Befehl.«
»Schön, in der französischen Sprache wird Ihr Name Schüstör ausgesprochen. Merken Sie sich das.«
»Zu Befehl.«
»Unterschreiben Sie Ihren Namen hier.«
Der Mann unterschrieb. Der Reihe nach wurden alle anderen aufgerufen. Jeder unterzeichnete, ohne lange zu fragen, was er eigentlich unterschrieb. Ich war der letzte.
Der Leutnant reichte mir einen Bogen hektographierten Papiers. Ich überflog ihn rasch. Es war ein Kontrakt, durch dessen Unterschrift man sich verpflichtete, fünf Jahre lang in der französischen Fremdenlegion zu dienen. Er enthielt alle möglichen Klauseln: da stand vor allem darin, daß der Angeworbene, falls er militärdienstunfähig würde, keinerlei Anspruch auf Entschädigung habe, und daß erst eine Dienstzeit von fünfzehn Jahren das Recht auf Pension verschaffe.
»Besitzen Sie Papiere?« fragte mich der Leutnant plötzlich.
Die Neugierde in seinem Gesicht war gar zu komisch. In meinem deutschen Reisepaß stand jedoch die Bezeichnung »Redakteur und Schriftsteller« und – na, ich hatte ein Gefühl, als ob mein guter deutscher Paß für diesen Zweck zu schade sei. Ich kramte in meiner Brieftasche herum, fand den ausgefüllten Fragebogen einer deutschen Lebensversicherungsgesellschaft und reichte ihn dem Offizier hinüber, ohne eine Miene zu verziehen.
Der las den Fragebogen verblüfft durch.
»Das genügt ja,« sagte er lächelnd und reichte mir die Feder.
Ich unterschrieb. Unter meinen Namen setzte ich das Datum: 6. Oktober 1905.
»Das Datum war nicht nötig,« sagte der Leutnant.
»Entschuldigen Sie!« antwortete ich. »Ich schrieb es unwillkürlich hin. Mir ist es ein wichtiger Tag.«
»Bei Gott, Sie haben recht!« sagte der Leutnant.
Im Gänsemarsch wurden wir dann zur Kaserne geführt. Es muß kein besonders schönes Bild gewesen sein. Einer der französischen Soldaten, die uns begegneten, blieb stehen und stemmte die Arme in die Hüften.
»Häh!«
Er schnitt eine Grimasse und sang gröhlend: » Nous sommes les légionaires d'Afrique ...«
*
Eine halbe Stunde später saßen drei Fremdenlegionsrekruten, von denen der eine Schuster, der andere Rader und der dritte Carlé hieß, in einem kleinen Mannschaftszimmer in der Kaserne des 31. Linienregiments.
Rader eröffnete die Unterhaltung.
»Ick heiß Rader. Is 'n juter, jediegener Name, aber er stimmt nich janz. Rader! Ick wollt mir eijentlich von Rader nennen – et wär een Aufwaschen jewesen. Ick bin aber nich stolz. Wat nützt dir 'n feiner Name, wenn du nischt zu fressen hast, sag ick. Nee. sie sollen mir nur »Rader« heeßen. Von Rechts wejen is ja Müller mein Name. Aber ick bin jezwungen, Rücksichten zu nehmen auf die hochjeborene Verwandtschaft ...«
»Rücksichten! Vasteht sich!!« wiederholte er, in schallendes Gelächter ausbrechend.
Dann sah er sich prüfend um, nahm ein langes Messer vom Tisch, stellte sich in Positur, machte den Mund auf und schob in aller Seelenruhe das Messer hinein, bis man kaum noch den Griff sah. Er zog das Messer heraus, steckte es in den rechten Rockärmel und brachte es grinsend aus dem linken Hosenbein wieder zum Vorschein.
»Ick bin Artist.« sagte leutselig Herr Rader, respektive von Rader, respektive Müller, »'n juter! Aberst diese Affenjesellschaft von Franzosen hat keen richtijes Verständnis nich' for die Kunst ... Junge, Junge, seit ick damals über die Grenze jeloffen bin und dem deutschen Schandarm hinübergerufen hab', er wär 'n Hornochse, hab' ick jeden Tag rejelmäßig bedeutend wenijer zu fressen jekriegt als for meine Konstitution jut jewesen is. So is der Herr von Rader auf den Hund gekommen, wollt' sagen auf die Fremdenlegion. Schad' nischt. Wenn sie mir nich' sehr höflich und zuvorkommend behandeln, dann empfehl ick mir wieder. Durch die Lappen – aus dem Sinn! Siehst du wohl??«
Herr von Rader kramte geheimnisvoll in seinen Taschen, drehte sich herum, um irgendwelche Vorbereitungen künstlerisch zu maskieren, wandte sich uns wieder zu und – aus dem verzerrten Maul seines grinsenden Satyrkopfes sprang ein gewaltiger Feuerstrahl. Der kleine Schuster (er mochte wenig über zwanzig Jahre sein) saß mit weitaufgerissenen Augen erschrocken da.
»Jroßartig, nich?« sagte Herr von Rader gelassen. »Ick hab' so 'ne Ahnung, als ob ick mir vons französische Afrika jelegentlich ins innerliche Afrika verflüchtijen werde und 'ne jediegene und jeachtete Stellung als Medizinmann und Zauberer bei einem Negerhäuptling akzeptiere. Ick fürchte nur for die Trinkverhältnisse. Palmschnaps, nich? Junge, Junge, wenn sie Kümmel hätten da unten! – – Sag' mal (er wandte sich an mich), du feinjekleidetes Bruderherz, wat sagst du eijentlich zum französischen Absinth?«
Ich brummte irgend etwas.
»Labberig ist er!« stöhnte Kerr von Rader betrübt. »Janz labberig ...«
Wenn der komische Kauz gewußt hätte, daß er mit seinen Schnurren und seinem Gerede mir getreulich half, einen unsäglich schweren Anfang zu überwinden, so würde er sich baß gewundert haben.
Ein großes Erzählen hub an. Von Artistenhunger und Artistenelend und von den tausend kleinen Kniffen und Gaunereien, mit denen sich der immer hungrige und immer durstige Herr von Rader durch ein Landstraßenleben hindurchgeschwindelt hatte. Von »Weibsen« und vom Schnaps und vom Hunger. Besonders viel vom Hunger.
Der Rekrut Schuster erzählte. Seine Geschichte war einfach. Vor wenigen Wochen hatte er noch die Uniform eines in Köln liegenden Infanterieregiments getragen. Er war Rekrut. Ging eines Sonntags mit anderen Rekruten ins Wirtshaus und betrank sich. Als die Wirtshauspatrouille kam, und der führende Unteroffizier grob wurde, stieß er ihn vor die Brust, rannte ein paar Soldaten der Patrouille um, riß sich los und lief davon. In irgend einem Winkel schlief er seinen Rausch aus. Dann kam die Furcht vor Strafe. Ein Trödler gab ihm schlechte Zivilkleider für seine Sonntagsuniform. Dann trieb er sich auf der Landstraße herum, kam zur Grenze, und Handwerksburschen zeigten ihm, wie man sich in einer dunklen Nacht über die Grenze stiehlt. Der Hunger kam im fremden Land und –
»Wir haben immer über die Legion gesprochen. Die anderen Deutschen, mit denen ich auf der Landstraß' gered't hab', haben auch alle in d' Legion wollen. Ich hätt' auch nie wieder nach Haus können. Mein Vater hätt' mich totgeschlagen.«
»Das hätt' er nich' jetan!« meinte Herr von Rader weise. »Du bist 'n dummes Luder jewesen, mein Sohn. Kalbsbraten hättest du jekriegt. Steht schon in der Bibel. Ja-woll!«
Die Tür wurde aufgerissen, und ein Sergeant kam herein.
»Ist der Legionär Carlé hier?«
Ich meldete mich.
»Der Herr Oberstleutnant wünscht, mit Ihnen zu sprechen. Kommen Sie mit auf den Kasernenhof.«
»... Bitte, setzen Sie den Hut auf.« sagte der Oberstleutnant. Er sprach Deutsch ohne den leisesten fremdartigen Akzent. »Nein, Sie brauchen nicht stramm zu stehen. Ich habe von Ihnen gehört und möchte Ihnen ein paar Worte sagen. Ich habe in der Fremdenlegion als gemeiner Soldat gedient. Seien Sie überzeugt, es ist keine Schande, in einem ruhmgekrönten Korps zu dienen. Es kommt alles auf Sie selbst an. Wer in der Fremdenlegion militärisch tüchtig und ein intelligenter Kopf ist, dem steht ein Avancement offen, wie es in keiner Armee der Welt zu haben ist. Gebildete und tüchtige Menschen haben ihren Wert in der Legion, das wollte ich Ihnen sagen. Welchen Beruf hatten Sie?«
»Journalist – – Schriftsteller ...,« stotterte ich.
Mir war erbärmlich zu Mute.
Die klugen Augen sahen mich forschend an. »Na ja, ich würde auch nicht gerne darüber reden an Ihrer Stelle. Aber ich will Ihnen einen Rat geben: Melden Sie sich zum ersten Regiment der Legion. Sie haben dort eine größere Chance auf Felddienst. Dort unten wird ein Kampf für die Zivilisation gekämpft, und schon so manche glänzende Karriere ist dabei gemacht worden. Ich wünsche Ihnen viel Glück.«
Er gab mir die Hand. Ich glaube, dieser Offizier war ein guter Soldat und ein braver Mann. –
*
Der Artist mit dem lustigen Sinn und dem großen Durst schnarchte fürchterlich: der deutsche Deserteur stöhnte dann und wann im Schlaf. Ich wälzte mich gequält auf meinem Bett.
In tollem Wirbel zog mein ganzes Leben an mir vorbei. Erinnerung auf Erinnerung folgte. Bild auf Bild jagte sich. Ich durchlebte wieder die Gymnasialjahre. Ich sah meinen Vater auf dem Quai in Bremerhaven stehen und mich zum letzten Mal grüßen: das Weinen meiner Mutter beim Abschied glaubte ich wieder zu hören. Dann kamen Erinnerungsbilder von dem großen Umherstreifen in Amerika. Ich sah mich als blutjungen Reporter und dachte in Schmerzen an die Begeisterung jener Zeiten – wie stolz ich war, als ich zum erstenmal eine große Sache in die Hand bekam. Wie ich damals von einer Droschke in die andere durch San Franzisko hetzte und interviewte und Details zusammentrug ... Wie ich die Arbeit mit der Feder lieb gewann, und wie der erste Erfolg kam.
Vorbei, alles vorbei!
Wie mich die Bilder quälten! Ich wollte sie gewaltsam wieder abschütteln. Ich dachte daran, wie ich in der allerersten amerikanischen Zeit, unten in Texas, Negeraufseher auf einer riesengroßen Farm gewesen war und den aufsässigen Schwarzen gegenüber meinen Mann gestellt hatte, ich dachte an das tolle Reiten, an die Revolverschießereien, an das harte, brutale Leben, in dem ich mich glücklich gefühlt hatte. Warum sollte es jetzt nicht gehen! In der Legion würde ich bald genug ernsten Dienst sehen, ins Feuer kommen – Aufregung und Kampf haben und ein Vergessen finden.
Hurrah für das alte wilde Leben ...
Es half nicht.
Ruhelos warf ich mich umher – es drängte mich, in bitterer Sehnsucht, einen lieben Namen hinauszuschreien ...
Zum erstenmal seit den Tagen der Kindheit kamen die Tränen.
Nach Afrika!
Bahntransport der Legionsrekruten. – Der kleine Faden am Bein. – Ein Patriotischer Kondukteur. – Marseille. – Die Pforte zu den französischen Kolonien. – Das Truppenhotel. – Von gelben und blauen Farben und der Symbolik des Herrn von Rader. – Die Zähmung des Schiffskochs. – Die Fama vom preußischen Prinzen der Legion. – Oran. – Algerischer Wein. – Wie der Legionär nach Spanien desertierte.
Am nächsten Morgen mußten wir uns im Kasernenhof aufstellen. Ein Sergeant gab jedem von uns ein Silberstück – einen Frank. Das war die Reisezehrung für die lange Fahrt ans Mittelländische Meer. Ein Küchensoldat verteilte Brotlaibe, und dann marschierten wir unter Führung eines Korporals zum Bahnhof. Ich muß sehr komisch ausgesehen haben mit dem Brotlaib unterm Arm – jedenfalls sah ich beharrlich auf den Boden, weil ich mir – es gibt keinen anderen Ausdruck dafür – so »deplaciert« vorkam, daß ich fürchtete, in den Augen Vorübergehender so etwas wie Verwunderung oder gar Mitleid zu lesen.
Wir kamen auf den Bahnhof. Der Korporal brachte uns an den Marseiller Zug, gab uns seinen Segen, drehte sich eine Zigarette und wartete geduldig auf dem Perron, bis der Zug aus dem Bahnhof hinausrumpelte. Jede weitere Aufsicht war unnötig. Das kollektive Militärbillett bezeichnete uns in deutlichen roten Lettern als Legionäre der Fremdenlegion. Und der Kondukteur sah in bravem Patriotismus auf jeder Station, auch auf der kleinsten, getreulich nach, ob die neuen Söhne Frankreichs nicht vielleicht das fluchwürdige Verlangen trügen, irgendwo anders als in Marseille auszusteigen. Es wäre aber nicht gegangen – mit dem Billett wäre man an keiner Perronsperre vorbeigekommen! Es ist eine praktische Einrichtung, dieses Militärbillett. Herr von Rader behauptete, er sei eine kleine Fliege, und das Militärbillett sei der Faden, mit dem man ihn an den Beinchen festgebunden habe.
Als wir in Marseille ankamen und aus dem Zug stiegen, sahen wir, wie unser fürsorglicher Kondukteur die Bahnhofshalle entlangsauste und mit herumfuchtelnden Armen einem Sergeanten an der Perronsperre Semaphorensignale machte.
»Ich Hab' sie, da sind sie!« sollte das vermutlich heißen.
Dieser Kondukteur war ein Steuerzahler und ein Patriot und sorgte dafür, daß Frankreich auch behielt, was Frankreichs war.
Der Sergeant, hinter dem noch ein Korporal auftauchte, nahm uns liebevoll in Empfang. Der Korporal führte uns durch die Stadt, der Herr Sergeant aber schlenderte in gehöriger Entfernung auf dem Trottoir voraus – er wollte zweifellos den Anschein vermeiden, als ob er zu uns gehöre. Man konnte ihm das nicht übelnehmen, denn wir sahen nicht hübsch aus, und die Nachtfahrt hatte uns sicherlich nicht verschönert.
Den langen Hafen entlang marschierten wir, durch eine wimmelnde Menschenmasse, durch ein kosmopolitisches Getriebe, zwischen arabischen Lastträgern, fetten Levantinern und gestikulierenden Südfranzosen. Da lag Schiff an Schiff. Elegante Salondampfer. Eiserne Tramps, denen man die Nöte des Lebens und die zu hohen Kosten des dringend erforderlichen neuen Farbanstrichs ansah; levantinische Barken mit komischen Rundsegeln und einer Besatzung, die für ihre Hemden nur die Wahl zwischen zwei Farben zu haben schien, zwischen schreiendem Rot und gellendem Blau; Segelschiffe in etlichen hundert verschiedenen Konstruktionen, Riesenkräne, eine kolossale Drehbrücke, die von ihrem einzigen Pfeiler aus hoch droben in der Luft herumbaumelte und sämtlichen Gesetzen der Schwerkraft Hohn zu sprechen schien. Fässer, Kisten und Säcke flogen uns an der Nase vorbei, von wuchtigen Fäusten gestoßen, geschoben, geschleudert. Ueber allem Schreien, Gellen und Lärmen.
Wir gelangten an das kleine, uralte Hafenfort, das die Durchgangspforte für alle Kolonialtruppen Frankreichs bildet. Das Fort St. Jean. Ueber eine mittelalterliche Fallbrücke schritten wir. In dem riesigen Eichentor tat sich ein kleines Pförtchen auf. Pfeifen und Johlen schallte uns von innen entgegen. Der Salut für die neuen Legionäre! Auf dem Hofe drängten sich, stoßend und gestikulierend Spahis und Tirailleurs, die hier auf das nächste Truppenschiff warteten. Das Herumstehen mochte ihnen langweilig genug geworden sein. Neugierig umringten sie uns.
» Oh la, la, les bleus pour la légion!«Die Blauen für die Legion. ...
Ein Korporal der Spahis erklärte mir die sonderbare Bezeichnung.
»Was heißt das eigentlich, die Blauen?« fragte ich ihn.
»Blau?« sagte er. »Oh, das sind Rekruten. Offiziell nennt man Rekruten: die jungen Soldaten ( les jeunes soldats). Im Armeejargon sagt man aber: »die Blauen«.«
»Komischer Ausdruck!« meinte ich.
Der Spahikorporal zündete sich eine neue Zigarette an und nickte nachdenklich. »Man weiß auch nicht recht, woher der Name kommt. Mein Kapitän erklärte mir einmal, die Bezeichnung stamme noch aus napoleonischen Zeiten. Damals trugen die französischen Soldaten steife Halsbinden, um den hohen Kragen der Uniform gerade zu halten. Diese Halsbinden sollen etwas Fürchterliches gewesen sein, eine Marter. Sie hielten den Kopf wie in einem Schraubstock, und man brauchte lange Zeit, sich an sie zu gewöhnen. Die Rekruten wurden von dieser famosen Halsbinde während der ersten Zeit ganz blau im Gesicht vor lauter Anstrengung und Gewürgtsein. Und die altgedienten Soldaten riefen ihnen lachend zu: Aha, die Blauen – die Blauen!
Herr von Rader (er lebt in meiner Erinnerung nur als »Herr von Rader«) – Herr von Rader stieß mich an.
»Bruderherz, wat machen die Kerle mit die kolossalen Hosen?«
Die Spahis waren bei der Toilette. Sie zogen ihre Zuavenjäckchen aus und zupften die riesigen roten Pluderhosen zurecht, die in ungeheuren Falten bis zu den Knöcheln herabfielen.
»Junge, Junge, wat for 'ne Verschwendung,« meinte Herr von Rader. »Aus einer solchen Hose mach' ick Hosen for 'ne janze Famillje, und dann bleibt noch 'n Unterrock for die Jroßmutter übrig.«
Dann kam das Anlegen der Schärpen. Je zwei Mann halfen sich gegenseitig. Sie hielten ein etwa fünf Meter langes, einen Viertelmeter breites hellblaues Tuch aus seinem dünnen Stoff straff gespannt. Der eine legte es sich an die Hüften und drehte sich blitzschnell um sich selbst, bis er in die Binde eingerollt war.
Die Spahis legten offenbar großen Wert auf diese Schärpen! Sie schlangen sie kunstvoll, möglichst straff, möglichst glatt und beäugelten sich kokett, ob auch ja die ceintures recht gut säßen. ...
Immer lauter wurde der Lärm auf dem Hof. Von einer Galerie herab schrie ein Unteroffizier Namen aus, und rottenweise stiegen die Soldaten die Treppen empor, um ihre Reiselöhnung in Empfang zu nehmen. Wir Legionsrekruten standen in einem Winkel und wußten nicht recht, was wir anfangen sollten. Schließlich rief uns ein Korporal zu, wir sollten uns zum Teufel scheren. Hier seien wir im Wege. Wir kämen noch lange nicht daran, wir verdammten Blauen! Als er brummend weiterging, trugen Soldaten lange Holzgestelle herbei, mit langen Reihen von Blechnäpfen darauf. Die Spahis und die Zuaven bildeten sofort einen dichten Knäuel um die dampfenden Eßgeschirre, aber Herr von Rader stürzte sich schleunigst dazwischen und eroberte auch richtig Portionen für uns alle. So lernte ich zum eisten Male la gamelle kennen, den ehrwürdigen blechernen Eßtopf des französischen Soldaten, der schon zu Zeiten des ersten Napoleons la gamelle genannt wurde. Die französische Militärsuppe, aus Brot, allen möglichen Gemüsen und einem Stückchen Fleisch, ist ebenso alt und ebenso ehrwürdig in ihrer Zubereitung. Die Musketiere des Sonnenkönigs kochten sich genau die gleiche Suppe und aßen sie aus fast den gleichen Feldgeschirren.
Dann schlenderten wir umher. Lärmender Wortschwall aus einer Ecke des Gebäudes, Weinfässer vor einer Türe, zeigten die Kantine an. Wir gingen hinein. Kaum hatten wir uns an einen Tisch gesetzt, so fielen der Kantinenwirt und seine Leute sofort über uns her. Geschäfte wollten sie mit uns machen. ... Rader verkaufte seine Stiefel für einen halben Frank. Als der Handel anfänglich daran zu scheitern drohte, daß er nicht barfuß laufen wollte, schleppte der Wirt ein Paar zerfetzte alte Zuavenschuhe als Ersatz herbei. Mich plagte er, ihm meinen Mantel zu überlassen. Ja, es sei ein sehr guter Mantel. Ein armer Mann wie er möchte gerne einen solchen Mantel haben. In der Legion müsse ich ihn doch sofort verkaufen, und ich bekäme sicherlich nicht mehr als zwei Franks dafür. Er würde mir vier geben. So viel würde ich nie bekommen in Algerien. Eine halbe Stunde lang redete er auf mich ein. Da der arme Mann aber sehr behäbig aussah, und ein Zuave mir zuflüsterte, das cochon von einem Wirt werde reich durch solche Geschäfte, ging ich auf den »Handel« nicht ein. Nun versuchte er es mit den anderen und erhandelte für Kupferstücke allerlei Sachen, die zwanzigmal soviel wert waren, als er für sie bezahlte. Stiefel, Röcke, Portemonnaies – alles mögliche. Der Schweizer verkaufte sogar seine Hose, von den Beinen weg. Fünf Sous bekam er und eine schmierige Infanteristenhose, weil er doch irgendeine Bekleidung für seinen unteren Menschen haben mußte. ... Des dicken Wirtes Augen funkelten vor Gier. Er kaufte auf, was er nur erhaschen konnte.
Die armen Teufel von Legionsrekruten waren noch ein Objekt für Ausbeutung.
Draußen war's schöner. Ich ging fort, während die anderen über dem schweren Wein lachten und lärmten, und schritt durch das Fort. Droben auf der höchsten Bastion setzte ich mich auf ein grasbewachsenes Plätzchen. Weithin war der Blick frei. Wie feiner gelber Dunst lag es über der Stadt und der Hafenseite. In massigen Häuservierteln lag die Stadt da. Weiter draußen wuchsen die Terrassen in leichter Steigung empor, mit kleinen Häuschen, deren flache Dächer das Gelb zurückwarfen und den Farbenton verstärkten und verdoppelten. Ueber dem Hafen breitete es sich wie ein Spinnengewebe. Das waren Schiffsmasten und Tauwerk und Kräne und Brücken, die in der Entfernung so zart und winzig klein erschienen wie Schleierfäden.
Auf der anderen Seite wohnte die große Ruhe. Zwischen die Fortmauern und ihrem Gegenüber von dunkelgelben Felsen schob sich eine kleine Bucht, ein Nebenpfad des Meeres. Wenn man hinunterblickte, sah man tief unter sich das schönste, tiefste, abgründigste Blau, das es in dieser Welt gibt.
Herr von Rader war mir nachgegangen. Er nickte mir zu, ließ, sich auf die Mauer setzend, die Beine baumeln und spuckte gedankenvoll in das raunende Meer tief unter ihm. Er freute sich sehr, wenn es ihm gelang, einen Fischer zu treffen.
Und ich dachte, welch' ein merkwürdig Ding dieser wellenbespülte Festungsbau, mit den uralten Bastionen und den leeren Plätzen für Lafetten und Festungskanonen war. Eine Herberge war aus ihm geworden in seinen alten Tagen, eine Karawanserai, ein Bungalow, das jahraus, jahrein nichts anderes zu tun hatte, als immer wieder anderen Rekruten der Kolonialarmee Obdach zu geben, bis das Schiff sie fortführte nach Afrika oder nach dem chinesischen Tonkin oder nach Madagaskar. Das alte Fort war die Pforte, durch die Frankreichs Regimenter in die Kolonien zogen. Für manchen die Pforte zur Ehrenlegion, für die Mehrzahl die Pforte zu Elend, Leiden, Krankheit, zu einem namenlosen Grab im heißen Sand.
Welchen Weg würde ich gehen? Ins Verderben hinaus. ...
*
Ich ging vorne an den Bug und hielt mir die Ohren zu, damit nicht irgendein französisches Wort mich daran erinnere, daß ich Legionär war. Ich vergaß Legion und Schiff und Elend und starrte hinaus auf das Märchen von Marseille. Da war ein stilles Meer. Aus seinem Wasser heraus wuchsen Halbinseln und Landzungen. Die hatten sich in blaugraue Dunstschleier gehüllt und spielten miteinander Verstecken, genau wie im Märchen. Bis Frau Sonne kam, den Dunstschleier wegstrahlte und nacheinander die Hügel und Häuserchen ins rechte Farbenlicht setzte. Eine Felseninsel stieg auf mit einem düstern alten Kastell, dem Gefängnis, aus dem Dumas seinen Abenteurer Monte Christo entfliehen ließ. Und dann nur das weite Meer, die Inkarnation blauer Schönheit. Meer und Sonne hatten sich zusammengetan, einen armen Teufel von Legionär das Vergessen zu lehren. Immer neue Bilder schufen sie in raschem Wechsel. Da war eine kleine Welle weit draußen, die mit der Sonne Haschen spielte. Bald gelang es ihr, zu entfliehen, bald wurde sie gefangen und spottend mit einer Flut von Licht überschüttet. Dann kam sie brausend auf uns zu, stieß sich den Kopf an der harten Schiffswand, prallte zurück, fing entrüstet zu zanken an und machte großen Lärm. Langsam beruhigte sie sich und fing an, leise zu erzählen. Plitsche – platsche – vom Frieden unten im Meer – plitsche – platsche – von den allerschönsten Meernixen – plitsche – platsche – lief sie lachend davon und balgte sich mit einer andern Welle.
Ich wußte, daß ich ein Deklassierter war. Aber daß die Verachtung, die Geringschätzung, die niederträchtige Behandlung schon beim Schiffskoch des Transportdampfers beginnen würde, hatte ich nicht erwartet.
» Nix comprend!« schrie der Koch. Das Paketboot der » Compagnie des Messageries Maritimes«, das uns neun Legionsrekruten von Marseille nach Oran brachte, hatte an dem Koch eine ganz miserable Akquisition gemacht. Der Mensch antwortete auf den Namen Jacques, wenn es ihm gerade paßte. Er war boshaft, heimtückisch, verlogen, cholerisch und schmutzig.
Am ersten Tag bekamen mir bis gegen Abend nichts zu essen. Als es am zweiten Tage drei Uhr wurde und wir immer noch nüchternen Magens auf die erste Mahlzeit warteten, sagte ich ihm, daß unsere Verpflegung bezahlt sei und daß er uns gefälligst etwas zu essen geben solle.
Die Antwort war zunächst ein reichhaltiges Assortiment von Flüchen. Fluchen konnte er sehr schön. Dreckige Legionäre müßten eben warten. Wenn er gerade übrige Zeit hätte, würden wir schon etwas zu essen bekommen.
Ich freute mich! Wie man mit der Sorte umgeht, wußte ich von meinen amerikanischen Zeiten her.
»Siehst du, mein Sohn,« wandte ich mich liebevoll an ihn, »diese acht Kameraden von mir sind Deutsche und können kein Französisch. Sie können aber prügeln! Siehst du, wie sie um dich herumstehen? Ich glaube, sie werden dich sehr prügeln.«
» Allez donc!« meinte der Koch zweifelnd und unruhig.
»Sie werden dich wahrscheinlich totschlagen!«
Der Koch wurde bleich, schob sich rückwärts in seine Kombüse zurück und fischte aus dem Herd ein Blech heraus, in dem Makkaroni schwammen. Dann brachte er uns Brot in Fülle und eine Art Gießkanne, in der drei Liter Wein sein mochten. Dafür gab es aber keine Messer, nur vier Gabeln für neun Mann und einen einzigen Blechtopf zum Trinken.
Neulich ist eines dieser Paketboote gestrandet. Hoffentlich war es dieses Boot und hoffentlich ist dieser Koch dabei ersoffen! –
Zwei Tage und zwei Nächte dauerte die Fahrt. Am Abend des zweiten Tages kam aus dem Territorium der ersten Kajüte ein Sergeant der Fremdenlegion zu uns Bewohnern des Vorderschiffs herüber. Wollte sich mal die neuen Legionäre ansehen. Da er ein Belgier war und mit den anderen nicht Deutsch sprechen konnte, so wurde mir für einige Stunden die Ehre seiner Gesellschaft zuteil.
Die Deutschen seien ein sehr gutes Soldatenmaterial, jedoch viele Dickschädel darunter. Eigensinnig, ein bißchen schwerblütig. Ich sollte in der Legion nur mit Franzosen verkehren, auf daß sich mein Französisch bessere. Worauf der Herr Sergeant eine Flasche Wein bestellte und von der Legion sprach. Das meiste, was er sagte, war gelogen. Eine dieser Geschichten ist dennoch des Erzählens wert.