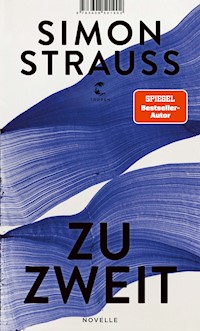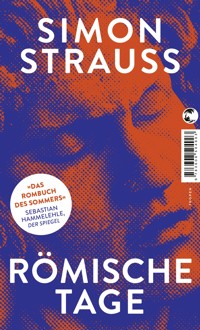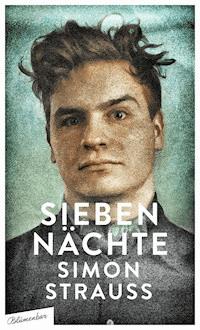18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Glück eines Menschen hängt daran, in der Nähe von anderen zu sein. Wir leben in Zeiten der Entfernung. Die politischen Lager, die großen Machtblöcke der Welt, die Stadt vom Land – alles entfernt sich voneinander. Umso wichtiger wird der Blick aus der Nähe. Wo ist im Zeichen medial befeuerter Selbstgerechtigkeit noch Gemeinschaft möglich? In seinem ersten Sachbuch findet Simon Strauß eine überraschende Antwort: in der Kleinstadt. Hier begegnen sich die Menschen als Gegenüber, hier müssen Konflikte ausgetragen und Kompromisse gefunden werden. Hier lernt man die Demokratie noch einmal neu kennen. Was macht ein gutes Zusammenleben aus? Am Beispiel der Kleinstadt Prenzlau erkundet Simon Strauß, wie Gemeinschaft gelingen kann, wann sie scheitert und welche politische Bedeutung es hat, in der Nähe zu sein. Welche Kraft hat der gemeinsame Glaube an einen physischen Ort? Gibt es noch so etwas wie einen geteilten Himmel oder greift inzwischen jeder nur noch nach den eigenen Sternen? Ein Buch, das das Wissen des Autors um die ersten städtischen Bürgerschaften in der Antike mit seiner Neugier für die Probleme unserer Gegenwart verbindet. Seine Beobachtungsgabe mit seiner Begeisterungskraft. Die Bedeutung von Nähe wird hier zuerst emphatisch gedacht – und dann real betrachtet. »Simon Strauß macht hier Ernst mit der Erkenntnis, dass Gesellschaft immer vor Ort passiert. Das gilt erst Recht für Ostdeutschland. Wer wissen will, wie hier die Menschen ihre Gesellschaft machen, muss dieses Buch lesen.« Heinz Bude »Die Wahrheit ist immer konkret, aber nie einfach. Simon Strauß gelingt mit seinem sehr persönlichen Buch eine exemplarische Erzählung über ostdeutsche und gesamtdeutsche Lebensverhältnisse seit 1945.« Dirk Oschmann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Simon Strauß
In der Nähe
Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht
Tropen Sachbuch
Impressum
In der Einleitung werden drei Auszüge aus Our Town von Thornton Wilder zitiert, © 1938 by The Wilder Family LLC. Nachdruck mit Genehmigung von The Wilder Family LLC und The Barbara Hogenson Agency, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen über Thornton Wilder finden Sie unter www.ThorntonWilder.com.
Zitiert nach: Thornton Wilder, Unsere kleine Stadt. Deutsch von Hans Sahl. © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1953.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Tropen
www.tropen.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-50271-8
E-Book ISBN 978-3-608-12376-0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
In the neighborhoodIn the neighborhoodIn the neighborhood …
Tom Waits
Einleitung
Im schönsten Wiesengrunde
Ich war siebzehn, als ich Unsere kleine Stadt inszenierte. Ein Theaterstück aus den Dreißigerjahren. Ein sanftes Drama, in dem es um das alltägliche Leben in einer amerikanischen Kleinstadt geht. Leben – das heißt hier: die frühmorgendlichen Kirchenglocken, das Toben auf den Schulhöfen, der Traum einer erschöpften Mutter von »einmal Paris«. Heißt weißes Brautkleid in der Kirche, heißt 5:45-Uhr-Zug nach Boston, heißt ein aufgeplatzter Blinddarm beim Pfadfinder-Marsch – heißt: Liebe und Leid statt Gier und Angst.
Thornton Wilders 1938 geschriebenes Stück handelt von den Grundlagen einer kleinen Gemeinschaft. Alles, was hier geschieht, wirkt wie ein Gleichnis über das Glück der Dauer. Wirkt wie eine Meditation über die Frage, was es bedeutet, zusammen zu sein und zu bleiben. Nicht nur den physischen Raum miteinander zu teilen, sondern ein gemeinsames Bewusstsein zu bilden. Nähe zu spüren – über die Zeiten hinweg.
Die Menschen, von denen er erzählt, fühlen sich einander zugehörig, weil sie täglich an den gleichen Orten vorbeikommen, dieselben Straßennamen lesen und Aussichten (nicht etwa Ansichten) teilen.
Unsere kleine Stadt – das ist mehr als die In-Szene-Setzung sentimentaler Heimatgefühle. Dahinter verbergen sich grundlegende Muster des Politischen: Was macht Bewohner zu Bürgern? Wie wird aus einer zufälligen Ansammlung von Menschen eine schicksalhafte Gemeinschaft? Was bindet? Was trennt? Wie entsteht das Gefühl von Verantwortung? Von Miteinander?
Der britische Philosoph Gilbert Ryle hat solche Fragen mit der Metapher des unsichtbaren Mannschaftsgeistes verdeutlicht. Auch Spieler eines Sportteams, die aufs Feld laufen, bilden für sich genommen nur einzelne Individuen. Genauso, wie die Spielregeln allein noch keinen Rückschluss auf einen besonderen Zusammenhalt geben. Jemand könnte daher, so Ryle, zu Recht fragen: »Ich sehe, wer angreift, wer verteidigt, wer die Verbindung herstellt und so weiter; aber wessen Rolle ist es eigentlich, den Mannschaftsgeist zu liefern?«
In ähnlicher Weise könnte man mit Blick auf eine Stadt fragen, wie genau eigentlich ihr innerer Zusammenhang gebildet wird. Der Verweis auf ihre räumliche und verwaltungspolitische Struktur, ihre Straßenverläufe und Lärmschutzregelungen, reicht dafür nicht aus. Es braucht die Rückschau auf die Geschichte, auf glückliche Erfahrungen und überwundene Gefahren, es braucht die Vergegenwärtigung von gemeinschaftlichem Gelingen – es braucht das Gefühl einer miteinander geteilten Nähe als Voraussetzung für ein städtisches Bewusstsein.
In Grover’s Corner, so heißt Wilders fiktive Kleinstadt, sind die Biografien eng miteinander verwoben. Das heißt: Die Menschen sehen sich gegenseitig beim Altern zu, nehmen einander als Gegenüber wahr und ernst, beziehen sich in ihren Gesprächen aufeinander, messen ihr Glück an dem, was in ihrer unmittelbaren Umgebung geschieht. Es ist eine face-to-face society, die der Autor beschreibt, eine Welt, die sich durch die Interaktion von Anwesenden konstituiert. Kommunikation entsteht hier in erster Linie aus Augenkontakt.
Der Protagonist in dem Stück ist eine Art Engelsfigur, die über den Dingen steht und sich zwischen den Zeiten bewegt. Bei Wilder heißt diese Rolle altmodisch: »Spielleiter«.
Er präsentiert dem Publikum seine Stadt wie ein begeisterter Fremdenführer, weist stolz auf die Ankerpunkte ihres Alltags hin, als wären sie bedeutende touristische Sehenswürdigkeiten. Jede Arztpraxis, jedes Lebensmittelgeschäft, jede Ausgabe der Lokalzeitung bekommt in seiner Beschreibung so eine existenzielle Bedeutung. Und wer weiß denn auch mit Sicherheit zu sagen, ob in einem Menschenleben am Ende die Regelmäßigkeit nicht doch prägender ist als das Außergewöhnliche, die graue Parkbank um die Ecke nicht wichtiger gewesen sein wird als der glänzende Eiffelturm im Frankreich-Urlaub …
Um diese Frage geht es in Unsere kleine Stadt. Nur auf den ersten Blick hat der Titel etwas harmlos Idyllisches. Auf den zweiten deutet er etwas Geheimnisvolles an: nämlich den Umstand, dass Menschen dem Ort, der sie umgibt, in dessen Straßen sie leben, eine eigene Persönlichkeit zuschreiben, zu der sie in ein Nahverhältnis treten. Unsere kleine Stadt heißt aber auch, dass es hier um ein geteiltes Gut geht, etwas, das nicht einer für sich besitzt, sondern an das alle gemeinsam glauben.
Nur unsere Vorstellung macht aus einer Ansammlung von Mauern, Häusern und Plätzen ein übergeordnetes Ganzes, einen Ort der Gemeinschaft, vielleicht sogar eine Heimat. Ähnlich wie bei einer Flagge, die an einem Mast im Wind flattert – rein sachlich ist ihre Wirkung nicht zu erklären: Warum schlägt bei ihrem Anblick dem einen das Herz höher und dem anderen nicht?
Natürlich kann man sich auch einer Stadt analytisch nähern. Das versucht Wilders Spielleiter, indem er Sachverständige hinzuzieht, die dem Publikum kleine Vorträge über die geographische, ethnologische, soziale und politische Lage von Grover’s Corner halten. Aber so klug, so interessant sie auch klingen mögen – dass jemand diese Stadt »unsere« nennt, können die Professoren nicht erklären.
Denn im Grunde ist die Stadt eines der wundersamsten politischen Phänomene überhaupt. Seit der Antike gilt sie – neben der Familie – als zentraler Bezugspunkt menschlichen Lebens: Die Soziologen sprechen von »Integrationseinheit«. In ihr erleben wir das Experiment der Gemeinschaft, sie fordert zu Konflikt und Kompromiss heraus, stiftet zu Nachbarschaft und Verantwortung an.
Die Stadt hat auch einen emotionalen Wert, der eine prägende Anziehungskraft entwickeln kann. An ihr richtet sich die Persönlichkeit eines Menschen aus, mit und in ihr lernt er, was es heißt, ein Bürger zu sein. Schon die Semantik erzählt davon: Das Wort »Bürger« leitet sich von der »Burg« her, jenem ummauerten Bezirk, in dem man sich geschützt fühlt. Seit der Antike wird als Hauptmerkmal der Stadt, neben der Mauer und dem Markt, die Bürgerschaft angesehen. Der griechische Geschichtsschreiber Thukydides sagt: »Die Bürger bilden die Stadt« – die Idee des »Staatsbürgers« kam erst spät auf, über viele Epochen der europäischen Geschichte hinweg war die Identität des Bürgers eng an die Stadt geknüpft, war sein Engagement als politisches Wesen von der Überschaubarkeit seiner Umgebung abhängig: Bürger kommt von Burg, Politik von Polis.
Aristoteles sah in der κοινωνία πολιτική, der städtischen Gemeinschaft, die zweckhafteste Ausprägung von sozialer Einheit, da sie sich am natürlichen Trieb des Menschen als ζῷον πολιτικόν orientiert. Hier, wo die Chance darauf besteht, dass man sich im Laufe seines Lebens zumindest einmal in die Augen schauen kann, ist das Verantwortungsgefühl für das Gemeinwesen am stärksten. Das Vertrauen in die Politik am größten.
»Bürger« ist in der antiken Vorstellung nicht jeder Bewohner, und vor allem keine Bewohnerin, sondern nur der, der als freigeborener Mann im Wechselspiel von Herrschen und Beherrscht-Werden an der Sphäre der Polis teilnehmen darf, exekutive, richterliche und gesetzgebende Positionen innehat. Politik stellt sich im aristotelischen Verständnis damit nicht als »Beruf«, sondern als ein schicksalsbestimmendes Integrations- und Identifikationsmittel dar.
Das hat sich geändert. Heute, in Zeiten der spätkapitalistischen Digitalmoderne, empfindet kaum jemand mehr seine Bürger-Eigenschaft als entscheidendes Privileg. Der Begriff ist zu einer Kategorie des Milieus heruntergestuft, beschreibt ökonomischen Stand, sowie moralische und modische Eigenschaften. Parallel dazu hat sich ein medial konditioniertes, schmählustiges und konsumorientiertes Bewusstsein gebildet, das keinen Sinn mehr darin sieht, politische Verantwortung als Mandatsträger oder auch nur als Wähler zu übernehmen, sondern seinen Einfluss auf Gesellschaft und Welt als Clickbaiter und Crowdpleaser geltend macht.
Und doch: Wenn Städte niedergehen, zerstört werden oder verfallen, dann trauert die verbliebene Einwohnerschaft, als wäre ein naher Angehöriger gestorben. Da geht es immer um mehr als um den Verlust von Besitzstand. Nämlich vor allem um das Verschwinden von Geschichte. Um die Auslöschung von Bildern, von eigener Erinnerung und kollektivem Gedächtnis.
Wie tröstend ist doch die Vorstellung, dass Mauern und Straßen, Plätze und Kreuzungen uns überdauern. Dass sie über die Zeiten hinweg Fixpunkte bleiben, Erinnerungen an das Aufwachsen und Erleben ihrer Bewohner bewahren.
Vielleicht können wir uns unsere Städte auch als Zeugen vorstellen. Als Dokumentationszentren menschlicher Existenz. Hier spiegelt sich Geschichte im Individuellen, hier lassen sich Zeitenwenden im Interieur eines Straßencafés fassen. Eine Stadt ist immer größer als ihre Bewohner. Ihr Name bleibt in Erinnerung, selbst dann, wenn all ihre Bürger längst vergessen sind.
Was wissen wir vom Leben der Menschen, wenn wir die Namen ihrer Städte aussprechen?
Thornton Wilders Spielleiter stellt gegen Ende des ersten Aktes die Frage nach dem Erkenntniswert unserer historischen Überlieferung. Was erfahren wir wirklich durch Daten und Fakten?
»In Babylon lebten einmal zwei Millionen Menschen, und das Einzige, was von ihnen übriggeblieben ist, sind die Namen der Könige und ein paar Verträge über Weizenlieferungen – und der Handel mit Sklaven. Ja, jeden Abend setzten sich alle diese Familien an den Tisch und aßen, und der Vater kam von der Arbeit nach Hause, und der Schornstein rauchte – genau wie bei uns. Und auch, was wir über die Griechen und Römer wissen, ich meine, wie sie wirklich gelebt haben, das müssen wir uns Stück für Stück aus den Spottgedichten und Komödien zusammensuchen, die damals für das Theater geschrieben wurden. Und darum möchte ich auch ein Exemplar dieses Stückes mit einmauern lassen, damit in tausend Jahren ein paar simple Wahrheiten über uns bekannt werden – nicht nur der Versailler Vertrag und der Lindbergh-Flug.«
»Ein paar simple Wahrheiten« – wahrscheinlich geht es heute, nach all den Feierstunden der Dekonstruktion, wieder genau darum: ein paar »simple Wahrheiten« darüber festzuhalten, wie Menschen gelebt und gedacht haben. Mit vorsichtigen Strichen Umrisse ihres Bewusstseins zu zeichnen – jenseits der sogenannten Strukturen, die sowieso häufig rückwärtige Projektionen sind, um in Ordnung zu bringen, was in Wirklichkeit voller Regellosigkeit war.
Unsere kleine Stadt – dabei geht es auch um die Vorstellung, dass Zusammenhänge noch sichtbar sind. Es einen festen Hintergrund gibt, vor dem sich die verschiedenen Stadien eines Lebens abzeichnen. Ein Kiez, eine Straße, ein Haus – Heimat im handfesten, im handlichen Sinne. Wenn Geburt und Tod im selben Raum stattfinden. Unter dem gleichen Dach, vor denselben Augen.
Für mich war Wilders Theaterstück damals in erster Linie eine Gelegenheit, um mir den Wunsch eines Gemeinschaftsprojekts zu erfüllen. Die an meiner Schule von oben herab organisierte Theater-AG hatte sich aufgelöst und damit die Möglichkeit eröffnet, etwas Eigenes, Unabhängiges auf die Beine zu stellen. Mit einer Gruppe von spielbereiten Schulfreunden und Klassenkameradinnen, deren politisch prägendste Erfahrung das Bild der brennenden Türme in New York war, entstand ein Banden-Gefühl, das sich im gemeinsamen Vorbereiten einer öffentlichen Abendveranstaltung mit Programmheft, Beleuchtung und Souffleuse erfüllte. Es war das passende Stück zur biografischen Stunde – junge Menschen, die das Zusammenleben in einer kleinen Stadt nachspielten und darüber selbst zu einer kleinen Gemeinschaft wurden. Ein wenig war diese Theaterarbeit ohne Aufsichtspersonal, bei der jeder verschiedene Rollen übernahm und Verantwortung für das Ganze trug, wirklich wie ein erstes Zusammenleben auf Probe. Hatte die Organisation von Auftritten und Toneinspielungen, die Einrichtung von Probenplänen und Verpflegungsstationen durchaus Ähnlichkeiten mit der Verwaltung einer »kleinen Stadt«.
Erst viel später wurde mir klar, was dieses Theaterstück für mein eigenes politisches Bewusstsein bedeutete, welche Idealvorstellungen es mir eingeprägt hat. Den Wunsch nach einem überschaubaren Zusammenhang etwa, danach, den abstrakten Begriff der »Gesellschaft« konkret vor Augen geführt zu bekommen. Wo immer es geht, eine praktische Entsprechung dafür in der Gemeinschaft zu finden, sie zu initiieren, zu inszenieren, zu beschreiben.
Schon lange begleitet mich das Traumbild eines langen Tisches, an dem die unterschiedlichsten Menschen Platz finden und durch streitlustige Gespräche zu Vertrauten werden. Im Grunde nichts anderes als eine Metapher für die »kleine Stadt«. Eine Chiffre für etwas, das uns heute überall abhandenzukommen scheint: Bindung durch Begegnung, Vertrauen durch gemeinsam verbrachte und durchdachte Zeit.
Unsere kleine Stadt – das bedeutet eben auch, dass hier das Vertrauen in die Bindung größer ist als die Angst vor der Trennung. Trotz oder gerade wegen der individuellen Unterschiede von Herkunft und Ansicht, die im Alltag für jeden offensichtlich werden. Im Grunde verbirgt sich dahinter das paradoxe Urprinzip robuster Demokratien: die Verschiedenheit als Voraussetzung der Einheit.
Es gibt eine verwackelte Videoaufnahme von unserer Aufführung. Und einen vergilbten Programmzettel. Wer weiß, wie viele der damaligen Mitspieler sich heute überhaupt noch daran erinnern. Eine Gemeinschaft auf Dauer ist aus unserer Theatertruppe nicht entstanden. Nach der gemeinsamen Probe, der Premiere begannen die vielen Einzelunternehmungen. Warum?
Vielleicht, weil wir Unsere kleine Stadt in einer zu großen aufgeführt haben. Es für uns nach dem Abitur mit dem Aus-den-Augen-Verlieren nicht schnell genug gehen konnte.
Ganz anders als im Stück, wo stolz davon berichtet wird, dass es »den jungen Leuten« in Grover’s Corner zu gefallen scheine: »Neunzig Prozent von denen, die eine höhere Schule besuchten, siedeln sich hier für den Rest ihres Lebens an.«
Für uns hingegen war Berlin kein notwendiger Lebenshintergrund. Wir konnten es uns leisten, leichtfertig darauf zu verzichten. Die Stadt war eben nicht unsere. Sondern existierte gewissermaßen als bewusstlose Behauptung für alle und jeden.
Kurz vor dem gemeinsamen Theaterprojekt hatte ich ein halbes Jahr auf einem neuseeländischen Jungeninternat verbracht und dort die dunklere Seite der Gemeinschaft kennengelernt. Am anderen Ende der Welt war ich mit lauter präpotenten »Farming Boys« zusammen gewesen, die in ihrem Leben noch nie einen Europäer, geschweige denn einen Deutschen gesehen hatten. Morgens wurde ich mit Hitlergruß und militärischem Hackenschlag begrüßt. In den Gemeinschaftsduschen herrschte das Recht der Stärkeren, denen man stets den Vortritt lassen musste. Für mich, der im Berliner Gymnasium von linksliberalen Alt-68er-Lehrern im demokratischen Miteinander unterrichtet worden war, ein bestürzender Vorgang. Während der Morgenandacht schnipste mir ein Mitschüler ans Ohr und fragte flüsternd, ob diese »Mauer« bei uns zu Hause eigentlich immer noch stünde.
Meinem halbseitig gelähmten und daher von den Rugby-Jungs erniedrigten Zimmergenossen sang ich zum Trost romantische deutsche Volkslieder vor. Ich sehe mich noch am Fenster unserer kleinen Kammer stehen und aus voller Kehle »Im schönsten Wiesengrunde« singen. Vielleicht entwickelte ich dort in der Ferne überhaupt erstmals eine Nähe zum Nationalen. Außerhalb des Heimatlandes in einer seelenfremden Zwangsgemeinschaft spürte ich zum ersten Mal eine Sehnsucht nach Deutschland.
Als ich zurückkehrte, war ich trotz oder gerade wegen der schlechten Erfahrungen mit einem Kollektiv vom romantischen Gedanken der Gemeinschaft beseelt. Mit Enthusiasmus rief ich die unterschiedlichsten Gruppen ins Leben, leitete die Schülerzeitung, wurde Schulsprecher, organisierte Partys und gründete die Theater-AG. Die Inszenierung von Wilders Unsere kleine Stadt war in gewisser Weise der performative Selbstzuspruch eines nach Nähe suchenden Heimkehrers.
1988 geboren, kurz bevor der Kommunismus zusammenbrach und das Internet kommerzialisiert wurde, war ich als Einzelkind im soeben wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen, ohne etwas von der Bedeutung des historischen Augenblicks zu ahnen. Meine Eltern hatten kurz nach der Wende ein Haus »im Osten«, in der brandenburgischen Uckermark, gebaut, und ich war ab 1993 dort zu Hause. So jedenfalls empfand ich es, wenn ich mit Danny und Nancy auf dem Dorfplatz spielte oder mit den Enkeln eines ehemaligen NVA-Offiziers im örtlichen Kornspeicher paramilitärische Übungseinsätze imitierte.
Dass ich ein Zugezogener sein könnte, auch noch einer aus einem anderen, ideologisch verfeindeten Land, wäre mir damals nie in den Sinn gekommen. Die LPG-Fahne, die wir im Stroh des verfallenen Schweinestalls fanden, benutzten wir ahnungslos als Zeltdecke. Und auch die Lieder, die meine Dorffreunde für ihre Einschulung übten, klangen in meinen Ohren überzeugend: »Kleine weiße Friedenstaube / fliege übers Land / allen sag es hier: dass nie wieder Krieg wir wollen / Frieden wollen wir«.
Allerdings ging ich dann eben in West-Berlin zur Schule und war deshalb nur an den Wochenenden und in den Ferien in meiner Heimat. Erst später habe ich verstanden, was für eine entscheidende Rolle der Schulbesuch bei der Sozialisation spielt, dass daran gemessen wird, wer wirklich »von hier« kommt und als Einheimischer auftreten darf.
Auch während meiner Schulzeit habe ich nie ernsthafter über die Unterschiede zwischen Ost und West nachgedacht, habe sie, wenn überhaupt, nur sehr am Rande wahrgenommen. Hier und da ein nachgeplapperter dummer Spruch über »die Ossis« oder ein kurzes Störgefühl beim Blick auf den sozialistischen Mosaikfries am Alexanderplatz, aber im Großen und Ganzen: kein Thema. Ost und West – das waren für mich Kategorien der Vergangenheit.
Erst die Begegnung im Studium mit einem jungen Kunsthistoriker aus Thüringen, der eine Zeit lang zu meinem wichtigsten Gefährten werden sollte, holte für mich die Ost-Frage in die Gegenwart. Sein Beharren auf der Eigenart eines ostdeutschen Erfahrungsraums, seine stets leicht heroisch vorgetragenen Zweifel im Umgang mit Westdeutschen und seine daraus resultierende Anstrengung, sich in Duktus und Habitus der bundesrepublikanischen Norm anzupassen, machten mich neugierig. Obwohl ein Deutscher im gleichen Alter, war etwas anders an ihm. Schaute er mir fester in die Augen, sprach er mit längeren Pausen. Von seinen Eltern, zu denen er ein inniges Verhältnis hatte, erzählte er wenig und stellte sie mir auch erst spät vor – als ob er ihre Lebensweise vor den zudringlichen Blicken der Jetztzeit schützen wollte. Ich spürte bei ihm eine ungewöhnliche Mischung aus Scham und Stolz, ein unruhiges Bewusstsein, das ihn antrieb und gleichzeitig behinderte. Als würde die Welt, in der wir beide lebten, auf ihn unsicherer wirken als auf mich. Da war bei aller äußerlichen Übereinstimmung in Haltung und Interessen etwas an ihm, das sich von mir unterschied, etwas, das unausgesprochen blieb, etwas, das ihn im Inneren beschäftigte. Ich bezog das zunächst auf seinen Charakter, erst mit der Zeit verstand ich, dass es etwas mit seiner Herkunft zu tun haben könnte. Mit der kulturellen Behauptungskraft jener politisch überwunden geglaubten Identitätskategorie Ost.
Überwunden geglaubt, weil ich beispielsweise mit einer Bundeskanzlerin aufwuchs, die zwar aus dem Osten kam, von ihrer Herkunft aber gar nicht erzählte, daraus nichts ableitete. Im Gegenteil wirkte Angela Merkel auf mich lange so, als stünde sie über der deutsch-deutschen Frage. Als hätte die institutionelle Identifikation mit der Bundesrepublik bei ihr den romantischen Sinn für ihr Land verdrängt. Als wäre sie Kanzlerin einer Staatsform und nicht eines wiedervereinigten Volkes. Aus ihrem Auftreten, ihren Umgangsformen schien jedes historische Herkunftsmerkmal verbannt, während ihrer Amtszeit strahlte sie etwas Unabhängiges, nahezu national Neutrales aus.
Erst seit ihrer Hallenser Rede zum Einheitstag im Jahr 2021 und ihrem darin zum Ausdruck gebrachten Ärger über verschiedene Formen westdeutschen Hochmuts wurde mir klarer, warum Merkel das Land, das sie regierte, so selten direkt beim Namen nannte. Offenbarte sich darin ein unausgesprochener Widerwille gegen die stille Übereinkunft, dass »Deutschland« im Grunde immer »Westdeutschland« meint? Dass all die Errungenschaften und Erfolge, die mit dem nationalen Charakter unseres Landes verbunden werden, im Grunde von vornherein als westdeutsche Erfolge und Errungenschaften konnotiert sind?
Inzwischen glaube ich, dass genau in diesem Widerwillen eine produktive Kraft liegt. Es ist vielleicht die letzte, die in einem von Wandel und Wohlstand ermüdeten Land noch etwas bewegen kann. Mit materiellen Begriffen allein ist diese Kraft nicht zu beschreiben. Während in unseren Kirchen immer weniger Menschen das Wort »Seele« hören wollen, kommt das hohe Wort bei der Beschreibung des Ostens interessanterweise immer häufiger zum Einsatz. Was zeigt: Das Thema braucht Metaphern. Nur mit Analysen kommen wir nicht weiter.
»Ich möchte nicht neu hier sein«, sagt Emily im letzten Akt von Wilders Stück. Eigentlich liegt sie schon längst im Grab, aber für einen einzigen Tag darf sie noch einmal zurückkehren in »ihre kleine Stadt«. Noch einmal besucht sie all die vertrauten Plätze und Orte und stellt traurig fest, dass das Leben hier auch ohne sie weitergegangen ist. Dort, wo immer nur sie saß, sitzen jetzt andere, da, wo nur sie sich zu Hause gefühlt hat, sind jetzt neue Bewohner heimisch und froh – es kommt ihr vor, als hätte die Stadt sie getäuscht und nur so getan, als wäre sie ihre.
Das schamvolle Gefühl, »nicht neu sein zu wollen« – war, nein, ist es nicht genau das, was viele Ostdeutsche empfinden? Sie stehen zwar mit auf dem Spielfeld, aber den Mannschaftsgeist, den spüren sie nicht? Und könnte das auch etwas damit zu tun haben, dass es eben nicht »ihre Städte« sind, die Deutschland heute repräsentieren, nicht ihre Geschichten, nicht ihre Bilder?
Haben die politischen Spannungen zwischen Ost und West vielleicht nur vordergründig etwas mit unterschiedlichen Ansichten zur Tagespolitik zu tun? Mit verschiedenen Bauchgefühlen zu Migration oder Waffenlieferungen? Geht es in Wahrheit viel mehr um kulturelle Dinge? Also um die Bedeutung von Bedeutungen? Um Prägungsvorteile? Zugehörigkeit? Sinnzusammenhänge?
Also im Kern letztlich um die Frage, wer die Stadt »unsere« nennen darf?
Knapp zwanzig Jahre nach der Berliner Schulaufführung habe ich »meine kleine Stadt« gefunden. Sie liegt auf dem 53. Breitengrad, knapp sechstausend Kilometer nördlich vom Äquator im Nordosten Deutschlands. Von Berlin ist sie gute anderthalb Autostunden in Richtung Polen entfernt. Am Rande von Nordbrandenburg gelegen, dient sie als Verwaltungssitz des bei Berlinern inzwischen sehr beliebten Landkreises Uckermark und zählt gut neunzehntausend Einwohner. Eine traditionelle Kasernenstadt mit Seeblick und Plattenbauten, Einkaufszentren, leerstehenden Kirchen und einer Verwaltung als größtem Arbeitgeber – »hübsche Stadt, wie viele andere auch, nett, ansprechend. Es ist niemand von Bedeutung aus ihr hervorgegangen – soweit mir bekannt«, wie es in Wilders Theaterstück heißt.
Mein Grover’s Corner heißt: Prenzlau.
Ich kenne diese Stadt schon lang, aber erst seit Kurzem habe ich sie wirklich kennengelernt. Früher bin ich nur zum Einkaufen hingefahren, von Südosten mit dem Auto kommend und dann gleich nach dem Ortseingangsschild links abgebogen zum Marktkauf. Dieses zur EDEKA-Kette gehörige Einkaufszentrum hat jahrelang mein Bild von Prenzlau bestimmt. Ein paradigmatischer Unort: Tankstelle, Autoparkplatz, McDonald’s-Flaggen – ein bisschen amerikanisches Nowhere-Gefühl mitten in der ostdeutschen Provinz. Als könnte hier jeden Moment Bruce Springsteen von einem Pick-up springen und im Baumarkt verschwinden – in Wirklichkeit hat in der Nähe Wolf Biermann sein letztes DDR-Konzert vor seiner Ausweisung gegeben.
Kein Ort für ausgedehnte Spaziergänge. Kein Ort für bürgerliche Gemeinschaft – aber das ist Prenzlau eben nur auf den ersten Blick. Nur aus den Augen des großstädtischen Ferienhausbesitzers betrachtet, der einmal im Monat zum Großeinkauf herfährt, um sich und die Berliner Freunde mit alkoholfreiem Bier und passierten Bio-Tomaten einzudecken.
Prenzlau, das ist eine Stadt, die man für kleiner hält, als sie ist. Die man leicht unterschätzt, an der man vorbeischaut, die man gern links liegen lässt. Auf dem Weg zum Ostseeurlaub sind wahrscheinlich viele schon einmal an Prenzlau vorbeigefahren. Im Augenwinkel haben sie auf den Ausfahrtsschildern den Namen gelesen und an nichts anderes gedacht als an den Prenzlauer Berg. Jenen Berliner Modekiez, dessen gutsituierte Doppelmoral gerne mit Lastenrad und Privatschulbesuch charakterisiert wird und in dem sich inzwischen einige der teuersten Wohngegenden der Hauptstadt befinden. Ein weiter Weg von dort bis nach Prenzlau: nicht in Kilometern, sondern in Lebenswelten gerechnet.
Und doch ist der berühmte Pankower Ortsteil eben nach Prenzlau benannt. Der Grund dafür rührt aus einer Zeit, als die Stadt zu Brandenburgs wichtigsten zählte, weil hier viel Handel getrieben wurde und ungewöhnlich schöne Türme in den Himmel ragten. Als diese Stadt mit sieben Kirchen und drei Klöstern sakraler Mittelpunkt der Uckermark war. Deren Wahrzeichen, die Marienkirche mit ihren zwei prächtigen gotischen Giebeltürmen, Anfang des 14. Jahrhunderts als erste ostelbische Hallenkirche gebaut, zu den schönsten Backsteingebäuden Norddeutschlands zählte. In der prunkvollen dreischiffigen Hallenkirche war einst der Leichnam des schwedischen Königs Gustav Adolf II. aufgebahrt. Und auch sonst stimmt es nicht ganz, dass »niemand von Bedeutung« aus Prenzlau hervorgegangen sei. Ein paar berühmte Töchter und Söhne hat die Stadt doch zu bieten. Neben der späteren preußischen Königin Friederike zum Beispiel den rechtsliberalen Achtundvierziger Carl Friedrich Grabow, den preußischen Ministerpräsidenten Paul Hirsch sowie die spätere Prinzessin Wilhelmine von Hessen-Darmstadt. Oder den Landschaftsmaler Jakob Philipp Hackert, dem Goethe eine eigene Biografie widmete. Prenzlau beschreibt der Dichter darin wenig schmeichelhaft als »kleine Stadt, wo wenig für die Kunst zu thun und die der ferneren Entwicklung der Fähigkeiten des jungen Künstlers eben nicht sonderlich günstig war«. Ein späterer Dichter, Gottfried Benn, saß Anfang des 20. Jahrhunderts dann in einer Prenzlauer Kaserne und schrieb hier vielleicht die ersten Zeilen seines ergreifenden Gedichtes »Mutter«. Darin heißt es: »Ich trage dich wie eine Wunde / auf meiner Stirn, die sich nicht schließt«.
Der Legende nach legten die Wenden unter ihrem König Pribislav 1138 den Grundstein der Stadt Prenzlau, weil ihrem König die gesunde Luft und die anmutige Lage am Nordende des Unteruckersees so gefielen. Der Name »Prenzlau« bedeutet daher auch nichts anderes als: »Siedlung eines Mannes namens Pribislav«.
Gründer und Besetzer prägen den Raum und das Bewusstsein seiner Bewohner über die Zeiten hinweg: Während der Westen Deutschlands gefühlt noch immer nach Rom und Frankreich schaut, meint man im Osten, den slawischen Einfluss noch heute zu spüren. Prägung ist keine empirische Kategorie, und doch kann man ihre Wirkung nicht verleugnen – der Duden gibt als erklärendes Beispiel an, dass der Raum und die Landschaft »sich als Einfluss auswirken und jemandem ein entsprechendes besonderes Gepräge geben« können. Die Unterschiedlichkeit zwischen Ost und West – sie könnte auch tiefere, geprägte Gründe haben.
1187/88 wird Prenzlau erstmals schriftlich erwähnt, 1234 von einem Pommernherzog zur »freien Stadt« erklärt, mit einem für damalige Verhältnisse sehr modernen Stadtrecht. 1303 erhält Prenzlau das älteste erhaltene Apothekenprivileg. 1465 wird Prenzlau als »Hauptstadt der Uckermark« tituliert. Die goldenen Zeiten enden spätestens mit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges: Die Stadt wird von plündernden und marodierenden Heerscharen zerstört und entvölkert. Später retten zweihundert Handel treibende Hugenotten die Stadt vor der völligen Bedeutungslosigkeit. Zur Zeit der Napoleonischen Kriege besetzen französische Soldaten die Stadt, nachdem sich zehntausend preußische Soldaten in einer – sogar im Pariser Arc de Triomphe verewigten – Kapitulation geschlagen gegeben hatten, weil sie auf eine Täuschung über die gegnerische Truppenstärke hereingefallen waren. Glanz und Elend, Hoffnung und Enttäuschung lagen in Prenzlaus Geschichte schon immer nah beieinander.
Aber ich bin nicht in erster Linie als Historiker, sondern als Zeitgenosse auf Prenzlau aufmerksam geworden. Als Bürger in der Nachbarschaft, der sich für eine Frage besonders interessiert: Wie ist im Zeichen wachsender Selbstgerechtigkeit und digital befeuerter Schmählust noch Gemeinschaft möglich? Welche Kraft hat der gemeinsame Glaube an einen physischen Ort? Gibt es noch so etwas wie einen geteilten Himmel, oder greift inzwischen jeder nur noch allein nach seinen Sternen?
In Prenzlau findet man darauf bessere Antworten als im Prenzlauer Berg. Hier kann man spüren, unter welchem Druck Deutschland gerade steht. Wie sicher geglaubte Überzeugungen an Rückhalt verlieren: das Vertrauen in die repräsentative Demokratie, die Anziehung des Liberalen, die Skepsis gegenüber dem Autoritären – alles nicht mehr selbstverständlich. Hier, in der ostdeutschen Kleinstadt, lernt man mehr über die Herausforderungen des Landes als in seinen unübersichtlichen Metropolen. Hier kann man die gesellschaftspolitischen Auswirkungen von Überalterung, wegbrechender Daseinsvorsorge und zunehmender Migration wie unter einem Brennglas betrachten. Die Vergrößerung des Details schärft den Blick für das große Ganze. Zu oft wird in unserer Zeit über politische Probleme so gesprochen, als flögen sie frei in der Luft herum, als gäbe es keinen Boden, auf dem sie wachsen würden.
Prenzlau – das ist das schlechte Gewissen der Großstadt, das ist die vielzitierte Überlastung der Kommune, das ist die drohende Machtübernahme von rechts, das ist aber auch die Sorge um Arbeit, Zukunft und Wohlstand. Und vor allem: die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Zugehörigkeit und nach Nähe.
Prenzlau – das ist ein verwaltungsstolzer Bürgermeister, das ist eine schaffenskräftige Kitaleiterin, das ist ein syrischer Flüchtling, der unbedingt arbeiten will, das ist ein engagierter AfD-Politiker, das ist eine Pfarrerin, die auf Widersprüche Wert legt, das ist ein Oberstleutnant, der die Stadt im Ernstfall verteidigen müsste, das ist eine junge Frau, die versucht, der brandenburgischen Gesellschaft den Wert der Wissenschaft vor Augen zu führen, das ist ein Landesvater a. D., der stolz auf den Überlebenswillen des Ostens ist.
Prenzlau – das ist vor allem die Einsatzkraft seiner Bürger. Das ist eine Geschichte von Wunden und von Gefahren, so, wie sie vor Ort erlebt wurden und werden. Das ist eine deutsche Erzählung von Niederlage und Weitermachen, von Frust und Stolz und von Hoffnung.
In dieser Stadt sieht man nicht nur, was schwierig ist, sondern auch, wie es ein bisschen leichter gehen könnte. Hier gibt es Lösungen. Lösungen, die vielleicht gar nicht in erster Linie politische sind.
Bei Steffen Mau, dem, im Vergleich zu anderen, gemäßigteren soziologischen Vermesser des ostdeutschen Bewusstseins, finden sich neben »bio-ostdeutsch« und »sozio-ostdeutsch« die Identitätskategorien »geo-ostdeutsch (nach Wohnort)« und »emo-ostdeutsch (nach emotionaler Zugehörigkeit)« für diejenigen, die nicht im Osten geboren und zur Schule gegangen sind, sich ihm aber durch ihren dauerhaften Aufenthalt verbunden fühlen. Wahrscheinlich kann ich nur die letzte Beschreibung für mich in Anspruch nehmen. Denn mir ist klar: Ich habe weder den Anpassungsdruck der DDR-Diktatur erleben noch die schmerzhaften Nachwehen der Wende aushalten müssen, bin nicht in »Baseballschlägerjahren« aufgewachsen, sondern habe den Osten weitgehend als freien, idyllischen Erfahrungsraum erlebt. In Wahrheit ist mir die Identitätsnuance »Ost« erst in den letzten Jahren als eine eigene bewusst geworden. Als ich nach Frankfurt am Main zog und voller Stolz bei der »Zeitung für Deutschland«, der F. A. Z., zu arbeiten begann. Vielleicht auf ähnliche Weise wie damals in Neuseeland, als ich mich im bäuerlichen Jungeninternat zum ersten Mal wirklich als deutsch empfand, habe ich mich hier zwischen den hohen Bankentürmen erstmals ein wenig ostdeutsch gefühlt.
Für mich hat das Wort auch etwas mit Romantik zu tun. Mit einer Haltung zur Welt, die dem Entzaubern und in Anführungszeichen-Setzen die Sehnsucht nach Nähe und Zusammenhang entgegenstellt. Die das emotionale Wort mitunter für geeigneter hält als das kühle Argument, um ein Gefühl der Zugehörigkeit herzustellen. Die daran glaubt, dass wirkliche Gemeinschaft erst dann entsteht, wenn sie einen gemeinsamen Traum hat und ihre Existenz nicht nur einem professionellen Pragmatismus verdankt. Es nicht nur ums Ankommen, sondern ums Vorhaben geht, um den Plan, die Fantasie eines »Was wäre, wenn?«. Ost als Codewort einer Neoromantik, die weiß, dass ein geistesgegenwärtiges Bewusstsein von Ganzheit und Größe immer auch von der Voraussetzung lebt, die Welt im Kleinen bestaunen zu können.
Das Bedeutende im Verborgenen zu erkennen, dem Unscheinbaren und Gewöhnlichen »einen hohen Schein geben« – diese urromantische Parole habe ich seit einiger Zeit wie einen Tinnitus im Ohr. Ihr folge ich, wenn ich auf Menschen und Geschehnisse schaue. An Gesten und Nebenbemerkungen bleibe ich hängen, lese sie als Zeichen einer verschatteten Dimension von Wirklichkeit. Als Ausdrucksmöglichkeiten im vorpolitischen Raum. Eben als Reflexe jener – in unseren Tagen häufig zum Genussmittel bagatellisierten – Kultur, die in Wahrheit die eigentlichen Bedingungen von politischem Sein und Sollen schafft.
Wahrscheinlich hat mich dieser Tinnitus auch nach Prenzlau geführt. Zu »meiner kleinen Stadt«.
Zwei Jahre lang habe ich sie immer wieder besucht. Bin aufgeregt zu ihr gefahren. Bei meinen Streifzügen habe ich verschiedene Prenzlauer »Stadtbürger« zum Gespräch getroffen – am Rande von Neujahrsempfängen, Wahlabenden oder Nachbarschaftsinitiativen. Ich war bei ihnen zu Hause, habe sie an ihren Arbeitsplätzen besucht, bei Festen und Umzügen, auf Demonstrationen und Sitzungen begleitet. Viele von ihnen habe ich als bewusste Könnerinnen und Könner kennengelernt, die durch ihren Einsatz das Gegebene verbessern, ohne ihr Handeln dabei unter die Vorzeichen eines größeren Wandelziels zu stellen.