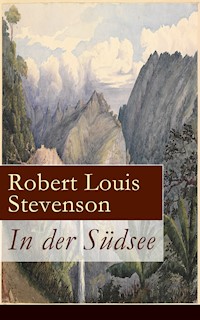
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "In der Südsee" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Robert Louis Stevenson (1850-1894) war ein schottischer Schriftsteller des viktorianischen Zeitalters. Bekannt geworden sind vor allem der Jugendbuchklassiker Die Schatzinsel sowie die Schauernovelle Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, die sich dem Phänomen der Persönlichkeitsspaltung widmet und als psychologischer Horrorroman gelesen werden kann. Der Erlös aus den Veröffentlichungen war für eine seit längerem geplante Südseereise gedacht, die die Familie Stevenson am 28. Juni 1888 auf dem Schoner "Casco" in San Francisco antrat. Die Reise führte über die Marquesas-Inseln nach Tahiti und Honolulu auf Oʻahu, einer der acht Hauptinseln des Hawaiʻi-Archipels, wo sie Freundschaft mit König Kalākaua und dessen Nichte Prinzessin Victoria Kaʻiulani schlossen. Stevenson verbrachte dort fünf Monate und gewann durch den König Einblicke in die komplizierten sozialen und politischen Verhältnisse in dieser Region. Als er 1893 nochmals für einige Wochen auf die Inseln zurückkehrte, war die letzte Königin Liliʻuokalani gestürzt worden, und das Land stand unter amerikanischem Einfluss. Im Juni 1889 reisten die Stevensons mit dem Handelsschoner "Equator" zu den Gilbert-Inseln. Im Dezember des Jahres besuchte Stevenson erstmals Samoa, wo er ein Anwesen am Fuß des Mount Vaea, unweit Apia auf der Insel Upolu erwarb. Im Februar 1890 reisten die Stevensons nach Sydney, machten von April bis August eine dritte Kreuzfahrt in der Südsee, kehrten nach Sydney zurück und siedelten im Oktober endgültig nach Samoa über, wo er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte. In the South Seas (In der Südsee) ist ein Erinnerungsbericht über Stevensons drei Kreuzfahrten, erschien im Jahr 1896.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
In der Südsee
Ein klassisches Erlebnis- und Reisebuch (Erinnerungsbericht über Stevensons drei Kreuzfahrten: Tahiti, Hawaii, Samoa und mehr)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Robert Louis Stevenson, dessen literarische Bedeutung Ernst Weiß in seinem Nachwort zu dem Abenteuerroman »Die Schatzinsel« (Deutsche Buch-Gemeinschaft) eingehend würdigt, hielt 1887 endgültig Umschau nach einem Wohnsitz, wo es ihm trotz seiner von jeher schwächlichen Veranlagung möglich wäre, eine ganze Reihe dichterischer Pläne zu verwirklichen. Zunächst nahm er für den Winter 1887/1888 seine Zuflucht zu einem neu eingerichteten Sanatorium für Lungenleidende in den Vereinigten Staaten, nahe der kanadischen Grenze. Die alte Liebe zur See erwachte mit neuer Heftigkeit im Frühling; seine Frau, die zum Ankauf eines geeigneten Fahrzeuges nach St. Franzisko gereist war, telegraphierte ihm, daß die Jacht »Casco« für eine Fahrt zu den Südseeinseln gepachtet werden könne. Stevenson entschloß sich, vierzigtausend Mark, zwei Drittel seines Vermögens, für seine Gesundheit zu opfern, ließ die Jacht herrichten, engagierte den erfahrenen Kapitän Otis nebst einem chinesischen Koch und vier tüchtigen Seeleuten und verließ am 28. Juni 1888 den Hafen in der Absicht, nach mehrmonatlichen Fahrten in den warmen Seewinden wieder in zivilisierte Gegenden zurückzukehren und dann vielleicht in Madeira sein Heim aufzuschlagen. Seiner Frau, die ihn überallhin begleitete, hatte er angedeutet, daß er ein Seemannsgrab in den Wellen des Ozeans dem Dahinsiechen auf dem festen Lande vorziehen würde, wenn seine Krankheit sich verschlimmern und die Strapazen der Seefahrt ihn niederwerfen sollten. Aber seine Gesundheit kräftigte sich, das Klima sagte ihm zu, so daß er fast drei Jahre auf Hin-und Herfahrten zwischen den verschiedenen Inselgruppen verbrachte. Er besuchte alle völkerkundlich und landschaftlich interessanten Plätze und ließ sich schließlich 1891 auf der Insel Upolu der Samoagruppe nieder, wo er im Dezember 1894 an Gehirnschlag starb, erst vierundvierzig Jahre alt.
Neben der laufenden literarischen Produktion, die stofflich zum Teil aus den neuen Erlebnissen genährt wurde, wollte Stevenson ein umfassendes Werk über die Südsee schreiben, deren soziale und wirtschaftliche Verhältnisse rasch einer völligen Auflösung entgegentrieben. Es mag sein, daß Stevenson bei längerer Lebensdauer die Kraft gefunden hätte, diese gewaltige anthropologische Aufgabe zu lösen, aber wahrscheinlich ist es, daß seine dichterische Phantasie ihm auch in späteren Jahren nicht die nötige Ruhe zu einer rein wissenschaftlichen Beschäftigung gegeben hätte. Er hinterließ umfangreiche Aufzeichnungen, die nach seinem Tode gesammelt und geordnet wurden, und so entstand schließlich der ansehnliche Band»In the South-Seas«,der hier in vollständiger Übersetzung vorliegt.
Eine Karte liefert einen Überblick über die Fahrten, die der Dichter unternahm. Zunächst trug die Schonerjacht »Casco« die Reisenden in zweiundzwanzig Tagen zu den Marquesas, einer Gruppe von gebirgigen Inseln unter französischer Oberhoheit, die äußerst selten von Globetrottern besucht wurden und abseits von den Schiffahrtsstraßen lagen. Der erste Teil des Werkes schildert die Erlebnisse und Erfahrungen auf den vulkanischen Inseln Nuka-hiva und Hiva-oa, deren Bewohner noch vor kurzer Zeit die leidenschaftlichsten Menschenfresser Polynesiens gewesen waren und nun aus verschiedenen Gründen wie Schnee im Frühlingswind dahinschmolzen. Der Aufenthalt dauerte vom 28. Juli bis zum 4. September 1888, also verhältnismäßig kurze Zeit, aber die Ergebnisse waren erstaunlich mannigfaltig, wie der erste Teil unseres Buches zeigt. Dann ging die Fahrt weiter zu den Paumotuinseln, wo man am 6. September eintraf und bis Ende September verweilte. Eine völlig andere Welt! Diese Lagunenriffe umschließen in einem Kranz oder Oval eine Art Binnensee, der allmählich durch Ablagerungen des Seewassers seichter wird. Der Korallenkranz ist mehr oder weniger dicht besetzt mit Palmen, unter denen die Häuser der Eingeborenen stehen, und zwar an der Lagunenseite, nicht an der Meeresküste, wo die blutgierigen Geister der Abgestorbenen ihr menschenfresserisches Unwesen treiben. Der erstaunliche Gegensatz zwischen der Bevölkerung der »hohen« und der »niedrigen« Inselgruppen kommt in der plastischen Schilderung Stevensons lebendig zum Ausdruck.
Die Jacht trug sie südwestlich weiter nach Tahiti in der Gruppe der Gesellschaftsinseln, wo Stevenson inmitten der herrlichsten Südseelandschaft schwer erkrankte. Er erholte sich jedoch bald und durchlebte die schönste Zeit seiner freiwilligen Verbannung, über die sich leider in seinem Tagebuch keine Aufzeichnungen fanden: der Dichter war von der Großartigkeit der Inseln so überwältigt, daß er die Niederschrift seiner Erlebnisse versäumte und statt dessen seine epischen Werke wesentlich förderte. Am Weihnachtstag 1888 nahm die »Casco« ihre Passagiere wieder auf und führte sie gen Honolulu, von wo Stevenson Molokai besuchte, die Insel der Leprakranken, aber auch hierüber fehlt ein Bericht, und man ist auf vereinzelte Briefe angewiesen, die er damals an seine Frau und zwei Freunde richtete.
In den folgenden Monaten wurde eine Fahrt vorbereitet in solche Gebiete, die möglichst unberührt waren von jeder Zivilisation, und im Juni 1889 trug der kleine Handelsschoner »Equator« die Reisegesellschaft zu den Gilbertinseln dicht am Äquator. Jener Teil der Tagebücher, der sich mit den Zuständen und Menschen auf diesen Koralleninseln beschäftigt, gehört ohne Zweifel zu den interessantesten und lebendigsten Partien des vorliegenden Werkes. Namentlich das groß angelegte Porträt des Königs Tembinok’ von Apemama übertrifft an Farbigkeit alles, was in Stevensons Aufzeichnungen vorgefunden wurde. Vier Jahre später hatte sich auf den Inseln Butaritari und Apemama alles geändert, Tembinok’ war gestorben, die Gilbertinseln waren von England annektiert worden, und ein Knabe spielte den Herrscher unter der Leitung eines britischen Residenten. Stevensons Bericht hat also eine einzigartige völkerkundliche Bedeutung.
Der Schoner setzte Anfang Dezember 1889 seine Reise fort nach Samoa und traf am 7. Dezember in Apia ein, der Hauptstadt von Upolu. Hier versuchte Stevenson alles Material zu sammeln, das ihm als Unterlage dienen sollte für seine umfassende Arbeit über diesen Teil der Südsee, und er entschloß sich zu einer besonderen Veröffentlichung unter dem Titel»A Footnote to History«,die viel Staub aufwirbelte und in Deutschland später verboten wurde, aber die grundsätzlichen Bemerkungen über die Behandlung der Eingeborenen haben sich im Verlauf der Jahrzehnte als unanfechtbar richtig erwiesen. Es ist in diesem Zusammenhang interessant zu erfahren, daß der deutsche Generalkonsul Dr. Stübel zu den vertrautesten Freunden Stevensons gehörte und von ihm als der fähigste und einsichtsvollste Diplomat der Großmächte in der Südsee bezeichnet wurde.
Das Heim, das Stevenson nach seiner Rückkehr in Madeira geplant hatte, wurde nun in Samoa errichtet, er kaufte Land in der Nähe Apias, bevor jedoch der dichte Busch gerodet und die Fundamente gelegt werden konnten, reiste er wieder fort, besuchte Australien und später viele ihm noch unbekannte Südseeinseln, bis er 1891 ernstlich seinen Plan zur Ausführung brachte und sein Haus auf der Insel Upolu bauen ließ: der entscheidende Wendepunkt seines Lebens, das allerdings nur noch etwa drei Jahre währen sollte. Ein Freund schrieb ihm aus England: »Seit Byron in Griechenland war, hat nichts auf die Literaten einen so tiefen Eindruck gemacht wie Ihr Aufenthalt in der Südsee.« Der Dichter nannte seinen Besitz »Vailima«, »Fünfwasser«, weil er im Gebiet von fünf Flüssen lag, und die Eingeborenen gaben dem Dichter den Namen »Tusitala«, Geschichtenerzähler. Der Platz lag ungefähr drei Meilen von der Küste entfernt und sechshundert Fuß über dem Meeresspiegel, durch das Gelände führte ein Weg, den befreundete Häuptlinge mit ihren eigenen Händen herrichteten, und den sie»Ala Loto Alofa«,»Weg des liebenden Herzens«, nannten. Rund um das dunkelgrün gestrichene Holzhaus herrschte tiefe Stille, von fernher drang das leise Rauschen der Brandung, und man kann sich schwerlich einen friedlicheren Ort in der weiten Welt vorstellen als Stevensons Waldheim auf Upolu. Häuptlinge und Weiße suchten ihn häufig auf, um seinen Rat einzuholen, man nannte sein Heim »das Haupthaus der Weisheit«.
Das Klima Samoas schien Stevenson zu kräftigen, er verlangte nicht mehr volle Gesundung, sondern war zufrieden mit der Möglichkeit, sein dichterisches Werk zu fördern. Die Lungenschwindsucht kam zum Stillstand, er war imstande eifrig zu schreiben und vermißte nur seine englischen Freunde und die heimatliche schottische Landschaft, so daß ihn nicht selten die schmerzlichen Empfindungen eines Verbannten überfielen. Seine Vailima-Briefe legen von dieser Sehnsucht nach der alten Heimat beredtes Zeugnis ab. Aber alles in allem hatte er endlich nach langen Wanderungen einen Ort gefunden, an dem er sich wohl fühlte, und hätte die Krankheit nicht doch unmerkbar und unaufhaltsam den Körper verwüstet, so wäre bei seiner lebendigen Schöpferkraft wohl noch manche herrliche Dichtung entstanden. Heimtückisch überfiel ihn der Tod an einem Tage, da er zu seiner Frau gesagt hatte, er fühle sich so gesund wie nie zuvor. Als die Abendmahlzeit nahte, holte er eine Flasche Burgunder aus dem Keller und trat heiter plaudernd zu seiner Lebensgefährtin, als er sich plötzlich mit beiden Händen an den Kopf griff und ausrief: »Was ist das? Sehe ich sonderbar aus?« Dann brach er in die Knie nieder, verlor das Bewußtsein, wurde in die Halle getragen und der deutsche Arzt Dr. Funk herbeigeholt, aber menschliche Bemühungen waren umsonst, und umgeben von seinen Freunden und den farbigen Hausgenossen starb er gegen acht Uhr abends am 3. Dezember 1894.
So fand Tusitala, der Geschichtenerzähler, ein Grab inmitten des Großen Ozeans auf einer Insel der Südsee, die er fast sosehr liebte wie seine schottischen Berge, und auf seinem Grabe hoch oben auf dem Gipfel von Vaea steht das von ihm selbst verfaßte Requiem, das wir im Urtext wiedergeben:
Under the wide and starry sky, Dig the grave and let me lie. Glad did I live and gladly die, And I laid me down with a will.
This be the verse you grave for me: Here he lies where he longed to be; Home is the sailor, hom[e] from sea, And the hunter home from the hill.
Die Häuptlinge belegten den Ort mit einem Tabu gegen Schußwaffen, damit die Vögel droben nisten und ihre Lieder an seiner Ruhestätte ungestört singen konnten.
Erster Teil. Die Marquesas
Erstes Kapitel Die Landung
Inhaltsverzeichnis
Nahezu vier Jahre ging es mit meiner Gesundheit bergab, eine Zeitlang vor meiner Ausreise glaubte ich, der letzte Abschnitt meines Lebens sei gekommen, und nur Krankenschwester und Totengräber warteten noch auf mich. Man riet mir, ich solle es einmal mit der Südsee versuchen, und ich war nicht abgeneigt, wie ein Geist oder Gespenst in jenen Gegenden aufzutauchen, die mich einst in Jugend und Gesundheit entzückt hatten. Ich charterte also Dr. Merrits Schonerjacht »Casco«, ein Schiff von vierundsiebzig Registertonnen, segelte Ende Juni 1888 von San Franzisko ab, besuchte die östlichen Inseln und befand mich Anfang des folgenden Jahres in Honolulu. Der Mut, zu meinem ehemaligen Krankenzimmerleben zurückzukehren, fehlte mir, und so segelte ich von dort mit dem Handelsschoner »Equator«, etwas über siebzig Tonnen, südwestlich, verbrachte vier Monate zwischen den Atollen (niedrigen Koralleninseln) der Gilbertgruppe und erreichte Samoa gegen Ende 1889. Zu dieser Zeit begannen Dankbarkeit und Gewohnheit mich an die Inseln zu fesseln, ich hatte neue Kräfte gesammelt, Freundschaften geschlossen und mir neue Interessengebiete gewonnen, die Reisezeit war wie ein Traum verflogen, und ich entschloß mich zu bleiben. Auf einer dritten Fahrt mit dem Handelsdampfer »Janet Nicoll« begann ich mit der Vorbereitung dieses Buches. Werden mir noch mehr Tage geschenkt, so sollen sie dort verbracht werden, wo ich das Leben am angenehmsten und die Menschen am interessantesten fand; die Äxte meiner Schwarzen beginnen bereits das Gelände zu roden für mein zukünftiges Heim, und ich muß lernen, zu meinen Lesern zu sprechen von den fernsten Fernen des Ozeans.
Daß ich auf diese Weise der Behauptung von Lord Tennysons Helden widersprechen mußte, ist weniger absonderlich, als es den Anschein hat. Wenige Menschen, die zu den Inseln kommen, verlassen sie wieder; sie werden grau, wo sie landeten, Palmen beschatten und Passatwinde umfächeln sie bis zum Tode. Sie spielen vielleicht bis zuletzt mit dem Gedanken, die Heimat wieder zu besuchen, aber er wird selten durchgeführt, noch seltener mit Genuß und am seltensten zum zweitenmal. Kein Teil der Welt übt einen bezaubernderen Einfluß auf den Besucher aus, und meine Aufgabe ist es, dem Reisenden am Kaminfeuer einen Begriff zu geben von seinem verführerischen Reiz und das Leben zu Wasser und zu Lande der vielen Hunderttausende zu beschreiben, die teilweise nach Blut und Sprache zu uns gehören und alle unsere Zeitgenossen sind, in Denken und Sitten aber uns so fernstehen wie Rob Roy dem Kaiser Barbarossa oder die Apostel den Cäsaren.
Erste Eindrücke wiederholen sich nie. Die erste Liebe, der erste Sonnenaufgang, die erste Südseeinsel sind einzigartige Erinnerungen, mit jungfräulichem Empfinden aufgenommen. Am 28. Juli 1888 war der Mond um vier Uhr morgens schon eine Stunde untergegangen. Im Osten verkündete sprühender Glanz den Tag, darunter, am Horizont, bildete sich bereits die morgendliche Nebelbank, schwarz wie Tinte. Wir haben alle gelesen von der Schnelligkeit, mit der in niedrigen Breiten der Tag kommen und gehen soll, wissenschaftliche und gefühlvolle Reisende sind sich darüber einig, und hübsche Gedichte singen davon. Sicher wechselt die Dauer mit der Jahreszeit, aber hier ist ein genau beobachteter Fall. Obgleich die Morgendämmerung um vier Uhr begann, war die Sonne nicht vor sechs Uhr aufgegangen, und wir konnten vor halb sechs Uhr die zu erwartenden Inseln nicht von den Wolken am Horizont unterscheiden. Acht Grad südlich brauchte der Tag zwei Stunden, um heraufzukommen. Inzwischen verharrten wir an Deck in stillschweigender Erwartung, die gewöhnliche Erregung vor einer Landung wurde gesteigert durch die Fremdheit der Küsten, denen wir uns damals näherten. Langsam gewannen sie Gestalt in der weichenden Dunkelheit. Ua-huna mit hochgerecktem, stumpfem Gipfel erschien zuerst an Steuerbord, fast geradeaus erhob sich Nuka-hiva, unser Ziel, in Nebel gehüllt, und dazwischen und südwärts umspielten die ersten Sonnenstrahlen die spitzigen Höhen von Ua-pu. Sie durchlöcherten die Linie des Horizonts und standen in der sprühenden Helligkeit des Morgens wie die Türme einer mit phantastischen Ornamenten überladenen Kirche als Wahrzeichen einer Welt der Wunder.
Niemand an Bord der »Casco« hatte jemals den Fuß auf diese Inseln gesetzt oder kannte mehr als einige Brocken der Sprache, und wir näherten uns den geheimnisvollen Ufern mit jener angstvollen Freude, die das Herz von Entdeckern bewegen mag. Das Land hob sich zu steilen Bergen und ansteigenden Tälern, es fiel ab in Klippen und Zacken, die Farben spielten in fünfzig Schattierungen von Perlgrau, Rosa und Oliv, gekrönt von opalisierenden Wolken. Wallende Schleier täuschten den Blick, die Wolkenschatten verschmolzen mit den Bergrücken, und die Insel mit ihrem luftigen Gewande erhob sich schimmernd vor uns wie eine einzige Masse. Kein Signal, kein Rauch von Städten, kein sorgsamer Lotse erwartete uns. Irgendwo verborgen im verschwommenen Wirrwarr der Klippen und Nebel lag unser Hafen und irgendwo östlich davon als einziger Anhaltspunkt ein gewisses Vorgebirge, ungenau bekannt als Kap Adam und Eva, erkennbar an zwei Kolossalfiguren, klotzigen Bildwerken der Natur. Sie mußten wir finden, nach ihnen spähten und forschten wir mit Augen und Fernrohren, sie suchten wir laut streitend nach den Karten, und die Sonne stand hoch, das Land lag dicht vor uns, bevor wir sie fanden. Für ein von Norden herankommendes Schiff wie die »Casco« waren sie tatsächlich am allerwenigsten bemerkbar an dieser einzigartigen Küste; Gischt spritzte hoch auf an ihrem Sockel, seltsame, düstere und zerklüftete Berge lagen im Hintergrund, und Adam und Eva hingen über den Brechern wie ein paar Warzen.
Wir fuhren nun an der Küste entlang, an der Landseite hörten wir das Getöse der Brandung, einige Vögel flogen fischend am Bug hin und her: kein anderes Lebenszeichen, kein Laut von Mensch und Tier in dieser Gegend der Insel. Beschwingt von eigener Sehnsucht und der abflauenden Brise strich die »Casco« an den Klippen vorbei, erschloß uns eine Bucht, einen Strand, einige grüne Bäume, glitt weiter, wiegte sich auf der Dünung. Die Bäume glichen aus der Entfernung Haselnußsträuchern, der Strand hätte in Europa liegen können, die Berge ähnelten fast den Alpen, und der Wald an den Abhängen schien nicht bemerkenswerter als der schottischer Heidegebiete. Wieder öffneten sich die Klippen, aber diesmal war die Einfahrt tiefer, und die »Casco« begann unter gutem Wind in die Bucht von Anaho zu gleiten. Wir sahen Kokospalmen, diese Giraffen unter den Bäumen, graziös, anspruchslos, dem europäischen Auge so fremdartig, zahlreich am Strande wachsen und die steilen Berghänge hinaufklettern und einsäumen. Rauhe und kahle Hügel umschlossen die Bucht zu beiden Seiten, landeinwärts erhoben sich gewaltige, zerklüftete Berge. Überall in den Schluchten wuchs Wald, wie Vögel auf Ruinen horsten und nisten, und hoch oben bekränzte er mit seinem Grün die messerscharfen Grate der Gipfel.
Am Ostufer schob sich unser Schoner nun ohne jede Brise langsam weiter: ein feines Fahrzeug, das in sich beweglich schien, wenn es einmal unterwegs war. Ganz nahebei am Ufer blökten Lämmer, ein Vogel sang am Abhang, der Duft des Bodens und hunderter Früchte oder Blumen strömte uns entgegen, und plötzlich tauchten ein oder zwei Häuser auf, hinaufgeschoben am Hügelabhang, das eine scheinbar von einem Garten umgeben. Diese sofort ins Auge fallenden Behausungen waren, ohne daß wir es wußten, Spuren von Weißen, Tupfen der Kultur, und wir hätten uns hundert Inseln nähern können, ohne ihresgleichen zu finden. Erst später entdeckten wir das Eingeborenendorf, nach allgemeiner Sitte dicht am Strande und unter einer Palmengruppe gelegen; davor die See weiß brandend im konkaven Bogen der Korallenriffe. Denn die Kokospalme und die Menschen sind beide Freunde und Nachbarn der Brandung. »Die Koralle wächst, die Palme sprießt, aber der Mensch verschwindet«, sagt das traurige tahitische Sprichwort, aber alle drei sind, solange sie leben, Nachbarn am Strande. Der Ankerplatz, den wir wählten, war gekennzeichnet durch ein Windloch in den Felsen, nahe der Südostecke der Bucht. Pünktlich wie für uns bestimmt drang ein Wasserstrom durch das Loch, der Schoner drehte sich auf dem Fleck, der Anker tauchte unter. Ein winziger Laut, ein großes Ereignis: meine Seele versank mit den Ketten in die Tiefe, keine Winde und kein Taucher mögen sie je wieder heraufholen, ich und manche meiner Schiffsgenossen waren von dieser Stunde Leibeigene der Insel Viviens.
Bevor noch der Anker versank, paddelte schon ein Kanu vom Dorf her. Es enthielt zwei Männer, der eine weiß, der andere braun, quer über das Gesicht mit blauen Strichen tätowiert, beide in tadellosen europäischen Kleidern: der hier ansässige Händler, Mr. Regler, und der Eingeborenenhäuptling, Taipi-Kikino.
»Ist es erlaubt, an Bord zu kommen, Kapitän?« waren die ersten Worte, die wir auf den Inseln vernahmen. Kanu folgte Kanu, bis das Schiff wimmelte von stämmigen, sechs Fuß hohen Männern in jedem Stadium der Unbekleidetheit; einige kamen im Hemd, andere im Lendentuch, einer hatte ein Taschentuch geschickt angebracht; einige, und zwar die vornehmsten, waren von Kopf zu Fuß mit entsetzlichen Mustern tätowiert, manche sahen wild aus, mit Messern bewaffnet, einer, der wie ein tierähnliches Wesen vor meinem Gedächtnis steht, rutschte in seinem Kanu auf dem Gesäß herum, sog eine Orange aus und spie die Reste nach beiden Seiten mit affenähnlicher Beweglichkeit aus. Alle schwatzten, und wir verstanden kein Wort; alle wollten handeln mit uns, während wir an Handel nicht dachten, und boten uns Inselkuriositäten zu lächerlich hohen Preisen an. Kein Wort des Willkommens, keine Spur von Höflichkeit, kein Handschlag, abgesehen von Mr. Regler und dem Häuptling. Als wir die angebotenen Gegenstände ausschlugen, machten sie uns lärmend und grob Vorwürfe, und einer, der Witzbold der Bande, machte sich über unsere Erbärmlichkeit unter wieherndem Gelächter lustig. »Ein äußerst vornehmes Schiff!« rief er unter anderen ärgerlichen Liebenswürdigkeiten aus, »kein Geld an Bord zu haben!« Ich gebe zu, daß ich sehr verdrossen und sogar beunruhigt war. Das Schiff war offenbar in ihrer Gewalt, wir hatten Frauen an Bord, und ich wußte nichts von meinen Gästen, außer daß sie Menschenfresser waren; unser Reiseführer, aus dem ich mich unterrichtet hatte, enthielt viele besorgniserregende Warnungen, und was den Händler betraf, dessen Anwesenheit mich sonst beruhigt hätte: waren nicht Weiße im Stillen Ozean gewöhnlich die Anstifter und Mitverschwörer bei den Missetaten der Eingeborenen? Wenn unser liebenswürdiger Freund Mr. Regler dies Bekenntnis liest, mag er gern lächeln.
Später am Tage, als ich in meinem Tagebuch schrieb, war die Kajüte bis zum letzten Platz mit Marquesanern angefüllt: drei braunhäutige Generationen saßen mit gekreuzten Beinen auf dem Fußboden und betrachteten mich schweigend mit beängstigenden Blicken. Die Augen aller Polynesier sind groß, leuchtend und wie schmelzend, sie gleichen den Augen von Tieren und manchen Italienern. Eine Art Verzweiflung überfiel mich, ich saß hilflos zwischen diesen mich anstarrenden Wilden und war in meiner Kajütenecke von der schweigenden Horde eingeschlossen: und ich war wütend, daß es keine Möglichkeit gab, sich durch Worte zu verständigen, als wären diese Menschen pelzbedeckte Tiere, taub geboren oder Bewohner eines fernen Planeten.
Für einen zwölfjährigen Knaben bedeutet eine Kanalüberfahrt etwas wie eine Weltreise; dagegen ändert ein Mann von vierundzwanzig Jahren kaum seine Mahlzeiten, wenn er den Atlantik überquert. Aber ich war nun dem Bereich des römischen Reiches entflohen, unter dessen erdrückenden Monumenten unser aller Wiege steht, dessen Gesetze und Geist uns führen, einkapseln und behüten. Ich sah nun, daß es Menschen gibt, deren Väter niemals Virgil gelesen hatten, die niemals von Cäsar bezwungen und von der Weisheit des Gajus oder Papinian regiert wurden. So hatte ich also die angenehmeren Gegenden verlassen, wo verwandte Sprachen geredet und der Fluch des Turmbaus zu Babel leicht überwunden wird, und meine neuen Landsleute saßen vor mir wie stumme Statuen. Ich dachte, alle menschlichen Beziehungen seien auf diesen Reisen ausgeschaltet, und wenn ich heimkehrte – denn in jenen Tagen dachte ich noch an eine Heimreise –, würde es mir vorkommen, als hätte ich in einem Bilderbuch geblättert ohne Text. Ja, ich überlegte, ob ich überhaupt noch weiterreisen könnte, vielleicht war meiner Fahrt ein schnelles Ende beschieden; vielleicht würde mein späterer Freund Kauanui, der mit den übrigen dort schweigend vor mir saß, als Mann von einigem Ansehen plötzlich aufspringen, ein ohrenbetäubendes Signal ausstoßen, die Mannschaft im Nu überrumpeln und die ganze Reisegesellschaft zum Mittagessen schlachten.
Nichts lag näher als diese Befürchtungen, und nichts war unbegründeter. Während meiner gesamten Erfahrungen auf den Inseln war ein Empfang niemals bedrohlicher; würde er mir heute irgendwo bereitet, so würde ich unruhiger und zehnmal überraschter sein. Mit den meisten Polynesiern kommt man leicht in Berührung, sie sind offenherzig, ehrgeizig, sehnen sich nach dem geringsten Zeichen der Zuneigung wie gutartige, schmeichelnde Hunde, und selbst die Marquesaner, die erst vor kurzem und noch nicht vollkommen aus blutiger Barbarei befreit wurden, wollten alle unsere Busenfreunde werden, und einer wenigstens trauerte aufrichtig bei unserer Abreise.
Zweites Kapitel Unsere neuen Freunde
Inhaltsverzeichnis
Das Hindernis des Sprachunterschiedes wurde besonders von mir überschätzt. Die polynesischen Dialekte lernt man leicht radebrechen, wenn es auch schwer ist, sie elegant zu sprechen. Sie sind einander äußerst ähnlich, so daß jemand, der eine Ahnung von einem oder zweien hat, die andern ziemlich hoffnungsvoll in Angriff nehmen darf.
Außerdem stehen Dolmetscher reichlich zur Verfügung. Missionare, Händler und herabgekommene Weiße, die von der Gastfreundschaft der Eingeborenen leben, findet man fast auf jeder Insel und in jedem Dorf; wo sie nicht zur Verfügung stehen, haben die Eingeborenen selbst oft einige Brocken Englisch aufgeschnappt und in der französischen Zone – wenn auch viel seltener – etwas Englisch-Französisch, oder sie verstehen hinreichend Pidginenglisch, das man im Westen »Beach-la-Mar« nennt. Es wird übrigens jetzt in den Schulen Von Hawaii gelehrt, und wegen der großen Anzahl englischer Schiffe und der Nähe der Vereinigten Staaten auf der einen Seite und der englischen Kolonien auf der andern kann man es die Sprache des Pazifischen Ozeans nennen, die es ziemlich sicher einst sein wird. Ich will einige Beispiele anführen. Ich traf in Majuro einen Jungen von den Marschallinseln, der ein ausgezeichnetes Englisch sprach; er hatte es bei einer deutschen Firma in Jaluit gelernt, ohne ein deutsches Wort zu kennen. Ich hörte von einem Gendarmen, der in Rapa-iti unterrichtet hatte, daß die Kinder nur schwer und widerwillig französisch lernten, während sie das Englische spielend und wie von ungefähr aufnahmen. Mein Freund Benjamin Hird fand zu seinem Erstaunen auf einer der entlegensten Atollen in der Karolinengruppe Jungens Kricket spielen und englisch sprechen, und auf englisch unterhielt sich die Mannschaft der »Janet Nicoll«, eine Anzahl Farbiger von verschiedenen melanesischen Inseln, mit anderen Eingeborenen während der ganzen Fahrt, auf englisch wurden die Befehle erteilt und manchmal Witze erzählt auf dem Vorderdeck. Aber wohl am meisten überraschte mich ein Wort, das ich auf der Veranda des Gerichtsgebäudes von Noumea hörte. Man hatte gerade über den Kindesmord einer affenähnlichen Eingeborenen verhandelt, und die Zuhörer erwarteten Zigaretten rauchend das Urteil. Eine besorgte, liebenswürdige Französin ereiferte sich für einen Freispruch, sie war dem Weinen nahe und erklärte, sie wolle die Gefangene als Kindermädchen zu sich nehmen. Die Zuhörer schrien auf bei dieser Zumutung und sagten, das Weib sei eine Wilde, sie spreche keine fremde Sprache. »Aber es ist doch bekannt,« entgegnete die weichherzige Schöne, »daß sie rasch Englisch lernen!«
Jedoch sprechen können zum Volk ist nicht alles. Im Anfang meiner Beziehungen zu Eingeborenen kamen mir zwei Umstände zustatten. Zunächst war ich der Wundermann der »Casco«. Das Schiff, seine feinen Linien, die hohen Masten und schneeweißen Decks, die roten Vorhänge des Speiseraums, das Weiß und Gold und die vielen Spiegel der zierlichen Kajüte brachten uns hunderte Besucher. Die Männer berechneten die Abmessungen mit den Armen, wie ihre Väter die Schiffe Cooks ausgemessen hatten, die Frauen erklärten die Kajüten für schöner als Kirchen, stattliche junonische Gestalten wurden nicht müde, sich in den Sesseln niederzulassen und ihre strahlenden Gesichter im Spiegel zu betrachten, und ich sah eine Dame ihr Gewand hochheben und unter Rufen der Bewunderung und des Entzückens ihre nackten Schenkel an den Samtkissen reiben. Zwieback, Marmelade und Sirup waren Leckerbissen, und das Photographiealbum wanderte wie in europäischen Salons von Hand zu Hand. Diese nüchterne Gemäldegalerie, die alltäglichen Kleider und Gesichter hatten sich während der dreiwöchigen Fahrt in wunderbare, köstliche und fremdartige Dinge verwandelt; fremde Antlitze und barbarische Gewänder wurden nun in der überfüllten Kajüte mit aufrichtiger Erregung und Überraschung angestaunt und betastet. Die Königin von England wurde oft erkannt, und ich sah französische Untertanen ihr Bild küssen; Hauptmann Speedy – in abessinischer Kriegstracht, die für eine Uniform des englischen Heeres gehalten wurde – fand viel Beifall, und das Bildnis des Herrn Andrew Lang erregte Bewunderung auf den Marquesas. Das ist der Platz, wohin er gehen sollte, wenn er Middlesex und Homer satt hat.
Doch vielleicht war es noch wichtiger, daß ich in meiner Jugend unser schottisches Volk im Hochland und auf den Inseln ein wenig kennengelernt hatte. Nicht viel mehr als ein Jahrhundert ist vergangen, seit es ähnliche Umwälzungen und Übergänge erlebt hat wie heute die Marquesaner. In beiden Fällen das Aufdrängen einer fremden Herrschaft, die Entwaffnung der Stämme, die Absetzung der Häuptlinge, die Einführung neuer Sitten und besonders der Gewohnheit, Geld als Existenzmittel und begehrenswert anzusehen. Das Zeitalter des Handels folgte in beiden Fällen unvermittelt einer Periode äußerer Kriege und innerer patriarchalischer Gemeinwirtschaft, hier wurde die liebgewordene Sitte des Tätowierens, dort die Landestracht verboten. In beiden Fällen wurde man des delikatesten Genußmittels beraubt: das Rind, im Schatten der Nacht von den Weiden des Flachlandes gestohlen, wurde dem fleischliebenden Hochländer, und das »Langschwein«, aus den Hütten des Nachbardorfes entführt, dem menschenfressenden Kanaken verwehrt. Murren, heimlicher Aufruhr, Furcht und Mißtrauen, Alarme und plötzliche Versammlungen der marquesanischen Häuptlinge erinnerten mich fortwährend an die Tage von Lovat und Struan. Gastfreundschaft, Takt, natürliche feine Sitten und Empfindlichkeit sind beiden Rassen gleich eigen: gemeinsam ist beiden Sprachen die Eigenart, Zwischenkonsonanten fortzulassen. Ich zähle einige polynesische Wörter auf:
Haus
Liebe
Tahiti:
Fare
Aroha
Neuseeland:
Whare
–
Samoa:
Fale
Talofa
Manihiki:
Fale
Aloha
Hawaii:
Hale
Aloha
Marquesas:
Ha’e
Kaoha
Die Ausstoßung der Zwischenkonsonanten, so bemerkenswert im marquesanischen Dialekt, ist im Gälischen und im schottischen Unterland ebenso häufig. Noch wunderbarer ist es, daß der vorherrschende polynesische Laut, der Hiatus, als Apostroph geschrieben, oft oder immer der Grabstein eines untergegangenen Konsonanten, bis auf den heutigen Tag in Schottland zu hören ist. Spricht der Schotte die Wörterwater, betteroderbottle–wa’er, be’eroderbo’le–, so entspricht der Laut genau dem Hiatus, und ich glaube, man könnte weitergehen und behaupten: Würde ein solches Volk isoliert und der Sprachfehler zur Regel, so wäre das der erste Schritt zum Übergang vom t zum k, der Krankheit aller polynesischen Sprachen.
Das Bestreben der Polynesier ist aber ein Ausrottungskrieg gegen Konsonanten, wenigstens gegen den sehr häufigen Buchstaben l. Ein Hiatus ist angenehmer für jedes polynesische Ohr, selbst das Gehör des Fremden gewöhnt sich an diese barbarischen Lücken, aber nur im Marquesanischen findet man Namen wie Haaii und Paaaena, in denen jeder Vokal gesondert gesprochen werden muß.
Diese Ähnlichkeiten zwischen einem Südseevolk und einem Teil meiner eigenen Stammesbrüder in der Heimat beschäftigten mich viel und machten mich nicht nur geneigt, meine neuen Bekannten mit Wohlwollen zu betrachten, sondern änderten allmählich auch mein Urteil. Ein wohlerzogener Engländer kommt heute zu den Marquesanern und findet die Leute zu seiner Verblüffung tätowiert; ein wohlerzogener Italiener kam vor nicht allzu langer Zeit nach England und fand unsere Vorfahren mit gelbem Pflanzensaft beschmiert, und als ich einen Gegenbesuch machte als kleiner Junge, war ich höchst erstaunt über die Rückschrittlichkeit der Italiener: so unsicher und so abhängig von Zeit und Umständen ist die Überlegenheit einer Rasse. Auf diese Weise lernte ich den Umgang mit den Eingeborenen und empfehle sie allen Reisenden. Wollte ich Einzelheiten wilder Gebräuche und abergläubischer Handlungen erforschen, so blickte ich zurück auf die Gesichter meiner Vorfahren und suchte nach irgendeinem Anhaltspunkte für verwandte Züge der Barbarei: Michael Scott, Lord Derwentwaters Kopf, das zweite Gesicht: alles das waren starke Stücke; die Geschichte vom schwarzen Stier zu Stirling ließ mich die Sage von Rahero begreifen, und meine Kenntnis von den Cluny-Macphersons und den Appin-Stewarts half mir, einzudringen in das Verständnis der Tevas von Tahiti. Der Eingeborene schämte sich nicht mehr, das Gefühl der Vertraulichkeit wurde stärker, und seine Lippen öffneten sich. Dies Gefühl der Vertraulichkeit muß der Reisende wecken und nähren, sonst täte er besser, vom Bett zum Sofa zu reisen. Und die Anwesenheit eines echten Londoner Spötters ist oft Ursache, daß eine ganze Reisegesellschaft in nebelhafter Dunkelheit wandelt.
Das Dorf Anaho steht auf einem Streifen flachen Landes zwischen dem Westufer der Bucht und dem Fuß der hohen Berge. Ein Palmenhain mit ewig rauschenden grünen Fächern überstreut es wie zum Triumph mit fallenden Zweigen und beschattet es gleich einer Laube. Ein Weg läuft von einem Ende des Hains zum andern zwischen Blumenbeeten, den Kleiderläden der Allgemeinheit, und hier und dort, in angenehmem Zwielicht und einer von Wohlgerüchen aller Art geschwängerten Luft, stehen willkürlich verstreut die Häuser der Eingeborenen, noch in Hörweite der Riffbrandung. Dasselbe Wort bezeichnet, wie wir gesehen haben, in vielen Dialekten Polynesiens mit geringen Abweichungen die menschliche Behausung. Aber obgleich das Wort gleich ist, weichen die Bauarten ständig voneinander ab, und der Marquesaner wohnt am behaglichsten, wenn er auch der rückständigste und barbarischste aller Insulaner ist. Die Grashütten von Hawaii, die Vogelkäfighäuser von Tahiti oder der offene Verschlag des gebildeten Samoaners, mit den sonderbaren venetianischen Blenden – sie alle halten den Vergleich nicht aus mit dempaepaehae, der Wohnplattform der Marquesaner. Daspaepaeist eine längliche Terrasse, gebaut aus schwarzem, vulkanischem Gestein ohne Zement, zwanzig bis fünfzig Fuß lang, vier bis acht Fuß über der Erde; eine breite Treppe führt hinauf. An der Rückseite erhebt sich die Wand des vorn offenen Hauses, das einer gedeckten Galerie gleicht und etwa halb so breit ist wie die Plattform. Das Innere ist manchmal hübsch und fast elegant in seiner Kahlheit, der Schlafraum ist abgeteilt durch eine Trennungswand, irgendein buntes Tuch hängt vielleicht an einem Nagel, eine Lampe und eine Mähmaschine sind die einzigen Anzeichen der Zivilisation. Draußen brennt an einem Ende der Terrasse das Herdfeuer unter einem Verschlag, am andern Ende ist manchmal ein Schweinestall. Der restliche Platz gehört der Abendruhe und ist der luftige Speisesaal aller Bewohner. Für manche Häuser wird das Wasser herbeigeschafft von den Bergen, in Bambusrohren, die durchlöchert sind, um es süß zu erhalten. Die Erinnerung an die schottischen Berge im Herzen, dachte ich schaudernd an die feuchten Höhlen aus Torf und Stein, in denen ich geweilt und mich unterhalten hatte – auf den Hebriden und den nördlichen Inseln. Zweierlei, glaube ich, erklärt die Gegensätze: in Schottland ist Holz selten, und das rauhe Material von Torf und Stein schließt jede Hoffnung auf Zierlichkeit aus; und in Schottland ist es kalt. Obdach und Wärme sind so notwendige Lebensbedingungen, daß der Mensch nicht weiterblickt; er ist den ganzen Tag beschäftigt, sich den kärglichsten Unterhalt zu beschaffen, und wenn er abends sagen kann: »Aha, es ist warm!«, wünscht er sich nichts mehr. Aber wenn schon, dann etwas Höheres: feiner Sinn für Poesie und Gesang in diesen rauhen Behausungen und eine Melodie wie die des schottischen Volksliedes »Lochaber no more« ist ein überzeugenderer und unvergänglicherer Beweis der Kultur als ein Palast.
Zu einer solchen Wohnplattform nimmt eine beträchtliche Anzahl von Verwandten und Angehörigen Zuflucht. In der Stunde der Dämmerung, wenn das Feuer flackert, der Duft kochender Brotfrucht die Luft erfüllt und vielleicht die Lampe schon zwischen Pfeilern und Haus glimmt, sieht man Männer, Frauen und Kinder schweigend sich zum Mahle versammeln. Hunde und Schweine drängen sich auf der Treppe, mißgünstig mit den Schwänzen wedelnd. Die Fremden vom Schiff waren bald gleicherweise willkommen: willkommen, ihre Finger in das hölzerne Geschirr zu tauchen, Kokosnüsse auszutrinken, an der herumwandernden Pfeife zu saugen und der hohen Debatte über die Missetaten der Franzosen, den Panamakanal, die geographische Lage von San Franzisko und New Yo’ko zu lauschen oder sich daran zu beteiligen. In einem Hochlanddorf, ganz abseits von Touristenwegen, habe ich dieselbe einfache und würdevolle Gastfreundschaft angetroffen.
Ich habe zwei Dinge erwähnt – das geschmacklose Benehmen unserer ersten Besucher und den Fall der Dame, die sich an den Kissen rieb –, die einen ganz falschen Eindruck von Marquesanersitten geben könnten. Die große Mehrzahl der Polynesier hat ausgezeichnete Manieren, aber die Marquesaner machen eine Ausnahme, sie sind lästig und reizend, wild, scheu und taktvoll zugleich. Macht man ihnen ein Geschenk, so geben sie vor, es zu vergessen, und man muß es ihnen beim Abschied nochmals anbieten: eine entzückende Art, die ich sonst nirgendwo fand. Eine Andeutung genügt, all und jeden zu verabschieden; sie sind erstaunlich stolz und bescheiden, während viele der liebenswürdigeren, aber aufdringlicheren Insulaner sich in Massen an den Fremden herandrängen und schwer zu vertreiben sind wie Fliegen. Eine Entgleisung oder Beleidigung scheint der Marquesaner niemals zu vergessen. Eines Tages unterhielt ich mich am Wegrande mit meinem Freunde Hoka, als ich seine Augen plötzlich aufflammen und seinen Körper sich straffen sah. Ein berittener Weißer kam aus den Bergen, und als er vorüberzog und Grüße mit mir austauschte, starrte Hoka immer noch vor sich hin und zitterte wie ein Kampfhahn. Es war ein Korse, der ihn vor Jahren eincochon sauvage – coçon chauvage, wie Hoka es aussprach – genannt hatte. Es war kaum zu erwarten, daß unsere Gesellschaft von Greenhorns so fein empfindliche Leute nicht unabsichtlich beleidigen würde. Hoka fiel bei einem seiner Besuche plötzlich in brütendes Stillschweigen und verließ gleich darauf das Schiff unter kalten Höflichkeitsbezeigungen. Als ich wieder in seiner Gunst stand, beschwerte er sich geschickt und bestimmt über die Natur meines Vergehens: ich hatte ihn gebeten, mir Kokosnüsse zu verkaufen, und nach Hokas Ansicht soll ein Gentleman Nahrungsmittel verschenken, nicht verkaufen, wenigstens nicht an seinen Freund. Bei anderer Gelegenheit gab ich meiner Bootsmannschaft Schokolade und Zwieback zum Frühstück. Ich hatte mich dabei gegen irgendeinen Punkt der Etikette versündigt, habe aber nie erfahren inwiefern; man dankte mir trocken, aber ließ meine Geschenke am Strande liegen. Jedoch der schlimmste Fehler war unser Benehmen gegen Toma, Hokas Adoptivvater, der sich für den rechtmäßigen Häuptling von Anaho hielt. Zunächst machten wir ihm keinen Besuch, wie es vielleicht unsere Pflicht war, in seinem feinen und neuen europäischen Hause, dem einzigen im Dorf, und dann, als wir an Land gingen, um seinen Widersacher Taipi-Kikino aufzusuchen, sahen wir Toma am Ende des Strandes stehen, eine herrliche Mannesgestalt, herrlich tätowiert, und gerade Toma fragten wir: »Wo ist der Häuptling?« – »Welcher Häuptling?« rief Toma, und wandte den Gotteslästerern den Rücken. Er hat uns nie verziehen. Hoka besuchte und begleitete uns täglich, aber von allen Bewohnern des Landes, glaube ich, waren Toma und sein Weib die einzigen, die nie den Fuß an Bord der »Casco« setzten. Was es hieß, dieser Versuchung zu widerstehen, ist für einen Europäer schwer zu verstehen. Die fliegende Stadt von Laputa für vierzehn Tage in den Londoner St.-James-Park versetzt, ist nur ein schwacher Vergleich mit der vor Anoha ankernden »Casco«, denn der Londoner hat Abwechslung in seinen Vergnügungen, aber der Marquesaner wandert zum Grabe durch eine ununterbrochene Reihe gleichförmiger Tage.
Am Nachmittag vor unserer Abreise kam eine Gruppe Eingeborener an Bord, um Abschied zu nehmen: neun unserer besonderen Freunde, mit Geschenken beladen und festlich gekleidet. Hoka, der beste Tänzer und Sänger, der größte Dandy von Anaho, einer der hübschesten jungen Männer der ganzen Welt – trotzig, eitel, schauspielerhaft, beweglich wie eine Feder und stark wie ein Stier –, war bei dieser Gelegenheit kaum wiederzuerkennen, er saß bedrückt und schweigsam da, das Gesicht ernst und grau. Es war sonderbar, den Jungen so bewegt zu sehen; noch sonderbarer, in seinem Geschenk etwas ganz Außergewöhnliches wiederzuerkennen, was wir am ersten Tage zu kaufen uns geweigert hatten, und dabei zu wissen, daß unser Freund, festlich gekleidet und offensichtlich tief gerührt über den Abschied, einer von denen war, die uns bei unserer Ankunft belagert und beleidigt hatten. Am sonderbarsten aber war es vielleicht, festzustellen, daß dieser geschnitzte Fächergriff die letzte der Kuriositäten des ersten Tages war, die uns inzwischen restlos von den Besitzern geschenkt worden waren: ihre Haupthandelsartikel, mit deren Hilfe sie uns auszuplündern suchten, solange wir uns fremd gegenüberstanden, und die sie uns aufzwangen ohne Gegenleistung, sobald wir Freunde geworden. Der letzte Besuch wurde nicht lange ausgedehnt. Einer nach dem andern reichte uns die Hand und kletterte in sein Kanu. Während Hoka dem Schiffe sofort den Rücken drehte, so daß wir sein Gesicht nicht wiedersahen, blieb Taipi stehen und blickte uns unter weichen Abschiedsgesten an. Als Kapitän Otis die Flagge senkte, grüßte die ganze Gruppe mit ihren Hüten. Das war der Abschied, die Episode unseres Besuches in Anaho wurde als abgeschlossen betrachtet, und obgleich die »Casco« noch ungefähr vierzig Stunden vor Anker blieb, kehrte keiner an Bord zurück, und ich bin geneigt zu glauben, daß sie jedes Erscheinen am Strande vermieden. Diese Zurückhaltung und Würde ist der feinste Charakterzug der Marquesaner.
Drittes Kapitel Der Verbannte
Inhaltsverzeichnis
Über die Schönheiten von Anaho könnte man Bände schreiben. Ich entsinne mich, daß ich um drei Uhr erwachte und die Luft warm und voll Wohlgeruch fand. Lange Dünung stand in der Bucht, schien sie ganz zu erfüllen und dann zurückzuweichen. Weich, tief und stumm rollte die »Casco«, nur manchmal kreischte die Kette wie ein Vogel. Seewärts strahlten die Sterne am Himmel und spiegelten sich im Wasser. Wenn ich dorthin blickte, hätte ich mit dem hawaiischen Dichter singen mögen:
Ua maomao ka lani, ua kahaea luna, Ua pipi ka maka o ka hoku.
(Die Himmel waren lieblich, sie dehnten sich da oben, Zahlreich waren die Augen der Sterne.)
Und dann wandte ich mich landwärts, hohe Wolken waren über meinem Haupt, schwarz türmten sich die Berge, und es war mir, als wäre ich tausend Meilen von hier und läge vor Anker in einer Hochlandsbucht; wenn der Tag anbräche, würde ich Pinien, Heidekraut, grüne Farne und Rauchschwaden aus Torfdächern erblicken; die fremde Sprache, die gleich an mein Ohr schlagen würde, müsse gälisch, nicht kanakisch sein.
Und der Tag, als er kam, brachte andere Gesichte und Gedanken. Ich habe den Morgen anbrechen sehen in vielen Teilen der Welt: sicher eine der größten Freuden meines Daseins, und die Morgendämmerung, die ich mit höchster Bewegung betrachtete, leuchtete über der Bucht von Anaho. Die Berge hingen jäh über dem Hafen in allen erdenklichen Formen und Gestalten, grasbedeckt, zerklüftet und bewaldet, aber jeder besaß eine besondere Tönung von Saffran, Schwefel, Nelken oder Rosen. Der Glanz war wie Seide, die helleren Flecke schienen blütenhaft weich zu zerfließen, die dunkleren waren wie feierliches Erblühen. Das Licht selbst war das gewöhnliche Licht des Morgens, farblos und rein, und zeichnete auf diesem Juwelengrund alle Linien klar ab. Inzwischen verrieten rund um das Dorf unter den Palmen, wo blauer Schatten lagerte, rote Kokosfaserglut und leichte Rauchfahnen die erwachende Geschäftigkeit des Tages; am Strande kehrten Männer und Frauen, Knaben und Mädchen vom Bade zurück in strahlenden Gewändern, rot und blau und grün, wie wir sie entzückt schauten in den bunten kleinen Bilderbüchern unserer Kindheit, und bald darauf hatte die Sonne den östlichen Hügel erklommen, und der Glanz des Tages lag über allem.
Das Leuchten wuchs und mehrte sich, alle Tätigkeit hörte fast auf, ehe sie begonnen hatte. Zweimal am Tage bemerkte man eine gewisse Lebhaftigkeit der Hirten auf den Hügeln an der See. Bisweilen zog ein Kanu aus zum Fischfang. Bisweilen füllten eine oder zwei Frauen schläfrig einen Korb in der Baumwollpflanzung. Bisweilen drang Flötenton aus dem Schatten eines Hauses, spielerisch drei Töne wiederholend, in der Wirkung etwa wie »Que le your me dure«, endlos wiederholt. Oder bisweilen verständigten sich zwei Eingeborene über eine Biegung der Bucht hinweg durch das übliche Pfeifen. Sonst alles Schlaf und Schweigen. Der Gischt brandete und erglänzte rundumher am Ufer, eine Art schwarzer Kraniche fischte im seichten Wasser, die schwarzen Schweine galoppierten fortwährend umher aus irgendeinem Grunde, aber die Menschen hätten nie wieder zu erwachen brauchen oder alle tot sein können.
Mein Lieblingsversteck lag gegenüber dem Dorf, wo eine Landungsstelle war unter dem Hang einer lianenbewachsenen Klippe. Die Bucht war umsäumt von Palmen und einem »purao« genannten Baum, in der Größe zwischen Feige und Maulbeerbaum, mit Blüten wie großer gelber Mohn, in der Mitte ein kastanienbraunes Herz. An manchen Stellen schoben sich die Felsen über den Sand vor, der Strand war hier ganz überflutet, der Gischt spritzte lauwarm bis zu meinen Knien empor und spielte mit Kokosnußschalen, wie unser Ozean daheim mit Wrackstücken, Abfall und Flaschen spielt. Flutete das Wasser zurück, so strömten wunderbar farbige Dinge zwischen meinen Füßen. Griff ich nach ihnen, fehlte oder faßte sie, so hielten sie manchmal, was sie versprachen, waren Muscheln, die ein Museum oder in goldner Fassung die Hand einer Dame zieren konnten; manchmal war es nur farbiger Sand, zusammenklebende Nichtigkeiten, die getrocknet ebenso langweilig und alltäglich waren wie Kiesel auf Gartenwegen. Ich habe mich bei diesem kindischen Vergnügen stundenlang abgemüht unter der heißen Sonne, meiner unverbesserlichen Unwissenheit voll bewußt, aber zu herzhaft fröhlich, um mich zu schämen. Inzwischen flötete die Drossel oder ihre tropische Schwester im Dickicht über meinem Kopf.
Etwas weiter, an der Krümmung der Bucht, murmelte ein Bach unten in einer Grotte und fiel dann über eine Felsentreppe ins Meer. Der Luftzug drang unter dem Laubwerk bis tief in die Grotte vor, ein wahres Paradies der Kühle. Vorn öffnete sie sich auf die blaue Bucht, wo die »Casco« unter ihrem Schutze lag mit ihren fröhlichen Farben. Zu Häupten standen Puraobäume, und darüber wirbelten Palmen ihre glänzenden Fächer, wie ein Zauberer sich aus blanken Schwertern einen Heiligenschein wirkt. Denn hier strömt der Passatwind über den flachen Landstrich am Fuße des Gebirges fast immer mächtig und himmlisch kühl in die Bucht von Anaho.
Eines Tages war ich zufällig mit meiner Frau und dem Schiffskoch in dieser Grotte an Land gegangen. Abgesehen von der »Casco«, die vor uns lag, von ein oder zwei Kranichen und der immer bewegten See und dem Wind, war das Antlitz der Welt von vorgeschichtlicher Leere, das Leben schien stockstill zu stehen, und das Gefühl der Abgeschiedenheit war tief und wohltuend. Plötzlich erfaßte der Passatwind, der in einer Böe über die Landzunge strich, die Fächer der Palme oberhalb der Grotte. Und siehe da! In zwei der Kronen saß ein Eingeborener, bewegungslos wie ein Götzenbild, und beobachtete uns, sozusagen ohne mit der Wimper zu zucken. Im nächsten Augenblick schloß sich der Baum, und das Gesicht war verschwunden. Diese Entdeckung von menschlichen Seelen über unserm Kopf, während wir glaubten, allein zu sein, die Regungslosigkeit unserer Baumspione, und der Gedanke, daß wir vielleicht stets in ähnlicher Weise beobachtet wurden, wirkte ernüchternd. Unser Gespräch stockte, der Koch, dessen Gewissen nicht rein war, setzte nie wieder einen Fuß ans Land, und zweimal, als die »Casco« Gefahr lief, auf die Felsen getrieben zu werden, konnte man lachend den Arbeitseifer des Mannes beobachten, denn er glaubte, der Tod warte am Strande auf ihn. Erst auf den Gilbertinseln, über ein Jahr später, dämmerte mir die Erklärung auf: die Leute hatten Palmwein gezapft, was gesetzlich verboten ist, und als der Wind sie plötzlich verriet, waren sie ohne Zweifel stärker beunruhigt als wir.
Oben in der Schlucht lebte ein alter, melancholischer, grauhaariger Mann namens Tari (Charlie) Sarg. Er war in Oahu auf den Sandwichinseln geboren und in seiner Jugend auf amerikanischen Walfischfängern zur See gegangen, ein Umstand, dem er seinen Namen, sein Englisch, seinen östlichen Dialekt und das Unglück seines schuldlosen Lebens verdankte. Denn ein Kapitän, der von Neubedford aus in See ging, verschleppte ihn nach Nuka-hiva und setzte ihn dort unter den Kannibalen aus. Diese Tat war glatter Mord. Taris Leben muß anfangs an einem Haar gehangen haben. In der Aufregung und dem Schrecken jener Zeit ist er wahrscheinlich irrsinnig geworden, eine Krankheit, an der er noch jetzt litt. Vielleicht hat sich ein Kind in ihn verliebt und um Schonung gebeten. Jedenfalls kam er mit dem Leben davon, heiratete auf der Insel und lebte, als ich ihn kennenlernte, als Witwer mit einem verheirateten Sohn und einer Nichte. Aber die Erinnerung an Oahu verfolgte ihn, sein Lob war stets auf seinen Lippen, er sah es vor sich als Ort ewiger Feste, Gesänge und Tänze, und in seinen Träumen mag er es freudestrahlend besucht haben. Ich möchte wissen, was er empfunden hätte, wenn man ihn wirklich dorthin versetzt und ihm das moderne Honolulu mit seinem lärmenden Verkehr gezeigt hätte, den Palast mit der Wache, das große Hotel und Mr. Bergers Kapelle mit ihren Uniformen und ausländischen Instrumenten; wenn er gesehen hätte, daß die braunen Gesichter so selten und die weißen so zahlreich geworden; daß seines Vaters Land an Zuckerplantagen verkauft und sein Haus völlig verschwunden ist, oder daß vielleicht der Letzte seiner Stammesgenossen leprakrank zwischen Brandung und Klippen auf Molokai gefangengehalten wird. So schnell und so traurig ändert sich das Dasein, auch auf den Südseeinseln.
Tari war arm und wohnte elend. Sein Haus war ein Holzgerüst, von Europäern zusammengezimmert; es war tatsächlich eine Amtswohnung, denn Tari war der Schafhirt des Vorgebirges. Ich kann ein vollständiges Inventar der Hütte geben: drei Bottiche, eine Blechdose, eine eiserne Pfanne, mehrere Näpfe aus Kokosschalen, eine Laterne und drei Flaschen, die wahrscheinlich Öl enthielten, während die Kleider der Familie und ein paar Matten über die freistehenden Balken geworfen waren. Gleich beim ersten Zusammentreffen brachte der Verbannte mir Inselfreundschaft entgegen, die ohne ersichtliche Gründe entsteht, gab mir Kokosmilch zu trinken und trug mich die Schlucht hinauf, um sein Haus zu besichtigen: das einzige Gastgeschenk, das er zu bieten hatte. Er liebte den »Amelican« und den »Inglisman«, aber der »Flesman« war ihm ein Abscheu, und er erklärte uns eifrig, daß wir als »Fles«, Franzosen, seine Nüsse nicht erhalten und sein Haus nicht zu Gesicht bekommen hätten. Seinen Haß gegen die Franzosen kann ich einigermaßen verstehen, aber seine Vorliebe für die Angelsachsen keineswegs. Am folgenden Tag brachte er mir ein Schwein, und einige Tage später traf einer von uns ihn auf dem Wege, ein zweites zu bringen. Wir waren noch fremd auf den Inseln und peinlich berührt durch die Freigebigkeit des armen Menschen, die er sich schlecht leisten konnte, und machten den verständlichen, aber unverzeihlichen Fehler, das Schwein zurückzuweisen. Wäre Tari ein Marquesaner gewesen, so hätten wir ihn nie wiedergesehen, da er aber jener höchst sanfte, leidgequälte, melancholische Mann war, nahm er eine viel empfindlichere Rache. Kaum hatte das Kanu mit den neun abschiednehmenden Dorfbewohnern die »Casco« verlassen, als das Schiff von der andern Seite bestiegen wurde. Es war Tari, der so spät kam, weil er kein eigenes Kanu besaß und sich nur unter Schwierigkeiten eins borgen konnte, und allein, wie wir ihn immer sahen – weil er ein Fremdling war im Lande und der langweiligste Gesellschafter. Meine ganze Familie floh vor dem Zusammensein mit ihm, und ich mußte unseren beleidigten Freund allein empfangen. Die Unterhaltung muß beinahe eine Stunde gedauert haben, denn es war ihm unmöglich, sich loszureißen. »Du gehen weg. Ich sehen dich nicht mehr – nein, Herr!« klagte er; und dann rief er, indem er mit schmerzlicher Bewunderung um sich blickte: »Dies guter Schiff – nein Herr! – guter Schiff!« Das »Nein, Herr!« stieß er scharf durch die Nase heraus unter starker Betonung, eine Erinnerung an New Bedford und den verruchten Walfischfänger. Von diesen Bezeugungen der Trauer und des Lobes kam er sofort zurück auf das zurückgewiesene Schwein. »Ich lieben schenken wie du,« beklagte er sich, »ich nur haben Schwein, du ihn nicht nehmen!« Er sei ein armer Mann, er könne die Geschenke nicht auswählen, er habe nur ein Schwein, wiederholte er, und ich habe es zurückgewiesen! Ich bin selten bedrückter gewesen, als da ich ihn so vor mir sitzen sah, alt, grau, hart geprüft, schmerzlich bewegt, und die Beleidigung immer deutlicher begriff, die ich ihm unschuldigerweise zugefügt hatte, aber es war einer jener Fälle, denen gegenüber die Sprache versagt.
Taris Sohn war heiter und lebhaft, seine Schwiegertochter – ein Mädel von sechzehn Jahren, hübsch, höflich und ernst, klüger als die meisten Frauen von Anaho – besaß leidliche französische Sprachkenntnisse, sein Enkelkind war ein winziges Geschöpfchen an ihrer Brust. Ich stieg eines Tages die Schlucht hinauf, als Tari nicht zu Hause war, und fand den Sohn bei der Arbeit, einen Sack aus Baumwolle zu knüpfen; seine Frau nährte das Kindlein. Als ich mit ihnen auf dem Fußboden saß, fragte mich das Mädchen über England aus, das ich zu beschreiben versuchte, indem ich die Pfanne und die Kokosschalen aufeinandertürmte, um Häuser darzustellen. Ich erzählte ihnen, so gut es möglich war, durch Worte und Gesten, von der Übervölkerung, dem Hunger und der ewigen Arbeitshast. »Pas de cocotiers? pas de popoi?« fragte sie. Ich erzählte ihr, es sei dort zu kalt, und suchte es ihr durch allerlei Mimik klarzumachen, indem ich so tat, als ob ich die Zugluft absperrte und mich über ein Phantasiefeuer beugte, damit sie mich verstände. Aber sie begriff mich sofort, sagte, das müsse schlimm sein für die Gesundheit, und saß eine Weile in ernstes Nachsinnen versunken über diese traurigen Zustände. Ich bin sicher, daß ihr Mitleid sich regte, denn ein anderer Gedanke, der stets in jeder marquesanischen Brust herrscht, regte sich in ihr. Mit traurigem Lächeln sah sie mich aus melancholischen Augen an und beklagte den Verfall ihres eigenen Volkes. »Ici pas de Canaques«, sagte sie, und reichte mir das Baby von ihrer Brust mit beiden Händen her. »Tenez– ein winziges Baby wie dies und dann tot. Alle Kanaken sterben. Dann keine mehr.« Das Lächeln und die Art, mit der diese jugendliche Mutter ihr eigenes überzartes Fleisch und Blut als lebenden Beweis darbot, berührte mich sonderbar: beides bewies stille Verzweiflung. Inzwischen arbeitete der Gatte lächelnd an seinem Sack, und das nichtsahnende Kindlein griff kriechend nach einem Topf mit Himbeermarmelade, den ich als Freundschaftsgabe soeben die Schlucht heraufgetragen hatte. Und im Ausblick auf die Jahrhunderte sah ich ihr Schicksal als das unsere, ich sah den Tod wie eine Flutwelle herankommen, den Tag schon bestimmt, da es kein »Beretani« mehr geben würde, überhaupt niemand mehr von irgendeiner Rasse und – was mich besonders anging – keine Literatur mehr und keine Leser.
Viertes Kapitel Tod
Inhaltsverzeichnis
Der Gedanke an den Tod beherrscht, wie gesagt, die Seele der Marquesaner. Es wäre sonderbar, wenn es anders wäre. Die Rasse ist vielleicht die schönste auf Erden. Sechs Fuß ist die mittlere Größe der Männer, sie haben starke Muskeln, kein Fett, sind flink in der Bewegung, graziös in der Ruhe; und die Frauen, obwohl dicker und langweiliger, sind doch edle Tiere. Dem Augenschein nach gibt es keine lebenstüchtigere Rasse, und doch hält der Tod seine Ernte mit beiden Händen. Als Bischof Dordillan zum erstenmal nach Tai-o-hae kam, schätzte er die Eingeborenen auf mehrere Tausend, aber gleich nach seinem Tode zählte Stanislao Moanatini in derselben Bucht acht seßhafte Insulaner. Oder man nehme das Tal von Hapaa, das den Lesern von Herman Melville unter der grotesk falschen Bezeichnung Hapar bekannt ist. Es gibt nur zwei Schriftsteller, die einigermaßen klug über die Südsee geschrieben haben: Melville und Charles Warren Stoddard, und bei der Taufe des ersten und größten müssen einige einflußreiche Feen schlecht behandelt worden sein. »Er soll sehen können, er soll erzählen können, er soll entzücken können,« sagten die freundlichen Patinnen, »aber er soll nicht hören können!« rief die letzte aus. Der Stamm der Hapaa soll vierhundert Seelen gezählt haben, als die Blattern kamen und ihn um ein Viertel verkleinerten. Sechs Monate später wurde eine Frau tuberkulös, und in weniger als einem Jahr flohen die letzten beiden Überlebenden, ein Mann und eine Frau, aus der plötzlich entstandenen Einsamkeit. Ein ähnliches Paar wird vielleicht eines Tages unter neuen Rassen dahinsiechen als tragisches Überbleibsel der Großbritannier. Als ich diese Geschichte zuerst hörte, machten mich die Zeitangaben stutzig, aber ich bin jetzt geneigt, sie für richtig zu halten. Zu Anfang meines Besuches zum Beispiel, oder im Spätjahr vorher, tauchte ein Fall von Phthisis in einer Hausgemeinschaft von siebzehn Personen auf, und im August, als man mir davon berichtete, lebte nur noch ein Knabe, der auf einer auswärtigen Schule gewesen war. Die Entvölkerung hat zwei Ursachen: die Tore des Todes stehen weit offen, und die Tore der Geburten sind fast geschlossen. So verzeichnete man im ersten Halbjahr 1888 zwölf Todesfälle und nur eine Geburt im Distrikt von Hatiheu. Sieben oder acht weitere Todesfälle waren nach menschlichem Ermessen noch zu erwarten, und Mr. Aussel, der diensthabende Gendarm, wußte nur von einer bevorstehenden Geburt. Unter solchen Umständen ist die Abnahme der Bevölkerung von sechshundert auf vierhundert im Laufe von vierzig Jahren nicht verwunderlich, Ziffern, die nach den Angaben von Mr. Aussel richtig geschätzt sind. Und das Tempo des Verfalls muß sich zum Schluß noch vergrößert haben.
Auf dem Landwege von Anaho nach Hatiheu an der nächsten Bucht kann man sich von der Entvölkerung ein richtiges Bild machen. Der Weg ist gut gangbar, aber grausam steil. Wir schienen an dem verlassenen höchsten Haus von Anaho soeben erst vorüber zu sein, als wir auch schon erstaunt auf das Dach blickten; die »Casco«, weit draußen in der Bucht, stark rollend, schrumpfte sichtbar zusammen, und bald sah man Ua-huna durch ein Loch der Landzunge von Tari wie eine Wolke am Horizont schweben. Jenseits des Gipfels, wo der Wind sehr kalt wehte, durch die schilfartigen Gräser pfiff und den Grasbehang des Pandanus zerzauste, gelangten wir plötzlich wie durch ein Tor in das nächste Tal und zur Bucht von Hatiheu. Ein Gebirgsmassiv umschließt das Tal von drei Seiten. Auf der vierten ist dies Bollwerk zersprengt zu Ruinen, stürzt abwärts zur See in steilen und zerklüfteten Felsblöcken und bildet so die einzige wegbare Bresche zu der blauen Bucht. Das Innere dieses Tales ist dicht bewachsen mit lieblichen und wertvollen Bäumen: Orangen, Brotfrucht, Mumienäpfeln, Kokospalmen, der Inselwallnuß und, an Stelle von Unkraut, mit Pinien und Bananen. Vier nie versiegende Flüsse halten es feucht und grün, und an den Ufern des einen und dann des andern führt der Weg ziemlich weit hinab in dies glückliche Tal. Der Sang der Wasser und der vertraute Anblick zerstreuter Felsblöcke erinnerte uns lebhaft an die Heimat, aber der Eindruck wurde, ehe wir ihn recht genossen, wieder zerstört durch das tropische Laubwerk, den sonderbaren Wuchs des Pandanus, die Säulenstämme der Banyan, die im Busch galoppierenden schwarzen Schweine und die Architektur der Eingeborenenhäuser.
Die Häuser auf der Hatiheuseite begannen hoch oben, noch höher aber der traurige Anblick verlassener Plattformen. Wenn ein Eingeborenenhaus leer steht, verrottet der Oberbau – Pandanusstroh, Bast, wenig haltbares tropisches Holz – sehr rasch und wird durch den Wind zerstreut. Nur die Steine der Terrasse bleiben, und keine Ruine, kein Grab, kein ragender Fels und keine zerstörte Festung kann ein traurigeres Bild des Alters darbieten. Wir müssen an sechs bis acht solcher häuserloser Plattformen vorübergekommen sein. An der Hauptstraße der Insel, wo sie das Tal von Taipi durchquert, sollen sie, wie mir Mr. Osbourne erzählt, zu Dutzenden stehen, und da die Straßen lange nach dem Bau der Häuser angelegt wurden, vielleicht sogar nach der Räumung, und einfach als Linien anzusehen sind, die willkürlich durch den Busch laufen, so muß der Wald zu beiden Seiten mit diesen Überbleibseln angefüllt sein: Grabdenkmälern ganzer Familien. Solche Ruinen sind streng tabu, kein Eingeborener darf sich ihnen nähern, sie sind zu Schildwachen des Königreiches der Gräber geworden. Es könnte scheinen, als ob es sich um eine natürliche und fromme Sitte der Hunderte handelte, die von untergegangenen Tausenden übrigblieben, sie wollten den Herd der Vorfahren nicht mit Füßen treten. Ich glaube jedoch, daß die Sitte auf anderen und düstereren Vorstellungen beruht. Haus, Grab und selbst der Körper des Toten wurden von den Marquesanern stets besonders geehrt. Bis vor einiger Zeit wurde ein Leichnam bisweilen von der Familie aufbewahrt und täglich eingeölt und gesonnt, bis er allmählich nach vielen Unannehmlichkeiten zu einer Art Mumie eintrocknete. Opfergaben werden noch heute auf die Gräber gelegt. In der Verräterbucht sah Mr. Osbourne einen Mann einen Spiegel kaufen und auf das Grab seines Sohnes legen. Und der Abscheu gegen die Entweihung der Grabstätten, die bei der Anlage neuer Wege gedankenlos zerstört wurden, ist einer der Hauptgründe für den Haß der Eingeborenen gegen die Franzosen.





























