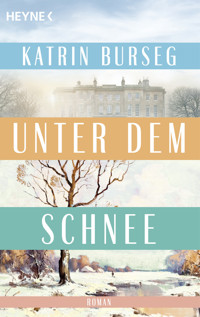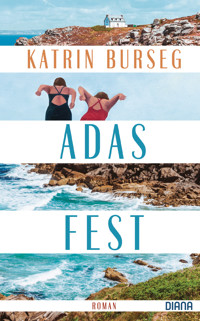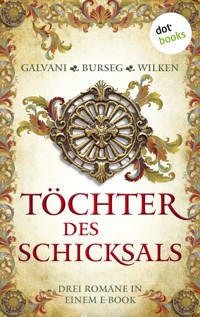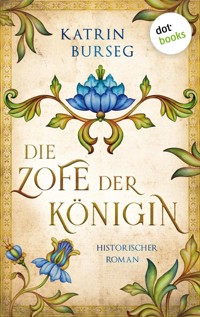9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Fragen Sie Dorothea nach Marguerite." Miriam bekommt anonyme Briefe mit nur diesem Satz geschickt. Dorothea Sartorius ist die charismatische Witwe eines Reeders und eine große Mäzenin in Hamburg. Gemeinsam mit ihr bereitet Miriam gerade die Verleihung des Sartorius-Preises für Zivilcourage vor. Dorothea beantwortet Miriams Frage nicht, ermuntert sie aber, nach dem Absender der Briefe zu suchen. In einem Beginenhof an der Schlei findet Miriam eine alte Bewohnerin und Antworten, die ihr Weltbild ins Wanken bringen. Dorothea war in den 70er Jahren Mitglied in einer linksextremen Terrorgruppe. Die frühere Freundin und politische Weggefährtin von Dorothea erhebt schwere Anklage: "Sie hat uns verraten. Sie hat alles verraten, was ihr heilig war." Katrin Burseg erzählt von Liebe und Verrat, von Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und von der Herausforderung, authentisch zu leben. "In einm anderen Licht" ist ein lebendiges Porträt einer Frau vor dem historischen Hintergrund des deutschen Herbstes. "Ein ungewöhnlicher und spannender Roman, an dem mir vieles gefallen hat" Rainer Moritz, Literaturhaus Hamburg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
»Fragen Sie Dorothea nach Marguerite.« Miriam bekommt Briefe mit nur diesem Satz geschickt. Dorothea Sartorius ist die charismatische Witwe eines Reeders und eine große Mäzenin in Hamburg. Gemeinsam mit ihr bereitet Miriam gerade die Verleihung des Sartorius- Preises für Zivilcourage vor. Dorothea beantwortet ihre Fragen nicht, ermuntert sie aber, nach der Absenderin zu suchen. In einem Damenstift an der Schlei findet Miriam beklemmende Antworten, die ihr Weltbild ins Wanken bringen. War Dorothea eine kaltblütige Terroristin? Eine frühere politische Weggefährtin erhebt schwere Anklage: »Sie hat uns verraten. Sie hat alles verraten, was ihr heilig war.« Katrin Burseg erzählt von Liebe und Verrat, von Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und von der Herausforderung, authentisch zu leben.
Die Autorin
Katrin Burseg, geboren 1971 in Hamburg, studierte Kunstgeschichte und Literatur in Kiel und Rom, bevor sie als Journalistin arbeitete. Sie hat mehrere historische Romane veröffentlicht. Für ihren Roman Liebe ist ein Haus mit vielen Zimmern wurde sie 2016 mit dem DELIA-Literaturpreis ausgezeichnet. Hamburg ist ihr Sehnsuchtsort, sie lebt mit ihrer Familie im Herzen der Stadt.
www.katrinburseg.de
Katrin Burseg
IN EINEM ANDEREN LICHT
Roman
List
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1626-0
© 2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, MünchenUmschlagabbildung: © Getty Images
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
»Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst man den anderen Satz, dass vorwärts gelebt werden muss.«
Søren Aabye Kierkegaard
EINS
Gregors letztes Bild war heiter. Das Porträt eines jesidischen Mädchens, fremde grüne Augen, Lichtblitze darin, und ein neugieriges Lächeln auf den Lippen. Es spiegelte Hoffnung und den Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Vertreibung, Gewalt und Angst sah man darin nicht. Lediglich Armut, die Not zeigte sich in dem zerschlissenen rostfarbenen Tuch, das dem Mädchen über Haar und Schulter fiel. Der Umhang und das Spiel von Licht und Schatten verliehen ihm die Aura einer Madonna.
Eine heitere Madonna – und ein Bild für die Ewigkeit. Es nutzte sich nicht ab. Zärtlich strich Miriam mit den Fingerspitzen über das Foto. Sie trug es immer bei sich, in ihrem schwarzen Notizbuch, und manchmal wünschte sie sich, mehr über dieses Mädchen erfahren zu können. Antworten zu finden auf all die Fragen, die sie immer noch quälten.
Vielleicht hätte Gregor ihr etwas über dieses Mädchen erzählen können, so wie er es oft nach seinen Reisen getan hatte. Nachts, flüsternd, wenn er sie in seinen Armen hielt und sie seinen warmen Geruch in sich aufsog. Wenn ihr Atem ruhig floss und sie sich im schützenden Kokon seiner Liebe eingesponnen hatte.
Doch Gregor war tot.
Kurz nachdem er die Aufnahme in einem Dorf in der Sindschar-Ebene gemacht hatte, war er ums Leben gekommen. Ein Querschläger, mitten ins Herz. Die Kugel aus der Kalaschnikow eines Dschihad-Kämpfers hatte eigentlich den vorausfahrenden UN-Botschafter treffen sollen. Ein irrwitziger Zufall, das Zusammenspiel erklärbarer und nicht erklärbarer Kräfte, hatte das Geschoss abgelenkt und ihren Mann getroffen. Gregor Raven, zweiundvierzig Jahre alt, Fotojournalist aus Hamburg, kriegserfahren und trotzdem nicht abgebrüht. Kein Hasardeur und auch kein Held. Jede seiner Reisen in die Krisengebiete der Welt war der Suche nach Wahrheit verpflichtet. Er hatte den einen Augenblick gesucht, der Augen öffnen konnte. Dieses eine Mal war er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.
Die Nachricht von seinem Tod hatte Miriam in der Redaktion des Hamburger Nachrichtenmagazins erreicht, für das sie beide arbeiteten. Wenig später war die Meldung schon online. Der Tod des Geliebten als Aufmacher, ein unbarmherziges Flackern auf den Bildschirmen im Newsroom. Auch heute noch, fast zwei Jahre später, fanden sich die Bilder und Artikel im Netz, sie musste nur Gregors Namen eingeben.
Miriam wischte sich über die Augen. Sie saß an ihrem Schreibtisch in der Redaktion, nun schaute sie auf und blickte aus dem Fenster. Der Märzhimmel war milchig-grau, ein Tiefdrucksumpf, der noch über der Nordsee festhing und Regen bringen würde, kündigte sich an. Fröstelnd kuschelte sie sich in ihren Schal und nahm einen Schluck Tee, dann steckte sie das Foto mit dem Mädchen in ihr Notizbuch zurück.
Es gab keine Antworten mehr.
Nur noch Fragen.
Quälende bohrende Fragen.
Und den Schmerz, der schwarz und schwer wie ein Krähenvogel in ihrer Brust hockte.
Der Rabe ihrer Trauer.
Er war ihr ständiger Begleiter. Mal zurückhaltend und mahnend, mal fordernd und laut.
Miriam konnte ihn spüren, er spreizte sich und trippelte unter ihren Rippenbögen auf und ab. Sie nickte dem Raben zu, bevor ihr Blick die gelben Kisten streifte, die sich in ihrem Büro stapelten. Sie wartete auf die Post, auf etwas, das sie davon abhielt, sich ganz auf die Traurigkeit einzulassen. Und auf die Zweifel.
Früher hatte sie nie an ihrem Beruf gezweifelt. Sie war Journalistin geworden, weil sie über die Welt, so wie sie war, berichten wollte. Das Schreiben war etwas Lebensnotwendiges gewesen, so wie Atmen. Und Lachen.
Doch Gregors Tod hatte alles verändert.
Sie war an ihre Grenzen gelangt – und darüber hinaus. Schock, Betäubung, Zusammenbruch. Dass sie heute wieder arbeiten konnte, verdankte sie nicht nur der Liebe zu Max, ihrem Sohn, sondern auch der Therapie, die sie ein halbes Jahr nach dem Unglück begonnen hatte. Die Trauerbegleitung hatte ihr wieder Hoffnung und Lebensmut schenken können. In der Therapie hatte sie Gregors Madonna das erste Mal anschauen können, ohne in Tränen auszubrechen. Sie hatte sich ihrer Trauer gestellt.
Nur nicht unterkriegen lassen!
Die Aufnahme, drei mal zwei Meter, hing auch in der Redaktion des Globus. Doch dort war sie seit ihrem Zusammenbruch nicht mehr gewesen. Zu viele Erinnerungen begegneten ihr in den Räumen, zu viele Anlässe, um in die Vergangenheit zu driften, zu viele Spuren des Glücks. Der Verlag hatte ihr jedoch ermöglicht, zur Anabel zu wechseln. Die Frauenzeitschrift saß im selben Gebäude an der Elbe und war ein anspruchsvolles Magazin mit treuen Leserinnen. Ehrlich, berührend und an der Welt interessiert. Reportagen, Kultur, Gesundheit, ein paar Rezepte und Mode – fünfter Stock statt des Panoramadecks des deutschen Journalismus. An ihrem ersten Tag im neuen Job hatten die Kollegen ihr einen riesigen Strauß Rosen aus dem Alten Land auf den Tisch gestellt, und aus der Versuchsküche der Anabel kam mitten im Sommer ein Teller mit Weihnachtskeksen. Sie hatten es ihr leichtgemacht, sich nicht fremd zu fühlen. Und nach und nach verlor auch der Bildschirm seinen Schrecken.
Miriam zögerte kurz, dann fuhr sie endlich ihren Computer hoch. Als das Handy neben ihr summte und eine SMS für einen neuen Tarif und noch mehr Freiminuten warb, schaltete sie es auf stumm.
Gregor – wieder flatterte ihr Herz. Es gab Tage, da fuhr sie summend aus der Redaktion nach Hause. Irgendein Song aus dem Autoradio verführte sie dazu, und im Rückspiegel sah sie ihr altes optimistisches Ich hinter der Wimperntusche aufblitzen. Und an den weniger guten rief sie ihn einfach an. Gregors Kamera und Mobiltelefon hatten den Anschlag unbeschadet überstanden, der Botschafter hatte ihr die Ausrüstung mit einem Beileidsschreiben zugesandt.
Miriam hatte es nicht geschafft, Gregors Handyvertrag zu kündigen. Seine Stimme auf der Mailbox war die letzte sinnliche Verbindung zu ihm, denn sein Geruch war längst aus den wenigen Kleidungsstücken verflogen, die sie noch von ihm aufbewahrte. Manchmal sprach sie ihm etwas auf die Mailbox, manchmal legte sie einfach wieder auf. Ihr Therapeut hatte von einem Trauerritual gesprochen. Miriam schaute auf ihr Handy. Trotzig dachte sie, dass sie wenigstens nicht klaute oder vierzig Kilo Kummerspeck mit sich herumtrug, so wie einige der anderen, die sie in der Therapie kennengelernt hatte. Sie bezahlte lediglich für das Handy eines Toten.
Dann kam die Post, Miriam atmete erleichtert auf. Der Einsendeschluss für den Sartorius-Preis rückte näher. Gemeinsam mit der Anabel verlieh Dorothea Sartorius, vermögende Reederswitwe und großzügige Stifterin, in diesem Jahr zum ersten Mal einen Preis für Zivilcourage. Sie hatte fünfundzwanzigtausend Euro ausgelobt, für die Preisverleihung im Mai war das Schauspielhaus angemietet worden, Prominenz aus Politik und Gesellschaft wurde zur Matinee erwartet. In Miriams Büro stapelten sich die Bewerbungen, die in dicken braunen Umschlägen eintrafen. Doch dieser Brief gehörte nicht dazu, dafür war er zu leicht.
Ein Spinner, dachte sie sofort, als sie den Umschlag betrachtete. Ein Standardformat, weiß und ausreichend frankiert. Die Briefmarke war ordentlich in die rechte obere Ecke gesetzt, im Adressfeld stach die saubere und irgendwie soldatisch anmutende Handschrift hervor. Unter die Anschrift war ein resoluter Strich aus schwarzer Tinte gezogen worden, einen Absender gab es nicht.
Beim Globus hatte es einen Redakteur für diese Art von Post gegeben, und bisweilen war einem anonymen Tipp sogar eine Titelgeschichte gefolgt. Bei der Anabel jedoch gab es niemanden für die Anonymen. Im Gegenteil: Die meisten Leserinnen bedankten sich für die unterhaltsame Mischung aus sorgfältig recherchierten Reportagen, inspirierenden Dossiers und tragbaren Modetrends. Sie waren Teil der Anabel-Familie, verteilten Komplimente und denunzierten nicht.
Kurz überlegte Miriam, ob es sich überhaupt lohne, den Brief zu öffnen. Dann riss sie entschlossen den Umschlag auf, zog den Bogen heraus und faltete ihn auseinander. »Fragen Sie Dorothea nach Marguerite!«, stand auf dem Papier, die Schrift etwas weicher als auf dem Umschlag, das Ausrufungszeichen wie eine Ermahnung. Und dann doch noch so etwas wie ein Absender: »Elisabeth«, las Miriam, das E großzügig geschwungen, das T und H am Ende fast wie ein Liebespaar umschlungen.
Dorothea Sartorius also. Miriam legte den Bogen vor sich auf den Tisch und lehnte sich zurück. Sie war schon seit mehr als einem halben Jahr mit der Preisverleihung beschäftigt. Als die Chefredakteurin mit der Idee zu ihr gekommen war, hatte sie sofort ja gesagt, obwohl das Projekt eher organisatorischen Charakter hatte. Es ging Miriam um die Sache und um ein Dankeschön an die Frau, die auch ihr geholfen hatte. Doch davon wusste Dorothea Sartorius nichts. Mit der Sartorius-Stiftung, die sie vor fast zwanzig Jahren gegründet hatte, half sie jedes Jahr mehreren Hundert Menschen, nach einem Trauerfall wieder ins Leben zurückzufinden. Darüber hinaus spendete sie für Museen und Mittagstische, Flüchtlingsinitiativen und Frauenhäuser. Ihre Schatulle war reich gefüllt, und ihr soziales und kulturelles Engagement hatte ihr diverse Auszeichnungen und Beinamen eingetragen. »Die Lady mit dem Löwenherzen«, so hatte etwa der Globus die Zweiundsiebzigjährige einmal in einem Artikel bezeichnet. Sie war Ehrenbürgerin der Stadt, wie es auch ihr Mann gewesen war.
Dorothea Sartorius als Schirmherrin für den Preis zu gewinnen war ein Scoop gewesen und dem guten Ruf der Anabel zu verdanken, die schon mehrmals Prominente für Aktionen und Kampagnen hatte begeistern können. Doch die Organisation der Preisverleihung verlief zäh. So präsent Dorothea Sartorius’ Geld im öffentlichen Leben der Stadt war, so zurückgezogen lebte die Stifterin privat. Es gab ein riesiges Anwesen an der Elbe, eine private Kunstsammlung und ein paar verschwiegene Angestellte. Ein effizienter Sekretär koordinierte ihre Termine und schirmte sie gleichzeitig ab. Die Sartorius kam nicht zu Charity-Events, und sie verabscheute das Blitzlichtgewitter am roten Teppich. Wenn sie irgendwo erschien, dann hatte sie ein Anliegen und ihr Auftritt hatte den Charakter einer Audienz. Mit der Mäzenin persönlich zu sprechen war in etwa so einfach wie ein Besuch im Weißen Haus.
Miriam hatte viel Zeit damit verbracht, nach Informationen für einen Artikel über Dorothea Sartorius’ Leben zu recherchieren, der parallel zur Preisverleihung in der Anabel erscheinen sollte. Doch auch sie war nicht über die spärlichen Fakten hinausgekommen, die man auf der Website der Stiftung nachlesen konnte: Geburtsjahr, Ausbildung, Ehe, Stiftungsgründung, Motivation. Wenig mehr als biographische Notizen. Miriam hatte auch mit Leuten gesprochen, die die Stifterin kannten oder behaupteten, sie zu kennen. So hatte sie immerhin erfahren, dass die Mäzenin Klavier spielte und Schwimmen liebte. Dass sie einen Hund besaß und einen Oldtimer fuhr. Das wildeste Gerücht, das Miriam zu Ohren gekommen war, raunte von einer Liebesnacht mit Mick Jagger, kurz vor der Ehe mit Peter Sartorius. Als nahezu sicher hingegen galt, dass die Stifterin einige Jahre nach dem Tod ihres Mannes eine Zeitlang mit dem Hamburger Bürgermeister liiert gewesen war. Viel mehr gab es nicht, noch nicht einmal Kinder. Dorothea Sartorius, so dachte Miriam nun, war einfach eine sehr reiche, sehr großherzige und sehr diskrete Frau.
Aber wem passte das nicht? Miriam schlug die Beine übereinander, nahm den Brief wieder zur Hand und überflog ihn noch einmal. »Fragen Sie Dorothea nach Marguerite!«
Marguerite – der Name einer Schriftstellerin fiel ihr ein und dann, natürlich, das französische Wort für Margeriten. Auch eine schnelle Internetsuche ergab nicht viel mehr: ein Vorname, eine Sommerblume, ein afrikanischer Berg. Miriam schüttelte den Kopf. Was wollte die Verfasserin des Briefes damit andeuten?
Nachdenklich ließ sie den Blick durch die Glastür ihres Büros wandern, ihre Füße begannen zu wippen. Die Architekten des Verlagshauses hatten auf Transparenz gesetzt, und so reihten sich die einzelnen Büros der Redaktion wie Glaskästen aneinander. Im Büro gegenüber telefonierte Chefredakteurin Anna Bartok, sie strahlte, als wäre sie frisch verliebt. Die Fensterfront ihres großzügigen Eckbüros gab den Blick frei auf ein Stück Hafenpanorama samt Containerterminal. Am Burchardkai auf der anderen Seite der Elbe sah Miriam die Containerbrücken hin- und hergleiten. Riesige blaue Krakenarme, die mühelos die schwere Ladung an Land hievten. Es sah fast so aus, als ob die Kräne Bauklötze übereinanderstapelten, dabei waren die Stahlboxen so groß wie Eisenbahnwaggons.
Miriams Blick blieb an den Kränen hängen. Nach dem Krieg hatte Peter Sartorius sein Geld mit einer Flotte von Fracht- und später dann mit Containerschiffen gemacht. Als Wirtschaftssenator hatte er sich kurz der Politik angedient, bevor er Präsident des Deutschen Reederverbandes geworden war. Dorothea lernte er Anfang der Siebzigerjahre kennen, da waren bereits zwei seiner Ehen gescheitert. Der Presse gegenüber hatte er Dorothea, fast dreißig Jahre jünger als er selbst, einmal als Geschenk bezeichnet. Bei der Trauerfeier für den angesehenen Senator im Hamburger Michel war seine Frau zusammengebrochen. Ein halbes Jahr später hatte sie mit dem größten Teil des riesigen Vermögens die Sartorius-Stiftung gegründet. Die Trauerbegleitung war ihr erstes großes Herzensprojekt gewesen.
Fragen Sie Dorothea nach Marguerite!
Miriam schüttelte den Kopf und trank noch einen Schluck Tee. Als sich die Tür zu ihrem Büro öffnete, zuckte sie zusammen.
»Alles klar?« Anna Bartok kam herein und schloss die Tür hinter sich. Groß und schlank, in petrolblauer Seidenbluse und Wildlederrock, war sie ein Hingucker, eine gutgelaunte Mischung aus Femme fatale und bester Freundin. Das lange Honighaar, das sie grundsätzlich offen trug, verlieh ihr etwas Mädchenhaftes, obwohl sie schon in den Vierzigern war. »Bella Anna«, so hieß sie im Verlag, und sie verkörperte die Anabel nahezu perfekt. Miriam mochte ihre geradlinige und unaufgeregte Art, die Redaktion zu führen. Und sie bewunderte ihren sicheren Geschmack. Kurz überlegte sie, wie sie selbst in einem Wildlederrock wohl aussehen würde. Wie ein Sofakissen?
Anna wies auf den Brief in Miriams Hand. »Schlechte Nachrichten?«
»Nein, nein«, Miriam faltete den Bogen wieder zusammen. »Gar keine Nachricht, das ist Müll.« Sie zerriss den Brief und ließ die Papierfetzen demonstrativ in den Abfallkorb rieseln. »Irgendjemand, der mit unserer Preisverleihung nicht klarkommt.«
»Anonym?«
»Ja.«
»Na dann«, Anna zuckte achtlos mit den Schultern, »Sondermüll also.« Sie lächelte amüsiert, beugte sich über eine der Postkisten und griff sich wahllos einen Stapel Bewerbungen. »Wann kümmern wir uns darum?«
»Nächste Woche«, antwortete Miriam. »Wir müssen eine Vorauswahl für unsere Schirmherrin treffen. Ich dachte, wir gehen mit zehn Favoriten ins Rennen.«
Anna nickte zustimmend, sie blätterte eines der Schreiben auf und begann zu lesen. »Das klingt interessant«, sagte sie, nachdem sie die Seiten überflogen hatte. »Eine Schülerinitiative, die sich um Flüchtlingskinder kümmert.«
»Da sind jede Menge richtig guter Sachen dabei«, pflichtete Miriam ihr bei. Sie wunderte sich jeden Tag wieder, wie viele couragierte und kreative Hilfsprojekte und Initiativen es gab, von denen sie noch nie etwas gehört hatte. Jede Menge Zivilcourage und freiwilliges Engagement. »Wird nicht so einfach sein, sich auf einen Sieger festzulegen.«
»Wann triffst du dich denn mit Frau Sartorius?« Anna legte die Bewerbungen zurück in die Kiste und strich sich das Haar aus dem Gesicht. Wieder dachte Miriam, dass sie wie frisch verliebt aussah. Annas Wangen leuchteten, und in ihren Augen lag ein Glanz, den kein Make-up herbeizaubern konnte.
»Wenn es nach ihrem Sekretär ginge, sehe ich sie bei der Preisverleihung zum ersten Mal«, gab sie seufzend zurück. »Herr Wanka geht davon aus, dass wir alles telefonisch klären können.«
»Sie ist ein harter Knochen, ich weiß«, sagte Anna, fast entschuldigend. »Vielleicht sollten wir den Verleger bitten, sich einzuschalten. Die beiden kennen sich, Frau Sartorius hätte ihn gern für das Kuratorium ihrer Stiftung.«
»Nein«, winkte Miriam schnell ab. Sie hatte sich vorgenommen, sich nicht von Herrn Wanka abschütteln zu lassen. »Ich kriege das hin.«
»Fein.« Anna nickte ihr zu und lächelte leise. Für einen winzigen Moment verhakten sich ihre Blicke. »Ja«, sagte sie, als Miriam den Kopf zur Seite drehte.
»Ja?« Miriam sah sie verdutzt an. »Was ja?«
»Neuer Mann!« Anna drehte sich zur Tür, das lange Haar wippte auf den Schulterblättern. Ihre Ehe war vor ein paar Jahren in aller Freundschaft versandet, eine unaufgeregte Trennung, so elegant wie Anna selbst. Die beiden Töchter, vierzehn und sechzehn, pendelten zwischen Mutter und Vater hin und her.
»Oh, wie schön«, rief Miriam ihr nach. Kurz spürte sie ein Trippeln unter ihren Rippenbögen, der Rabe ihrer Trauer schreckte auf und schüttelte sich.
»Gehen wir nachher zusammen essen?« Anna drehte sich noch einmal um, ein argloser fröhlicher Blick, der zum Fenster hinaus wanderte. »In der Versuchsküche sind sie bei den Herbstrezepten, passt doch zu diesem miesen Wetter.«
»Mal schauen.« Miriam griff nach ihrem Becher mit Tee und sah ihr hinterher. Der Rabe in ihrem Inneren krächzte. Sie war nicht empfindlich, aber sie war sich nicht sicher, ob sie Appetit auf Kürbissuppe und Annas launiges Romanzengeplauder hatte.
ZWEI
Ein paar Tage später war Miriam mit ihrem Sohn auf dem Weg zum Kindergarten. Im Autoradio lief Popmusik. Hits aus den Charts, bewährte Muntermacher für den Morgen. Ein strahlender Himmel überspannte die Stadt. Ein endloses Blau, wie mit Tusche gemalt. Der Regen war abgezogen, und sie summte leise.
»Warum hat Papa eigentlich keine Rüstung getragen?«, fragte Max plötzlich von hinten. Miriam hielt den Atem an. Das war eine dieser Fragen, die scheinbar aus dem Nichts kamen und die Welt für einen Augenblick aus den Angeln heben konnten. Sie schaute in den Rückspiegel, ein kurzer schneller Mutterblick. Max saß angeschnallt in seinem Kindersitz. Aus seinem Rucksack lugte eine Ecke des Ritterbuchs hervor, das er derzeit ständig mit sich herumschleppte. Im nächsten Moment sah sie Gregor vor sich, wie er die schwere Fotoausrüstung in das Taxi zum Flughafen hievte. Sein Winken von der Straße hinauf, ein letzter Blick, dann war er fort gewesen.
Die Erinnerungen trafen sie mit Wucht, haltsuchend umklammerten ihre Hände das Steuer.
Gregor.
Der Schock über seinen Tod hatte sie zunächst in eine gefühllose Marionette verwandelt. In den Tagen und Wochen danach funktionierte sie wie fremdgesteuert. Ein dumpfes, betäubtes Voran. Sie hatte versucht, Gregors Eltern zu trösten und Max, der gerade mal drei Jahre alt gewesen war. Selbst als sie das Baby in der zwölften Woche verloren hatte, war sie nicht zusammengebrochen. Es war ihr nur konsequent erschienen, dass dieses Kind sich nicht für das Leben entschieden hatte. Es war einfach seinem Vater gefolgt.
Drei Monate nach Gregors Tod hatte plötzlich eine Phase wilder Energie die Betäubung abgelöst. Miriam war schon immer eine Macherin gewesen, schnell und sicher in allem, was sie tat, und so erschien ihr dieser Aktionismus vertraut und irgendwie heilsam. Da war eine unbändige Kraft in ihr, die sie durch den Nebel der Tage trug. Sie waren umgezogen, ein anderes Viertel und ein neuer Kindergarten für Max. Sie leistete sich eine viel zu teure Küche, kaufte ein neues Bett und schnitt sich die Haare ab. Den neuen Nachbarn sagte sie, sie sei alleinerziehend. »Ja, mir geht es gut«, antwortete sie den fragenden Blicken der Freunde. »Macht euch keine Sorgen, ich halte das aus.«
Und dann der Zusammenbruch, wie aus dem Nichts. Eine einzige schlaflose, von Fragen zerquälte Nacht hatte sie an den Rand eines gähnenden Abgrunds geführt. Am Morgen schaffte sie es gerade noch so, ihren Sohn im Kindergarten abzuliefern. Auf dem Weg zurück zum Auto stolperte sie auf dem Kopfsteinpflaster, und dieses Stolpern hatte sie umgehauen. Da war keine Kraft mehr in ihr aufzustehen. Das Herz aus dem Takt, ein rasender Puls. Irgendjemand rief einen Krankenwagen und hielt sie fest, als die Tränenflut wie ein Tsunami über sie hereinbrach. Sie weinte um Gregor, um das Baby und um das gemeinsame Leben, das es nicht mehr gab. In diesem Moment hatte Miriam geglaubt, nicht mehr weiterleben zu können.
»Mama?«
Max – seine fragende Stimme holte sie zurück. Miriam holte tief Luft, sie suchte nach einer Antwort. Ja, warum hatte Gregor keine Rüstung getragen?
»Ich glaube, er wollte den Menschen nahe sein«, versuchte sie es ehrlich. »Und wenn man in einer Rüstung steckt, ist das ziemlich schwierig.«
»Aber dann wäre ihm vielleicht nichts passiert …«
Max drehte das Gesicht zur Seite. Er sah aus dem Fenster und schwieg, die Unterlippe leicht vorgeschoben. Als sie an einer roten Ampel hielten, drehte sie sich zu ihm um.
»Ich habe ihn das auch oft gefragt, Schatz«, sagte sie. »Und er hat mir versprochen, gut auf sich aufzupassen. Das war einfach …«, wieder suchte sie nach den richtigen Worten.
»Pech?«, fragte Max, er sah sie immer noch nicht an. Sein dunkles lockiges Haar, ein großväterliches Erbe, schimmerte rötlich.
»Ja, vielleicht war es Pech. Dickes, fettes Pech.«
»Drachenpech.« Jetzt grinste Max, er sah sie an. Es kam oft vor, dass er von einem Moment zum anderen traurig war. Dann schob sich eine dunkle Wolke über sein Gesicht, manchmal flossen auch Tränen. Doch ebenso schnell wie die Schlechtwetterfront aufzog, war sie auch wieder verschwunden.
»Drachenpech, ja das passt.« Miriam zwinkerte ihm zu, sie mochte das Wort. Gregor hätte es auch gemocht. Sie spürte, dass sich etwas in ihr zusammenzog. Ein wütender Schmerz. In Augenblicken wie diesen fehlte er ihr unglaublich. Sie sehnte sich nach seiner Nähe und nach einer väterlich stolzen Bemerkung, mit der er die Gedanken seines Sohnes kommentiert hätte. Ja, warum zum Teufel hatte er keine Rüstung getragen?
Tatsächlich hatte sie mit Gregor über seine Sicherheit gestritten. Immer wieder und auch vor der Reise in den Nordirak. Gregor hatte gewusst, dass er noch einmal Vater werden würde. »Diese eine Reise noch«, hatte er gesagt. Er wollte unbedingt ein Projekt besuchen, das die Vereinten Nationen auf den Weg gebracht hatten. Bildung und Arbeit anstelle der Barbarei und der Hoffnungslosigkeit. »Wenn jemand diese geschundene Region umkrempeln kann, dann sind es die Frauen«, hatte er gemeint. Er hatte schon immer lieber Frauen als Männer fotografiert.
Gregor war kein Risikojunkie gewesen, im Gegenteil. In der Redaktion hatte er den Ruf des besonnenen Profis gehabt, und das Gebiet an der syrischen Grenze galt zudem als relativ sicher. Der Journalistentross hatte sich der Kolonne des Botschafters angeschlossen. Während der Jeep des Diplomaten gepanzert gewesen war, hatten die Presseleute jedoch bewusst darauf verzichtet. Auch Helme und Schutzwesten lehnten die meisten von ihnen ab.
»Zu viel Sicherheit schafft nur Distanz zu den Menschen«, das war das Credo aller Kriegsreporter, die versuchten, zwischen Propagandalügen und der Realität zu unterscheiden. Und Gregor wollte den Menschen nahe sein – und der Wahrheit. Miriam hatte nichts dagegensetzen können.
Pech.
Drachenpech.
Die Ampel war immer noch rot. Fußgänger eilten über die Straße, die übliche morgendliche Hektik: hochgezogene Schultern, Kopfhörer in den Ohren und kein Blick zur Seite. Als ein Blaulicht vorbeirauschte, stiegen weitere Bilder in Miriam auf. In der Notaufnahme des nahe gelegenen Klinikums hatte man damals ihren Kreislauf stabilisiert, den Knöchel bandagiert und sie mit Tabletten versorgt, die das Versprechen von Ruhe und Erlösung auf dem Beipackzettel trugen. Schon im Gehen hatte ihr die Krankenschwester einen Flyer in die Hand gedrückt: »Die Trauer bewältigen, Hilfe finden.« Nach einer watteweichen Tablettennacht hatte sie das Medikament weggeschmissen und die Nummer der Stiftung gewählt. Der Sartorius-Stiftung. Miriam wollte sich nicht unterkriegen lassen, und sie hatte Glück. Zwei Wochen später konnte sie dort eine ambulante Therapie beginnen. Sechs Wochen lang betreute man sie intensiv, acht Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche. Eine Art seelischer Druckbetankung, die ihr wieder auf die Beine half. Dann wechselte sie in eine Gesprächstherapie, Einzelsitzung, zweimal die Woche. Jetzt ging sie nur noch ab und zu in eine Trauergruppe. Die Treffen taten ihr gut, und die Macken der anderen, die sie auch an sich selbst beobachtete, amüsierten sie. Sie kämpften alle mit ihren Raben.
Miriam seufzte, sie sah auf die Uhr, in wenigen Minuten begann der Morgenkreis im Kindergarten. Sie löste die Hände vom Steuer, ihre Finger trommelten ungeduldig auf dem Leder. Als die Ampel auf Grün umsprang, gab sie Gas. Quer durch St. Georg fuhr sie mit ihrem schwarzen Mini die Lange Reihe hinauf Richtung Hauptbahnhof. Vor einigen Jahren noch hatten kleine Läden und Handwerksbetriebe die Straße geprägt, jetzt war die Gegend schick geworden. Boutiquen, Straßencafés und Szenerestaurants wechselten einander ab, die alten Häuser waren saniert worden und die Mieten und Immobilienpreise stiegen. Miriam mochte die Mischung aus Normalos und Freaks, die das Viertel bevölkerten. Ein Nachmittag in einem der zahlreichen Cafés war unterhaltsamer als jedes Fernsehprogramm. Straßentheater: Dramen, Komödien und Trash. Es hatte sie schon immer gereizt, Menschen zu beobachten. Gregor hatte sie gern damit aufgezogen. »Eule«, hatte er gespottet, wenn sie das Leben der anderen in sich aufsog.
Miriam hatte darüber gelacht und ihm einen Kuss gegeben, ihre Neugier hatte sie als Berufskrankheit abgetan. Eine déformation professionnelle. Nun überlegte sie, ob sich Raben und Eulen wohl vertrugen.
Kurz bevor sie zum Kindergarten abbogen, brauste der Mini an der goldglänzenden Statue des heiligen Georg vorbei. Der Ritter war im Mittelalter der Schutzheilige eines Leprahospitals gewesen und hatte dem Stadtteil seinen Namen gegeben. Zu seinen Füßen lag der Körper des getöteten Drachens, ein mächtiges geflügeltes Fabelwesen.
Miriam sah wieder in den Rückspiegel. Ein Lächeln kräuselte Max’ Lippen, er winkte dem Ritter zu, als grüßte er einen Freund. Wenn man ihn fragte, wo er wohnte, nannte er sein Viertel fast ein wenig martialisch »Drachentöterland«. Eine Zeitlang hatte Miriam sich Sorgen gemacht, dass Max sich in eine Phantasiewelt flüchtete. Setzte der Kummer ihm immer noch so zu? Brauchte auch er therapeutische Hilfe? Doch die Erzieherinnen in der Kita hatten sie beruhigt und von einem ganz normalen Verhalten gesprochen: »Max ist ein lieber und aufgeweckter Kerl.« Und sie wollte es ihnen glauben.
Dann waren sie da, wie immer auf die letzte Minute. Miriam parkte vor dem Kindergarten. Kastanienbäume umstanden den kleinen gepflasterten Platz, wenn es wärmer wurde, explodierten die Kronen in einem schaumigen Frühlingsweiß. Im Herbst prasselten die Kastanien kiloweise auf die Erde, die Kinder bastelten Ketten und Männchen daraus, die bis Weihnachten runzlig wurden. Der jährliche Kastanienbasar hatte Tradition im Viertel, und auch Miriam freute sich das ganze Jahr darauf. Sie mochte den Herbst, immer schon. Den Geruch des fallenden Laubs, die Farben, die schräg einfallenden Sonnenstrahlen und den Wind, der an den Haaren zerrte. Das Frühjahr war dagegen schwierig. Gregor war kurz nach Ostern ums Leben gekommen, an einem fast schon frühsommerlich warmen Tag, und alles Knospende, Schwellende erinnerte sie unwillkürlich an seinen Tod und an das Baby. Am Liebsten hätte sie die Osterfeiertage aus ihrem Kalender gestrichen. In diesem Jahr wollte sie mit Max verreisen, um nicht in der Stadt mit den Schatten der Erinnerung kämpfen zu müssen.
»Was wollen wir über Ostern machen?«, fragte sie ihn, als er sich in der Eingangshalle von ihr verabschiedete. »Überlegst du dir was, mein Schatz?«
»Klaro!« Max grinste und streckte beide Daumen in die Höhe. Dann schlüpfte er in seine Hausschuhe, gab ihr einen Kuss und lief zu den anderen Kindern in den Gruppenraum. Miriam sah ihm nach, sein Eifer rührte sie. In der Tür drehte er sich noch einmal kurz zu ihr um. »Was hältst du davon, wenn wir uns einen Hund aus dem Tierheim holen, Mami? Dann sind wir wieder zu dritt.«
»Gregor Raven, Nachrichten bitte nach dem Signal …«
Im Auto hatte Miriam sofort Gregors Nummer gewählt. »Max wünscht sich einen Hund«, sprudelte es aus ihr hervor. Dann erzählte sie ihm von dem Drachenpech. Sie war zu ungeduldig gewesen, das Telefon mit der Freisprecheinrichtung zu verbinden. Mit dem Handy am Ohr schlingerte sie über die Kreuzung am Hauptbahnhof Richtung Elbe. Hinter ihr hupte jemand.
Gregors Stimme auf der Mailbox klang wie immer, souverän und eine Spur amüsiert, so als ob er daran zweifelte, dass dieses Gespräch unbedingt nötig war. Miriam legte wieder auf. Kurz bevor sie den Verlag erreicht hatte, rief sie ihn noch einmal an. »Außerdem bekomme ich merkwürdige Briefe«, sprach sie ihm auf die Mailbox. »Es geht um Dorothea Sartorius.«
In den vergangenen Tagen waren weitere Briefe eingetroffen. Jeden Morgen lag da wieder einer dieser weißen Umschläge auf ihrem Platz, die Schrift auf dem Bogen säuberlich über dem Mittelfalz platziert. »Fragen Sie Dorothea nach Marguerite!« Ein irritierend aufforderndes Ausrufungszeichen. Brief Nummer zwei und drei hatte Miriam noch zerrissen, alle weiteren hatte sie in einer Mappe gesammelt. Inzwischen waren es fünf Stück.
Als Miriam sich an ihren Schreibtisch setzte, fragte sie sich, wie lange die Briefeschreiberin wohl durchhalten würde. Sie hatte für sich ein Limit gesetzt, willkürlich und ohne Sinn: Wenn sie mehr als vierzehn Briefe von »Elisabeth« erhielt, würde sie Dorothea Sartorius darauf ansprechen. Wenn weniger eintrafen, wollte sie alle Briefe zerreißen. Die Vierzehn, so dachte sie nun, wäre Elisabeths Schicksalszahl.
Doch zunächst brauchte sie endlich einen Termin bei der Stifterin. In den zurückliegenden Tagen hatte sie diverse Male bei Herrn Wanka vorgesprochen und versucht, ein persönliches Gespräch mit der Sartorius zu vereinbaren. »Das Porträt über Frau Sartorius ist gewissermaßen Teil der Preisverleihung. Unsere Leserinnen wollen wissen, wer sie wirklich ist. Wie denkt sie, wie lebt sie, wie tickt sie?«
Herr Wanka hatte noch einmal versucht, Miriam mit dem bereits vorhandenen Pressematerial abzuspeisen. »Frau Sartorius gibt keine Interviews.« Dann hatte er ihr angeboten, die Fragen schriftlich einzureichen. Seine Hartnäckigkeit und sein Unverständnis hatten Miriams Geduld herausgefordert. Kurz hatte sie überlegt, ob er vielleicht eine Prämie für jedes vereitelte Interview bekäme. »Ich würde mir gern persönlich ein Bild von Frau Sartorius machen«, hatte sie ein weiteres Mal erklärt. Ihrem Tonfall hatte man die Gereiztheit angehört, obwohl sie sich bemühte, freundlich und entspannt zu klingen. »Wenn ich den Artikel kalt schreibe, wird es ein Text ohne Seele. Korrekt, aber ohne Tiefenschärfe. Und dafür steht die Anabel nicht.« Sie waren so verblieben, heute noch einmal zu telefonieren.
Miriam hatte wenig Hoffnung, als sie zum Telefon griff. Die Liste ihrer Argumente war abgearbeitet, und Dorothea Sartorius saß am längeren Hebel. Wenn sie partout nicht mit ihr sprechen wollte, könnte Miriam nichts daran ändern. Dann müsste sie sich ihre Geschichte doch aus den Fingern saugen. Wieder wunderte sie sich darüber, dass die Stifterin ein derart abgeschiedenes Leben führte.
Nach kurzem Klingeln meldete sich der Sekretär: »Guten Morgen, Frau Raven.«
»Na, Sie kennen meine Nummer inzwischen wohl auch auswendig?«, erwiderte Miriam ein wenig spitz. Sie drehte sich zum Fenster und sah hinaus. Von ihrem Büro aus hatte man einen wunderbaren Blick auf den Michel. Möwen kreisten um die barocke Kirchturmspitze, die Morgensonne ließ die Haube aufleuchten, ein warmes Kupfergold. Die Zeiger der riesigen Turmuhr zeigten neun Uhr dreißig an, darüber schlängelte sich eine Wendeltreppe bis hinauf in die Spitze des Wahrzeichens. Noch eine halbe Stunde, dachte Miriam. Nach altem Brauch blies der Michel-Türmer morgens um zehn und abends um neun Uhr einen Choral auf seiner Trompete in alle vier Himmelsrichtungen. Auch dabei hatte Dorothea Sartorius ihre Hände im Spiel. Miriam hatte herausgefunden, dass sie regelmäßig für den Fortbestand dieser alten Tradition spendete.
Der Sekretär lachte kurz auf, und Miriam nahm das als gutes Zeichen. »Wie sieht es aus?«, fuhr sie fort. »Haben Sie etwas erreichen können?«
»Frau Sartorius steht gerade neben mir«, antwortete Herr Wanka, er klang fast ein wenig verwundert. »Sie möchte kurz mit Ihnen sprechen.«
»Oh …« Miriam schaute wieder auf den Bildschirm, schnell öffnete sie den Sartorius-Ordner. Das angesammelte Material poppte auf. »Ja natürlich, sehr gerne.«
»Dann reiche ich den Hörer einmal weiter.«
Da war eine kurze Pause in der Leitung, Miriam meinte Schritte zu hören, so als ob die Sartorius sich mit dem Telefon von ihrem Sekretär entfernte. Eine Tür schien sich zu schließen.
»Frau Raven«, hörte sie dann eine angenehme, überraschend tiefe Stimme. »Vielen Dank für Ihre Geduld.«
»Sehr gern«, antwortete Miriam höflich. »Vielen Dank, dass Sie sich ein wenig Zeit für mich nehmen.« Sie beschloss, den Moment zu nutzen und gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. »Ich würde Sie gern persönlich treffen, Frau Sartorius.«
»Das hat mir mein Sekretär schon ausgerichtet. Sie wollen Tiefenschärfe, ja?« Dorothea Sartorius sprach schnell und präzise, so als hätte sie keine Zeit zu verlieren. »Kommen Sie mit einer Stunde aus?«
»Zwei Stunden wären toll.« Miriam drückte sich selbst die Daumen, nach dem ganzen Hin und Her konnte sie es kaum glauben, nun so schnell zum Ziel zu kommen. »Ich würde auch gern einen Fotografen mitbringen.«
»Ja, das dachte ich mir.« Dorothea Sartorius schwieg. Miriam biss sich auf die Lippen, hatte sie zu viel gewagt?
»Keine Löwenherz-Story, kein Schnickschnack«, fuhr die Sartorius nach einem kurzen Moment streng fort. »Sind Sie damit einverstanden?«
»Kein Schnickschnack«, versprach Miriam, ein Lächeln auf den Lippen.
»Dann kommen Sie nächste Woche Donnerstag, am Nachmittag. Passt es Ihnen um vier?«
»Perfekt«, log Miriam. Sie würde jemanden finden müssen, der Max vom Kindergarten abholte. Außerdem würde sie ihre Trauergruppe verpassen.
»Mögen Sie Kuchen?«
»Ja, aber …«
»Apfelkuchen oder lieber Käsesahne?«
»Apfelkuchen.« Miriam spürte, dass ihr Herz schneller schlug. Auf ein Stück Apfelkuchen mit Dorothea Sartorius – sie freute sich auf das Treffen.
»Und der Fotograf?«
»Apfelkuchen geht immer, Frau Sartorius. Machen Sie sich bitte nicht zu viele Umstände. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.«
»Gut, dann gebe ich Sie noch einmal an Herrn Wanka zurück. Wiederhören, Frau Raven.«
Miriam verabschiedete sich, sie hörte eine Melodie, etwas Klassisches, dann war der Sekretär wieder in der Leitung. Herr Wanka schien sich noch nicht von seiner Überraschung erholt zu haben.
»Chapeau!«, sagte er mehr anerkennend als angefasst. »Kommen Sie doch bitte eine Viertelstunde früher, Frau Sartorius hasst es zu warten.« Dann notierte er sich den Namen des Fotografen und beendete das Gespräch.
Als der Türmer seinen Choral blies, klopfte der Bote mit der Post an ihre Tür. Heute war der letzte Tag für die Einsendungen zum Sartorius-Preis. Ein paar große braune Umschläge landeten auf ihrem Tisch und ein weiterer weißer Brief. Wieder in einem Briefzentrum im Norden abgestempelt.
Miriam sah sich zunächst die Bewerbungen an – eine Anlaufstelle für Vergewaltigungsopfer, ein Projekt, das die Kriegswaisen in der Ukraine unterstützte und eine weitere nachbarschaftliche Flüchtlingshilfe –, dann öffnete sie den kleineren Umschlag und zog das Schreiben heraus.
Fragen Sie Dorothea nach Marguerite!!!
Drei Ausrufungszeichen nun, die Absenderin, wenn es denn tatsächlich eine Frau war, schien die Dringlichkeit ihrer Botschaft noch einmal unterstreichen zu wollen. Ja, dachte Miriam gut gelaunt und legte den Bogen in die Mappe zu den anderen Briefen, wenn du so hartnäckig bleibst, mache ich das.
Nach dem Telefonat mit Dorothea Sartorius war Miriam noch ein wenig neugieriger, auch wenn sie davon ausging, dass die Sartorius nichts mit den Briefen würde anfangen können. Bestimmt handelte es sich um eine abgewiesene Bittstellerin, die keine Hilfe von der Stiftung oder von der Stifterin selbst erhalten hatte. Vielleicht, so überlegte Miriam nun, sollte sie besser gleich ihren Sekretär nach Marguerite fragen. Die Sartorius würde sich bestimmt nicht mit einem anonymen Schreiben befassen wollen.
Miriam zog ihr Notizbuch zu sich und trug sich den Interviewtermin ein. Als sie Anna aus ihrem Büro kommen sah, winkte sie ihr zu.
Anna nickte und hielt einen Becher hoch, sie wollte sich noch schnell einen Kaffee holen. Kurze Zeit später steckte sie ihren Kopf durch die Tür.
»Ich habe einen Termin«, platzte es aus Miriam heraus. »Nächste Woche Donnerstag.«
»Doch nicht etwa bei Frau Sartorius?« Anna kam herein und zog anerkennend die Augenbrauen in die Höhe. Sie stellte einen Becher Tee vor Miriam ab.
»In der Höhle der Löwin …«
»Super, dann kriegen wir doch noch ein ordentliches Stück ins Heft. Ich glaube, sie hat noch nie mit der Presse gesprochen.«
»Sie hat ab und zu über die Stiftung und über neue Projekte gesprochen, aber nichts Privates«, gab Miriam ihr recht. »Kaum Fotos, keine Interviews. Ich habe ihr versprechen müssen, nichts von dem üblichen Schnickschnack zu schreiben.«
»Ja, das passt zu ihr.« Anna lehnte sich gegen ein Regal mit Büchern und Nachschlagewerken, das gegenüber von Miriams Schreibtisch stand. Sie prostete Miriam mit dem Kaffeebecher zu. Heute trug sie ein helles, figurbetontes Wickelkleid mit V-Ausschnitt, eine Kette aus Holzkugeln und einem elfenbeinfarbenen Buddhakopf baumelte zwischen ihren Brüsten. Die Kette erinnerte Miriam an ein Geschenk, das Gregor ihr einmal aus Indien mitgebracht hatte.
Anna bemerkte ihren Blick. »Albern?«, fragte sie, kein bisschen unsicher. »Habe ich meiner Tochter heute Morgen gemopst.«
»Nein, nein«, Miriam schüttelte den Kopf. »Erinnert mich nur an etwas.«
»Oh …« Anna nickte ernst, sie schien zu erahnen, worum es ging. Immer wenn Miriam das Wort »Erinnern« in den Mund nahm, zuckten Kollegen und Freunde schuldbewusst zusammen, als ob sie vermintes Terrain betreten hatten. Meist folgte dann betretene Stille, weil ihnen Miriams Verlust zu groß erschien für harmloses Geplauder.
»Ist wirklich hübsch«, versuchte Miriam, das Gespräch in unverfänglichere Gewässer zu bugsieren. »Sollte ich auch mal wieder tragen.«
Anna ließ sich nicht darauf ein. »Weißt du, Miriam, ich habe gerade heute Morgen noch einmal über unser Gespräch von neulich nachgedacht. Das war blöd von mir, dir von meinem Freund vorzuschwärmen. Wirklich blöd. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Zu viele Glückshormone, entschuldige.«
»Ach Anna, bitte …« Miriam winkte ab und griff nach dem Becher mit Tee. Anna hatte ihr einen Darjeeling aufgebrüht, der Beutel schwamm noch im Wasser. Vorsichtig zupfte sie das tropfende Säckchen heraus und versenkte es im Abfallkorb. Sie fand nicht, dass Anna sich entschuldigen musste. Das Leben ging weiter, für alle anderen und irgendwie auch für sie selbst. »Wie finden ihn denn deine Töchter?«, fragte sie betont munter und pustete in den Tee, der noch zu heiß zum Trinken war.
Anna trank einen Schluck Kaffee und sah zu Boden. »Schwieriges Thema«, sagte sie schließlich. »Ich hab’s ihnen erzählt, aber sie kennen ihn noch nicht. Mal abwarten, wie sich die ganze Sache entwickelt.«
»Ja, kann ich verstehen.« Miriam nickte, auch wenn sie sich nicht vorstellen konnte, Max irgendwann einmal so etwas wie einen Ersatzvater zu präsentieren. Ja, sie konnte sich noch nicht einmal vorstellen, sich jemals wieder neu zu verlieben. Jedenfalls nicht so, wie sie sich in Gregor verliebt hatte. Sie hatte alles an ihm gemocht, seinen eigensinnigen Charakter, sein sommersprossiges Gesicht, seine langen Finger und seine Gabe, sich überall zu Hause zu fühlen. Und sie hatte ihn für seinen Mut bewundert, auch dort genau hinzusehen, wo es bestenfalls Grautöne zu entdecken gab. Er hatte die Realität heranzoomen und in seinen Bildern verdichten können.
»Max wünscht sich einen Hund«, fuhr sie übergangslos fort.
Anna lachte auf, sie wirkte erleichtert. »Sei froh, dass er kein Meerschweinchen will«, witzelte sie. »Die sind wirklich schrecklich. Und die Biester stinken«, sie rümpfte die Nase. »Ohne Worte! Ich habe drei Meerschweinchen-Generationen durchgefüttert, bis sich das Thema bei meinen Töchtern endlich erledigt hatte.«
»Eine Schildkröte könnte ich mir vorstellen.« Miriam lächelte, auch weil Anna schon wieder das Gesicht verzog. Sie sah so aus, als ob sie etwas ganz besonders Scheußliches auf ihrem Schreibtisch entdeckt hätte.
»Also, einen Hund könntest du in die Redaktion mitbringen. Aber eine Schildkröte …« Anna schüttelte sich, der Buddha hüpfte auf und ab. »Was Langweiligeres gibt’s doch gar nicht! Die bewegen sich ja noch nicht mal. Und wenn’s ganz blöd läuft, schleppst du die auch noch mit in die Seniorenresidenz. Bei guter Haltung werden die doch hundert Jahre alt.«
»Vielleicht freue ich mich dann über ein bisschen Gesellschaft?« Miriam dachte an den letzten Zoobesuch mit Gregor zurück. Er hatte die Riesenschildkröten von allen Seiten fotografiert und später ein Bild von ihrem Sohn auf einem der Krötenpanzer montiert.
Max, der Schildkrötenreiter. Die Montage hing in der neuen Küche über dem Esstisch. Sie waren seitdem nicht mehr im Zoo gewesen.
»Na, aber zwischen Hund und Schildkröte liegen Welten, oder? Mir fällt jetzt wirklich kein Argument ein, mit dem du deinen Sohn von einem gepanzerten Vierbeiner überzeugen könntest. Wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen?«
»Mein Fehler.« Miriam nahm einen Schluck von dem rauchigen Darjeeling, der Tee war immer noch sehr heiß. »Ich habe ihn gefragt, was er über Ostern machen will.«
»Na, das war eine Steilvorlage.« Anna trank ihren Kaffee aus und machte Anstalten zu gehen.
»Max meinte, dass wir dann wieder zu dritt wären«, setzte Miriam hinzu. Sie wusste selbst nicht, warum sie Anna davon erzählte.
»Und du?« Anna drehte sich noch einmal um und sah sie forschend an. »Was denkst du darüber?«
Miriam zuckte mit den Schultern, dann schüttelte sie den Kopf. »Inzwischen komme ich ganz gut alleine klar.«
»Sicher?«
»Ziemlich sicher.«
Anna sah sie nachdenklich an, dann nickte sie Miriam zu und war aus der Tür.
Miriam atmete tief ein und aus. Der Rabe in ihrem Inneren schüttelte den Kopf. Im Kino, so dachte sie aus einem unerfindlichen Grund, wäre das jetzt der Moment, wo die Filmmusik anfing sanft zu seufzen.
DREI
Die Preisverleihung im Schauspielhaus rückte näher. Miriam hatte eine Event-Agentur angeheuert, die auf Veranstaltungen dieser Art spezialisiert war, die Profis kümmerten sich um die beängstigende Flut von Details. Vom Look der Einladungskarten (elegantes Silber und Weiß) bis hin zum Bühnenbild (puristisch mit jahreszeitlichem Blumenschmuck) gab es nahezu täglich neue Entscheidungen zu treffen. Manches, wie etwa die Auswahl der Getränke, ließ sich schnell entscheiden, anderes, wie Sitzordnung und Ablauf, musste reifen. Miriam fand es schwierig, Stiftung und Verlag angemessen zu repräsentieren, ohne den Zweck der Veranstaltung aus den Augen zu verlieren. Im Mittelpunkt sollten der Preis und die Preisträger stehen, die Promis durften ihnen nicht die Show stehlen.
Nachdem sie im Sommer des vergangenen Jahres angefangen hatte zu planen, begann nun die heiße Phase der Vorbereitungen. Der Countdown lief, bis zur Verleihung des Sartorius-Preises waren es noch knapp zwei Monate. Mehr als vierhundert Gäste hatten inzwischen zugesagt und das Programm der Matinee, eine muntere Abfolge prominenter Redner und musikalischer Einlagen, war bis auf die letzte Minute durchgetimt. Die Symphoniker würden Mozart und Haydn spielen (ein Wunsch von Dorothea Sartorius), und für die Jüngeren gab es Pop: Eine Band aus Berlin trat mit ihrem aktuellen Hit auf, ein Singer/Songwriter aus England stellte seine neue Ballade vor. Durch das Programm führte die ebenso blonde wie aufgeweckte Talkshow-Moderatorin Julia Hinrichs.
Miriam telefonierte nun fast jeden Tag mit den Eventleuten, einmal wöchentlich gab es dazu ein Meeting im Verlag. Die jungen Frauen von der Agentur – Anna nannte sie »die Mädels« – sahen in ihren Shirts, Skinny Jeans und Stiefeletten hip und lässig aus, doch sie schulterten den Auftrag mit einer einschüchternden Professionalität. Mit perfekt manikürten Fingernägeln wischten sie über ihre Tablets und konnten innerhalb von Sekundenbruchteilen jede benötigte Information abrufen oder den Ablaufplan verändern. »Die bekämen sogar den Dalai Lama und den chinesischen Staatspräsidenten an einen Tisch«, hatte Anna nach einem Treffen einmal gewitzelt.
Miriam fand, dass die Mädels einen tollen Job machten. Sie hatte es ihnen zu verdanken, dass sich ihre eigene Anspannung noch in Grenzen hielt. Es war ihr lediglich schwergefallen, sich zwischen den vielen unterschiedlichen Arrangements zu entscheiden, und sie hatte über den Sinn oder Unsinn von dreißig möglichen Speisefolgen gegrübelt. Schließlich hatte sie ein frühlingshaftes Menü mit vielen frischen Produkten aus der Region gewählt. Das schwarzgekleidete Heer der Servicekräfte würde unter anderem Spargelsüppchen im Glas, Lachsterrine und Kalbsbäckchen mit Möhren und Sellerie servieren. Natürlich gab es auch eine vegane Alternative für die ganz Korrekten. »Häppchen für Helden«, hatte sie Gregor auf die Mailbox gesprochen. Er hätte darüber gelacht, sein warmes Lachen, ganz tief aus dem Bauch heraus, das sie so sehr vermisste.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.