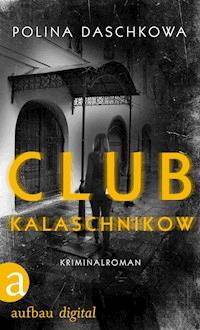Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Russische Ermittlungen
- Sprache: Deutsch
Olga ist Ärztin in einer psychiatrischen Klinik, sie ist verheiratet und hat zwölfjährige Zwillinge. Seit kurzem betreut sie einen Patienten, der sein Gedächtnis verloren zu haben scheint. Doch Olga nimmt ihm das nicht ab. Was er ihr erzählt, erinnert sie an einen Mann, der im Internet obszöne Erzählungen und Kinderpornographie verbreitet. Nie wieder wollte Olga mit solchen Dingen zu tun haben. Vor anderthalb Jahren waren sie und ihre Kollegen kläglich daran gescheitert, einen Serienmörder zur Strecke zu bringen. Der Misserfolg hatte sie noch lange seelisch belastet. Doch als im Fernsehen vom Tod der fünfzehnjährigen Shenja berichtet wird und alles so sehr der Mordserie von damals ähnelt, kann sie nicht anders, als sich wieder einzumischen, auch wenn sie dabei mit ihrer Jugendliebe zusammenarbeiten muss ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Polina Daschkowa
In ewiger Nacht
Kriminalroman
Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt
Impressum
Die Originalausgabe unter dem Titel Wetschnaja notsch
erschien 2006 im Verlag Astrel, Moskau
ISBN 978-3-8412-0298-7
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, April 2012
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2009 bei Aufbau; Aufbau ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
© 2006 by Polina Daschkowa
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung capa, Anke Fesel
unter Verwendung eines Motivs
von Chris Keller/bobsairport
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
Inhaltsübersicht
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Ein Abgrund tut sich vor uns auf,
Erfüllt von Angst und Finsternissen,
Und keine Macht kann uns beschützen –
Drum flößt die Nacht uns Grauen ein!
F. I. Tjutschew
Erstes Kapitel
»Sie wären gern ein kleines Mädchen, Sie möchten, dass jemand Ihnen über den Kopf streicht, die Decke zurechtzupft und Ihnen ein Märchen vorliest, ein schön gruseliges. Mochten Sie als Kind Gruselmärchen? Erinnern Sie sich an die Geschichten vom roten Klavier im Pionierferienlager, nachts im dunklen Schlafraum? Aus dem Klavier kam eine Totenhand und erwürgte erst den Großvater, dann die Großmutter, dann die Mutter und den Vater. Und zum Schluss die Tochter. Ihnen stockte das Herz in Erwartung der eiskalten Hand, die nach der Kehle griff. Lange Finger, geschmeidig wie Würmer. He, Frau Doktor, warum sagen Sie nichts?«
Doktor Olga Filippowa ging durch eine menschenleere dunkle Gasse, und in ihrem Kopf klang der heisere Bariton nach. Sie redete sich ein, dass sie sich dieses Gespräch mit einem Patienten absichtlich in Erinnerung rief. Er war nur ein Patient, mehr nicht. Einer von Hunderten Unglücklichen, die sie in den letzten fünfzehn Jahren behandelt hatte.
»Die Psychiatrie kann nicht heilen, das wissen Sie doch. Sie kann höchstens aus einem Menschen ein Tier machen und aus dem Tier eine Pflanze. Sie müssen mich nicht mit giftigen Psychopharmaka abfüllen. Ich werde nicht toben, Pionierehrenwort. Übrigens – Sie waren doch bestimmt auch Pionier, oder? Haben jeden Morgen das Halstuch gebügelt, Sie erinnern sich noch an den Geruch des heißen nassen Stoffs, der unterm Bügeleisen zischt, und an die nervtötende Stimme im Radio: ›Guten Morgen, Kinder! Hier ist euer Pionierfunk!‹«
Olga schlug die Kapuze ihrer Pelzjacke hoch und verbarg ihr Gesicht im hohen Kragen ihres Pullovers. Noch vor ein paar Tagen war die Sonne warm gewesen, morgens hatten die Vögel gesungen, die Knospen waren prall, und man hatte glauben können, dass der Winter nun endlich vorbei sei. Statt der ewigen Winterjacke ein leichter heller Mantel, statt des dicken Schals ein Seidentuch. Doch dann war ein Gewitter gekommen, und eine schwarze Wolke hatte eiskalte Hagelkörner über der Stadt ausgeschüttet. Am Abend hatte es aufgeklart und Frost gegeben. Zurück in die schwere Jacke und den Pullover.
Aprilfröste haben etwas von Verrat. Zumindest empfand Olga es so. Vorgestern hatte sie ihren alten Shiguli in die Werkstatt gebracht, und nun musste sie zu Fuß von der Metro nach Hause laufen, denn die hundertfünfzig Rubel für ein Taxi konnte sie sich nicht leisten.
Der Wind blies ihr die Kapuze vom Kopf, sie musste sie festhalten. Sie war ohne Mütze und Handschuhe aus dem Haus gegangen, ihre Hände waren eiskalt, die Finger ganz steif.
Ringsum war keine Menschenseele. Mitten in Moskau, kurz nach Mitternacht. Der arktische Zyklon hatte alle nach Hause getrieben, selbst die Obdachlosen, die Hundebesitzer und die jungen Leute, die sonst den Boulevard bevölkerten. Olga lief schneller, sie rannte fast. Die hohen Absätze ihrer Stiefel klapperten hell auf dem sauberen Asphalt. Eis und Matsch waren von den warmen Märzregen schon weggewaschen worden, darum hatte Olga die neuen weißen Schnürstiefel mit den hohen Absätzen und den modischen runden Kappen angezogen.
»Sind Sie als Kind Schlittschuh gelaufen? Ihre Stiefel sehen danach aus. Konnten Sie eine Waage? Und eine Schwalbe? Wie hoch konnten Sie das Bein schwingen? Ach, wissen Sie, zu weißen Schuhen gehört eigentlich eine weiße Tasche. Und möglichst helle Strumpfhosen. Zwei Töne heller als die, die Sie jetzt tragen, und fast durchsichtig. Sie haben übrigens schöne Beine. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Sie sollten kurze Röcke tragen. Sie meinen, dafür seien Sie zu alt? Sie irren sich. Sie sehen viel jünger aus und gar nicht wie eine Frau Doktor. Soll ich Ihnen sagen, wie Sie aussehen?«
Olga bog in einen Hof ein. Sie sollte lieber nicht den Weg an den Abrisshäusern vorbei nehmen, doch er war nun mal um hundert Meter kürzer. Der erste eigene Gedanke, der durch den Strom des fremden Monologs drang, war der an ein heißes Bad.
Die Badewanne war der einzige Ort, wo Olga allein sein konnte. Ihre Familie, sie, ihr Mann und zwei Kinder, hauste in einer engen Zweizimmerwohnung. Die Kinder gingen spät schlafen, ihr Mann noch später. Sie standen alle früh auf, trotzdem war der Tag immer zu kurz. Wenn Olga von der Arbeit kam, stürmten alle mit dringenden Anliegen auf sie ein.
Ihr Mann Alexander, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Handschriftenabteilung eines Forschungsinstituts für die Kunst des Altertums, schilderte seiner Frau allabendlich ausführlich seinen Tag. Das hatte sich auch auf die Kinder vererbt, die zwölfjährigen Zwillinge Andrej und Katja. Die beiden redeten meist gleichzeitig. Sie gingen in dieselbe Klasse und reagierten auf ein und dieselben Ereignisse ganz entgegengesetzt. Was Katja schrecklich fand, reizte Andrej zu schallendem Gelächter.
»Sie sehen aus wie ein kleines Mädchen, das sich Lidschatten angemalt hat und ein strenges Gesicht macht, damit man sie in einen Erwachsenenladen reinlässt. In einen Sexshop. Oder in einen Nachtklub mit Männerstriptease. Aber Sie sind eine ehrbare Mutter und Ehefrau. So etwas würden Sie sich nie erlauben. Geben Sie zu, Sie haben ihre Ehrbarkeit schon lange satt. Dieser Gedanke beschämt Sie und macht Ihnen Angst. Sie fürchten sich vor sich selbst. Übrigens leiden Ärzte laut Statistik am häufigsten unter den Krankheiten, die sie selbst zu heilen versuchen. Onkologen haben Krebs, Psychiater werden verrückt. Woran mögen wohl männliche Gynäkologen leiden? Oh, ich weiß! Sie werden entweder impotent oder sexuelle Psychopathen. Wobei das eine das andere nicht ausschließt.«
Olga erinnerte sich plötzlich genau, dass sie an dieser Stelle dachte: Unter der Gürtellinie. Sie war sich fast sicher gewesen, dass sein Monolog früher oder später in diese Richtung abgleiten würde – Gynäkologie, Impotenz, sexuelle Psychopathen. Sie wusste noch nichts über diesen neuen Patienten, argwöhnte aber bereits nach den ersten zehn Minuten Gespräch, dass er nicht der war, für den er sich ausgab. Er litt keineswegs unter Amnesie, und die reaktive Psychose, mit der man ihn in die Klinik eingeliefert hatte, war gekonnt simuliert.
»Ich weiß absolut nichts über mich, die Fragen können Sie sich sparen«, erklärte er. »Auf mich stürmen eine Menge Gedanken ein, aber die haben nichts mit mir zu tun. Ich denke an Sie, Frau Doktor. Darüber kann ich mit Ihnen reden, wenn Sie wollen.«
Im Durchgangshof brannte keine einzige Lampe. Im schmalen Torbogen des alten Hauses war ein einziges Fenster. Durch dicke Schmutzschichten drang Licht, so schwach, dass der Schein nicht einmal bis zur gegenüberliegenden Wand reichte. Olga wusste, dass hinter diesem Fenster ein kleines Zimmer lag, das nichts enthielt als stinkende Matratzen und einen zerschrammten Hocker. Auf dem Boden lagen Lumpen und Zeitungspapier herum. Auf den Matratzen schliefen unter Lumpen zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge mochte etwa vier sein, das Mädchen höchstens zwei. Sie hatten eine Mutter, die Väter wechselten jeden Monat.
Letztes Jahr, im Frühherbst, war Olga ebenso wie jetzt nach Mitternacht auf dem Heimweg von der Arbeit gewesen, als sie im Torbogen von einer Kinderstimme angesprochen wurde.
»Tante, bring uns bitte nach Hause.«
Sie hatte die beiden, die auf dem nackten Asphalt an der Wand saßen, nicht gleich erkennen können und darum ihr Feuerzeug aus der Tasche geholt und angezündet.
»Auf der Treppe ist es dunkel, wir haben Angst.«
Gesprochen hatte der Junge. Das Mädchen war so klein, dass Olga fast staunte, dass es schon allein laufen konnte.
»Mama ist da drüben auf dem Hof mit den Onkeln, sie sind alle betrunken, aber wir wollen schlafen«, erklärte der Junge. »Wir wohnen hier, im dritten Stock.«
»Wie alt bist du?«, fragte Olga.
»Dreieinhalb. Ich heiße Petja. Und das ist Ljuda. Sie ist ein Jahr und vier Monate.«
»Soll ich euch nicht lieber zu eurer Mama bringen?«
Hinter dem Torbogen, in einem Winkel des schmutzigen Hofs, tönten betrunkene Stimmen und lautes Gelächter.
»Nein. Wir wollen schlafen.«
Der Junge umklammerte ihre Hand.
Zum ersten Mal betrat Olga den Hauseingang, den alle anständigen Mieter der umliegenden Häuser mieden. Gestank, Dunkelheit und Kälte. Das Gas in ihrem Feuerzeug ging zu Ende. Die Flamme zitterte und flackerte und taugte nicht zum Leuchten.
»Hier ist eine Stufe kaputt«, warnte Petja.
Olga hätte nicht sagen können, wer wen in die dritte Etage brachte.
»Wir sind da, Tante. Mach du Licht an, ich komme nicht an den Schalter.«
Olga warf einen Blick in die Küche: Fetzen von dreckstarrendem Wachstuch, verkrustete Schmutzschichten. Ein riesiger Plastiksack voller leerer Flaschen. Das Zimmer sah nicht viel besser aus. Ein roter Spielzeuglaster aus Plastik war der einzige normale Gegenstand in dieser Müllgrube.
Sie war gegangen, ohne sich noch einmal umzudrehen, war die Treppe hinuntergerannt, beinahe ohne die maroden Stufen zu berühren.
Ob das Haus wohl noch beheizt wird? Wie haben sie hier bloß den Winter überlebt?, dachte Olga mit einem Blick auf das einsame Fenster. Für einen Moment glaubte sie dort hinter der trüben Scheibe einen dunklen Schatten zu sehen. Sie spürte sogar einen Blick. Vielleicht schaute eins der Kinder aus dem Fenster?
Olga passierte im Laufschritt den Torbogen, schlüpfte in ihren vertrauten warmen Hauseingang und befahl sich: Vergessen! Vor allem den geschwätzigen neuen Patienten ohne Namen und Alter. Auch die Katze Dussja, den Liebling der Station. Sie war am Abend verschwunden, nicht zum Fressen erschienen und reagierte auf kein Rufen. Die Kinder vergessen, die leben, wo eigentlich kein Mensch leben kann, und ihre Mutter, die drogensüchtige Prostituierte, die erst achtzehn Jahre alt war.
»Sie sind zu sensibel für Ihren Beruf, Olga. In Ihrem Sprechzimmer lebt eine Katze. Dussja, hab ich gehört. Sie ist weiß und lieb. Wenn ihr was passieren sollte, werden Sie weinen. Oh, ich kann mir gut vorstellen, wie Sie weinen. Wie ein Kind, untröstlich und rührend. Die meisten Männer mögen es nicht, wenn Frauen weinen, aber ich schon. Mich macht das unheimlich an.«
Zu Hause angekommen, stellte Olga erleichtert fest, dass ihre Familie bereits schlief. Die Kinder in ihrem durch Bücherregale zweigeteilten Zimmer – Andrej war im Sitzen auf dem Fußboden eingeschlafen, zwischen Tisch und Bett, in seinen zerschlissenen Hausjeans, mit Kopfhörern, aus denen hektischer Rap klang; Katja hatte sich immerhin die Mühe gemacht, einen Pyjama anzuziehen und sich ins Bett zu legen.
Olga weckte niemanden, schaltete Fernseher und Stereoanlage aus, entledigte sich der Jacke und der Stiefel, griff nach dem Telefon, ging barfuß auf Zehenspitzen ins Bad, schloss die Tür hinter sich und rief in der Klinik an.
»Hat Dussja sich wieder angefunden?«
»Nein. Wer weiß, wo die sich rumtreibt«, antwortete die diensthabende Schwester Galja nach einem langen Gähnen. »Es ist Frühling, sie streunt durch die Gegend. Ist nun mal eine Katze.«
»Und was macht der Neue?«
»Alles in Ordnung. Er schläft.«
»Sieh bitte mal nach. Ich bleibe am Apparat.«
»Wozu denn? Ob er vielleicht abgehauen ist?«
Stimmt, ist ja Unsinn, tadelte sich Olga. Wo soll er hin?
Galja ging trotzdem nachsehen. Olga hörte, wie sie den Telefonhörer auf den Tisch legte und in Pantoffeln über das abgewetzte Linoleum schlurfte. Einen Moment lang fühlte sich Olga unbehaglich, ganz allein mit der lebendigen Stille im Hörer. Sie saß auf dem Wannenrand. Aus dem Hahn tropfte es träge.
Olga schloss die Augen, um ihr Gesicht nicht im Spiegel zu sehen. In dem hellen Licht wirkte es grau und alt. Sofort erschien im regenbogenfarbenen Schimmern unter ihren Lidern das Gesicht des Unbekannten. Ein Mann zwischen fünfunddreißig und vierzig. 1,80 groß, 73 Kilo schwer, der Kopf kahlgeschoren. Kleine braune Augen, rundes Gesicht. Gerade, platte Nase. Volle, glänzende, leuchtend rote Lippen, wie geschminkt. Rosa Pusteln unterm Kinn, eine Hautreizung vom Rasieren. Keine besonderen Kennzeichen zur Identifizierung.
»Nehmen Sie einfach an, dass Sie einen Toten vor sich haben. Eine Person ohne Papiere, ohne Namen, ohne Gedächtnis – das ist doch ein Toter, stimmt’s? Sie werden mich reanimieren müssen, Olga. Ist zwar nicht ganz Ihr Metier, aber was tun?«
Nach einer Ewigkeit kam die Nachtschwester wieder ans Telefon.
»Wie ich gesagt habe, er schläft, der verdammte Karussellfahrer. Ihnen auch eine gute Nacht.«
Am Vortag hatte der Nachtwächter des Kulturparks am frühen Morgen in einer Riesenradkabine einen Mann entdeckt. Die Kabine schwebte ganz oben. Der Strom war abgeschaltet und der Mann vergessen worden. Er hatte die ganze Nacht dort verbracht. Am Morgen, als das Riesenrad wieder eingeschaltet und die Kabine mit dem Unglücklichen heruntergeholt wurde, wollte er nicht aussteigen. Auf Fragen reagierte er nicht. Er klammerte sich an die stählernen Kabinengriffe und starrte ausdruckslos vor sich hin.
Die vorläufige Diagnose des Notarztes lautete: psychogene Starre. Plus Unterkühlung. Der Mann war für die Aprilfröste viel zu leicht gekleidet: T-Shirt, Flanellhemd und dünn gefütterte Jeansjacke. Seine Taschen enthielten lediglich zweihundert Rubel und etwas Kleingeld, eine halbleere Schachtel Marlborogh light und ein billiges Wegwerffeuerzeug. Auf der Station bekam er den Namen »Karussellfahrer« verpasst – schließlich musste man ihn ja irgendwie nennen.
Er redete erst am Abend, bei Doktor Olga Filippowa.
Boris Rodezki öffnete die Augen und sah einen schwarzen Busch, der von Autoscheinwerfern angeleuchtet wurde und sich bewegte. Der Park war menschenleer. Rodezki saß auf einer eiskalten Bank und war so durchgefroren, dass seine Zähne klapperten. Er hatte nicht die Kraft, aufzustehen und nach Hause zu gehen.
Ganz in der Nähe tönte Musik, mal lauter, mal leiser, als spiele jemand am Lautstärkeregler. Hinter dem Park, auf der anderen Straßenseite, lag ein bunt beleuchtetes Kasino. Rodezki wusste, dass dort an der Fassade ein Clown mit Zylinderhut mit einem Kartenspiel jonglierte.
Das Kasino war vor drei Jahren eröffnet worden; in dem Gebäude hatte sich früher ein Dienstleistungszentrum befunden, im Erdgeschoss Wäscherei und chemische Reinigung, im ersten Stock Schneiderei, Kunststopferei und Fotoatelier.
Eines Abends war an der renovierten Fassade der Clown mit den Spielkarten aufgeleuchtet. Rodezki war gerade auf dem Heimweg aus der Klinik, in der seine Frau im Sterben lag. Der Clown tauchte unvermittelt aus der Dunkelheit auf und hing in der Luft, unter der halbrunden Leuchtschrift: Kasino. Er warf Karten in die Luft, zwinkerte und lachte.
An jenem Abend war Rodezki zum ersten Mal bewusst geworden, dass sich kein Wunder ereignen würde. Nadja verließ ihn. Nicht einmal in Gedanken konnte er sagen: Sie stirbt. Er saß am Steuer seines alten Shiguli und weinte. Der elektrische Clown schaute auf ihn herab und lachte.
Inzwischen waren drei Jahre vergangen. Irgendwie lebte Rodezki trotzdem weiter, ohne Nadja. Er wusste, dass sie sich bald wiedersehen würden. Rodezki hatte keine Angst mehr vorm Tod. Sterben hieß für ihn nur, zu Nadja gehen.
Doch nun erfuhr er, dass es Schlimmeres gab als den Tod. Trauer und Scham. Dinge, mit denen man nicht fortgehen konnte.
»Hast du vergessen, dass keine gute Tat ungestraft bleibt?«
Rodezki redete mit sich selbst. Er kniff die Augen zusammen, hielt sich die Hände vors Gesicht und hauchte in die eiskalten Handflächen. Wenn er hier nur noch ein paar Minuten sitzenblieb, würde er nie mehr aufstehen können.
Die Musik verstummte. Einige Sekunden lang herrschte eine seltsame Stille, erfüllt vom Rascheln und Flüstern der kahlen Zweige. Rodezki war nun nicht mehr allein im Park. Jemand kam die Allee entlang. Weiche Schritte näherten sich. Den alten Lehrer erfassten Angst und ein Zittern. Er wagte nicht, den Kopf zu drehen, um zu sehen, wer da kam. Plötzlich fragte eine Stimme neben ihm: »Ist Ihnen nicht gut?«
Vor ihm stand eine Frau in seinem Alter. Strickmütze, Jacke, Jeans und eine große Einkaufstasche über der Schulter.
»Hören Sie mich?« Die Frau tippte ihn an.
»Haben Sie vielleicht Nitroglyzerin dabei?«, fragte er mühsam, mit trockenen Lippen. Er sprach undeutlich, es klang wie »Niglin«, aber die Frau verstand.
»Das Herz, ja? Augenblick. Ich hab was dabei. Das nehme ich immer mit, für alle Fälle. Soll ich vielleicht den Notarzt rufen? Ich habe ein Handy.«
»Nicht nötig, danke.« Er schob sich zwei Tabletten in den Mund und nahm nicht einmal den widerlichen bittersüßen Geschmack wahr. Der Schmerz im Herzen betäubte alle anderen Empfindungen.
»Soll ich Sie begleiten?«
»Nein, danke. Gehen Sie nach Hause. Es ist schon spät. Und kalt.«
Das Sprechen fiel ihm schwer, er keuchte heftig. Die Frau ging nicht, sondern setzte sich neben ihn auf die Bank.
»Ist etwas passiert?«
Sie hatte eine so warme, sanfte Stimme und so mitfühlende Augen, dass Rodezki ihr am liebsten alles erzählt hätte. Er konnte sich sonst niemandem mitteilen. Aber er würde es nicht so erklären können, dass sie verstand.
»Ein Herzanfall, aber es wird schon besser. Danke. Es ist alles in Ordnung.«
Sie half ihm aufstehen. Er erklärte, wo er wohnte. Es war nicht weit. Unterwegs erzählte ihm die Frau von ihren beiden Söhnen, den Schwiegertöchtern, den Enkeln und von ihrem Mann, der im Alter mit dem Trinken angefangen hatte, der alte Esel.
Na also, es gibt noch etwas Normales, Lebendiges, dachte Rodezki, mühsam laufend und gegen die Atemnot ankämpfend. Sie hilft mir ganz uneigennützig, aus Herzensgüte. Es gibt viele gute Menschen. Es scheint nur so, als sei die ganze Welt vertiert. Sobald man einmal mit etwas wirklich Bösem konfrontiert wird, glaubt man gleich, dass es nichts anderes mehr gebe. Vielleicht sollte ich ihr alles erzählen?
Aber er wusste: Er würde niemandem je erzählen, was ihm widerfahren war, warum er am späten Abend auf einer Bank im kalten, menschenleeren Park gesessen und so heftige Herzschmerzen bekommen hatte. Nicht einmal mit Nadja, wenn sie noch am Leben wäre, hätte er dieses Geheimnis teilen können. Dabei hatte er ihr immer alles erzählt.
»Ist jemand bei Ihnen zu Hause?«, fragte die Frau vor seiner Haustür.
»Ja, natürlich«, schwindelte er. »Ich danke Ihnen.«
»Gern geschehen.« Sie nickte und lächelte.
Im stillen Hof ertönte plötzlich Glockengeläut. Die Frau seufzte und zog ein Telefon aus der Handtasche.
»Ich komme schon, bin gleich da, schrei nicht so! Du bist doch kein kleines Kind! Kannst du es dir nicht selber warmmachen? Steht alles im Kühlschrank, tu’s in eine Pfanne und stell’s auf den Herd.«
Sie nickte Rodezki noch einmal zu und ging rasch davon, noch immer ins Telefon sprechend. Er bedauerte, dass er sie nicht nach ihrem Namen gefragt hatte.
Zweites Kapitel
Der Zeuge Oleg Krasnoschtschokow war erstaunlich ruhig. Kaum zu glauben, dass er wirklich vor einer halben Stunde im Wald auf eine Leiche gestoßen war. Er hatte sie nicht nur gesehen, er war im Dunkeln ausgerutscht und direkt daraufgefallen. Er hatte etwas Kaltes, Glitschiges unter der Hand gespürt, es mit dem Feuerzeug angeleuchtet und da erst entdeckt, dass es ein totes Mädchen war.
Während er seine Aussage machte, zitterten ihm nur ein wenig die Hände.
»Ich hab gehalten, weil ich pinkeln musste. Na, und Kusja ist auch mit raus. Er ist eigentlich sehr folgsam und ruhig, aber plötzlich rastete er total aus. Er rannte los in den Wald, bellte und heulte. Ich rief ihn, aber er kam nicht zurück. Ich hörte ihn ganz in der Nähe wie verrückt bellen. Gut, dass ich eine Taschenlampe im Auto habe. Ich bin also Kusja nach, durch den ganzen Dreck und Schneematsch. Dabei bin ich ausgerutscht und direkt auf sie draufgefallen, stellen Sie sich das vor! Ein Wunder, dass ich keinen Herzschlag gekriegt hab. Aber mein Kusja, der Dummkopf, hat gar nicht sie gewittert, er hat bloß einer Krähe nachgebellt. Alberner Jagdinstinkt!«
Er sprach leise und langsam. Seine Freundin dagegen war vollkommen hysterisch. Als die Einsatzgruppe ankam, hatte sie geschrien und geheult und später im Notarztwagen leise vor sich hin gejammert: »O Gott, o Gott, o Gott!«
Sie hatte eine Beruhigungsspritze bekommen.
»Nein, ich habe nichts angefasst, ich hab natürlich gleich die 02 angerufen. Aber ich bin im Dunkeln auf sie draufgefallen. Vielleicht hab ich dabei irgendwelche Spuren verwischt.« Der Zeuge zündete sich erneut eine Zigarette an. »Verdammt, sie war noch ganz jung, ein Kind, höchstens zwölf! Sie wird mir für den Rest meines Lebens im Traum erscheinen.«
In den siebzehn Jahren bei der Kriminalmiliz war Dmitri Solowjow bisher nur viermal mit Kinderleichen konfrontiert gewesen. Dies war die fünfte. Der Fundort war ein Waldrand an der Pjatnizkoje-Chaussee, zwanzig Kilometer entfernt vom Moskauer Stadtring. Die Tote war ein Mädchen, zwölf bis vierzehn Jahre alt. Sie hatte langes dunkles Haar. Der Körper war nackt. Ihre Kleider – Jeans, Stiefel, Pullover und Jacke – waren im Umkreis von zwei Metern um den Fundort verstreut. Mutmaßliche Todesursache: mechanische Asphyxie durch Erwürgen. Bei der ersten Untersuchung wurden außer den Würgemalen am Hals keinerlei Anzeichen für sonstige Verletzungen festgestellt.
»Aber ich glaube, die Position war irgendwie anders. Ich glaube, sie hat gesessen, an einen Baumstamm gelehnt. Sie ist umgekippt, als ich auf sie drauffiel. Ein Wunder, dass ich keinen Herzschlag gekriegt hab. Da war was Kaltes, Glitschiges unter meinen Händen, und es hat sich irgendwie bewegt, stellen Sie sich das vor! Und dann dieser Geruch, so komisch süß. Wie Bonbons oder Kaugummi, in der Art.« Der junge Mann verzog das Gesicht und betrachtete seine Hände.
»Öl«, sagte seine Freundin. »Körperöl. Deine Hände riechen immer noch danach, und auf deinem Pullover sind Fettflecke.«
Die junge Frau war unbemerkt herangetreten und stand nun neben ihm. Sie hatte sich fast beruhigt, sie zitterte nur vor Kälte.
»Wie kommen Sie darauf?«, fragte Solowjow.
»Dazu braucht man nicht viel Grips.« Das Mädchen zündete sich eine Zigarette an. »Liegt doch auf der Hand. Psychopath ist Psychopath. Die denken sich doch immer irgendwas Originelles aus. Für die ist Mord eine Art Performance. Ein schöpferischer Akt. Ein Kunstwerk, verdammt. Wieso – haben Sie eine andere Theorie?«
Solowjow zuckte wortlos die Achseln, sprang über den Straßengraben und tauchte unter dem Absperrband hindurch. Die Zeugen blieben am Straßenrand stehen.
»Den kriegen Sie sowieso nie. Übrigens ist gerade Vollmond. Da werden Psychopathen besonders aktiv.«
»Woher weißt du denn das?«
»Ich lese eben schlaue Bücher.«
Solowjow schaute sich um. Die Zeugen standen Arm in Arm da und beobachteten, wie die blasse, vollkommen runde Mondscheibe hinter den Wolken hervorglitt.
»Hier sind überall Büsche und Zweige abgeknickt«, sagte der Spurensicherer leise. »Wie von einem Orkan.«
Der Strahl einer Taschenlampe bewegte sich langsam im Kreis.
»Bei dieser Dunkelheit hat das keinen Sinn«, sagte Oberleutnant Anton Gorbunow. »Wir müssen warten, bis es hell wird.«
Solowjow schwieg. Der Lichtstrahl fiel auf den dünnen Stamm einer jungen Birke. Der Baum stand schräg, als hätte in der Tat ein Orkan daran gerüttelt und ihn entwurzeln wollen. Solowjow kehrte zu dem Leichnam zurück.
Ein süßer Geruch schlug ihm entgegen. Stimmt, wie Bonbons oder Kaugummi. Der Täter musste eine ganze Flasche Öl ausgekippt haben. Die leere Plastikflasche lag gleich daneben. Auf dem Etikett prangte ein lächelndes Kind, in ein rosa Handtuch gehüllt. »Babydream«. Pflegeöl nach dem Baden. Fünfhundert Milliliter. Das gab es in jeder Apotheke. Solowjow registrierte, dass der Deckel wieder ordentlich aufgeschraubt worden war. Die Fingerabdrücke waren vermutlich abgewischt worden. Ein ordnungsliebender Mörder.
Der Lichtstrahl glitt über eine Hand mit grell lackierten kurzen Fingernägeln.
»Sie ging noch zur Schule«, murmelte Solowjow, »war bestimmt eine gute Schülerin.«
»Wie kommen Sie darauf?«, fragte der Kriminaltechniker.
»Die charakteristische Verdickung am obersten Glied des Mittelfingers. Typisch für jemanden, der viel mit der Hand schreibt.«
Da haben wir schon den ersten Unterschied, dachte Solowjow. Die anderen Kinder hatten glatte Finger, ohne Schwielen. Sie haben nicht viel geschrieben. Sie gingen nicht zur Schule, sonst hätte sie irgendwer identifiziert.
»Ach, was haben wir denn hier?« Solowjow bog vorsichtig ein Büschel vertrocknetes vorjähriges Gras beiseite.
»O mein Gott«, stöhnte der Kriminaltechniker und hob mit einer Pinzette einen hellblauen Babynuckel auf.
Einen Augenblick schwiegen alle. In der eintretenden Stille schien es irgendwie besonders kalt. Die Hände in den Gummihandschuhen waren steif vor Kälte. Solowjow meinte einen einsamen Vogel zwitschern zu hören. Aber es konnte keine Vögel geben hier in diesem Wald, Anfang April, bei Frost, höchstens Krähen. Doch das Zwitschern hörte nicht auf. Solowjow ging dem Geräusch nach und leuchtete mit der Taschenlampe jeden Zentimeter ab.
Es war ein Mobiltelefon. Es lag unter einem Baum, grellrosa, mit einem kleinen goldenen Schuh als Anhänger.
Solowjow hob es vorsichtig auf und drückte auf Annahme.
»Hallo! Shenja! Wo steckst du? Hallo! Melde dich doch! Shenja, mein Kind …«
Die heisere Frauenstimme traf Solowjows Ohr wie ein Trommelfeuer. Das Telefon piepste und verstummte. Der Akku war alle.
Der Wanderer war aus dem Reich des Lichts, wo alles klar war, zurückgekehrt in die Realität, in die ewige Nacht, wo nichts verständlich war. Er hatte seine heilige Mission erfüllt. Einen Engel gerettet.
Er erinnerte sich nur vage daran, wie er durch die nächtliche Stadt geirrt und wieder zu seinem Auto gelangt war. Er schaute sich um, als sähe er das alles zum ersten Mal. Nacht. Mitten in Moskau. Der Fluss. Eine Brücke. Dunkle Häuserblocks. Der ölige Lichtschimmer der Straßenlaternen, rote, blaue und gelbe Neonreklame.
Öde und beängstigend war diese Stadt voller Leben, voller Menschenleiber – unter der Erde, über der Erde, in den Tiefen der Metro und in den obersten Etagen der Hochhäuser. Drogen, Prostitution, dumpfer Existenzkampf, geschäftige Befriedigung schmutziger Lüste. Ein Triumph des Bösen, auf Millionen Fernsehbildschirme, Computermonitore und Zeitungsseiten gebannt.
Das Ende der Welt war bereits da, aber niemand hatte es bemerkt, weil niemand es bemerken konnte. Die Welt war voller Hominiden, Mutanten, Dämonen in Menschengestalt. Im Grunde waren sie alle Tiere, Affen. Sahen aber aus wie Menschen. Doch der Mensch hatte eine Seele, der Affe dagegen nicht. Ein Hominide war ein fleischfressendes Scheusal, hinterlistig, aggressiv, für ein Stück Fleisch zu allem bereit. Aber sie begnügten sich nicht mit Fleisch allein, nein, das reichte ihnen nicht. Wie jede Ausgeburt der Hölle fraßen sie Seelen.
Der Mythos von der tierischen Abstammung des Menschen hat mit den Hominiden zu tun. Sie und der Homo sapiens haben ganz verschiedene Wurzeln. Die menschenähnlichen Wesen sind Geschöpfe des Teufels. Sie entstanden zur gleichen Zeit wie die Menschen, als teuflische Alternative zum vernunftbegabten, geistigen Menschen.
Der kräftige große Mann in der dunklen Jacke stand auf der Krimbrücke, beugte sich über das Geländer und sah seiner Zigarettenasche nach. Das Wasser war genauso grau und trübe wie die Asche. Nach einer langen Tauwetterperiode herrschte nun erneut Frost, doch der Fluss war ohne Eiskruste.
Die Zigarette war bis zum Filter heruntergebrannt. Er warf die Kippe in den Fluss, beugte sich noch tiefer hinunter und beobachtete, wie das Glutfünkchen in der schwarzen Tiefe langsam erlosch. Der gierige schwarze Abgrund schaute direkt in seine Seele und flüsterte: He, was hast du denn? Hab keine Angst!
»Ich war halbnackt, ja, schließlich muss ich die Klamotten ja anprobieren. Und da zieht der Typ den Vorhang auf, starrt mich an und meint: Oh, pardon, ich dachte, hier wäre frei. Eine glatte Lüge! Ich weiß Bescheid, der macht das mit Absicht! Immer, wenn ein Mädchen in eine Kabine geht, zieht der Kerl den Vorhang auf, von wegen: Oh, pardon! Verschafft sich ne kostenlose Peepshow, der Arsch!«
Die Stimme klang so nahe, so durchdringend, dass der Wanderer beinahe von der Brücke gestürzt wäre.
»Ach, Scheiße, meine Kippen sind alle!«
»He, Sie, haben Sie mal ne Zigarette?«
Zwei etwa vierzehnjährige Mädchen sahen den Wanderer an und klapperten mit den dick geschminkten Lidern. Im Licht der Straßenlaterne funkelten Piercingringe, bei der einen in der Augenbraue, bei der anderen in der Nase. Die glänzenden, geschminkten Lippen der beiden lächelten. Trotz der Kälte trugen die Mädchen enge Miniröcke, die tief unter der Taille saßen, und extrem kurze Jacken, die ihre flachen Bäuche entblößten. Die eine hatte einen Metallstift mit einer glänzenden Kugel im Nabel, die andere ein Tattoo, eine farbige Rose. Beide hatten lange, schlanke Beine, die in Netzstrumpfhosen und Lackstiefeln mit sehr hohen Absätzen steckten.
»He, Sie!« Eines der Mädchen wedelte vor seinen Augen mit der Hand. »Haben Sie vielleicht eine Zigarette? Sind Sie taub, oder was?«
Er konnte nicht antworten. Er sah sie an, ohne zu blinzeln. Sie lachten und gingen weiter.
Durch das heisere Lachen, den Gestank nach Alkohol und billigem Parfüm, durch die Leiber der jungen Hominidinnen hindurch hörte er deutlich leises Weinen. Es waren die Engel, die da weinten, sie waren schon sehr schwach, aber noch am Leben. Er sah sie aus den dick umrandeten Augen dieser beiden unglücklichen, verlorenen Geschöpfe blicken, sie schauten ihn durch die geschminkten Wimpern hindurch an wie durch Gefängnisgitter: Hilf uns, rette uns! Wer, wenn nicht du?
Die Mädchen liefen laut lachend weiter über die Brücke. Ihm wurde heiß. Seine Hände waren schweißnass, sein Mund war trocken. Er folgte den Mädchen, erst langsam, dann immer schneller. Er wusste, dass er das nicht tun sollte, mit zweien würde er nicht fertig werden.
Eines der Mädchen drehte sich um, sah, dass er ihnen folgte, sagte etwas zu ihrer Freundin, und die beiden rannten los. Sie kamen nicht sehr schnell voran, dazu waren ihre Absätze zu hoch und zu schmal. Er hätte sie mühelos einholen können. Aber nur ein Verrückter würde sie hier mitten im Zentrum verfolgen. Der Wanderer aber handelte stets überlegt.
Er blieb stehen, atmete durch und ging dann in die entgegengesetzte Richtung, weil ihm einfiel, dass er dort sein Auto geparkt hatte.
Der unbekannte Patient, der Karussellfahrer, lag mit offenen Augen im Bett. Draußen vorm Fenster schaukelte eine Lampe hin und her. Der Schatten des Fenstergitters kroch langsam über die Decken und die Gesichter der Patienten. Einer murmelte im Schlaf vor sich hin, einer wälzte sich herum, und das Quietschen der panzerharten Matratze hallte im Kopf wider wie das Knirschen von Sand zwischen den Zähnen.
Irgendwo weit weg klingelte ein Telefon. Der Karussellfahrer geriet in Panik. Vielleicht galt der Anruf ihm? Er wusste, dass das unlogisch war, dennoch brach ihm vor Angst der Schweiß aus.
Das Klingeln hörte auf. Endlich hatte jemand abgenommen. Nach einer Weile näherten sich im Flur Schritte. Der Karussellfahrer zog sich sicherheitshalber die Decke über den Kopf, bis auf einen kleinen Spalt, damit er sehen konnte, wer hereinkam.
Ein Schlüssel knirschte im Schloss. Eine Schwester betrat das Zimmer. Die Schwestern hier waren eine wie die andere kräftige Matronen mit schweren Fäusten. Er hielt die Luft an, als sie an sein Bett trat.
Warum kommt sie zu mir? Wieso steht sie hier und sieht mich an?
Die Schwester gähnte herzhaft, reckte sich, murmelte etwas vor sich hin und schlurfte davon. Die Tür wurde wieder geschlossen. Der Karussellfahrer atmete erleichtert auf, und ihm wollten schon die Augen zufallen, als der Alte im Bett neben ihm sich plötzlich aufsetzte und laut rief: »Natascha!«
»Was hast du?«, fragte der Karussellfahrer flüsternd.
»Natascha, meine Frau. War sie gerade hier?«
»Nein. Das war sie nicht.«
»Wer denn?«
»Eine Schwester.«
»Wieso?«
»Woher soll ich das wissen? Schlaf weiter.«
Doch der Alte dachte nicht an Schlaf. Er schaute sich unruhig um, starrte den Karussellfahrer an, zeigte dann mit dem Finger auf die Tür und sagte: »Das Telefon. Das Telefon hat geklingelt. Haben Sie das gehört?«
»Ja. Und?« Der Karussellfahrer drehte sich weg. Er hatte absolut keine Lust, sich mit seinem verrückten Nachbarn zu unterhalten.
»Das war Natascha, ich weiß es.« Der Nachbar berührte seine Schulter. »Das war sie, aber sie haben mich nicht ans Telefon geholt. So ist das immer. Sie ruft an, und sie holen mich nicht und sagen mir nicht Bescheid. Das machen sie mit Absicht. Natürlich, unser Verhältnis wirkt ein bisschen komisch, sie könnte meine Tochter sein. Moment, ich zeige Ihnen ein Foto, dann verstehen Sie, was ich meine.«
Meinetwegen, was soll’s, dachte der Karussellfahrer, ist immerhin eine Ablenkung, ich kann sowieso nicht mehr einschlafen.
Er drehte sich zu seinem Nachbarn um und warf einen flüchtigen Blick auf ein Farbfoto. Der Alte hielt es ihm direkt vor die Nase, gab es ihm aber nicht in die Hand und versteckte es hastig wieder unter seinem Kopfkissen.
»Sehen Sie, wie schön sie ist? Wenn wir zusammen weggehen, dann schauen alle Männer sie an. Ich habe mich mein Leben lang für einen anständigen, vernünftigen und nüchternen Mann gehalten, ich dachte, ich hätte meine Gefühle vollkommen im Griff und mich immer unter Kontrolle. Aber das war wie eine Heimsuchung, wie Hypnose, ich habe meine Familie verlassen und verraten, und nun muss ich dafür büßen. Ich habe es verdient. Was soll ich machen? Ich habe es verdient …«
Die Worte des Alten wurden immer undeutlicher, er fiel mit dem Gesicht aufs Kissen, murmelte weiter, schluchzte, verstummte schließlich und schlief ein.
Die Nacht neigte sich zum Morgen. Im Zimmer war es schwül, es roch nach Chlor und schwarzer Schwermut.
Nein, tröstete sich der Karussellfahrer, das hier ist nicht die Hölle. Das hier ist viel besser. Die Hölle, das war, als sie mir dicht auf den Fersen waren. Die Hölle, das war in der Riesenradgondel, als ich vor Kälte fast krepiert wäre. Hier dagegen kann man’s aushalten. Hier werde ich überleben.
Boris Rodezki liebte seine kleine, saubere Wohnung. Im Wohnzimmer ein runder Tisch mit einer weinroten Tischdecke, ein Sofa und zwei Sessel, alles schon ziemlich zerschlissen, aber sehr bequem. Im Schlafzimmer, das ihm auch als Arbeitszimmer diente, stand ein alter Schreibtisch, der drei Kriege und Tausende korrigierter Schulaufsätze mitgemacht hatte. Das schwere Eichenmöbel mit der ledernen grünen Schreibtischunterlage passte nicht recht zu der schmalbeinigen Liege aus den siebziger Jahren, doch über der Schaumgummimatratze lag ein grüner Überwurf, passend zur Schreibtischunterlage. Grün waren auch die Vorhänge und der Schirm der Schreibtischlampe. Das Licht mit dem hellgrünen Schimmer schuf eine Illusion von ewigem Frühling, von frischem Waldgrün, von Ruhe und Glück.
In beiden Zimmern und im winzigen Flur reichten Bücherregale vom Boden bis zur Decke. Zweimal in der Woche putzte Rodezki gründlich, wischte feucht, saugte und polierte. Er duldete keine Unordnung.
Wo keine Bücherregale standen, hingen Fotos an der Wand. Klassenfotos von 1965 bis 2002. Seine Schüler.
Die ältesten Fotos waren mit Ähren, den Profilen von Lenin, Marx und Engels, den Silhouetten der Kremltürme und Fabrikschloten geschmückt. Unverzichtbar waren Hammer und Sichel, das Staatswappen der UdSSR. In den siebziger Jahren tauchte hin und wieder Breshnew mit seinen buschigen Augenbrauen auf. Je näher die Neunziger rückten, desto seltener wurde die Sowjetsymbolik. Das bärtige kommunistische Dreigespann wich Puschkin, Tolstoi, Gorki und Majakowski. Auf den letzten beiden Fotos prangte statt Gorki Dostojewski, statt Majakowski Pasternak.
Rodezki übernahm alle drei Jahre eine neue Klasse und führte sie von der Achten bis zur Zehnten. In siebenunddreißig Jahren hatte er zwölf Klassen gehabt. Fast viertausend Schüler. Er erinnerte sich an jeden namentlich.
Außer den Schulfotos gab es noch Familienfotos. Mehrere Generationen Rodezki. Die junge Großmutter Maria in der Uniform der barmherzigen Schwester (Kunstfoto von I. I. Rosenblatt, Jekaterinburg 1912), der junge Großvater Stanislaw Rodezki in Offiziersuniform, Fähnrich der Zarenarmee, ein Pole aus dem niederen Adel. Dasselbe Jahr, dieselbe Stadt. Und der Stempel desselben Fotoateliers. Die beiden lernten sich kennen, als sie die Fotos abholten.
Ein erschrocken wirkendes Kleinkind im Spitzenhemd vor einer felsigen Grotte, einer Sperrholzdekoration, fotografiert von Fr. de Maizière, Moskau 1917 – der einjährige Sascha Rodezki, der Vater von Boris.
Auf den übrigen Fotos gab es keine verschnörkelten Fotografenstempel, keine Spitze und keine Sperrholzgrotten. Großvater Stanislaw in Rotarmistenuniform, Großmutter Maria in einer abgewetzten Lederjacke, streng und mit kurzen Haaren. Boris’ Vater als Schüler mit Pionierhalstuch unter einem Stalinbild.
1912 war der katholische Großvater zum orthodoxen Glauben übergetreten, um die aus einer strenggläubigen Kaufmannsfamilie stammende Maria Kusina heiraten zu können. 1919 lief der Großvater als Offizier zur Roten Armee über, um nicht erschossen zu werden.
Rodezki kannte seinen Großvater nur als Invaliden, als zahnlosen, schrecklich dünnen Greis in Wattejacke. Er war 1954 in der Familie aufgetaucht, als Boris elf Jahre alt war. Dem Kind wurde erklärt, der Großvater sei von einer langen Dienstreise aus Sibirien zurückgekehrt. Er habe dort an einem geheimen Rüstungsbetrieb mitgebaut. Aber Boris wusste, dass das keine Dienstreise gewesen war. Großvater hatte im Lager gesessen, von Stalin eingesperrt. Nun war Stalin tot, und Chruschtschow hatte den Großvater rausgelassen.
Großvater Stanislaw rauchte stinkende Papirossy und hustete nachts dumpf. Er hatte Parkinson, sein Kopf zitterte, was aussah, als ob er jemandem zuhörte und dazu nickte.
Die Fotos von Rodezkis Mutter und seiner Frau Nadja steckten zusammen in einem Rahmen. Beide hatten helles, glatt zurückgekämmtes und im Nacken zu einem schweren Knoten gebundenes Haar, gerade, dunkle Augenbrauen und weiche Gesichtszüge. Seine Mutter hatte braune Augen, seine Frau graublaue. Auf den Schwarzweißfotos sah man den Unterschied nicht. Auch den zeitlichen nicht. Seine Mutter war auf dem Foto fünfunddreißig, seine Frau im selben Alter. Sie ähnelten sich wie Schwestern.
Daneben, auch zusammen in einem Rahmen, hingen die Fotos seines Vaters Alexander und seines Sohnes Stanislaw, ebenfalls im selben Alter, beide mit siebenunddreißig. Doch sie sahen sich kein bisschen ähnlich. Sein Vater hatte eine Glatze, eine große, breite Nase und trug eine runde Brille. Sein Sohn hatte dichtes helles Haar, ein längliches, regelmäßiges Gesicht und eine edle schmale Nase.
Von den vier Rodezki am nächsten stehenden Menschen lebte nur noch sein Sohn. Rodezki hatte ihn vor drei Jahren zum letzten Mal gesehen, nach Nadjas Tod. Stanislaw, inzwischen Augenarzt, war aus Amerika angereist, hatte es aber nicht mehr zur Beerdigung seiner Mutter geschafft. Nach einer Woche bei seinem Vater war er zurückgeflogen nach Boston. Dort hatte er eine hochbezahlte Stelle in einer Klinik, seine amerikanische Frau Joy und zwei Kinder, die fünfjährige Sonja und die dreijährige Nadja. Boris Rodezki hatte seine Enkelinnen noch nie gesehen. Das große Farbfoto der beiden blonden Mädchen stand auf einem Ehrenplatz auf dem Schreibtisch.
Stanislaw lud seinen Vater immer wieder ein, nach Boston zu kommen, aber Rodezki zögerte jedesmal, er wollte erst seine jeweilige Klasse zum Abschluss führen.
Die Schule, in der er sein Leben lang unterrichtet hatte, galt als eine der besten Moskauer Spezialschulen. Die Regierung wechselte, die Lehrbücher wurden umgeschrieben, Direktoren kamen und gingen. Boris Rodezki aber unterrichtete nach wie vor russische Sprache und Literatur in den oberen Klassen.
Er fand die Literatur interessanter und verlässlicher als das reale Leben. Mit zusammengekniffenen Augen tauchte er ein in die Texte der russischen Klassiker und fühlte sich in diesem vertrauten Element wie ein Fisch im Wasser. Doch sobald er daraus auftauchte, benahm es ihm den Atem, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern ganz direkt. Er bekam Asthmaanfälle.
Die Probleme in der Schule, die schwierigen Schüler, die Intrigen im Lehrerkollektiv, der Tod der Eltern, die Abreise des Sohnes nach Amerika, die Geldreform und die Krisen, das kleine Gehalt – all das berührte ihn nur oberflächlich. Bis die eiserne Hand der Realität zuschlug und ihn zerquetschte wie eine Fliege.
»Boris, ich habe Krebs«, sagte Nadja eines Tages. »Hör mir genau zu und hilf mir, eine Entscheidung zu treffen. Variante eins, die traditionelle: Operation, Chemotherapie, das volle Programm. Das bedeutet im besten Fall anderthalb bis zwei Jahre Leben. Variante zwei: Alles lassen, wie es ist. Dann bin ich in fünf, sechs Monaten tot. Aber es wird ein leichter Tod sein. Die Schmerzen sind mit Medikamenten sehr gut zu behandeln.«
Gemeinsam entschieden sie sich dennoch für Variante eins, und das darauffolgende Jahr wurde ein qualvoller, nutzloser Kampf. Von der Chemotherapie fielen die Haare aus, und jede kleine Schramme brauchte Monate zum Verheilen, schwoll an und eiterte. Dann die Operation, nach der ein künstlicher Darmausgang gelegt wurde. Rodezki konnte bis zum letzten Monat nicht glauben, dass seine Nadja starb, und als es dann geschah, starb er gleichsam mit ihr.
Er arbeitete weiter, ging jeden Tag in die Schule, korrigierte Aufsätze und gab Nachhilfestunden. Einmal stieß er auf zwei vollkommen identische Aufsätze zu »Krieg und Frieden«, recht flüssig geschrieben von zwei sehr schwachen Schülern.
»Die haben sie sich aus dem Internet geholt«, erklärte ihm ein jüngerer Lehrer.
Rodezki hatte von seinem Sohn einen Computer geschenkt bekommen, damit sie per E-Mail Kontakt halten konnten. Das Mailprogramm benutzte er auch, ging aber ansonsten nie ins Internet. Nun wollte er es doch einmal versuchen. Der neue Zeitvertreib gefiel ihm. Im Netz hatte man Zugang zu einer riesigen Informationsmenge, ohne das Zimmer verlassen zu müssen, die Wohnung mit Büchern oder Zeitschriften zuzuschütten oder den Fernseher einzuschalten.
Nun blätterte er sich abends durch Enzyklopädien, wanderte durch die berühmtesten Museen der Welt und durch Städte, die er nie besuchen würde. Er stöberte in Artikeln zu Literaturthemen und Bestsellerlisten. Hin und wieder schaute er in Chatrooms und las, was andere Benutzer schrieben, ohne sich selbst an den Debatten zu beteiligen.
Beim Surfen stieß er häufig auf Schmutz. Im Internet trieben sich viele Verrückte herum: Vampire, Hexen, schwarze und weiße Magier, Satanisten, Faschisten und Perverse aller Art. Vor allem gab es jede Menge Pornographie. Rodezki umging diese Dinge rasch und vorsichtig, wie schmutzige Pfützen, bemüht, nicht hineinzugeraten.
Doch eines Tages geschah es trotzdem.
In einem durchaus seriösen Chat mit klugen Diskussionen über Literatur. Einer der Teilnehmer behauptete, ein gewisser Mark Moloch sei ein Genie, ein neuer Nabokov. Das interessierte Rodezki. Er verließ den Chatroom und gab »Mark Moloch« in die Suchmaschine ein.
Der »neue Nabokov« entpuppte sich als einer der üblichen Pornographen. Doch beim flüchtigen Überfliegen seiner Texte stellte Boris immerhin fest, dass Mark Moloch eine recht flotte Schreibe hatte und nicht ohne literarisches Talent war. Als der alte Lehrer die Seite verlassen wollte, drückte er versehentlich auf einen falschen Button, und auf dem Bildschirm erschien eine Szene aus einem Pornofilm. Die Darsteller waren Kinder. Zwei Mädchen und zwei Jungen zwischen zehn und vierzehn Jahren.
Was ist denn das? Wie ist das möglich? Für so etwas muss es doch eine Zensur geben! Das ist ja kriminell! Noch dazu so offen, so ungeniert!
Boris bekam einen schweren Asthmaanfall. Er lief ins Bad, um sein Spray zu holen. Als er an den Computer zurückkehrte, war der Pornofilm ins Detail gegangen, die Kinder waren nackt und produzierten sich in verschiedenen Posen. Bloß weg damit, raus und vergessen! Sonst würde er noch verrückt. Boris griff nach der Maus und erstarrte – auf dem Bildschirm erkannte er eine Schülerin, die Achtklässlerin Shenja Katschalowa.
Drittes Kapitel
Olga Filippowa wurde einfach nicht wach. Der Wecker hatte geklingelt, sie hatte ihn auf Wiederholung gestellt und sich die Decke über den Kopf gezogen. Nach fünf Minuten klingelte er erneut. Olga setzte sich auf, und ihr Blick fiel sogleich auf den Spiegel auf der alten Frisierkommode im Schlafzimmer. Es war der freundlichste Spiegel in der Wohnung, doch heute schmeichelte auch er ihr nicht.
»Was verlangst du?«, fragte der Spiegel kalt. »Du bist einundvierzig, du bekommst nie genug Schlaf, deine Schläfen werden langsam grau. Wenn dir das nicht gefällt, färb dir die Haare. Rauch nicht so viel, reg dich weniger auf, verbring mehr Zeit an der frischen Luft, arbeite nicht mehr an Wochenenden, quäl dich nicht mit Dingen, an denen du nicht schuld bist, und auch nicht mit denen, an denen du schuld bist, denn deine Selbstvorwürfe nützen keinem etwas.«
In der Wohnung herrschte schrecklicher Lärm. In der Küche dröhnte der Fernseher, aus dem Kinderzimmer drang Rock ’n’ Roll. Katja sang den Presley-Titel mit und machte dazu ihre Gymnastik. Zwanzig Übungen für die Taille, zwanzig für die Hüften, dann ein paar spezielle Sprünge und Drehungen und schließlich Laufen auf dem Gesäß.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!