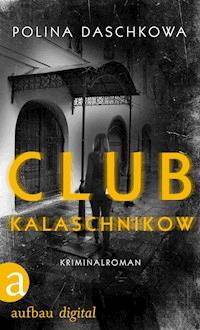Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Russische Ermittlungen
- Sprache: Deutsch
Lena fürchtet um ihr noch ungeborenes Baby. Es ist zwar kerngesund, aber da sind Leute, die ihr einreden, es sei schon tot. Instinktiv flieht sie aus der Klinik. Doch die Miliz glaubt ihr nicht. Als in Lenas Wohnung eingebrochen wird, erkennt sie, dass es offenbar um mehr geht als um eine medizinische Fehldiagnose. Sie wird gejagt …
Keine beschreibt das moderne Russland so packend wie sie. Polina Daschkowas Erfolgsgeschichte als Königin des russischen Krimis begann mit diesem Buch.
»Ein Kriminalroman, der den Leser permanent in Atem hält und keine Minute Langeweile aufkommen lässt.« Deutsche Welle.
»Unglaublich dicht und spannend!« Brigitte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Polina Daschkowa
Lenas Flucht
Kriminalroman
Aus dem Russischen von Helmut Ettinger
Impressum
Die Originalausgabe unter dem Titel»Krow neposhdjonnych«erschien 1998 im Verlag EKSMO-Press, Moskau.
ISBN E-Pub 978-3-8412-0296-3ISBN PDF 978-3-8412-2296-1ISBN Printausgabe 978-3-7466-2381-8
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2011© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, BerlinDie deutsche Erstausgabe erschien 2004bei Aufbau Taschenbuch; Aufbau Taschenbuch ist eine Markeder Aufbau Verlag GmbH & Co. KG© by Polina Daschkowa 1997
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung gold, Anke Fesel und Kai Dieterichunter Verwendung eines Fotos von Kai Dietrich / bobsairportKonvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,KN digital - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
Inhaltsübersicht
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Epilog
Erstes Kapitel
Sie fiel in ein bodenloses schwarzes Loch. In den Ohren rauschte es, der Körper verlor jeden Halt. Dieses widerliche Gefühl der Schwerelosigkeit kam ihr bekannt vor. So war es gewesen, wenn sie als Kind zu lange geschaukelt hatte und danach keinen festen Boden unter den Füßen fand. Der Horizont schwankte und wollte nicht wieder in die Waagerechte kommen …
Die bleischweren Lider ließen sich nur mit Mühe öffnen. Gleißendes Licht stach in die Augen. Sie suchte zu begreifen, wo sie war, aber es gelang ihr nicht. Dann drangen durch das Dröhnen im Kopf Stimmen an ihr Ohr.
Zwei junge Frauen sprachen miteinander:
»Hör mal, wenn sie künstliche Wehen bekommen soll, warum hat man sie dann so mit Promedol vollgepumpt? Die wacht doch bis morgen früh nicht auf.«
»Wir warten noch ein bißchen, dann wecken wir sie.«
»Was ist denn mit ihr?«
»Woher soll ich das wissen? Vielleicht ist das Kleine tot oder behindert. Was interessiert’s dich?«
»Einfach so … Sie tut mir leid. Oxana, vielleicht hör’ ich mal die Frucht ab?«
»Blödsinn, da ist nichts zu hören.«
»Nur so, zum Üben.«
»Na meinetwegen, wenn du unbedingt willst.«
Sie traten an das Bett heran. Die Frau lag regungslos mit geschlossenen Augen da. Sie spürte, wie sie sie aufdeckten. Dann wurde es ganz still. Ein Stethoskop glitt über ihren Bauch.
»Oxana, das Kind lebt! Der Herzschlag ist normal – hundertzwanzig! Vielleicht braucht sie gar keine künstlichen Wehen! Die ist doch höchstens fünfunddreißig.«
»Das ist es ja – fünfunddreißig. Eine alte Erstgebärende. Die kriegen behinderte Kinder.«
Oxana klopfte der Schwangeren leicht auf die Wangen.
»Aufwachen!«
Keine Reaktion.
»Oxana, komm, wir gehen erst mal Tee trinken. Laß sie doch noch ein bißchen schlafen.«
Sie deckten sie wieder zu, zogen den Wandschirm vor das Bett und verließen das Zimmer.
»Walja, steck deine Nase nicht in Sachen, die dich nichts angehen. Du reißt hier dein Praktikum runter und tschüß! Aber ich muß bleiben. So viel wie hier krieg ich als Schwester nirgends.«
Lena Poljanskaja erschrak so sehr, daß ihre Übelkeit sofort verflog. Als die Schritte der Schwestern verklungen waren, sprang sie aus dem Bett und schaute hinter dem Wandschirm hervor.
Das war kein Krankenzimmer, sondern eine Art Büro – ein Glasschrank mit Instrumenten und Arzneimitteln, eine ledergepolsterte Bank, ein Schreibtisch. Darauf erblickte sie ihre Handtasche. Über der Stuhllehne hing ein grüner Operationskittel. Lena griff nach Handtasche und Kittel und lugte auf den Gang hinaus. Der war leer. Gegenüber eine halb geöffnete Tür mit einem Schild, auf dem ein Männlein über eine Treppe lief: der Notausgang. Lena eilte, so schnell sie konnte, die Stufen hinunter.
Um sie war es dunkel und still. Ihre nackten Füße spürten die Kälte nicht. Das Herz schlug, als wollte es zerspringen.
Nach mehreren Treppenabsätzen mußte Lena innehalten, um Luft zu schöpfen. Wo renn’ ich eigentlich hin und warum? schoß es ihr durch den Kopf. In diesem Aufzug auf die Straße. Und was dann?
Schon etwas ruhiger, ging sie noch einige Stufen. Als ihr Blick nach unten fiel, konnte sie in der Dunkelheit eine schwach schimmernde Metalltür erkennen. Das war sicher der Keller.
Als die Krankenschwester Oxana Staschuk und die Praktikantin Walja Schtscherbakowa in das Zimmer zurückkehrten, war das Bett leer.
»Okay«, meinte Oxana, »jetzt ist sie selber aufgewacht. Wird wohl auf die Toilette gegangen sein. Wenn sie wieder da ist, fangen wir an.«
Ein hochgewachsener Mann in weißem Kittel und Gazemaske kam herein.
»Na, ihr Hübschen, wie geht’s unserer Patientin?« fragte er gutgelaunt.
»Entschuldigen Sie, Boris Wadimowitsch«, platzte Walja heraus und errötete heftig, »ich habe die Frucht abgehört. Das Herz schlägt normal, und das Kind bewegt sich. Vielleicht untersuchen Sie die Patientin noch einmal und entscheiden dann, ob wir anfangen sollen oder nicht.«
Der Stationsarzt Boris Wadimowitsch Simakow maß die kleine, rundliche Praktikantin mit einem Blick, vor dem jede andere im Boden versunken wäre. Aber Walja ließ sich nicht beirren.
»Ich verstehe, davon haben Sie nichts, aber man kann doch nicht …«
Nun platzte dem Arzt der Kragen.
»Du grüne Rotznase, wovon redest du? Was willst du eigentlich hier? Uns sagen, was wir zu tun haben?! Dir werd’ ich zeigen, was ein Praktikum ist! Oxana!« wandte er sich scharf an die Schwester. »Ist der Tropf angelegt?«
»Noch nicht, Boris Wadimowitsch. Die Kranke hat doch geschlafen. Wie sollte ich da den Tropf anlegen?«
»Warum haben Sie sie nicht geweckt?«
»Das habe ich versucht, aber sie hat doch Promedol gekriegt«, rechtfertigte sich Oxana. Sie trat so dicht an Simakow heran, daß er ihre straffe Brust spürte. »Keine Sorge. Sie ist eben von selbst aufgewacht. Wir fangen gleich an.«
Walja, deren Blick durch das Zimmer irrte, fiel plötzlich auf, daß die hübsche Handtasche der Patientin nicht mehr auf dem Schreibtisch stand. Ihre Kleider hatte sie selber in die Aufbewahrung getragen, aber ihre Tasche mit dem Paß war zurückgeblieben. Als dann das Krankenblatt endlich ausgefüllt war, hatte die Aufbewahrung bereits geschlossen. Auch der grüne Operationskittel hing nicht mehr über der Stuhllehne.
Dumm sind Sie nicht, Lena Poljanskaja, dachte Walja bei sich. Laut sagte sie:
»Entschuldigen Sie bitte, Boris Wadimowitsch. So bin ich eben – immer interessieren mich Sachen, die mich nichts angehen. Wir fangen jetzt gleich an.«
Im Keller war es dunkel. Nur der Mond schien schwach durch das trübe, halb geöffnete Fenster hoch oben unter der Decke.
Mit den nackten Füßen über den schmutzigen Boden zu laufen war widerlich, aber Lena entschloß sich, den Keller ganz zu erkunden. Zwar hatten sich ihre Augen inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt, aber sie konnte sich nur tastend vorwärts bewegen. Sie hielt sich dicht an der Wand. Am meisten fürchtete sie, sie könnte auf eine Ratte treten.
Der Keller war vollgestopft mit ausrangierten Möbeln, Bündeln alter Wäsche und allem möglichen Gerümpel. Unter dem Fenster standen einige Sperrholzkisten. Es war das einzige, von dem man das Metallgitter abgeschlagen hatte.
Die Kisten erwiesen sich als so stabil, daß sie sie zu einer Art Treppe aufstapeln konnte. Sobald es hell wurde, wollte sie hinausklettern und die nächste Milizstation aufsuchen. Aber was sollte sie dort erzählen? Egal, das kam später …
Aus den Kisten ragten Nägel, an denen sich Lena Hände und Füße blutig riß. Sie öffnete eines der Wäschebündel, zerrte ein paar verschlissene Bettücher heraus, nahm ihre ganze Konstruktion noch einmal auseinander, umwickelte jede Kiste sorgfältig mit den Laken und stellte sie wieder auf. Dann setzte sie sich auf die unterste Stufe und ließ ihre Füße auf einem weichen Wäschebündel ruhen.
An Schlaf war nicht mehr zu denken. Lena machte es sich bequem und begann darüber nachzugrübeln, was eigentlich mit ihr geschehen war.
Der betagte Arzt hatte ihren Bauch mit einem widerlichen Gel eingerieben, um eine Ultraschalluntersuchung vorzunehmen. Lange starrte er auf den flimmernden Bildschirm und wiegte schließlich besorgt den Kopf. Da war es sechs Uhr abends gewesen …
Als man ihr mitgeteilt hatte, ihr Kind sei tot, wischte sich Lena den Bauch mit einem Handtuch ab und schnürte ihre hohen Stiefel zu. Dem netten Doktor glaubte sie kein Wort. Daher war sie vollkommen ruhig. Aber er hielt sie ganz unmotiviert am Handgelenk fest und fühlte ihr den Puls.
»Moment mal, Kindchen, nicht so schnell! Wo wollen Sie denn hin in Ihrem Zustand? Warten Sie, ich gebe Ihnen eine Spritze, und Sie bleiben noch ein bißchen bei mir sitzen, bis Sie sich beruhigt haben. Inzwischen schreibe ich Ihre Überweisung aus. Sie müssen morgen früh sofort ins Krankenhaus.«
Der Arzt hatte warm und einfühlsam zu ihr gesprochen, dabei ihren Arm nicht losgelassen und ihr tief in die Augen geschaut. Sein Name wollte Lena nicht einfallen. Aber dieses intelligente, gütige Gesicht mit dem gepflegten grauen Bärtchen stand ihr deutlich vor Augen.
Danach hatte sie einen absoluten Filmriß. Bis sie in diesem Krankenbett wieder aufgewacht war.
Plötzlich durchfuhr Lena ein kalter Schreck: Wenn er ihr nun mit dem Schlafmittel etwas gespritzt hatte, das die Wehen auslöste? Wenn sie jetzt in diesem staubigen Keller ein winziges Kind zur Welt brachte, das in ihren Armen starb?
Lena schloß die Augen und lauschte in sich hinein. Nein, ihr tat nichts weh, nur das Herz schlug immer noch heftig, und ihre Knie zitterten. Völlig unerwartet für sich selbst sprach sie zum ersten Mal zu ihrem Kind: »Es ist alles in Ordnung, du Krümel. Wir beide stehen das durch.« Da spürte sie unter der Hand, die auf dem prallen Bauch lag, eine winzige Bewegung. So zart und geheimnisvoll war dieses Gefühl, daß sie für einige Momente völlig vergaß, wo sie war, gebannt von dem winzigen und doch schon lebendigen Wesen, das sich in ihrem Leib regte.
Die Leiterin der gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses von Lesnogorsk, Amalia Petrowna Sotowa, war sechzig Jahre alt. Groß und etwas füllig, wie es für eine Frau jenseits der Fünfzig nur von Vorteil ist – weniger Falten und eine würdevolle Erscheinung –, behandelte Amalia Petrowna alles, was sie selbst betraf, mit Liebe und Sorgfalt.
Der Tag begann für sie mit einer halben Stunde Gymnastik und Wechselduschen. Ein-, zweimal die Woche besuchte sie einen sehr teuren und angesehenen Schönheitssalon. Das korrekt geschnittene und frisierte graue Haar ließ sie mit einer auserlesenen französischen Farbe bläulich tönen. Vor Jahren hatte Amalia Petrowna dafür gewöhnliche blaue Tinte benutzt, die sie in vier Litern Wasser auflöste. Damals besaß sie kein einziges Paar ungestopfter Strumpfhosen …
Jetzt aber blitzten an ihren Ohren und Fingern große, lupenreine Brillanten. Unter den Fenstern ihrer Dreizimmerwohnung stand ein nagelneuer silberglänzender Toyota.
Die vergangene Woche war für Amalia Petrowna nicht die beste gewesen. Es fehlte ihr an Material, das sie dringend brauchte – nicht für die Menge ihres Präparates, die regelmäßig in den Verkauf ging, sondern für den Sonderauftrag einer bestimmten, sehr wichtigen Persönlichkeit. Offenbar war das ein hohes Tier aus dem Gesundheits- oder dem Innenministerium.
Als Amalia Petrowna vor einer Woche angerufen wurde, hatte sie nur kurz geantwortet: »Wenn es gebraucht wird, dann kommt es auch.« Als sie dann aber ihre Reserveliste durchging, mußte sie feststellen, daß neues Material frühestens in einem Monat zu erwarten war. Also begann sie ihre Lieferanten abzutelefonieren. Bislang ohne Erfolg.
Am dritten Tag wurde Amalia Petrowna ins Restaurant »Christoph Kolumbus« auf der Twerskaja beordert, wo man ihr den Ernst der Lage in aller Deutlichkeit klarmachte.
Das Ganze kam für sie nicht unerwartet. Seit drei Jahren brummte ihr Geschäft, dehnte sich der Kundenkreis immer weiter aus. Bereits vor zwei Monaten hatte Amalia Petrowna gewarnt: »Wir arbeiten ohne jede Materialreserve. Jedes Milligramm geht in die Produktion. Unser Kühlschrank ist leer.«
»Was sollen wir denn machen?« erhielt sie zur Antwort. »Suchen Sie nach neuen Varianten, erschließen Sie neue Quellen. Dafür werden Sie schließlich bezahlt. Auf eine Warteliste können wir unsere Kunden wohl kaum setzen.«
Das war leicht gesagt – neue Quellen! Noch am selben Abend läutete sie wieder alle ihre Kunden an und verabredete sich mit jedem einzelnen an verschiedenen Orten in Moskau.
Den halben Tag – von ein Uhr mittags bis zehn Uhr abends – verbrachte sie in teuren Restaurants im Zentrum der Hauptstadt. Überall bestellte sie das gleiche: einen Obstsalat mit kalorienreduzierter Sahne und einen Orangensaft.
»Ich kann doch nicht jeder Schwangeren, die bei mir aufkreuzt, einreden, daß sie ein behindertes Kind erwartet, und sie dann postwendend zu Ihnen schicken!« So oder ähnlich antworteten alle vier Gesprächspartner auf Amalia Petrownas Vorhaltungen.
»Genauso machst du es. Aber beschränk dich auf alte Erstgebärende. Da fällt einem immer was ein«, erklärte sie in belehrendem Ton.
»Das ist doch sehr riskant. Weshalb drängen Sie so? Wir müssen einfach die passenden Fälle abwarten.«
»Abwarten geht nicht«, erwiderte Amalia Petrowna in eisigem Ton, »aber wenn du nicht willst, kannst du ja gehen. Auf Wiedersehen.«
Keiner der Lieferanten machte von diesem Angebot Gebrauch.
Abends um halb elf hatte Amalia Petrowna ihr letztes Rendezvous. Sie steuerte ihren Toyota auf den Gartenring und fuhr in Richtung Patriarchenteiche. Als sie die Grünanlage auf dem Platz erreicht hatte, hielt sie dicht hinter einem schwarzen BMW. Sie stieg aus, öffnete die Tür der großen Limousine und ließ sich auf den Rücksitz fallen.
»Morgen von neun bis sechs.«
Am nächsten Tag konnte sie ihre Nervosität kaum verbergen. Bei der Morgenvisite nörgelte sie an den Schwestern herum und blaffte die behandelnden Ärzte an.
Um sechs Uhr abends schloß sich Amalia Petrowna in ihrem Büro ein, nahm sich eine Zigarette und rauchte. Das tat sie äußerst selten, denn die Gesundheit war ihr heilig. Aber wenn sie sich sehr aufregte, konnte eine Zigarette Wunder wirken.
Fünf vor sieben kam der ersehnte Anruf aus Moskau.
»Guten Abend, Amalia Petrowna! Entschuldigen Sie die Störung, aber ich habe eben eine Patientin mit der Schnellen Medizinischen Hilfe zu Ihnen schicken müssen. Ein sehr unangenehmer Fall: eine Fünfunddreißigjährige in der 24. Woche …«
Amalia Petrowna hängte ein, atmete erleichtert auf, drückte die Zigarette aus und ließ Stationsarzt Simakow kommen.
Zweites Kapitel
Lena Poljanskaja war Vaters Tochter. Ihre Mutter, eine begeisterte Bergsteigerin und Meisterin des Sports, stürzte von einer Felswand ab, als sie kaum zwei Jahre alt war. Jelisaweta konnte ohne ihren Sport nicht leben. Nikolai Poljanski nahm also Urlaub und kümmerte sich um das zweijährige Kind, damit seine Frau den Elbrus besteigen konnte. Diese Großmut verzieh er sich sein Leben lang nicht.
Seine Tochter zog er allein groß. Auch die beste Frau, meinte er, konnte für seine Lena nur eine Stiefmutter sein …
Lena gehörte von der ersten Schulklasse bis zum letzten Semester an der Journalistenfakultät stets zu den Besten. Dabei war sie keine Streberin; das Lernen machte ihr einfach Spaß.
In den oberen Klassen begannen sich ihre Mitschülerinnen die Brauen auszuzupfen, hüpften auf Partys nach Rockmusik herum, rauchten auf der Toilette und schwärmten von den Jungen, die ihnen gefielen.
Lena suchte man dort vergeblich. Partys fand sie blöd, außerdem konnte sie nicht tanzen. Statt dessen las sie von früh bis spät alles, was ihr in die Finger kam. Völlig unerwartet für den Vater, einen Doktor der Physik und der Mathematik, und auch für sich selbst schrieb sie sich an der Journalistenfakultät der Moskauer Universität ein.
Der Vater blieb also fortan allein. Dafür heiratete Lena gleich zweimal. Ihr erster Mann war ein Mitstudent, ein zarter Knabe mit aschblondem Schnurrbärtchen. Lena überragte ihn um einen halben Kopf. Wer seiner ansichtig wurde, erklärte augenblicklich: »Sie sind ja der zweite Lermontow!« Worauf er finster zur Antwort gab: »Ich weiß.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!