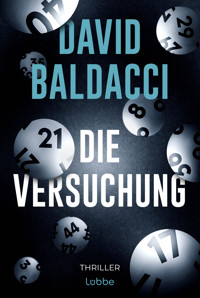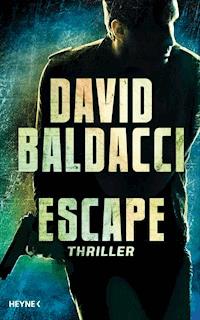Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sean King & Michelle Maxwell
- Sprache: Deutsch
Auf der Jagd nach der Wahrheit - ein neuer Fall für Maxwell und King
Der Teenager Tyler erhält die schreckliche Nachricht, dass sein Vater, ein Soldat in Afghanistan, tot ist. Doch dann taucht eine E-Mail seines Vaters auf, eine E-Mail, die lange nach seinem Tod geschrieben wurde. Ratlos bittet Tyler Sean King und Michelle Maxwell um Hilfe. Die beiden Ermittler erkennen rasch, dass hinter dieser Geschichte etwas weit Größeres steckt als zunächst angenommen. Ihre Suche nach der Wahrheit führt sie in die höchsten Ebenen der Macht, dorthin, wo ein Menschenleben nichts zählt - und das erfährt das Duo bald am eigenen Leib ...
Packende Thriller-Unterhaltung aus der Feder von Bestsellerautor David Baldacci
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 19 min
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Danksagungen
Über den Autor
David Baldacci, geboren 1960, war Strafverteidiger und Wirtschaftsanwalt, ehe er 1996 mit DER PRÄSIDENT (verfilmt als ABSOLUTE POWER) seinen ersten Bestseller veröffentlichte. Seine Bücher wurden in fünfundvierzig Sprachen übersetzt und erscheinen in mehr als achtzig Ländern. Damit zählt er weltweit zu den Top-Autoren des Thriller-Genres. Er lebt mit seiner Familie in Virginia, nahe Washington, D. C.
David Baldacci
IN LETZTERMINUTE
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonDiana Beate Hellmann
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 by Columbus Rose, Ltd.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »King and Maxwell«
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Arno Hoven
Titelillustration: © Trevillion Images/Eric Forey
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1488-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Shane, Jon und Rebecca und das gesamte Teamder Fernsehserie King & Maxwell –
vielen Dank für die so lebendige Umsetzung
1
Viertausendachthundert Pfund.
Ungefähr so viel wog die Ladung in der Kiste. Ein Gabelstapler hob sie aus dem Sattelschlepper heraus und stellte sie in den Laderaum des kleineren Lastkraftwagens. Die Hecktür wurde zugeklappt und mit zwei unterschiedlichen Schlössern gesichert – das eine ließ sich mit einem Schlüssel öffnen, das andere mit der richtigen Zahlenkombination. Beide Schlösser galten als manipulationssicher. Doch in Wirklichkeit konnte jedes Schloss geknackt und jede Tür aufgebrochen werden, wenn genügend Zeit vorhanden war.
Der Mann stieg ins Führerhaus des LKW und setzte sich auf den Fahrersitz. Anschließend zog er die Tür zu und verriegelte sie. Nachdem er den Motor gestartet hatte, ließ er ihn mehrmals aufheulen, drehte dann die Klimaanlage bis zum Anschlag auf und stellte den Sitz richtig ein. Er hatte eine weite Strecke vor sich und nicht viel Zeit, um ans Ziel zu gelangen. Und es war so heiß wie in der Hölle. Vielleicht sogar noch heißer. Die Hitze flimmerte in sichtbaren Wellen und verzerrte den Anblick der Landschaft. Er konzentrierte sich nicht darauf, weil er sich ansonsten möglicherweise hätte übergeben müssen.
Eine bewaffnete Eskorte wäre ihm lieber gewesen. Sicherheitshalber vielleicht auch noch ein Abrams-Kampfpanzer, aber der war weder im Budget noch im Plan für diese Mission vorgesehen. Das Terrain war steinig und wurde in der Ferne gebirgig. Und die Straßen wiesen mehr Schlaglöcher als Asphalt auf. Er führte Schusswaffen und jede Menge Munition mit sich. Aber er war nur ein Mann und hatte nur einen Abzugsfinger.
Er trug keine Uniform mehr. Vor etwa einer Stunde hatte er sie zum letzten Mal ausgezogen. Er strich mit den Fingern über seine »neuen« Klamotten. Sie waren verschlissen und nicht übermäßig sauber. Als der Gabelstapler wegfuhr, holte er seine Landkarte hervor und breitete sie auf dem Beifahrersitz aus.
Jetzt war er allein, mitten im Nirgendwo – in einem Land, in dem es weitgehend immer noch zuging wie im neunten Jahrhundert.
Als er durch die Windschutzscheibe auf die beeindruckende Landschaft schaute, ging ihm kurz durch den Kopf, wie es ihn hierher verschlagen hatte. Damals war ihm das, was er vorhatte, tapfer erschienen, ja sogar heroisch. Jetzt kam er sich vor wie der größte Idiot auf Erden, weil er sich auf eine Mission hatte schicken lassen, bei der es eine derart geringe Überlebenschance gab.
Doch es blieb die Tatsache, dass er jetzt hier war. Und er war allein. Er hatte einen Job zu erledigen und machte sich jetzt besser an die Arbeit. Wenn er starb … Nun ja, dann war immerhin seine Angst vor dem Tod vorüber, und er hatte zumindest einen Menschen, der um ihn trauern würde.
Er besaß nicht nur die Landkarte, sondern auch ein GPS-Navigationssystem. Hier draußen allerdings funktionierte das an vielen Stellen nicht – ganz so, als wüssten die Satelliten da oben gar nicht, dass hier unten ebenfalls ein Land war, in dem die Leute von Punkt A zu Punkt B gelangen mussten. Deshalb die altmodische Papierversion auf dem Beifahrersitz.
Er legte den ersten Gang ein und dachte an das, was in der Kiste war. Es handelte sich dabei um über zwei Tonnen einer sehr speziellen Ladung. Ohne sie war er mit Sicherheit ein toter Mann. Selbst mit ihr würde er möglicherweise ein toter Mann sein, aber seine Überlebenschancen waren mit ihr erheblich größer.
Während er über die rumpelige Straße fuhr, rechnete er aus, wie lange er nun unterwegs sein würde: voraussichtlich zwanzig Stunden. Und es war eine schwierige Fahrt, die vor ihm lag. Autobahnen gab es hier nicht. Er würde nur mühsam und holpernd vorankommen. Und vielleicht würden sogar Leute auf ihn schießen.
Doch es gab auch Leute, die ihn am Ende der Fahrt erwarteten. Man würde die Kiste umladen und ihn gleich mit. Man hatte Mitteilungen ausgetauscht. Versprechungen gegeben. Allianzen gebildet. Jetzt kam es nur noch darauf an, dass er im richtigen Moment das Richtige sagte und die anderen ihr Wort hielten.
Während der endlosen Besprechungen mit Männern in Hemd und Krawatte, deren Smartphones unablässig Töne von sich gaben, hatte sich das alles gut angehört. Hier draußen, wo er ganz allein war und es um ihn herum nichts als eine absolut trostlose Landschaft gab, hörte es sich verständlicherweise wahnwitzig an.
Aber er war immer noch Soldat; und so machte er wie ein Soldat unermüdlich weiter.
Er mühte sich auf die Berge in der Ferne zu. Er trug nichts bei sich, was Angaben zu seiner Person enthielt. Trotzdem hatte er Papiere, die ihm eine sichere Fahrt durch die Region ermöglichen sollten.
Sollten, nicht würden.
Falls Leute ihn anhielten und die Dokumente als unzureichend erachteten, würde er sich mit irgendwelchen Ausflüchten aus der Situation herausreden müssen. Wenn sie wollten, dass er ihnen zeigte, was in dem LKW war, musste er es ihnen verweigern. Für den Fall, dass sie nicht lockerließen, hatte er ein Kästchen aus matt lackiertem schwarzem Metall. Es hatte an der Seite einen Schalter, und obendrauf war ein roter Knopf. Wenn er den Schalter umlegte und den Knopf drückte, war alles noch okay. Wenn er seinen Finger von dem Knopf herunternahm, während der Schalter immer noch umgelegt war, verschwanden er und alles im Umkreis von zwanzig Metern.
Ohne Unterbrechung fuhr er zwölf Stunden und sah dabei keinen einzigen lebenden Menschen. Er erhaschte einen flüchtigen Blick auf ein Kamel und auf ein Maultier, die umherirrten. Irgendwann fiel ihm eine tote Schlange auf. Und dann erblickte er ein menschliches Skelett – eine Leiche, die offenbar als Futter für die Aasgeier gedient hatte und von der bloß noch Knochen übrig geblieben waren. Es erstaunte ihn, dass er nur auf die Überreste eines toten Menschen stieß. Normalerweise müsste es sehr viel mehr Leichen geben. Dieses Land hatte eine ganze Reihe von Massakern erlebt. Von Zeit zu Zeit versuchte irgendein anderes Land, hier einzumarschieren. Die Invasoren gewannen immer schnell den Krieg, verloren dann aber all die kleinen Scharmützel und fuhren schließlich wieder nach Hause, die Panzer quasi zwischen die Beine geklemmt.
Während der zwölfstündigen Fahrt sah er die Sonne unter- und wieder aufgehen. Da er in östlicher Richtung unterwegs war, fuhr er direkt auf sie zu. Als sie grell in seine Augen schien, klappte er die Sonnenblende nach unten und hielt weiterhin Kurs. Er spielte eine CD nach der anderen und hatte die Lautsprecher aufgedreht, sodass die Rockmusik durch das Führerhaus dröhnte. Zwanzigmal in Folge hörte er sich Meat Loafs Paradise by the Dashboard Light an, so laut, wie seine Ohren es aushielten. Jedes Mal, wenn die Stimme des Baseball-Ansagers ertönte, lächelte er. Das fühlte sich hier draußen wie ein Stück Zuhause an.
Obwohl Meat Loaf ihn anbrüllte, wurden seine Augenlider immer schwerer, und er nickte immer häufiger ein. Doch jedes Mal, wenn sein LKW von der Straße abkam, wachte er ruckartig auf. Zum Glück war hier kein weiterer Verkehr. Es gab nicht viele, die in dieser Gegend leben wollten. Sie wirkte »Unheil verkündend« – das war eine Möglichkeit, sie zu beschreiben. Man konnte sie aber auch als »wahnsinnig gefährlich« bezeichnen, was zutreffender war.
Nach dreizehn Stunden Fahrt wurde er so müde, dass er beschloss, an den Straßenrand zu fahren und ein kurzes Nickerchen zu machen. Er war bisher gut vorangekommen und konnte deshalb ein wenig Zeit erübrigen, um sich auszuruhen. Aber genau in dem Moment, als er anhalten wollte, glitt sein Blick die Straße entlang, und er sah, was da kam. Seine Müdigkeit verflog sofort. Sein Nickerchen würde warten müssen.
Ein offener Lastwagen steuerte geradewegs auf ihn zu. Der Wagen fuhr mitten auf der Straße, sodass er die Fahrspur in beiden Richtungen blockierte.
Zwei Männer saßen vorn, drei standen hinten auf der Ladefläche, und alle hielten sie Maschinenpistolen in ihren Händen. Offenbar ein Begrüßungskomitee, wie es in Afghanistan üblich war.
Er fuhr halb von der Straße, ließ das Fenster herunter und die wogende Hitze herein. Dann wartete er. Er schaltete den CD-Player aus, und Meat Loafs Bariton verstummte. Diesen Männern würden die gewaltigen Stimmbänder und lüsternen Songtexte des Rockers sicherlich nicht gefallen.
Der kleine Lastwagen kam neben seinem Fahrzeug zum Stehen. Während zwei der Männer mit Turbanen mit ihren Maschinenpistolen auf ihn zielten, stieg der Mann auf dem Beifahrersitz aus und ging auf die Fahrertür des anderen LKWs zu. Er trug ebenfalls einen Turban. Die Schweißstreifen, von denen der Stoff durchtränkt war, zeugten davon, dass ihr Besitzer sich lange Zeit in großer Hitze aufgehalten hatte.
Der Fahrer schaute dem Mann ins Gesicht, als der sich näherte.
Er griff nach dem Bündel Papiere auf dem Beifahrersitz. Sie lagen gleich neben seiner geladenen Glock, in deren Kammer bereits eine Kugel war. Er hoffte, dass er sie nicht würde benutzen müssen, denn ein Kampf »Pistole gegen Maschinenpistole« konnte nur eines zur Folge haben – seinen Tod.
»Papiere?«, sagte der Mann in Paschtu.
Der Fahrer reichte sie ihm durch das geöffnete Fenster. Sie waren ordnungsgemäß unterschrieben worden und trugen die unverwechselbaren Siegel von jedem der Stammesfürsten, die in dieser Region herrschten. Er verließ sich darauf, dass man sie anerkennen würde. Dabei ermutigte ihn die Tatsache, dass es in diesem Teil der Welt oftmals den Tod nach sich zog, wenn man den Befehlen eines Stammesfürsten nicht Folge leistete. Und der Tod war hier fast immer brutal und kam fast nie rasch. Sie hatten es gern, wenn jemand spürte, wie er starb, wie es hierzulande hieß.
Der Mann mit dem Turban war schweißgebadet. Seine Augen waren rot und seine Kleider ebenso dreckig wie sein Gesicht. Er las sich die Papiere durch und begann, hastig zu blinzeln, als er sah, welche erlauchten Personen unterzeichnet hatten.
Er schaute zum Fahrer auf und nahm ihn ganz genau in Augenschein, dann gab er ihm die Papiere zurück. Der Blick des Mannes glitt zum hinteren Teil des LKWs und bekam einen neugierigen Ausdruck. Der Fahrer umschloss mit der Hand das schwarze Kästchen, legte den Schalter an der Seite um und aktivierte damit den Zünder. Wieder sprach der Mann in Paschtu. Der Fahrer schüttelte den Kopf und erklärte, es wäre nicht möglich, den LKW zu öffnen. Er war verriegelt, und er besaß weder den Schlüssel noch die Zahlenkombination, die dazu vonnöten waren.
Der Mann zeigte auf seine Schusswaffe und sagte, das wäre sein Schlüssel.
Der Fahrer drückte mit dem Finger auf den roten Knopf. Wenn sie ihn erschossen, würde sein Körper erschlaffen und sein Finger vom Knopf gleiten. Und dann würde dieses »Idiotenschalter«-Kästchen den Sprengstoff zur Detonation bringen und alle anderen hier töten.
In Paschtu erklärte er: »Die Stammesfürsten haben es deutlich gesagt. Niemand soll die Ladung zu sehen bekommen, bis sie ihr endgültiges Ziel erreicht hat. Ganz deutlich haben sie das gesagt«, fügte er hinzu, um es noch einmal zu betonen. »Wenn es da ein Problem gibt, müsst ihr das mit ihnen abmachen.«
Der Mann ließ sich das durch den Kopf gehen, während seine Hand nach unten zu der Waffe glitt, die im Holster an seiner Seite steckte.
Der Fahrer versuchte, ruhig und gleichmäßig weiterzuatmen und dafür zu sorgen, dass seine Gliedmaßen nicht anfingen zu zucken. Blieben einem nur noch wenige Sekunden, bis man möglicherweise in die Vergessenheit gebombt wurde, führte das jedoch zu gewissen körperlichen Reaktionen, die sich nicht kontrollieren ließen.
Fünf zum Zerreißen gespannte Sekunden vergingen, während deren nicht feststand, ob der Mann mit dem Turban sich zurückhalten würde oder nicht.
Schließlich ging der Mann weg, stieg wieder in den kleinen Pritschenwagen und sagte etwas zu seinem Kameraden, der am Steuer saß. Augenblicke später preschte das Fahrzeug davon, große Staubwolken wirbelten hinter ihm her.
Der Fahrer deaktivierte den Sprengzünder und wartete, bis das Begrüßungskomitee so gut wie außer Sichtweite war; erst dann legte er wieder den ersten Gang ein. Langsam fuhr er an, aber dann trat er voll aufs Gaspedal. Seine Müdigkeit war verflogen.
Die Musik brauchte er jetzt nicht mehr. Er schaltete die Klimaanlage herunter, denn plötzlich war ihm ziemlich kalt. Dann folgte er weiter seinen Anweisungen und hielt sich genau an die Streckenvorgabe. Es zahlte sich nicht aus, hier draußen vom Weg abzukommen. Mit wachem Blick suchte er am Horizont nach weiteren Pritschenwagen mit bewaffneten Männern, die in seine Richtung kamen, sah aber keine. Er hoffte, dass inzwischen allen Leuten entlang der Strecke die Anweisung mitgeteilt worden war, dem LKW mit der besonderen Ladung eine sichere Durchfahrt zu gewähren.
Knapp acht Stunden später erreichte er sein endgültiges Ziel. Der Abend nahte, es dämmerte bereits, und der Wind wurde heftiger. Der Himmel war von Wolken verhangen, und es sah aus, als würde es in wenigen Minuten wie aus Eimern regnen.
Er hatte erwartet, dass bei seiner Ankunft hier etwas ganz Bestimmtes geschehen würde.
Es passierte nicht.
2
Das Erste, was schiefging, war, dass ihm das Benzin ausging, als er durch das offene Rolltor des Steingebäudes fuhr. Er hatte zwar zusätzliche Treibstofftanks, aber irgendjemand hatte sich da offenbar verkalkuliert.
Das Zweite, was schiefging, war, dass man ihm eine Waffe vor die Nase hielt.
Der Mann hier war kein Kerl mit Turban und Maschinenpistole. Der Typ war ein Weißer wie er selbst und hatte eine Pistole Kaliber .357, deren Hahn bereits zurückgezogen war.
»Gibt es ein Problem?«, fragte der Fahrer.
»Nicht für uns«, erwiderte der Mann, der stämmig war, Hängebacken hatte und altersmäßig eher bei vierzig als bei dreißig lag.
»Uns?« Er schaute sich um und erblickte weitere weißhäutige Kerle, die aus den Schatten traten. Sie waren alle bewaffnet, und jede einzelne ihrer Pistolen zielte auf ihn.
So viele weiße Gesichter fielen hier auf wie ein Planet, der aus seiner Umlaufbahn geraten war.
»So war das nicht geplant«, sagte der Fahrer.
Der andere Mann hielt ihm ein paar Unterlagen hin. »Der Plan wurde geändert.«
Der Fahrer sah sich den Ausweis und die Dienstmarke ganz genau an. Sie wiesen den Mann als einen Agenten der CIA aus, der Tim Simons hieß.
»Wenn wir auf der gleichen Seite sind, warum habe ich dann die Waffe vor der Nase?«, fragte der Fahrer.
»Ich habe gelernt, in diesem Teil der Welt niemandem zu trauen. Aussteigen, los!«
Der Fahrer warf sich seinen voll beladenen Rucksack über die Schulter, stieg aus dem LKW und blieb auf dem Lehmboden stehen. In seinen Händen hielt er zwei Dinge.
Das erste war seine Glock. Sie war nutzlos angesichts der vielen Waffen, die auf ihn zielten.
Das zweite war das schwarze Kästchen. Das war total nützlich. Tatsächlich war es das einzige Druckmittel, das er besaß. Er aktivierte den Sprengzünder und drückte den Knopf.
Dann streckte er es Simons entgegen.
»Todsicher«, erklärte er ihm. »Lasse ich den roten Knopf los, werden wir alle pulverisiert. Der LKW ist rundum mit dicken Brocken Semtex verdrahtet. Genug, um all das hier in ein Loch im Boden zu verwandeln.«
»Blödsinn«, widersprach Simons.
»So ganz scheinen Sie nicht in die Mission eingeweiht worden zu sein.«
»Das denke ich schon.«
»Dann denken Sie falsch. Schauen Sie mal unter die Radhäuser.«
Simons nickte einem seiner Kollegen zu, der daraufhin eine Taschenlampe hervorholte und sich unter das Radhaus des rechten Hinterrades duckte.
Er kam wieder darunter hervor und drehte sich um. Sein Gesichtsausdruck sagte alles.
Die bewaffneten Männer richteten ihre Blicke wieder auf den Fahrer. Dass sie in der Überzahl waren, hatte sich soeben als bedeutungslos erwiesen. Das wusste der Fahrer, doch er wusste ebenfalls, dass dies ein gefährlicher Vorteil war. Bei einem Spiel mit dem Feuer konnte es nur einen Gewinner geben, und auch das nur im besten Fall. Ebenso wahrscheinlich war, dass beide Seiten verloren. Außerdem lief ihm die Zeit davon. Das konnte er an den Fingern ablesen, die sich um die Abzugshähne legten, und an den Schritten, mit denen die Männer heimlich zurückzuweichen versuchten. Er vermochte ihre Gedanken bei jeder ihrer Bewegungen zu lesen: Nichts wie raus aus dem Radius des Semtex, und dann soll er das Zeug ruhig zünden und sich umbringen. Oder wir legen ihn mit einem gezielten Schuss um und retten hoffentlich die Ladung. In beiden Fällen würden sie überleben, und das war ihr vorrangiges Ziel. Es würde neue Ladungen geben, die sie an sich reißen konnten. Doch ein neues Leben konnten sie sich nicht herbeizaubern.
»Sofern Sie alle nicht wesentlich schneller rennen können als Usain Bolt, kommen Sie niemals rechtzeitig aus der Explosionszone raus«, sagte er. Er hob das Kästchen höher in die Luft. »Und dann bleibt uns eine ganze Ewigkeit, um über unsere Sünden nachzudenken.«
»Wir wollen nur, was in dem LKW ist«, erklärte Simons. »Gib uns das, und du kannst gehen.«
»Ich weiß nicht, wie das funktionieren sollte.«
Nervös beäugte Simons das Kästchen. »In der Ecke da drüben parken zwei Fahrzeuge. Beide sind vollgetankt, im Laderaum sind auch noch mal Ersatzkanister, und beide haben ein Navigationssystem. Mit denen sind wir hergekommen, aber einen davon kannst du nehmen. Such dir einen aus.«
Der Fahrer schielte in die Richtung. Er sah einen schwarzen Kleintransporter, neben dem ein grüner Geländewagen stand.
»Und wohin fahre ich dann damit?«, erkundigte er sich.
»Ich schätze mal, aus diesem Drecksloch raus.«
»Ich habe einen Auftrag zu erfüllen.«
»Der Auftrag hat sich geändert.«
»Warum bringen wir die Sache nicht einfach zu Ende?« Er begann, den Druck auf den Knopf zu verringern.
»Warte!«, rief Simons. »Warte.« Er hob die Hand.
»Ich warte ja.«
»Nimm dir einfach einen der Transporter und hau ab. Deine Ladung ist nicht wert, dafür zu sterben, oder?«
»Vielleicht ist sie das wert.«
»Du hast Familie zu Hause in den Staaten.«
»Woher wissen Sie das?«
»Das weiß ich eben. Und ich gehe mal davon aus, dass du zu denen zurückwillst.«
»Und wie soll ich erklären, dass ich die Ladung verloren habe?«
»Das wirst du nicht erklären müssen«, erwiderte Simons. »Glaub’s mir.«
»Genau da liegt das Problem. Ich glaube und traue Ihnen nicht.«
»Dann werden wir alle hier sterben. So einfach ist das.«
Der Fahrer spähte zu den beiden Fahrzeugen in der Ecke. Er glaubte kein Wort von dem, was Simons ihm erzählte. Doch er wollte unbedingt lebend aus dieser Geschichte herauskommen, und wenn vielleicht auch nur, um das Ganze hinterher in Ordnung zu bringen.
»Schau«, sagte Simons. »Dass wir nicht die Taliban sind, ist offensichtlich. Verdammt noch mal, ich komme aus Nebraska. Mein Ausweis und die Dienstmarke sind echt. Wir sind hier auf derselben Seite, okay? Warum wäre ich sonst hier?«
Der Fahrer zögerte. »Sie wollen also, dass ich mich einfach stillschweigend vom Acker mache?«, fragte er schließlich.
»Das ist mein Angebot.«
»Und wie stellen Sie sich das vor?«
»Zunächst einmal – lass den Knopf nicht los«, riet Simons ihm.
»Wenn Sie das wollen, dürfen Sie nicht abdrücken.« Er schritt auf die zwei Fahrzeuge zu.
Die Männer stoben auseinander, um ihn durchzulassen.
»Ich werde den grünen Geländewagen nehmen«, erklärte er plötzlich. Er sah, wie Simons nahezu unmerklich zusammenzuckte, was ein gutes Zeichen war. Er hatte die richtige Wahl getroffen. Der schwarze Transporter war offenbar mit einer Sprengfalle versehen.
Er erreichte den grünen Geländewagen und schielte auf die Zündung. Die Schlüssel steckten. Es gab tatsächlich ein Navigationssystem, das auf dem Armaturenbrett montiert war.
»Wie viel Reichweite hat der Zünder?«, rief Simons.
»Das behalte ich für mich.«
Er warf seinen Rucksack auf den Beifahrersitz, stieg in den Wagen und ließ den Motor an. Als Nächstes schaute er auf die Tankuhr. Voll. In seiner freien Hand hielt er nach wie vor den aktivierten Zünder.
»Wie können wir dir trauen, dass du das Ding nicht zündest, wenn du weit genug weg bist?«, wandte Simons ein.
»Das ist eine Frage der Reichweite«, gab er zur Antwort.
»Die du uns nicht verraten hast.«
»Also werden Sie mir einfach vertrauen müssen, Nebraska. Genauso wie ich Ihnen vertrauen muss, dass dieser Wagen nicht mit einer explosiven Ladung verdrahtet ist, die in die Luft geht, sobald ich hier raus bin. Aber vielleicht hätte das ja nur der andere getan.«
Er trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch, und mit dröhnendem Motor fuhr der Geländewagen aus dem Steinbau heraus. Er rechnete damit, dass man auf ihn schießen würde. Das aber passierte nicht.
Er nahm an, sie glaubten, das hätte ihren Tod zur Folge, weil er dann aus Rache den Knopf loslassen würde.
Als er weit genug weg war, schaute er auf das schwarze Kästchen. Wenn die Kerle da hinten wirklich von der CIA waren, ging hier sehr viel mehr ab, als er geglaubt hatte – so viel, dass er im Moment keine Lust verspürte, darüber nachzudenken. Er wollte das Ganze aber durchstehen. Und das konnte er nur, wenn er der Sache ihren Lauf ließ. Und am Leben blieb.
Er deaktivierte den Sprengzünder und warf ihn auf den Beifahrersitz.
Jetzt musste er erst mal nur hier weg.
Er hoffte, dass ihm das möglich war. Die meisten Menschen kamen nur in diesen Teil der Welt, um zu töten oder getötet zu werden.
3
Sean King saß am Steuer, Michelle Maxwell auf dem Beifahrersitz.
Normalerweise hielten die beiden es genau umgekehrt. Im Allgemeinen fuhr sie den Wagen, und zwar so, als würde sie an einem Rennen in Daytona teilnehmen. Und Sean klammerte sich am Sitz fest und sprach dabei leise seine Gebete, allerdings ohne große Zuversicht, dass sie erhört wurden.
Es hatte einen guten Grund, dass er heute Abend fuhr und auch während der letzten drei Wochen im Auto immer am Steuer gesessen hatte. Michelle war einfach nicht auf dem Damm, zumindest noch nicht. Sie kam allmählich wieder dahin, allerdings langsamer, als sie sich das gewünscht hatte.
Er sah sie an. »Wie fühlst du dich?«
Sie blickte mit starrem Blick nach vorn. »Ich bin bewaffnet. Solltest du mich das also noch einmal fragen, werde ich dich erschießen, Sean.«
»Ich mache mir doch nur Sorgen, okay?«
»Das weiß ich, Sean. Und ich bin dir wirklich dankbar dafür. Ich bin aber seit drei Wochen raus aus der Reha. Meines Erachtens bin ich fit und kann wieder voll loslegen. Hör also auf, dir ständig Sorgen um mich zu machen.«
»Deine Verletzungen waren lebensgefährlich, Michelle. Du hast nur um Haaresbreite überlebt. Du bist beinahe verblutet. Glaub es mir, ich habe jede Sekunde davon mitbekommen. Drei Wochen aus der Reha raus zu sein ist – nach so einer Geschichte – im Grunde keine lange Zeit.«
Michelle strich mit der Hand über ihr Kreuz und dann über ihren Oberschenkel. Dort hatte sie Narben. Da würden immer Narben bleiben. Die Erinnerung daran, wie sie diese Verletzungen erlitten hatte, war ebenso plastisch wie das Gedächtnisbild vom ersten Messer, das man ihr in den Rücken gestoßen hatte. Verübt von jemandem, den sie für eine Verbündete gehalten hatte.
Dennoch – sie war am Leben geblieben. Und Sean hatte ihr die ganze Zeit über zur Seite gestanden. Erst jetzt fing er an, ihr mit seiner ständigen Fürsorge auf die Nerven zu gehen.
»Ich weiß. Aber es waren geschlagene zwei Monate Reha. Und bei mir heilt alles schnell. Gerade du solltest das inzwischen wissen.«
»Es war einfach knapp, Michelle. Viel zu knapp.«
»Wie viele Male habe ich dich fast verloren?«, fragte sie ihn und warf ihm einen kurzen Blick zu. »So was passiert in unserem Job. Das gehört einfach dazu. Wenn wir ein sicheres Leben wollen, müssen wir uns eine andere Art von Arbeit suchen.«
Sean schaute durch die Windschutzscheibe nach draußen und sah, dass es immer noch wie aus Kübeln regnete. Es war eine kalte, düstere Nacht, und die Wolken schienen so verschlagen wie ein Fuchs zu sein. Sie fuhren durch einen ganz besonders einsamen Teil im Norden von Virginia und waren auf ihrem Rückweg von Edgar Roy, einem ehemaligen Klienten. Sie hatten ihn vor der Todesstrafe bewahrt. Er war ihnen so dankbar dafür gewesen, wie man das von einem zwar höchst funktionstüchtigen, aber autistischen Gelehrten mit äußerst begrenzter Sozialkompetenz erwarten durfte.
»Edgar hat gut ausgesehen«, meinte Michelle.
»Wenn man bedenkt, wie er nach Verabreichung einer Giftspritze ausgesehen hätte, hat er sogar richtig gut ausgesehen«, erwiderte Sean, der über den Themenwechsel erleichtert zu sein schien.
Sean nahm auf der kurvenreichen, regenglatten Straße die nächste Biegung zu schnell, und Michelle klammerte sich an der Armlehne fest.
»Fahr langsamer«, mahnte sie ihn.
Er heuchelte Erstaunen. »Worte, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie dir je über die Lippen kommen würden.«
»Ich fahre schnell, weil ich weiß, wie man das macht.«
»Ich habe Blessuren und Therapierechnungen, die das Gegenteil beweisen«, konterte er.
Mürrisch blickte sie ihn an. »Also, was machen wir denn jetzt, nachdem wir mit der Arbeit an der Edgar-Roy-Sache fertig sind?«
»Wir setzen unsere Laufbahn als Privatdetektive fort. Sowohl Peter Bunting als auch die amerikanische Regierung haben uns sehr großzügig bezahlt, aber das stecken wir in den Sparstrumpf, damit wir uns was gönnen können, wenn wir mal in Rente sind. Oder damit wir Rücklagen haben, auf die wir in Notzeiten zurückgreifen können.«
Michelle sah zum stürmischen Himmel hoch. »Notzeiten? Dann lass uns jetzt ein Boot davon kaufen. Wir brauchen vermutlich eines, um nach Hause zu kommen.«
Sean hätte etwas darauf erwidert, aber etwas anderes forderte plötzlich seine Konzentration.
»Verdammt!«
Er riss das Lenkrad scharf nach links, und der Land Cruiser schlitterte seitwärts über die glatte Straße.
»Lenk dagegen«, riet Michelle ihm ruhig.
Sean folgte ihrer Empfehlung und hatte rasch wieder die Kontrolle über das Fahrzeug. Er trat auf die Bremse und hielt auf dem Seitenstreifen.
»Was war das, verflucht noch mal?«, blaffte er.
»Du meinst wohl – wer war das?«, erwiderte Michelle.
Sie öffnete die Beifahrertür und lehnte sich nach draußen, sodass sie dem Regen ausgesetzt war.
»Warte, Michelle!«, rief Sean.
»Leuchte mal mit den Scheinwerfern nach rechts. Schnell!«
Sie schlug die Tür zu, und Sean fuhr das Fahrzeug wieder auf die Straße.
»Schalt das Fernlicht ein«, wies sie ihn an.
Er tat es. Die Lichtkegel vor ihnen wurden heller und ermöglichten es ihnen, eine größere Strecke vorauszublicken – allerdings nur so deutlich, wie es die Dunkelheit und der Regen zuließen.
»Da«, sagte Michelle und zeigte mit dem Finger nach rechts. »Fahr los!«
Sean trat aufs Gas, und der Land Cruiser schoss nach vorn.
Die Person, die auf dem rechten Seitenstreifen die Straße entlangrannte, sah sich nur einmal nach hinten um. Aber das reichte.
»Das ist ein Kind«, stieß Sean verwundert aus.
»Das ist ein Teenager«, verbesserte ihn Michelle.
»Na ja, es hätte nicht viel gefehlt, und er wäre jetzt ein toter Teenager«, fügte Sean in ernstem Ton hinzu.
»Sean, der hat eine Pistole.«
Sean beugte sich über das Lenkrad und sah die Waffe in der rechten Hand des Jungen. »Das sieht nicht gut aus«, meinte er.
»Er sieht aus, als hätte er Angst.«
»Er rennt bei einem sehr starken Gewitter im Freien herum – mit einem Gegenstand aus Metall in der Hand. Da sollte er Angst haben. Und außerdem habe ich ihn beinahe überfahren. Wäre das passiert, hätte er jetzt keine Angst mehr. Er wäre einfach tot.«
»Fahr dichter an ihn ran.«
»Was?«
»Fahr dichter ran.«
»Warum sollte ich das tun, Michelle? Er hat eine Pistole.«
»Wir haben auch Pistolen. Fahr einfach dichter ran.«
Er beschleunigte, während Michelle das Fenster herunterließ.
Eine Lanze aus Licht erhellte den Himmel mit der Kraft und Energie von einer Milliarde Kerzen. Es folgte ein Donnerknall, der so laut war, dass es sich anhörte, als würde ein Wolkenkratzer implodieren.
»Heh!«, rief Michelle dem Jungen zu. »Heh!«
Der Teenager drehte sich noch einmal nach hinten um, und im grellen Licht der Scheinwerfer sah sein Gesicht kalkweiß aus.
»Was ist passiert?«, brüllte Michelle. »Bist du okay?«
Die Antwort des Jungen bestand darin, mit seiner Pistole auf sie zu zielen. Er schoss aber nicht. Er lief von der Straße und begann, ein Feld zu überqueren. Seine Füße rutschten über das nasse Gras, und er geriet immer wieder ins Stolpern.
»Ich rufe die Polizei«, sagte Sean.
»Warte erst mal«, entgegnete Michelle. »Halt an.«
Sean verlangsamte das Tempo des Land Cruisers und brachte ihn nach ein paar Metern zum Stehen.
Michelle sprang aus dem Fahrzeug.
»Was, zum Teufel, machst du da?«, schrie Sean.
»Er steckt ganz offensichtlich in Schwierigkeiten. Ich werde in Erfahrung bringen, warum.«
»Ist dir schon in den Sinn gekommen, dass er vielleicht in Schwierigkeiten steckt, weil er gerade jemanden erschossen hat und jetzt vom Tatort flieht?«
»Das glaube ich nicht.«
Ungläubig sah er sie an. »Das glaubst du nicht? Und worauf stützt sich dieser Glaube?«
»Ich bin gleich wieder da.«
»Was? Warte, Michelle.«
Er beugte sich weit über den Beifahrersitz, um sie am Arm festzuhalten, doch es misslang.
Nur einen Augenblick später rannte auch sie über das Feld. Nach wenigen Sekunden hatte der strömende Regen sie bis auf die Haut durchnässt.
Sean schlug mit der Hand auf das Lenkrad und konnte es einfach nicht fassen. »Hast du Todessehnsucht, Michelle?«, brüllte er zum Fenster hinaus. Aber Michelle war schon längst außer Hörweite.
Er beruhigte sich, sah sich die Gegend ein paar Sekunden genauer an und raste dann los. An der nächsten Kreuzung bog er scharf rechts ab und trat dabei so fest aufs Gaspedal, dass der hintere Teil des Geländewagens ins Schleudern geriet. Im nächsten Moment hatte er das Fahrzeug wieder unter Kontrolle und fuhr weiter. Bei jeder Umdrehung der Räder verfluchte er lautstark seine Partnerin.
4
Michelle war in ihrem Leben schon vielem hinterhergejagt. Als Spitzenleichtathletin und später als olympische Ruderin hatte sie sich bei Rennen ständig mit anderen gemessen. Als Polizistin in Tennessee hatte sie so manchen Verbrecher eingefangen, der vom Tatort hatten fliehen wollen. Als Agentin des Secret Service war sie zu Fuß neben Limousinen hergerannt, in denen sich wichtige Führungspersönlichkeiten befanden.
Heute Nacht lieferte sie sich jedoch ein Duell mit einem langbeinigen Teenager, der über die unerschöpfliche Energie und die unverbrauchten Knie der Jugend verfügte, einen gewaltigen Vorsprung hatte und rannte, als wäre ihm der Teufel auf den Fersen. Und ihr rutschten bei jedem Schritt auf dem nassen Boden die Füße weg.
»Warte!«, rief sie, als sie für den Bruchteil einer Sekunde einen Blick auf ihn erhaschte, bevor er die Richtung wechselte und auf einem Pfad entschwand, der zwischen ein paar Bäumen hindurchführte.
Er wartete nicht. Stattdessen lief er jetzt noch schneller.
Obwohl sie es Sean gegenüber immer wieder beteuerte, war Michelle noch nicht wieder vollkommen in Ordnung. Der Rücken tat ihr weh. Das Bein tat ihr weh. Ihre Lungen brannten. Und dass der Wind und der Regen sie blendeten, war auch nicht hilfreich.
Sie rannte den Pfad entlang und zog vorsichtshalber ihre Waffe. Denn sie fühlte sich immer besser, wenn sie ihre Sig in der Hand hielt. Sie strengte sich noch mehr an, kämpfte gegen die Schmerzen und die Erschöpfung an, die ihren Körper befielen, und verringerte deutlich den Abstand zu dem Jungen. Ein Blitz, dem ein krachender Donner folgte, lenkte sie für einen kurzen Moment ab. Ein Baum, der am Wegesrand stand und von heftigen Winden malträtiert wurde, begann umzukippen. Es gelang ihr, nochmals ihr Tempo zu steigern, und sie raste blitzschnell an dem Baum vorbei, der offenbar kein starkes Wurzelwerk besaß. Er schlug etwa drei Meter hinter ihr in den Dreck, aber seine dicken Äste verpassten sie nur um wenige Zentimeter. Jeder einzelne hätte ihr den Schädel zerschmettern können.
Das war knapp gewesen.
Der Teenager war gefallen, als der Baum umstürzte, aber jetzt war er wieder auf den Füßen und rannte weiter. Der Abstand zwischen ihnen hatte sich jedoch verringert.
Sie mobilisierte Kraftreserven, von denen sie nicht genau wusste, ob sie die überhaupt noch besaß, und schoss nach vorn, als habe man sie aus einem Granatwerfer abgefeuert. Dann war sie direkt hinter ihm, warf sich nach vorn und erwischte seine Waden. Er fiel der Länge nach in den Dreck, und Michelle stürzte neben ihn, rappelte sich aber sogleich wieder auf. Ihre Lungen brannten, und sie schnappte keuchend nach Luft. Sie beugte sich nach vorn und behielt ihn mit gezogener Waffe im Blick, denn sie konnte sehen, dass er seine Pistole immer noch in der Hand hielt. Allerdings konnte sie eines erkennen: Sie musste keine Sorge haben, dass er mit seiner Waffe schoss.
Er drehte sich um und saß jetzt mit dem Hintern im Schmutz. Seine Knie presste er gegen die Brust.
»Wer, zum Teufel, sind Sie? Warum verfolgen Sie mich?«
»Warum rennst du bei einem Unwetter mit einer Waffe herum?«, entgegnete sie.
Er sah sehr jung aus und mochte vielleicht fünfzehn Jahre alt sein. Sein rotbraunes Haar klebte auf seinem sommersprossigen Gesicht.
»Lassen Sie mich einfach in Ruhe!«, schrie er.
Dann erhob er sich, und Michelle richtete ihren Oberkörper auf. Sie standen etwa einen Meter voneinander entfernt. Mit ihren einhundertachtundsiebzig Zentimetern Körperlänge war Michelle beinahe zehn Zentimeter größer als er. Seine langen Beine und Füße – Schuhgröße sechsundvierzig, schätzte Michelle – ließen allerdings darauf schließen, dass er über einen Meter fünfundachtzig groß sein würde, wenn er ausgewachsen war.
»Wie heißt du?«, fragte sie ihn.
Er trat einen Schritt nach hinten. »Lassen Sie mich bitte einfach in Ruhe.«
»Ich versuche, dir zu helfen. Mein Partner und ich hätten dich da hinten um Haaresbreite überfahren.«
»Ihr Partner?«
Michelle befand, dass eine Lüge im Moment besser war als die Wahrheit. »Ich bin Polizistin.«
»Polizistin?« Misstrauisch sah er sie an. »Zeigen Sie mir Ihre Dienstmarke.«
Sie ließ ihre Hand in die Jackentasche gleiten und zog ihren Zulassungsausweis als Privatdetektivin hervor. In der Dunkelheit, so hoffte sie, würde dieser wie ein Dienstausweis aussehen. Sie zeigte ihn nur kurz.
»Sagst du mir jetzt, was hier vorgeht? Vielleicht kann ich dir ja helfen.«
Er blickte nach unten. Bei jedem seiner schnellen und ungleichmäßigen Atemzüge hob und senkte sich seine schmale Brust.
»Mir kann niemand helfen.«
»Das ist eine extrem weitreichende Behauptung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Situation so schlimm ist.«
Seine Lippen fingen an zu zittern. »Hören Sie … ich muss jetzt wieder nach Hause.«
»Bist du von dort weggelaufen?«
Er nickte.
»Und woher hast du die Waffe?«
»Die hat meinem Vater gehört.«
Michelle wischte sich die nassen Haare aus dem Gesicht. »Wir können dich mit dem Wagen hinbringen. Sag uns einfach, wo dein Zuhause ist.«
»Nein, ich werde laufen.«
»Das ist keine gute Idee. Nicht bei einem Unwetter wie diesem. Du könntest von einem Auto überfahren oder von einem Baum erschlagen werden, was beides schon fast passiert ist. Wie heißt du?«
Er antwortete nicht.
Daraufhin sagte sie: »Mein Name ist Michelle. Michelle Maxwell.«
»Sind Sie wirklich bei der Polizei?«
»Das war ich früher mal. Danach war ich Agentin beim Secret Service.«
»Echt?« Jetzt klang er wie ein Teenager. Wie ein ehrfürchtiger Teenager.
»Japp. Heute arbeite ich als Privatdetektivin. Aber manchmal bin ich immer noch wie eine Polizistin tätig. Also: Wie heißt du?«
»Tyler«, erwiderte er. »Tyler Wingo.«
»Okay, Tyler Wingo, das ist schon mal ein guter Anfang. Dann lass uns jetzt zu meinem Wagen gehen und …« Ihr Blick fiel auf eine Person, die plötzlich hinter ihm auftauchte. Aber ihr blieb keine Zeit, noch irgendetwas zu sagen.
Sean packte Tyler von hinten, schlug ihm die Pistole aus der Hand und trat sie weg. Dann drehte er ihn zu sich herum.
Tyler war dermaßen entsetzt, dass er gleich wieder losrennen wollte, aber Sean hielt sein Handgelenk mit der Rechten fest umklammert. Mit seiner Größe von einem Meter fünfundachtzig und einem Gewicht von über neunzig Kilogramm hatte er genau die Maße, um den Jungen am Weglaufen zu hindern.
»Lassen Sie mich los!«, brüllte Tyler.
»Sean, es ist okay!«, rief Michelle. »Lass ihn los.«
Widerwillig löste Sean seinen Griff. Er bückte sich, hob die Waffe vom Boden auf und begutachtete sie. »Was, zum Teufel, ist das denn?«
Mit finsterer Miene sah Tyler ihn an. »Eine deutsche Mauser«, antwortete er.
»Ohne Abzugshahn«, hob Michelle hervor. »Das hatte ich im Scheinwerferlicht bereits gesehen. Das macht es etwas schwierig, sie als Waffe zu benutzen, es sei denn, du wirfst damit nach jemandem.«
»Richtig«, pflichtete Sean ihr bei.
»Tyler wollte mir gerade erzählen, wo er wohnt, damit wir ihn dort hinfahren können«, erklärte Michelle.
»Tyler?«, wiederholte Sean.
»Tyler Wingo«, sagte der Junge mit mürrischem Gesichtsausdruck. »Und ich will nicht hoffen, dass Sie die Waffe meines Vaters beschädigt haben. Das ist ein Sammlerstück.«
Sean ließ die Pistole in seinen Hosenbund gleiten. »Weshalb es ziemlich dämlich ist, im Regen damit durch die Gegend zu rennen«, meinte er.
Tyler schaute Michelle an. »Können Sie mich einfach nur nach Hause fahren?«
»Ja«, antwortete sie. »Und auf dem Weg kannst du uns vielleicht erzählen, was passiert ist.«
»Ich hab Ihnen doch schon gesagt, dass es nichts gibt, was Sie tun können.«
»Und das stimmt. Wir können absolut nichts tun, solange du uns nichts erzählst«, erwiderte Michelle.
»Wäre es möglich, dass wir uns auf den Weg zum Wagen machen?«, fragte Sean. »Andernfalls müssen wir ins nächste Krankenhaus fahren, damit sie uns dort wegen Lungenentzündung behandeln. Es sei denn, irgendein Blitz ist schneller und erschlägt uns«, fügte er hinzu, weil gerade ein weiterer Blitz zu sehen war, dem ein ohrenbetäubend lauter Donnerschlag nachfolgte.
Sie liefen zu der Stelle, wo Sean den Land Cruiser geparkt hatte. Im Laderaum waren ein paar Decken. Michelle griff sich drei und gab Tyler eine davon, die er sich um die Schultern legte. Eine zweite reichte sie Sean, und in die letzte wickelte sie sich selbst ein.
»Danke«, murmelte Tyler.
Er kletterte auf den Rücksitz, und Michelle setzte sich neben ihn. Sean fuhr los.
»Wohin?«, wollte er wissen.
Tyler sagte ihm den Straßennamen.
»Und wie kommt man dahin?«, erkundigte sich Sean. »Ich kenne mich in dieser Gegend nicht aus.«
Tyler gab ihm eine detaillierte Wegbeschreibung, während Sean weiterfuhr. Zu guter Letzt bog er nach links in eine Sackgasse ein, an deren Ende ein paar ältere Einfamilienhäuser standen.
»Welches Gebäude?«, fragte Sean.
Tyler zeigte auf das hinten rechts. Es war hell erleuchtet.
Michelle und Sean tauschten einen Blick. Vor der Einfahrt stand ein mattgrüner Ford mit einem Kennzeichen der U. S. Army. Als sie vor dem Haus vorfuhren, traten eine Frau und zwei uniformierte Armeeoffiziere der Army auf die überdachte Veranda hinaus.
»Warum sind die hier?«, wollte Michelle von Tyler wissen.
»Um mir zu sagen, dass mein Vater in Afghanistan getötet wurde«, gab Tyler zur Antwort.
5
Als Sean, Michelle und Tyler aus dem SUV stiegen, hastete die Frau ihnen durch den Regen entgegen. Sie rutschte auf einer der Zementstufen aus, fing sich aber schnell wieder und rannte über die kleine, völlig durchnässte Rasenfläche. Wenn sie ausatmete, entstiegen weiße Wölkchen ihrem Mund.
»Tyler!«, rief sie. Sie war klein, etwa einen Meter sechzig groß und zierlich. Gleichwohl umarmte sie Tyler mit einer solchen Kraft, dass man befürchten musste, sie wollte ihn zu Tode drücken. »Gott sei Dank, dass dir nichts passiert ist. Gott sei Dank.«
Sowohl Sean als auch Michelle bemerkten, dass Tyler während dieser Begrüßung keine Miene verzog. Im nächsten Moment schob er die Frau schnell von sich weg.
»Hör endlich auf«, sagte er. »Du brauchst nicht mehr zu heucheln. Er ist tot.«
Vom Regen völlig durchnässt, stand sie einen Augenblick lang nur da; die Wimperntusche lief ihr über das Gesicht. Dann verpasste sie ihm eine Ohrfeige. »Verdammt noch mal, Tyler Wingo, du hast mich zu Tode erschreckt.«
Michelle stellte sich zwischen die beiden. »Okay, das wird nicht helfen.«
»Wer sind Sie?«, wollte die Frau wissen und schaute zu Michelle auf.
»Nur zwei Menschen, die zufällig Ihren Sohn getroffen und ihn sicher nach Hause gebracht haben«, antwortete Sean. »Das ist alles. Wir werden jetzt gehen.«
Die Soldaten auf der Veranda trugen ihre grünen Uniformen und hatten einen mürrischen Gesichtsausdruck. Der eine war ein sogenannter Benachrichtigungsoffizier, der den undankbaren Job hatte, Hinterbliebenen mitzuteilen, dass ein Mitglied ihrer Familie zu Tode gekommen war. Der andere war ein Geistlicher, dessen Aufgabe darin bestand, den Hinterbliebenen in dieser höchst schwierigen Zeit zur Seite zu stehen.
Michelle legte Tyler die Hand auf die Schulter. »Bist du okay?«
Stumm nickte er und schaute dabei zu den beiden Männern auf der Veranda. Er machte ein Gesicht, als wären die beiden Außerirdische, die ihn entführen wollten.
Michelle zog eine ihrer Visitenkarten aus ihrer Jacke und hielt sie ihm hin. »Wenn du irgendetwas brauchst, ruf uns einfach an, okay?«
Tyler sagte nichts, steckte die Karte aber in seine Jeans und bewegte sich Richtung Veranda.
»Es war nicht meine Absicht, ihn zu schlagen«, sagte die Frau. »Ich hatte mir nur solche Sorgen gemacht. Vielen Dank, dass Sie ihn nach Hause gefahren haben.«
Sean streckte ihr die Hand entgegen. »Mein Name ist Sean King. Das ist Michelle Maxwell. Unser herzlichstes Beileid. Solche Dinge sind immer schwierig, ganz besonders für die Kinder.«
»Es ist für uns alle schwierig«, antwortete die Frau. »Ich bin übrigens Jean Wingo. Tyler ist mein Stiefsohn.«
Sean war im Begriff, die deutsche Mauser aus dem Hosenbund zu ziehen, aber Michelle bedachte ihn mit einem Blick, der ihn innehalten ließ. Anschließend sagte sie: »Noch einmal, unser aufrichtiges Beileid, Mrs Wingo. Tyler scheint ein guter Junge zu sein. Falls wir irgendetwas tun können, lassen Sie uns das bitte wissen.«
»Vielen Dank, aber die Army wird sich um uns kümmern. Die Soldaten haben uns erzählt, dass es da ein Familienbetreuungsprogramm gibt. Diese Leute werden sich morgen mit uns in Verbindung setzen.«
»Das ist gut«, sagte Sean. »Ich bin sicher, dass die Ihnen jetzt helfen können.«
»Wie lange war Tyler denn weg?«, wollte Michelle wissen.
»Er rannte vor etwa zwei Stunden aus dem Haus«, erwiderte Jean. »Ich hatte keine Ahnung, wohin er gelaufen war. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht.«
»Ich verstehe«, antwortete Michelle, die mit gerunzelter Stirn zu Tyler hinüberschaute. Er stand nun auf der Veranda und blickte auf sie hinunter. Die beiden Soldaten versuchten, sich mit ihm zu unterhalten, aber es war deutlich zu sehen, dass er ihnen nicht zuhörte.
»Noch einmal, unser herzlichstes Beileid«, sagte Sean. Er drehte sich zu Michelle. »Können wir jetzt gehen? Ich bin sicher, dass die Army und die Wingos eine Menge zu besprechen haben.«
Michelle nickte zwar, ihr Blick blieb aber auf Tyler geheftet. Sie hob eine ihrer Visitenkarten, um ihn noch einmal daran zu erinnern, dass er sie anrufen könne. Dann stiegen sie und Sean in den Land Cruiser und fuhren weg.
Im Rückspiegel beobachtete Michelle, wie die Wingos und die Soldaten langsam ins Haus zurückgingen. Als Sean Gas gab, lehnte sie sich vorsichtig auf dem Sitz zurück. Ihm fiel auf, dass ihr das Beschwerden bereitete.
»Ein bisschen Muskelkater? Das hast du allein dir selbst zuzuschreiben. Einem Jugendlichen in einem Gewitter nachzujagen! Du hast dir wahrscheinlich jeden einzelnen Muskel im Leib gezerrt. Mir tun die Knie höllisch weh, und ich bin nur halb so weit und auch nur halb so schnell gerannt wie du.«
»KIA«, sagte Michelle.
»Killed In Action, genau«, erwiderte Sean. »Was für ein Mist! Jeder tote US-Soldat ist meiner Meinung nach einer zu viel.«
»Tyler und seine Stiefmutter scheinen nicht gut miteinander auszukommen.«
»Weil sie ihm eine geknallt hat? Er war weggelaufen. Und wie sie sagte, hatte sie sich wahnsinnige Sorgen gemacht. Das war eine Überreaktion. Die machen gerade das Schlimmste durch, was einer Familie passieren kann, Michelle. Da musst du ein bisschen Nachsicht mit ihr haben.«
»Richtig, sie hatte sich wahnsinnige Sorgen gemacht. Und trotzdem war Tyler zwei Stunden verschwunden, und sie wurde erst nass, als sie nach unten kam und ihm eine knallte. Wäre das mein Kind, wäre ich ihm hinterhergelaufen. Er hat ja schließlich kein Auto genommen. Er war zu Fuß unterwegs. Da konnte sie ihm nicht nachrennen? Warum nicht? Hatte sie Angst vor ein bisschen Regen?«
Sean wollte etwas darauf erwidern, tat es dann aber doch nicht. Schließlich sagte er: »Ich weiß nicht. Die Soldaten waren auch nicht nass. Vielleicht zählt das aber auch nicht zu ihren Aufgaben, hinter einem Jugendlichen herzurennen. Wir waren nicht dabei. Wir wissen nicht, was da im Einzelnen gelaufen ist. Vielleicht ist sie ihm mit dem Auto nachgefahren.«
»Auch dann wäre sie nass geworden. Die haben keine Garage. Nicht einmal einen überdachten Stellplatz. Und erinnerst du dich, was Tyler gesagt hat? Nachdem er sie von sich geschoben hatte, meinte er, sie könne aufhören zu heucheln, jetzt, da sein Vater tot sei. Aufhören, was zu heucheln? Dass Tylers Vater ihr etwas bedeutet hat?«
»Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das geht uns doch alles nichts an.«
»Und warum hat Tyler ausgerechnet die Waffe seines Vaters, dieses Sammlerstück, mitgenommen?«
»Welcher Teil von ›geht uns nichts an‹ geht dir nicht ein?«
»Es gefällt mir nicht, wenn gewisse Sachverhalte keinen Sinn ergeben.«
»Schau, wir wissen nichts über ihn. Vielleicht hat die Pistole eine besondere Bedeutung für Tyler. Vielleicht aber war der Junge so am Boden zerstört, als er erfuhr, dass sein Vater tot ist, dass er einfach nach dem erstbesten Gegenstand von ihm gegriffen hat und dann weggerannt ist. Und warum unterhalten wir uns überhaupt darüber? Er ist wieder zu Hause, wo er hingehört.« Plötzlich sah Sean nach unten auf seinen Hosenbund. »Scheiße, ich habe immer noch die Pistole. Ich wollte sie ihm zurückgeben, aber in dem Moment hast du mich mit diesem bösen Blick bedacht. Warum hast du das eigentlich getan?«
»Weil die Waffe uns eine Ausrede liefert, noch mal hinzufahren. Vorzugsweise morgen.«
»Noch mal hinzufahren? Warum?«, rief er.
»Ich will mehr in Erfahrung bringen.«
»Wir haben den Jungen gefunden und ihn nach Hause gebracht. Unsere Arbeit ist getan.«
»Bist du denn gar nicht neugierig?«
»Nein. Warum sollte ich das sein?«
»Ich habe gesehen, wie er seine Stiefmutter angeschaut hat. Ich habe gehört, was er gesagt hat. Von Liebe ist da nichts zu spüren gewesen.«
»So ist das im Leben. Probleme gibt es in allen Familien. Nur der Schweregrad variiert. Aber deshalb verspüre ich nicht das Bedürfnis, mich mitten in die traumatische Lebenssituation zu stürzen, in der sich die Wingos gerade befinden. Im Moment brauchen sie Familie und Freunde, die ihnen helfen.«
»Wir könnten Tylers Freunde sein.«
»Verdammt, Michelle, warum tust du das?«
»Was?«
»Warum mischst du dich in das Leben von Menschen ein, die wir nicht mal kennen?«
»Tun wir das nicht immer wieder? Schließlich gehört das zu unserer Arbeit, oder?«
»Ja, bei unserer Arbeit! Aber nicht bei dieser Sache. Das hier ist kein Fall, also behandle diese Angelegenheit auch nicht wie einen. Niemand hat uns angeheuert, Michelle. Also ziehen wir weiter.«
»Es kommt mir so vor, als würde ich Tyler kennen – oder zumindest das, was er durchmacht.«
»Wie sollte das denn möglich sein? Dein Vater lebt doch noch –« Sean verstummte.
Michelles Vater war zwar noch am Leben, ihre Mutter aber nicht. Sie war ermordet worden. Anfangs hatte Michelle ihren Vater verdächtigt, dieses Verbrechen begangen zu haben. Und das hatte schließlich dazu geführt, dass sie sich mit einer Kindheitserinnerung hatte auseinandersetzen müssen, die während ihres gesamten erwachsenen Lebens wie eine Krebsgeschwulst an ihr gefressen hatte.
In der Folge war einer der Freunde von Sean, ein Psychologe, zu ihr vorgedrungen und hatte ein paar Untersuchungen über ihre Vergangenheit angestellt. Mit seiner Hilfe und einigen traumatischen Momenten in dem Haus, in dem sie aufgewachsen war, hatte Michelle sich schließlich wieder aufgerappelt. Doch nichts davon war einfach gewesen. Und Sean wollte nicht, dass sie so etwas noch einmal durchmachen musste.
Die Messerwunden waren verheilt. Die seelischen Wunden, die sie erlitten hatte, waren vernarbt. Sie würden Narben bleiben, und das Gewicht jeder einzelnen war immens. Und er wusste nicht, wie viele sie mit sich herumschleppen konnte, bevor sie darunter zusammenbrach.
Im Takt des Regens, der auf das Dach des Geländewagens trommelte, klopfte Sean mit der Hand auf das Lenkrad. Er schaute zu Michelle hinüber. Sie starrte scheinbar gedankenverloren vor sich hin. Und ein Teil von ihm hatte das Gefühl, dass er sie noch einmal verlor, nachdem er sie gerade erst wiederbekommen hatte.
»Zumindest die Waffe können wir zurückbringen«, sagte Sean leise. Er schob sich ein paar feuchte Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Lass uns das morgen tun, und dann hoffentlich zu einer Zeit, wenn es nicht regnet.«
»Danke«, erwiderte Michelle, ohne ihn anzusehen.
Sie fuhren zu Michelles Wohnung, wo Sean seinen Wagen geparkt hatte, ein Lexus-Cabrio mit Hardtop. In der überdachten Garage stiegen sie aus dem SUV. Sean händigte ihr die Autoschlüssel aus.
»Fühlst du dich halbwegs okay?«, fragte er.
»Ein heißes Bad, und es wird mir prächtig gehen. Du solltest dir Eisbeutel auf die Knie legen.«
»Alt zu werden ist Mist.«
»Du bist nicht alt.«
»Noch nicht, aber bald.« Er spielte mit seinen Autoschlüsseln. »Es ist zwar kalt, aber du solltest trotzdem morgen auf dem Potomac rudern gehen. Danach fühlst du dich immer besser.«
»Sean, hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich werde nicht wieder verrückt.«
»Du warst niemals verrückt«, stellte er in sanftem Tonfall richtig.
»Noch war ich es nicht, wäre es aber bald geworden«, erwiderte sie. Mit Absicht formulierte sie ihre Aussage in ähnlicher Weise, wie er es gerade eben bei dem kleinen Wortwechsel zu seinem Alter getan hatte.
»Möchtest du heute Abend ein wenig Gesellschaft?«, fragte er und bedachte sie dabei mit einem Seitenblick.
»Heute Abend nicht. Aber danke für das Angebot.«
»Ich bin sicher, dass diese Tyler-Wingo-Sache nichts zu bedeuten hat.«
»Wahrscheinlich hast du recht.«
»Wir bringen einfach die Waffe zurück und schauen mal, was da los ist.«
»Danke, dass du mich bei Laune hältst.«
»Ich halte dich nicht bei Laune. Ich bin nur diplomatisch.«
»Dann danke, dass du diplomatisch bist.«
Sie lief auf den Fahrstuhl zu, der sie nach oben ins Gebäude bringen würde.
Sean behielt sie im Blick, bis sie sicher in der Fahrstuhlkabine war. Eigentlich hätte er sich diese Mühe sparen können. Er hatte einmal mit eigenen Augen gesehen, wie sie gleichzeitig fünf Kerle ausgeschaltet hatte, ohne dabei großartig in Schweiß zu geraten.
Trotzdem behielt er sie im Blick. Trotzdem machte er sich Sorgen um sie. Er nahm an, dass man das als Partner einfach tat.
Er lief zu seinem Wagen und stieg ein. Und dann fuhr er los, in einem gemäßigten, sicheren Tempo.
6
Sam Wingo starrte auf die Landkarte, die vor ihm lag.
Zuerst hatte er seine Ladung und dann um ein Haar sein Leben verloren. Als Nächstes war dann dem Geländewagen, den er sich genommen hatte, mitten in Afghanistan der Treibstoff ausgegangen – nicht gerade ein Ort, an dem man ohne Benzin dastehen wollte.
Von diesem Augenblick an waren ihm nur noch begrenzte Alternativen geblieben. Im Norden lagen Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan, im Westen war der Iran und im Osten und Süden Pakistan. Als Fluchtweg oder -ziel war keines dieser Länder verheißungsvoll. Amerikaner zu sein war in einem der drei Länder im Norden sicherlich vorteilhafter als im Iran oder in Pakistan. Doch Wingo wusste, wohin er letzten Endes fliehen wollte: nach Indien. Es brachte ihm allerdings auch nichts, sich durch Tadschikistan und China nach Indien durchzuschlagen. Das war einfach zu weit.
Nachdem ihm das Benzin ausgegangen war, hatte er einem Mann aufgelauert, der mit einem zusätzlichen Kamel reiste. Er hatte ihm in einheimischer Währung wesentlich mehr bezahlt, als der Mann vermutlich je zu Gesicht bekommen hatte. Dann war Wingo auf dem Biest durch eines der unwegsamsten Terrains im ganzen Land geritten. Die heiße Sonne hatte so erbarmungslos auf ihn herabgeschienen, dass sie jeden Bereich seiner Haut, der ihr ausgesetzt gewesen war, rot verbrannt und ausgetrocknet hatte.
Den Stadtrand von Kabul erreichte er in den Morgenstunden. Endlich hatte er Handyempfang. Während der Reise hatte er sein Telefon ausgeschaltet gelassen, um die Batterie zu schonen. Das Kamel war schließlich nicht mit einer 110-Volt-Steckdose ausgestattet.
Er rief seinen Vorgesetzten an, Colonel Leon South.
»Was, zum Teufel, ist da draußen vorgefallen?«, verlangte South zu wissen.
»Ich hatte gehofft, das würden Sie mir sagen können«, gab Wingo zur Antwort.
»Wo sind Sie?«
»Ich bin in einen Hinterhalt gelockt worden. Zwölf gegen einen.«
»Wo sind Sie, Sam?«
Es störte Wingo, dass der Mann diese Frage nun schon zum zweiten Mal gestellt hatte.
Wingo erwiderte: »Und wo sind Sie?«
»Das Ganze ist eine unvorstellbare Katastrophe!«, fuhr South ihn an.
»Ich konnte nichts dagegen tun. Wie ich schon sagte, stand es zwölf gegen einen. Und der Anführer hatte Ausweispapiere, auf denen ›CIA‹ stand. Die sahen zwar echt aus, aber ich habe ihnen ihre Geschichte trotzdem nicht abgekauft.«
»Gequirlte Scheiße.«
»Tim Simons – so hieß der Anführer. Er hat behauptet, er stamme aus Nebraska. Prüfen Sie es nach.«
»Ich prüfe hier gar nichts nach. Erst müssen Sie herkommen.«
»Ich konnte nichts tun, Sir.«
»Sie hatten ein Sicherungssystem für den Notfall, Wingo. Aber da Sie sich hier mit mir unterhalten, gehe ich davon aus, dass Sie den nicht zum Einsatz gebracht haben – obwohl Sie den strengen Befehl hatten, genau das zu tun, wenn irgendetwas schiefgehen sollte. Wenn Sie Zweifel an der Identität der Leute hatten, warum sind Sie dann noch am Leben?«
»Die Papiere wiesen sie als CIA-Agenten aus. Ich war zwar skeptisch, wollte aber nicht riskieren, unsere eigenen Leute in die Luft zu jagen.«
»Mich interessiert einen Scheißdreck, was auf dem Ausweis gestanden hat. Von mir aus kann da Jesus Christus gestanden haben. Ist Ihnen bewusst, was Sie getan haben?«
»Ja, ich kann es mir denken.«
»Wo ist der LKW?«
»Das weiß ich nicht.«
»Und die Ladung?«
»Die war im LKW, als ich den das letzte Mal gesehen habe.«
»Das ist nicht gut, Wingo, das ist ganz und gar nicht gut.«
»Ja, auch das kann ich mir denken.«
»Wenn Sie irgendetwas mit der Ladung gemacht haben …«, hob South an.
»Wenn ich sie gestohlen hätte«, fiel Wingo ihm ins Wort, »glauben Sie, dann würde ich Zeit darauf verschwenden, Sie anzurufen?«
»Wenn Sie mir eine Tarngeschichte erzählen wollen, um Ihren Arsch zu retten, würden Sie genau das tun.«
»Warum sollte ich diese Ladung stehlen?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich denke nicht wie ein Verbrecher oder Verräter.«
»Was ich beides nicht bin.«
»Gut zu hören. Dann wird das Ganze keine negativen Konsequenzen haben. Aber Sie müssen wirklich herkommen.«
»Erst muss ich mehr wissen.«
»Wir haben Sie speziell für diese Mission rekrutiert. Wir haben die gesamte Basisarbeit geleistet, weiß Gott wie viel Zeit und Geld investiert, mehr Risiken auf uns genommen, als wir je auf uns nehmen sollten, und jetzt ist das alles zum Teufel gegangen. Und Sie stecken mittendrin in dem Ganzen. Ich wusste es! Wir hätten niemals nur einen einzigen Mann losschicken dürfen. Die Versuchung war zu groß.«
»Ich bin nie in Versuchung geraten.«
»Ich weiß. Irgendwelche Kerle sind vorbeispaziert, mitten im verfluchten Afghanistan, und dann ist die Mutter aller Zufälle passiert, und die haben Ihnen alles abgenommen.«
»Geplant war, dass mich Freiheitskämpfer in Empfang nehmen sollten, nicht die CIA.«
»Die waren nicht die CIA!«, brüllte South.
»Sind Sie da sicher?«, blaffte Wingo ihn an.
Er konnte hören, dass South sehr schwer atmete, aber eine Antwort gab der Colonel ihm nicht.
»Diese Leute waren da. Sie wussten, was im LKW war. Ihre Dienstausweise sahen echt aus. Dieser Knabe Simons sagte, der Plan sei geändert worden.«
»Der Plan ist nicht geändert worden. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich davon gewusst.«
»Ich sauge mir die Scheiße nicht aus den Fingern, Sir. Es ist wirklich passiert.«
Eine Weile sprach South kein Wort. »Okay«, meinte er dann, »beschreiben Sie mir diesen Kerl. Und die anderen, die bei ihm waren.«
Wingo tat es. Das war einfach. Er hatte in seiner Ausbildung gelernt, sich derartige Einzelheiten zu merken. Und die Wahrheit war: Wenn jemand einem eine Knarre unter die Nase hielt, merkte man sich, wie derjenige aussah, weil es möglicherweise das letzte Gesicht war, das man sehen würde.
»Ich werde schauen, was ich herausfinden kann, Wingo. Aber dass Sie da draußen geblieben sind, ist für viele wichtige Leute hier bereits der Beweis für Ihre Schuld.«
»Was ist den Leuten passiert, mit denen ich verabredet war?«
»Die waren am vereinbarten Treffpunkt.«
»Nein, das waren sie nicht.«
»Lassen Sie mich deutlicher werden. Ihre Leichen wurden hinter dem Gebäude gefunden, das als Treffpunkt vereinbart war.«
Wingo schnappte nach Luft. »Dann muss die CIA sie umgebracht haben.«
»Vielleicht haben Sie es aber auch getan.«
»Sir …«
»Haben Sie sie umgebracht?«, brüllte South.
»Nein!«, schrie Wingo zurück. »Wenn diese Kerle nicht zur CIA gehören und der Plan nicht geändert worden ist, dann haben sie auf illegale Weise von der ganzen Sache erfahren. Was bedeutet, dass wir irgendwo eine verfluchte undichte Stelle haben.«
»Hören Sie, Wingo, Ihre Arbeit ist getan. Sie müssen herkommen und uns Ihren Abschlussbericht geben, und dann sehen wir weiter.«
»Ich muss das in Ordnung bringen«, erwiderte Wingo.
»Sie müssen herkommen, Soldat. Das müssen Sie tun.«
»Warum? Damit Sie mich irgendwo ins Gefängnis stecken können? Es hört sich ganz so an, als wären Sie ziemlich überzeugt von meiner Schuld.«
»Ob Sie schuldig sind oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Sie haben Ihre Mission total versaut und direkte Befehle verweigert. Ganz egal, wie Sie das drehen – Sie werden in einem Militärgefängnis enden und dort sehr, sehr lange sitzen.«
Bei diesen Worten lehnte Wingo den Kopf gegen die Steinmauer des alten Hauses, neben dem er stand. Mitten im afghanischen Dreck wurde ihm mulmig zumute.
Militärgefängnis für den Rest meines Lebens?
»Ich muss Verbindung zu meinem Sohn aufnehmen und ihm sagen, dass ich okay bin«, sagte Wingo. »Ich will nicht, dass er sich Sorgen macht.«
Wingo hörte, wie South sich räusperte. »Das ist nicht möglich«, entgegnete der Colonel.
»Wieso nicht? Man hat ihm gesagt, ich würde vermisst. Sagen Sie ihm einfach, dass man mich gefunden hat. Ich will nicht, dass er sich Sorgen um mich macht.«
»Er geht nicht davon aus, dass Sie vermisst werden.« South hielt einen Moment inne. »Man hat ihm gesagt, dass Sie gefallen sind.«
Ein paar Sekunden vergingen, bevor Wingo etwas darauf erwidern konnte. »Was, zum Teufel, reden Sie da?«, flüsterte er in blutrünstigem Ton.
»Das Risiko, dass Sie nicht lebend wiederkommen würden, war sehr groß, Wingo.«
»Noch bin ich nicht tot.«
»Es ist geschehen. Ich kann es nicht ungeschehen machen, ohne der Mission schwer zu schaden. Sogar noch mehr zu schaden«, fügte er hinzu.
»Ich kann das nicht fassen. Mein Sohn glaubt, ich sei tot? Welcher Idiot hat das autorisiert?«, brüllte Wingo.
»Dafür haben Sie ausschließlich sich selbst die Schuld zuzuschreiben. Wir dachten, Sie seien tot. Sie haben sich nicht gemeldet.«
»Ich konnte mich nicht melden. Ich hatte bis jetzt gerade keine Möglichkeit, mich zu melden.«
»Nun, Soldat, diese Sache sollte noch Ihre geringste Sorge sein«, meinte South. »Sind Sie noch im Land? Ich kann Ihnen einen Hubschrauber oder ein Humvee schicken, je nachdem, wo Sie sind.«
»Ich bin nicht mehr im Land«, log Wingo, dem immer noch der Kopf schwirrte.
South sprach die nächsten Worte langsam und mit größtem Bedacht. »Sagen Sie mir ganz genau, wo Sie sind, und ich werde Leute schicken, um Sie abzuholen.«
»Ich glaube nicht, Sir.«
»Wingo!«
»Wenn ich das nächste Mal anrufe, wäre ich dankbar dafür, ein paar richtige Antworten zu bekommen, anstatt mit Scheiße abgefüttert zu werden. Und sollte meinem Sohn wegen dieser Sache etwas passieren, irgendetwas, werde ich Sie persönlich dafür zur Verantwortung ziehen.«
»Wingo!«