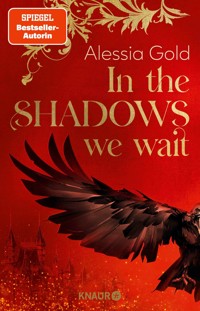
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Redveil
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe, die nie starb. Zwei Vampire, die nie vergessen. Und eine Legende, die zur Wirklichkeit wird. Seit Xara weiß, dass sie adoptiert ist, suchen sie schreckliche Albträume heim. Um mehr herauszufinden, reist sie an ihren Geburtsort in ein mysteriöses rumänisches Dorf. Hier verstricken sich ihre Träume mit der Realität und sie muss sich fragen, ob die Legende um eine verfluchte Fürstin mehr als nur ein Märchen ist. Denn sie wird für genau diese gehalten und das allen voran von dem mächtigen Vampirfürsten Dorian und seinem charismatischen Diener Juraj. Beide Männer behaupten, sie sei die Reinkarnation ihrer großen Liebe, und beide wollen sie für sich. Koste es, was es wolle … Der Auftakt zur neuen fesselnden Dark-Romantasy-Dilogie von der SPIEGEL-Bestsellerautorin Alessia Gold mit den beliebten Tropes: - True Love Triangle - Cursed Love - Slow Burn - Chosen One - Reincarnation - Haters to Lovers - Forbidden Love - Arranged Marriage - Mafia Vibes Dark, spicy, romantisch – perfekt für Leser*innen von The Serpent and the Wings of Night und Empire of Sins and Souls. *** Morally Grey is our favourite colour *** Dieses Buch beinhaltet Themen, die bei manchen Menschen ungewollte Reaktionen auslösen können. Bitte achtet daher auf die Liste mit sensiblen Inhalten, die wir im Buch zur Verfügung stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alessia Gold
In the Shadows we wait
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine Liebe, die nie starb. Zwei Vampire, die nie vergessen. Und eine Legende, die zur Wirklichkeit wird.
Seit Xara weiß, dass sie adoptiert ist, suchen sie schreckliche Albträume heim. Um mehr herauszufinden, reist sie an ihren Geburtsort in ein mysteriöses rumänisches Dorf. Hier verstricken sich ihre Träume mit der Realität und sie muss sich fragen, ob die Legende um eine verfluchte Fürstin mehr als nur ein Märchen ist. Denn sie wird für genau diese gehalten und das allen voran von dem mächtigen Vampirfürsten Dorian und seinem charismatischen Diener Juraj. Beide Männer behaupten, sie sei die Reinkarnation ihrer großen Liebe, und beide wollen sie für sich. Koste es, was es wolle …
Zwischen alten Flüchen, verbotener Magie und zwei unsterblichen Herzen muss Xara ihre Vergangenheit entschlüsseln und herausfinden, wer sie wirklich ist – der Auftakt zur neuen fesselnden Dark-Romantasy-Dilogie von SPIEGEL-Bestsellerautorin Alessia Gold.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Content Notes - Hinweis
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Glossar
Content Notes
Bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findest du am Ende des Buches eine Liste mit sensiblen Inhalten.
Für alle, die schon immer Team Beide waren.
Diesmal müsst ihr euch nicht entscheiden.
Prolog
Die Hure muss brennen!«
»Auf den Scheiterhaufen mit ihr!«
»Die Hexe ist unser aller Untergang!«
Die schrillen Stimmen übertönen sogar das Knistern der Flammen, die hoch in den Nachthimmel ausschlagen und ihn in helle Orangetöne färben. Das Holz ächzt und knarzt unter jedem meiner erzwungenen Schritte und gibt unter der Hitze des Feuers mehr und mehr nach. Es riecht nach Rauch, nach heißem Holz, nach etwas, das ich nicht benennen kann, aber das sich wie eine Vorahnung in meine Nase frisst. Als wüsste mein Körper längst, was auf ihn zukommt. Meine Augen brennen und tränen, ich kann nichts erkennen außer dem, was mich in Kürze umbringen wird.
Wo sind sie?
Lassen sie mich hier sterben?
Verbrennen?
Wie die Hexe, die ich bin?
Die Hure, die das Volk in mir sieht?
Meine Lippen verziehen sich zu einem Grinsen, was den Schaulustigen nicht entgeht. Ihre Sicht ist durch den Rauch, der mich umgibt, ganz offensichtlich nicht so eingeschränkt wie meine, ihre Augen brennen nicht, sie sehen jedes erbärmliche bisschen meiner Qual. Das Stimmengewirr schwillt an wie ein freigelassener Bienenschwarm. Surrend dringen weitere Wortfetzen an meine Ohren. Ich muss sie nicht genau verstehen, um zu wissen, was sie von mir halten.
Verräterin.
Lügnerin.
Abschaum.
Feindin.
Ein Stoß in den nackten Rücken wirft mich nach vorn, und ich lande mit den Händen auf dem glimmenden Holz. Heißer Schmerz durchzuckt meinen Körper, doch ich beiße mir auf die Unterlippe, um mir keine Blöße zu geben.
Ich bin ihre Königin. Wenn ich sterbe, dann erhobenen Hauptes.
Doch ich habe nicht vor, hier und jetzt zu sterben. Mit all meiner verbliebenen Kraft, die wegen der zeitlosen Tage im Verlies nicht annähernd so machtvoll ist wie sonst, richte ich mich auf und schreite durch das Feuer. Die Flammen schlagen an mir empor.
Ich wische mir über die Augen, versuche, dem Tränenschleier Einhalt zu gebieten, und blinzle heftig, um meine Sicht zu klären. Suchend gleitet mein Blick über die Menge. Männer, Frauen und Kinder, gehüllt in Lumpen, recken ihre Fackeln in die Luft.
»Gebt ihr, was sie verdient!«, brüllt ein Weib, und ich kann nicht anders, als zu lachen.
Die Flammen züngeln immer höher, lecken an meiner Haut, fressen sich in mich. Je länger ich im Feuer ausharre, desto mehr schwindet meine Kraft. Doch ich bleibe hocherhobenen Hauptes stehen.
Und warte.
Kapitel 1
Xara
Es ist so heiß. Schweiß steht mir auf der Stirn und rinnt in kleinen Tropfen in meinen Nacken. Ich spüre meine Muskeln nicht mehr, kann mich nicht rühren. Und mit dem nächsten Atemzug kommt ein weiterer, krächzender Hustenanfall.
Ich ersticke.
Panik macht sich in mir breit, als sich das Feuer immer höher an meinen Waden hinauffrisst. Meine Haut ist übersät mit Blasen, die eine nach der anderen aufplatzen, und der Anblick des freigelegten blutigen Fleisches bringt mich zum Würgen. Wieder ringe ich nach Luft, wieder legt sich ein Druck auf meine Lunge, der mir das Atmen unmöglich macht.
»Miss?«
Ein zusätzliches Gewicht auf meiner Schulter drückt mich tiefer in die Hitze, in die glimmende Glut des Feuers. In die Asche, die meine Lunge verklebt.
»Miss, geht es Ihnen gut?«
Hustend und nach Luft ringend komme ich zu mir. Ich blinzle, einmal, zweimal, dann kann ich das Bild vor mir ausmachen als das, was es ist: das Gesicht der besorgt dreinblickenden Flugbegleiterin.
»Möchten Sie ein Glas Wasser?«, fragt sie und nimmt ihre Hand von meiner Schulter.
Oh verdammt. Ist es schon wieder passiert? In aller Öffentlichkeit?
Hastig setze ich mich auf, räuspere mich und ziehe die Decke von meinen Schultern, bis sie als kleiner Haufen in meinem Schoß liegen bleibt. Nur langsam verschwindet der Nebel aus meinem Kopf, wie immer, wenn mich Träume von dieser Frau heimsuchen.
Doch die Hitze bleibt.
Ich bin besser darin geworden, die Bilder abzuschütteln, doch dafür werden sie mit jedem Mal intensiver. Es ist, als könnte ich noch immer spüren, wie sich die Flammen des offenen Feuers in meine Haut fressen. Als würde ich wirklich in dem Scheiterhaufen stehen und verbrennen.
»M-mir geht es gut, danke«, erwidere ich und räuspere mich erneut, um das Kratzen in meiner Stimme loszuwerden. »Es war nur ein Albtraum. Ein Glas Wasser wäre toll.«
Ich zwinge mich zu einem Lächeln, auch wenn mir nicht danach ist. Seit zehn Monaten, seit meinem einundzwanzigsten Geburtstag, verfolgen mich diese Träume, die nicht nur mit jedem Mal deutlicher, sondern auch gefährlicher werden. Ich habe gespürt, wie ich sterbe. Diese Träume wirken so verdammt real, realer als alles, was ich je gefühlt habe.
Mein Herz pocht noch immer viel zu schnell, als die Flugbegleiterin zurückkehrt. Ich kann das Zittern in meinen Händen nicht unterdrücken und stelle den Becher Wasser gleich auf dem Tisch vor mir ab, statt ihn an meinen Mund zu führen und dabei alles auf mich zu schütten, wie es unweigerlich passieren würde.
Mit einem letzten besorgten Blick lässt die Flugbegleiterin mich endlich allein, und ich verbringe den Rest des Fluges damit, mich mit meinem Buch wach zu halten, ohne irgendwas vom Inhalt wirklich wahrzunehmen. Aber einen weiteren wirren und viel zu realistischen Traum will ich auch nicht riskieren.
Als wir nach dem zehnstündigen Flug endlich in Bukarest landen, bin ich dank der Zeitverschiebung und des Nachtfluges völlig gerädert. Doch auch auf der anschließenden Busfahrt zwinge ich mich, die Augen offen zu halten, auch wenn es mir die völlig unspektakuläre Umgebung wirklich nicht leicht macht. Nachdem wir die alten sozialistischen Wohnblöcke hinter uns gelassen haben, folgt ein genauso wenig ansprechendes Industriegebiet, bevor der Bus stundenlang an Feldern entlangfährt. Im Sommer liegt darin vielleicht irgendein Reiz, aber jetzt, im Spätherbst, liegen die Flächen verwittert und grau vor mir. Dazu kommt der Schneeregen, der die ohnehin schon lange Fahrt noch länger und trister wirken lässt.
Mit der einen Hand presse ich den Rucksack an meine Brust, lege meine Wange darauf ab und versuche, irgendwie wach zu bleiben. Doch das Schneeflocken-Regen-Gemisch vor dem Fenster und das beständige Ruckeln des Busses lullen mich ein. Immer wieder fallen mir die Augen zu, immer wieder schrecke ich mit klopfendem Herzen hoch und werfe einen hastigen Blick durch den Bus, um zu sehen, ob mich jemand anstarrt, weil ich im Schlaf … nun ja … sterbe.
Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Laut meiner Mom – und auch dem ängstlichen Blick der Flugbegleiterin nach zu urteilen – gehen diese Träume nicht spurlos an meinem schlafenden Körper vorbei. Ich wimmere, ich flehe, ich mache Geräusche, die man wohl einfach macht, wenn man verbrennt. Nicht nur einmal stand meine Mom in meinem Zimmer und hat mich voller Panik geweckt. Den Anblick, wie sie in diesen Momenten vor mir stand, werde ich wohl niemals vergessen.
Fahrig ziehe ich mein Handy aus der Seitentasche meiner Winterjacke. Beim Verlassen des Flughafengeländes konnte es keine Verbindung aufbauen, jetzt, hier, abseits jeder Zivilisation, ist das Netz nicht besser. Ich unterdrücke ein Seufzen. Hier draußen ist wirklich nichts.
Eine halbe Stunde lang starre ich mit müden Augen auf mein Display, spiele irgendwelche sinnlosen Games, die keinen Internetzugang benötigen, bis sich schließlich etwas tut. Ein kleiner Balken zeigt die lausige Verbindung an, und dann ploppt eine ganze Reihe neuer Nachrichten auf dem Display auf.
Das Gerät noch in der Hand, reibe ich mir mit dem Handrücken über die Augen, bevor ich den Nachrichtenverlauf öffne.
Mom
Denk dran, viel zu trinken! So ein langer Flug dehydriert.
Mom
Dein Dad hat nicht eine Minute geschlafen, als er deine Flugnummer im Internet verfolgt hat. Das Internet … Fluch und Segen zugleich.
Mom
Diese Stalkingseite sagt, dein Flugzeug ist um 10:02 Uhr sicher in Bukarest gelandet. Wieso bekomme ich keine Antwort von meiner Tochter??
Mom
Xara?
Mom
Ich habe beim Flughafen angerufen. Sie sagen, das Gepäck ist längst ausgegeben. Wo bist du? Geht es dir gut?
Die letzte Nachricht kam vor zwanzig Minuten, und in dieser Sekunde beginnen die Punkte über dem Eingabefeld erneut zu hüpfen. Bevor meine Mutter noch vor Sorge in den nächsten verfügbaren Flieger springt und mir hinterherreist, komme ich ihr mit einer Nachricht zuvor.
Ich
Schlechtes Netz, Mom. Tut mir leid.
Ich schicke die Nachricht ab und hänge drei Herz-Emojis an, bevor ich erneut tippe. Sollte sich das Netz wieder verabschieden, weiß sie immerhin, dass ich weder verschleppt noch verschollen bin.
Ich
Es hat alles gut geklappt. Ich sitze im Bus, habe eine gefüllte Wasserflasche in der Hand und ein überteuertes Flughafen-Sandwich im Bauch. Es schneit leicht, aber der Bus kommt gut durch. Ich melde mich, wenn ich in Surnova angekommen bin. Macht euch keine Sorgen, ich bin ein großes Mädchen. Grüß Dad von mir. Hab euch lieb.
Ihre Antwort kommt postwendend.
Mom
Du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben, auch wenn du vierzig bist und eigene Kinder hast. Pass auf dich auf!
Ihre Worte treiben mir die Tränen in die Augen. Meine Hand um das Handy verkrampft sich, als ich es zurück in die Jackentasche stopfe. Es ist unfair ihnen gegenüber, so zu fühlen. Meine Eltern sind die besten Eltern, die man sich nur wünschen kann. Sie sind und waren immer für mich da, haben mir die beste Kindheit ermöglicht, in der es mir an nichts mangelte. Aber seit sie mir an meinem einundzwanzigsten Geburtstag eröffnet haben, dass sie nicht meine leiblichen Eltern sind, ist etwas anders. In mir ist etwas anders. Auch wenn sie mir schluchzend beteuert haben, dass sich nichts an unserer Beziehung zueinander ändern wird, hat sich etwas geändert. Das ist der Grund, warum ich nun hier im Bus sitze und in ein Dorf fahre, das so verdammt klein ist, dass es auf keiner Karte eingezeichnet ist. Laut der Adoptionsurkunde stamme ich aus Surnova, aber das ist auch alles, was man über meine Geburt festgehalten hat. Die Namen meiner leiblichen Eltern sind nicht vermerkt. Und niemand weiß, wie ich im zarten Alter von zwei Wochen nach Philadelphia gekommen bin. Doch für mich ist es jetzt Zeit, genau das herauszufinden.
Meine Mom und mein Dad werden immer meine Eltern bleiben, aber die Unruhe in mir, die mit jedem Tag drängender wird, kann ich nicht länger ignorieren.
Genauso wenig wie die Träume.
Ich schätze, sie sind eine Art Bewältigungsstrategie meines Geistes, um meine ungeklärte Identität und meine Wurzeln zu verarbeiten. Ein Hoch auf die zwei Semester Psychologie, die mir wenigstens in eigener Sache recht nützlich sind.
Ich setze all meine Hoffnung auf diese Reise, ich will endlich alles über mich und meine Vergangenheit lernen und dann mit all den Fragen abschließen können, die mich seit der Adoptions-Offenbarung quälen. Ich will mein gewohntes Leben zurück.
Und sollte dieser Plan nicht aufgehen, habe ich mein Urlaubssemester wenigstens sinnvoll genutzt und neue Erfahrungen gemacht.
Nach vorne schauen. Positiv bleiben. Das ist mein Motto. Alles passiert aus einem Grund.
Während der Fahrt nimmt der Regen ab und der Schnee zu, und so kommt der Bus mit einer Stunde Verspätung an seinem Zielort Ashrode an.
Der Himmel ist grau, dichte Flocken fallen herab, und die wenigen Mitreisenden verteilen sich auf die alten Autos, die vor dieser mittelalterlichen Kulisse warten. In meinem ganzen Leben habe ich noch keinen so altmodischen Busbahnhof gesehen. Nicht, dass dieser hier diese Bezeichnung verdient hat. Es ist lediglich ein asphaltierter, runder Platz, auf dem ein großer Reisebus gerade so genügend Raum zum Wenden hat. Ein Wartehäuschen mit zerschlagener Fensterscheibe steht mit etwas Abstand vor dem anschließenden, weitläufigen Feld und ist neben dem Bus alles, was besagten Busbahnhof ausmacht.
Genau zwei Wege führen von hier weg: zurück auf die Autobahn, von der wir gekommen sind, oder über den hügeligen Kopfsteinpflasterweg in Richtung der Stadtmauer.
Ja, hier gibt es eine echte Stadtmauer. Ich wusste durch meine Google-Recherchen, wie abgelegen Surnova liegt, aber die Realität zu sehen, sprengt all meine Vorstellungen. Und hier bin ich noch nicht einmal an meinem Endziel angekommen.
Auf die gute Weise, schätze ich. Nichts geht über neue Erfahrungen, und so, wie es aussieht, werde ich hier viele davon machen.
Mit der Reisetasche in der einen Hand und dem Riemen meines Rucksacks in der anderen, stehe ich wie bestellt und nicht abgeholt in der Kälte, während alle anderen Mitreisenden ihre Mitfahrgelegenheiten finden. Nur für mich bleibt keine übrig.
Das ist nicht gut. Ich hatte meine Ankunft beim städtischen Taxidienst angekündigt, doch anscheinend wollte der Fahrer nicht auf mich warten. Und ein Blick auf mein stummes Handy verrät, dass ich an meinem Zielort genauso wenig Netz habe wie auf fast der ganzen Fahrt.
Keine Chance, dass ich mir ein neues Taxi bestelle.
Mit einem leisen Zischen schließen sich die Türen des Reisebusses, bevor auch dieser wendet, im Nebel verschwindet und mich ganz allein zurücklässt.
Ich atme tief ein, umfasse den Riemen meines Rucksacks fester und stapfe entschlossen los.
Plan B muss her, und der ist nicht sonderlich schwer zu erraten: Ich muss laufen.
Seufzend stoße ich die nervös angehaltene Luft aus, und sie steigt als kleines Wölkchen um meinen Kopf herum auf. Das von Schneematsch bedeckte Kopfsteinpflaster ist rutschig, und so brauche ich länger als gedacht, um mich den ansteigenden Pfad zur Stadtmauer hochzukämpfen. Aber als ich ankomme, ist mir warm, und meine Glieder haben mir das stundenlange Sitzen der Reise endlich verziehen.
Das Positive sehen – Check.
Kurz lasse ich meinen Blick schweifen. Das mit Efeu überwucherte Holztor ist geöffnet, und so marschiere ich guter Dinge hindurch. Dahinter erwartet mich eine Kulisse, die mich gedanklich an ein Filmset eines Mittelalterfilms katapultiert. Nur mit dem Unterschied, dass dieses Dorf echt ist. Laute Stimmen überlagern sich, und es dauert nicht lange, bis ich sie einer Richtung zuordnen kann. Die gepflasterte Straße führt in einem großen Bogen auf eine Kirche zu, vor der zahllose Stände aufgebaut sind. Es herrscht reger Betrieb. Marktschreier preisen ihre Waren in einer Sprache an, die ich nicht beherrsche, Leute stehen in kleinen Gruppen zusammen, unterhalten sich laut, Kinder rennen umher, lachen und schreien.
Gebrochen wird das mittelalterlich anmutende Bild durch die Autos, die am Wegesrand abgestellt sind oder sich ihren Weg zwischen den Marktständen hindurch bahnen.
Und durch das blinkende Neonschild mit der Aufschrift Informații turistice über einem windschief gemauerten Haus.
Laut meinen Recherchen sind es von Ashrode noch einmal gute dreißig Kilometer bis zu meinem eigentlichen Ziel. Wenn es hier schon so klein und rückständig aussieht, was erwartet mich dann in dem noch abgelegeneren Dorf?
Nachdem ich die erste Irritation abgeschüttelt habe, überquere ich die Straße und schiebe die Tür zur besagten Touristeninformation auf. Eine kleine Glocke klingelt und kündigt mein Eintreten an, dennoch dauert es ein paar Minuten, bis sich etwas regt und eine untersetzte, rundliche Frau aus einem angrenzenden Büro zu mir in den Raum kommt. Mit sichtlich irritiert gehobenen Augenbrauen mustert sie mich skeptisch. Sie wirft die Bürotür ins Schloss und bleibt mit vor der üppigen Brust verschränkten Armen hinter dem Tresen stehen. Dabei bedenkt sie mich mit einem weiteren abschätzenden Blick, scannt mich förmlich von oben nach unten, und hält ihr Gesicht nicht davon ab, ihr Urteil ungefiltert zu offenbaren. Und ganz offensichtlich urteilt sie hart.
Ich trete näher. »Hallo«, sage ich und lächle, bekomme von ihr aber nur ein aufforderndes Grunzen als Erwiderung. »Ich hatte ein Taxi bestellt, aber mein Bus hatte eine Stunde Verspätung.« Mit einem lauten Rumpeln lasse ich meine Tasche auf den Boden fallen, damit ich mit der freien Hand wenig hilfreich durch die Luft gestikulieren kann. »Haben Sie vielleicht ein Telefon, das ich benutzen könnte, um den Taxidienst anzurufen?«
»Taxi?« Sie kneift die Augen zusammen. »Hier gibt es keine Taxis.«
»Hier gibt es ke– Okay.« Ich breche mitten im Satz ab, da die Frau sichtlich ungeduldig mit ihren Fingerspitzen auf ihrem Unterarm herumtrommelt. »Ich muss nach Surnova. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich …«
»Niemand will nach Surnova.«
Ich versuche, mir meine wachsende Irritation nicht anmerken zu lassen, und setze zu einer Erklärung an. »Ich habe ein Taxi bestellt, mein Bus hatte aber eine Stunde Verspätung, und so war das Taxi nicht hier, was ich absolut verstehen kann.« Ich hole tief Luft und mache eine weitere, überflüssige Geste mit der Hand. Ich habe das Gefühl, mich um Kopf und Kragen zu reden. »Aber ich hatte keine Möglichkeit, den Fahrer zu informieren, weil ich einfach kein Netz bekomme …«
Die gute Dame sieht nicht so aus, als würde es sie kümmern, was ich zu sagen habe. »Hier gibt es keine Taxis.« Sie macht einen Schritt zurück. »Niemand will nach Surnova.«
»Aber ich …«
»Niemand will nach Surnova!« Ihre Stimme schneidet wie ein Messer durch die kalte Zimmerluft. Sie zeigt auf die Tür, durch die ich gekommen bin, dreht sich um und verschwindet im Nebenraum.
Ein paar Sekunden stehe ich nur fassungslos da, dann bücke ich mich nach meiner Tasche und hebe sie mit klammen Fingern vom Boden.
Das hätte besser laufen können. Deutlich besser.
Aber wer bin ich, dass ich an der kleinsten Herausforderung scheitere?
Nein. Ich werde nicht scheitern. Ich will und werde nach Surnova kommen – und wenn ich den ganzen Weg laufen muss.
Kapitel 2
Xara
Es ist schwer, die positive Grundeinstellung aufrechtzuerhalten, wenn es immer dunkler und kälter wird und man weder ausreichendes Netz hat, um Google zu befragen, noch irgendwelche Menschen findet, die einem weiterhelfen wollen.
Nachdem ich eine Runde über den Markt gedreht habe und jeden, der nicht völlig abweisend dreingeblickt hat, vergeblich um Hilfe gebeten habe, bin ich gelinde gesagt aufgeschmissen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als mir ein Hotel zu suchen. Morgen finde ich vielleicht eine Möglichkeit, nach Surnova zu kommen, im schlechtesten Fall muss ich wohl laufen. Bei dreißig Kilometern und diesem furchtbar deprimierenden Wetter ist Letzteres nicht unbedingt mein Lieblingsszenario.
Mit zusammengepressten Lippen lasse ich meinen Blick über die vor mir liegende Straße wandern. Der Schnee hat sich verzogen und einem kalten Nieselregen Platz gemacht, der das Kopfsteinpflaster noch rutschiger werden lässt. Ich bewege mich nur langsam voran, ein Sturz wäre wirklich das Letzte, was ich heute noch gebrauchen könnte. Ich lasse den belebten Markt hinter mir und folge einem Labyrinth aus verwinkelten Gassen tiefer in die kleine Stadt hinein.
Ashrode ist objektiv betrachtet eigentlich ganz süß, und wenn der verdammte Regen und meine Verzweiflung nicht wären, würde ich die Stadt mit anderen Augen sehen. Die kleinen Häuser sind zwar deutlich in die Jahre gekommen, aber gepflegt. Die meisten Fenster sind mit ordentlich drapierten, bunten Gardinen behangen, an den Steinfassaden gibt es zahlreiche bepflanzte Blumenkästen zu bestaunen, und die kleinen Vorgärten erinnern an Märchengärten. Es ist der absolute Kontrast zu Philly, aber auch wenn hier keine Wolkenkratzer in den Himmel ragen, fühle ich mich erstaunlich wohl und angekommen. Es klingt verrückt und sehr weit hergeholt, aber mein begrenztes Psychologiewissen redet mir ein, dass mein Hirn längst den Fakt akzeptiert hat, dass ich aus dieser Gegend stamme und die Akzeptanz meiner Wurzeln eng mit meinem Wohlbefinden verknüpft ist. Vielleicht sollte ich doch weitere Kurse in dem Bereich belegen und diese Fragestellung in meiner Bachelorthesis überprüfen.
Aber erst im nächsten Semester.
Ich passiere einige Gaststätten, in denen reger Betrieb herrscht. Durch die gekippten Fenster dringt lautes Stimmengewirr, aber verstehen kann ich davon nichts. Der Duft nach würzigem Essen füllt die engen Gassen, und mein Magen meldet sich mit einem Knurren, das verrät, wie lang das Sandwich im Bus schon her ist.
Knapp eine halbe Stunde später erreiche ich schließlich einen weiteren Marktplatz vor einer kleineren Kapelle. Die Stände sind verschlossen oder werden gerade von in dicke Fleecejacken gehüllten Männern abgebaut, die sich gegenseitig lautstarke Anweisungen zurufen.
Oh Mann, ich hätte vielleicht einen Sprachkurs besuchen sollen, bevor ich Hals über Kopf hierhergeflogen bin. Zu spät.
Mein Blick bleibt an einem weißen Transporter hängen. Ein junger Mann, der nicht viel älter als ich selbst sein kann, steht an der geöffneten Schiebetür und hievt einen Sack in den Innenraum. Vielleicht habe ich bei ihm mit Englisch ja mehr Glück als bei der älteren Bevölkerung.
Entschlossen umfasse ich den Griff meiner Reisetasche fester und marschiere los. Mit großen Schritten überquere ich den Platz, laufe an den Ständen vorbei und stoppe erst am Heck des Transporters. Der Mann lehnt weit mit dem Oberkörper vorgebeugt im Wagen und schiebt einige Kisten zur Seite, bevor er sich aufrichtet und nach dem nächsten Sack greift, der vor dem Wagen steht.
»Hey«, sage ich, als er in der Bewegung innehält, eine Hand um den Sack geschlungen, und mich mit zusammengekniffenen Augen mustert. »Kann ich dich kurz etwas fragen?«
»Hey«, wiederholt er. »Was ist los?« In seiner Stimme schwingt ein leichter Akzent mit.
»Du sprichst Englisch!« Erleichtert mache ich einen großen Schritt nach vorn und würde ihm am liebsten in die Arme fallen.
Dunkelbraune, kinnlange Strähnen fallen ihm in die Stirn, als er den Sack in seinen Händen kurzerhand in den Wagen hebt, wo er mit einem lauten Rumms auf dem Blechboden aufkommt. Dann streicht er sich die Hände an der weißen, mit Schmutz befleckten Schürze ab. Doch statt mir die Hand zu reichen, fährt er sich lediglich in einer ausweichenden Geste durch die Haare und neigt entschuldigend den Kopf.
»Sorry, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und weiß nicht, wann ich mir zuletzt die Hände gewaschen habe.« Er zwinkert mir zu und lehnt sich mit der Schulter gegen den Transporter. »Ich bin Adrian. Kann ich dir irgendwie helfen? Du siehst nicht so aus, als würdest du hier hingehören.« Sein Blick bleibt vielsagend an meiner Tasche hängen, die über meiner Schulter hängt und die ich sehr gerne endlich abstellen würde. »Machst du hier etwa Urlaub?«
Ich schnaube, halb amüsiert über den ungläubigen Ton in seiner Stimme, halb frustriert. »Xara«, stelle ich mich vor und nicke ihm mit einem breiten Lächeln zu. »Und nein, nicht wirklich. Ich möchte nach Surnova.«
Schon als ich den Namen des Dorfes ausspreche, verändert sich sein Gesichtsausdruck. Seine Augenbrauen springen erstaunt in die Höhe, und seine Lippen formen ein stummes O.
Um ihm direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen, spreche ich hastig weiter. »Ich weiß, es ist ein kleines Dorf, aber ich habe meine Gründe. Nur ist es leider so, dass ich hier gestrandet bin, und bei der Touristeninformation konnte man mir nicht weiterhelfen.« Ich deute auf seinen Transporter. »Vielleicht hast du ja einen Tipp, wie ich hier ohne Handyempfang ein Taxi bestellen kann?«
Es dauert eine Sekunde, dann fängt er sich, verschränkt die Arme vor der Brust und kreuzt die Beine. Abschätzig blickt er an mir herab. Ich weiß genau, was er sieht, und auch, dass das kein sonderlich erfreulicher Anblick ist. Ich sehe aus wie jemand, der einen Langstreckenflug in die eklige Kälte hinter sich hat: dicke Boots, noch dickere Leggings, ein dicker Hoodie plus Winterjacke und Messie-Bun, der sehr viel mehr Messie als Bun ist.
Plötzlich hebt sich sein Mundwinkel, und in seiner Wange erscheint ein kleines Grübchen. Doch je länger seine babyblauen Augen auf meine gerichtet bleiben, desto mehr steigt ein anderes Gefühl in mir auf. Ich bin nicht hier, um zu flirten. Doch bevor ich ihm das klarmachen kann, entlässt er mich aus seinem stechenden Blick.
»Es gibt keine Taxis in Ashrode«, sagt er den Satz, den ich nicht mehr hören will. »Nur einen Bus, der alle zwei Tage in die nächste große Stadt fährt. Nach Surnova kommt man nur mit dem eigenen Auto. Es sei denn, du willst zum Fest, aber dann bist du einige Tage zu früh. Dann fahren Busse.«
Busse spricht er aus wie eine Beleidigung oder als wäre es ein Witz, einer, den ich nicht verstehe.
Doch auf meinen verständnislosen Blick winkt er nur ab.
Ich unterdrücke ein nun wirklich frustriertes Seufzen und taste in meiner Jackentasche nach meinem Handy. »Aber ich habe ein Taxi bestellt, das mich von Ashrode nach Surnova bringen sollte«, erkläre ich ihm und kann nicht verhindern, dass meine Stimme das erste Zeichen meiner langsam ansteigenden Verzweiflung zeigt. Sie zittert am Ende des Satzes, genauso wie meine Finger, als ich meine Mails aufrufe. »Ich habe die Bestätigung für die Fahrt samt Kontaktdaten des Fahrers gespeichert. Du hast hier doch bestimmt Netz, oder?«
»Sicher«, sagt Adrian und greift in seine Hosentasche, um ein älteres Modell herauszuziehen. »Zeig her, dann rufen wir über meins an.«
Ich suche in meinen gespeicherten Dateien nach der Reservierungsbestätigung, doch egal, wie oft ich schaue und welche Suchbegriffe ich meinem Handy mitgebe, ich kann sie nicht finden. Dabei habe ich alle wichtigen Dokumente inklusive E-Mails doppelt und dreifach gedownloadet, damit eine solche Situation, wie ich sie jetzt habe, eigentlich ausgeschlossen ist. Langsam, aber sicher setzt Panik ein. »Hey.« Adrian stößt sich vom Wagen ab und macht einen Schritt auf mich zu. Vorsichtig legt er eine Hand auf meine Schulter. »Ich glaube dir, auch wenn ich keine Ahnung habe, welchen Taxidienst du da gefunden hast. Wahrscheinlich war das nur Scam, und du siehst dein Geld nie wieder.«
»Ich habe es nicht im Voraus bezahlt«, erwidere ich, was mir einen weiteren, genauso fragenden Blick einbringt.
»Okay … Also, ich würde dir echt gern helfen, aber es gibt hier meines Wissens nach wirklich keine Taxis. Aber … Ich muss noch die Reste einladen, und dann könnte ich dich –« Er bricht mitten im Satz ab, packt mich am Oberarm und zerrt mich mit einem beherzten Griff an seine Seite. »Woah, Vorsicht, Mann!«, brüllt er über meinen Kopf nach hinten, dann flucht er noch weiter auf Rumänisch.
Es geht so schnell, dass ich ein paar Sekunden brauche, um mich zu sortieren. Das laute Hufgetrappel kommt so plötzlich zum Erliegen, wie es angefangen hat. Mein Herz hämmert in meiner Brust, als ich mich umdrehe und einer schwarzen Kutsche entgegensehe, die genau dort steht, wo ich eben noch stand – und immer noch stehen würde, wenn Adrian mich nicht so vehement zur Seite gezogen hätte.
»Diese verdammten Kutscher denken auch, ihnen gehörten alle Straßen, dabei haben sie genaue Vorgaben, wo sie ihre überteuerten Stadtrundfahrten anbieten dürfen und wo nicht«, schimpft Adrian weiter. »Der Markt ist nur für Autos freigegeben!«, ruft er über das laute Schnauben der zwei Pferde hinweg, die dampfend und prustend vor der schwarzen Kutsche eingespannt sind.
Auf dem Kutschbock sitzt ein älterer Mann mit weißem Haar, der in eine altertümliche schwarze Kutte gehüllt ist. Er ignoriert Adrian und zieht an den Zügeln, um die beiden auf der Stelle tänzelnden Rappen im Zaum zu halten. Dann trifft mich ein eisiger Blick, und ich höre die wenigen Worte, die ich heute nicht mehr erwartet habe – und die in diesem Kontext absolut keinen Sinn ergeben.
»Sie haben ein Taxi bestellt. Entschuldigen Sie die Verspätung, aber der Weg aus Surnova ist weit.«
Ich blinzle verwirrt und sehe zu Adrian, dessen Stirn ebenfalls in Falten liegt. »Du hast eine Kutsche als Taxi bestellt?«
»Ähm.«
Der Kutscher verzieht keine Miene und starrt mich mit einem irgendwie leeren Blick an. Seine Pferde pumpen schwer, und ihre Flanken sind mit weißem Schaum bedeckt. Sofort überkommt mich das schlechte Gewissen. Hat er die Tiere meinetwegen dreißig Kilometer durch die Kälte getrieben?
»Ich … also … nicht, dass ich wüsste«, stammle ich und trete einen weiteren Schritt zurück, näher an Adrian heran, der sich sogleich schützend vor mich schiebt. Ich bin dankbar für die Geste, auch wenn er nicht wirklich viel größer ist als ich und im Fall der Fälle wohl wenig Schutz bietet. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber diese komplett schwarz gehaltene Kutsche lässt all meine Alarmglocken schrillen. Da kann sie noch so schön und reich verziert sein. Noch dazu der Fakt, dass der Kutscher mich an einem ganz anderen Ort gefunden hat, als wir vereinbart haben. Gruselig.
Und als wäre das nicht alles schon suspekt genug, bin ich mir sehr sicher, keine Kutsche bestellt zu haben, sondern ein Auto.
Adrian erwidert meinen aufgeschmissenen Blick mit einem Zucken seines Mundwinkels, dann beugt er sich an mein Ohr. »Ich komme aus Surnova und fahre heute noch zurück, das wollte ich dir sagen, bevor wir fast umgenietet worden sind«, flüstert er. »Wenn du eine Mitfahrgelegenheit brauchst, die ein paar PS mehr zu bieten hat, können wir dich mitnehmen.«
Wir?
Ich nicke, bevor ich dann doch den Kopf schüttle.
Mein Plan, einfach nach Surnova zu laufen, klingt zwar immer noch wahnsinnig anstrengend, aber scheint mir am sichersten zu sein. Adrian ist zwar nett und höflich, aber ich kenne ihn nicht, und das war eins der ersten Dinge, die mir meine Mom eingebläut hat: Steige nie bei einem Fremden ins Auto – es sei denn, er hat eine offizielle Personenbeförderungslizenz.
Ich bezweifle irgendwie, dass der dunkle Kutscher eine solche hat, daher werde ich auch in die Kutsche mit den Höllenpferden freiwillig keinen Fuß setzen. Okay, auch deswegen, aber vor allem aus Gruselgründen.
Doch der Kutscher hat andere Pläne. »Steigen Sie ein, Miss«, sagt er freundlich, wenn auch vehement, und deutet mit der Peitsche in Richtung der Stadtmauer. »Es wird bald dunkel. Wir sollten besser vor Einbruch der Nacht in Surnova ankommen.«
»Ich … ich glaube nicht …«, flüstere ich ausweichend und schlinge meine Hand fester um den Riemen meines Rucksacks. Zum ersten Mal weiß ich nicht, wie ich reagieren soll. Ich will weder die verwöhnte Städterin raushängen lassen noch das ängstliche Mäuschen, aber ich ertappe mich selbst bei dem Gedanken, dass ich offenbar beides bin. »Danke, dass Sie den Weg auf sich genommen haben, aber … aber …«
»Sie fährt bei mir mit«, unterbricht Adrian mich mit fester Stimme, macht einen Schritt vor und zieht seine Geldbörse hervor. »Das sollte reichen.«
Der Kutscher nimmt ihm einige Scheine ab, ohne eine Regung im wettergegerbten Gesicht zu zeigen.
»Hăis!«, ruft er mit monotoner Stimme, schwingt die Peitsche und ruckt an den Zügeln, woraufhin sich die Pferde schwungvoll in Bewegung setzen. In einem schnellen Trab überquert die Kutsche den Platz und verschwindet in einer der Gassen.
Das Hufgetrappel verklingt, dafür bleibt ein Rauschen in meinen Ohren, als ich mich Adrian zuwende. »Sorry«, setze ich an und mache einen Schritt zurück. »Danke für deine Hilfe und das Angebot, aber …« Ich fische mein Portemonnaie aus der Jackentasche und halte ihm einen großen Batzen Scheine hin, ohne sie abzuzählen. »Das hättest du nicht tun müssen. Ich werde laufen.«
Oder den nächsten Bus zum Flughafen nehmen.
Innerlich schüttle ich den Kopf über mich. Tag eins, und ich will schon aufgeben, weil die Dinge nicht ganz so laufen, wie ich es geplant habe? Nein. Ich werde einen Weg finden und ganz bestimmt nicht aufgeben.
»Laufen?« Adrian greift nach meiner Hand, schließt meine Finger um die Dollarnoten und drückt sie sanft nach unten. »Behalte dein Geld. Das wirst du bestimmt noch brauchen, wenn du auf Reisen bist.« Er lässt mich los und hebt eine der auf den Boden gestapelten Kisten auf. »Ich kann verstehen, wenn du nicht mit einem Fremden allein fahren möchtest, aber vielleicht änderst du deine Meinung.« Er wuchtet die Kiste in den Transporter und deutet mit dem Kinn hinter mich. »Das ist Chris.«
Ich drehe mich um und sehe nun auch, dass wir Gesellschaft haben. Dieser Chris ist einen ganzen Kopf größer als ich und überragt auch Adrian um einige Zentimeter, doch auch ihn würde ich nicht älter als Mitte zwanzig schätzen. Seine mitternachtsschwarzen Haare sind zu einem losen, hohen Zopf auf seinem Hinterkopf befestigt, und er trägt die gleiche weiße Schürze über seinem dunklen, legeren Outfit. Anscheinend arbeiten sie zusammen auf dem Markt.
Chris sieht mich lediglich mit einem verurteilenden Ausdruck an, dann wirft er einen fragenden Blick in Adrians Richtung. »Was ist hier los?«, fragt er ihn, seine Stimme ein tiefer Bariton. »Gibt es ein Problem?«
Adrian richtet sich auf, angelt kurzerhand nach Chris’ Hand und verschränkt seine Finger mit seinen, bevor er ihn mit einem Ruck an seine Seite zieht. Der große, breit gebaute Mann stolpert überrumpelt vor, lässt es aber zu, dass Adrian ihm einen Kuss auf die Wange drückt. Dann grinst Adrian mich breit an und zwinkert mir zu. »Möchtest du deine Entscheidung noch einmal überdenken und mit uns fahren?«
Auf Chris’ blassen Wangen bildet sich ein rosa Schleier. »Mit uns fahren? Wohin?«
»Das ist Xara, und sie möchte nach Surnova«, erklärt Adrian seinem Freund und streicht mit dem Daumen über dessen Handrücken, bevor er ihn loslässt und beiläufig die letzte Kiste vom Boden hebt. »Sie mitzunehmen ist doch kein Problem, oder?« Er stellt die Kiste ab und dreht sich zurück zu mir. »Und du musst keine Angst haben, dass einer von uns dir an die Wäsche will. Wir schwimmen beide sehr tief in anderen Gewässern.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Redewendung anders geht«, murmelt Chris und legt sich eine Hand in den Nacken. Im Gegensatz zu Adrian ist er offenbar kein Fan von spontanen Planänderungen.
»Ach, wie auch immer. Ich wollte Xara nur die Angst nehmen, die für junge Frauen heutzutage allgegenwärtig ist. Die muss sie vor uns ja nun wirklich nicht haben.« In einer weiteren übertrieben klischeehaften Bewegung klappt Adrian seine Hand ab und macht einen genauso übertriebenen Kussmund, bevor er seine vollen Lippen auf Chris’ Wange presst, die mittlerweile einen dunklen Rotton annimmt.
Ich kann nicht anders und stoße ein erleichtertes Kichern aus, bevor ich zustimmend nicke. Mein Gefühl bei Adrian war von der ersten Sekunde an ein gutes, und ihn mit seinem Freund zu sehen, lässt auch die letzte Alarmglocke in mir verstummen.
Chris grunzt ungehalten und wendet sich nun direkt an mich. »Was willst du in Surnova? Niemand will nach Surnova.«
Ich unterdrücke ein Seufzen, dabei kann er nicht wissen, wie oft ich diesen Satz heute schon gehört habe.
Zu meinem Glück springt Adrian ein. »Xara will das offensichtlich doch. Wir können das arme, durchgefrorene Mädchen doch nicht allein ihrem Schicksal überlassen. Komm schon, Babe. Wo ist das Problem?«
»Wir haben in Surnova nicht einmal Hotels«, protestiert Chris.
Adrian verdreht die Augen, ignoriert den Einwand seines Freundes und öffnet die Beifahrerseite des Transporters. »Du bist schlank und klein und passt auf den Mittelsitz. Deine Taschen können wir hinten zwischen die Kisten quetschen.«
»Nur wenn es für euch wirklich in Ordnung ist«, gebe ich nach einem kurzen Moment der Stille zurück. »Ich kann mir auch hier eine Unterkunft nehmen und versuche morgen, ein Taxi zu …«
»Hier gibt es keine Taxis«, unterbricht Chris mich mit einem vielsagenden Blick in Adrians Richtung und tritt zur Seite, um auf den Transporter zu deuten, nun doch eine eindeutige Einladung an mich. »Wieso hast du ihr das nicht gesagt?«
Adrian lacht leise auf, doch als er den Mund zu einer Erwiderung öffnen will, bringe ich ihn mit einem raschen Kopfschütteln zum Schweigen und lasse die Tasche von meiner Schulter rutschen. »Wo darf ich sie abstellen?«
Kapitel 3
Xara
Wir haben Ashrode kaum über die Zufahrtsstraße verlassen, da weiß ich bereits, dass ich meine ursprüngliche Laufen-Idee unter »völlig realitätsfern« verbuchen kann. Ich wäre schon an der ersten Kreuzung aufgeschmissen gewesen, an der es nach links in Richtung der hügeligen Landschaft geht, nach rechts in die gleich aussehende karge hügelige Landschaft oder geradeaus in – Überraschung – ebenfalls eine hügelige Landschaft.
Natürlich gibt es hier keine Straßenschilder, an denen man sich orientieren könnte, und als Adrian nach rechts abbiegt, ausgerechnet auf den schmalsten der unbefestigten Wege, den ich nie und nimmer selbst eingeschlagen hätte, sacke ich resigniert zurück gegen die Lehne. In diesem Moment beschließe ich, nichts mehr infrage zu stellen und auf die Jungs zu vertrauen. Etwas anderes bleibt mir, wenn ich ehrlich bin, ohnehin nicht übrig.
Recht schnell verändert sich die Landschaft; aus den hügeligen kargen Feldern werden immer dichter besiedelte Waldabschnitte aus hohen und alten Eichen, deren Kronen die restlichen Farbpigmente am Himmel schlucken. Trotz Dunkelheit findet Adrian mühelos seinen Weg durch die engen Pfade, die immer weiter ins Nichts zu führen scheinen.
Adrian ist wohl der Gesprächigere meiner beiden Reisebegleiter. Während der Transporter über Wurzeln, lose Pflastersteine und durch sandige Löcher rumpelt, berichtet er völlig entspannt von ihrem Tag auf dem Markt. Zweimal in der Woche transportieren er und Chris die gesamten landwirtschaftlichen Erträge ihrer Dorfgemeinschaft nach Ashrode, um diese dort zu verkaufen. Wie ich es mir schon gedacht habe, ist die Altersstruktur in Surnova nicht gerade jung, und Chris und Adrian nehmen damit der älteren Bevölkerung einen großen Teil der Arbeit ab. Recht schnell verfestigt sich der erste Eindruck von ihnen. Die beiden gehören zu den Guten.
»Und ihr stammt also aus Surnova?«, frage ich, als der Weg eine weitere Gabelung nimmt und wir tiefer in den Wald fahren. »Wie ist es, in so einem kleinen Dorf zu wohnen?« Der Transporter ächzt unter der Belastung durch die Steigung des Pfades, und nicht nur einmal heult der Motor gefährlich auf, wenn Adrian das Gaspedal zu fest durchdrückt.
»Hm«, macht er gänzlich unbeeindruckt davon, dass sein Transporter ihm unter den Händen wegstirbt. »Ehrlich gesagt ist es nicht die Umgebung, in der man sich als Mitte Zwanzigjähriger gern aufhalten möchte, aber der da«, er wirft ein schiefes Grinsen über meinen Kopf hinweg, »hat einen großen Anteil daran, dass es nur halb so wild ist, im Dorf zu bleiben.«
Chris rutscht grummelnd tiefer in seinen Sitz. »So schlimm ist Surnova nun wirklich nicht.«
»Stimmt«, pflichtet Adrian ihm über das laute Ächzen und Ruckeln des Wagens bei. »Wenn man Menschen hasst und seine Nase am liebsten den ganzen Tag in Geschichtsbücher steckt, wovon es in Surnova viel zu viele gibt, dann ist es wohl der perfekte Ort.«
»Tote Menschen sind die besseren Menschen.«
Adrian lacht, ich hingegen bin mir nicht sicher, ob Chris einen Scherz gemacht hat. Dafür klingt er viel zu ernst, aber vielleicht ist diese grollende, knappe Art auch nur seiner Persönlichkeit geschuldet.
»Viele Geschichtsbücher?«, greife ich den unverfänglichen Teil seiner Aussage auf. »Interessierst du dich für Geschichte?«
»Ja.«
Adrian gibt ein amüsiertes Schnauben von sich. »›Ja‹ ist die untertriebene Version von: Geschichte ist sein Leben. Er hat schon in der Grundschule alle mit seinem Wissen ausgestochen, da hat es niemanden gewundert, dass aus ihm jemand geworden ist, der diese langweiligen Schinken schreibt.«
»Wow, ernsthaft?«
Chris versinkt noch tiefer in seinem Sitz. Ich kenne ihn gerade einmal eine Stunde und weiß, dass er nicht der Typ ist, der gern die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auf seinen blassen Wangen liegt ein rosa Schimmer, wie vorhin, als Chris so selbstbewusst nach seiner Hand gegriffen und ihn geküsst hat.
»Das ist nicht so spektakulär«, wiegelt er prompt ab. »Ich war nur sehr schnell mit dem Studium und kann den Doktor größtenteils von zu Hause machen.«
»Weil man in Surnova ohnehin nichts anderes machen kann?«
Er kneift auf anklagende Weise die Augen zusammen, bevor er seinen Blick von mir abwendet und durch die beschlagene Windschutzscheibe nach draußen sieht. »Sozusagen.«
Adrian brummt amüsiert. »Nimm das nicht persönlich. Chris ist bei Fremden immer zurückhaltend. Wir leben bei meiner Grandma auf dem Hof und helfen ihr mit dem Betrieb, seit mein Großvater vor zwei Jahren unerwartet verstorben ist. Sie ist zwar noch fit für ihr Alter, aber allein mit den Tieren und den Feldern dann doch überfordert. Ich kann von Glück reden, dass Chris so ein Menschenmuffel und gemeinsam mit mir zurückgekommen ist und mir das zu keinem Zeitpunkt zum Vorwurf gemacht hat. Wenn es nach ihm geht, übernehmen wir den Hof und bleiben unser ganzes Leben dort.« Seinem tiefen Schnaufen und dem anschließenden Kopfschütteln nach zu urteilen, teilt Adrian diese Zukunftsvision nicht.
»Zurückgekommen?«, frage ich. »Seid ihr zum Studieren weggezogen?«
»Jup. Der Abschluss der Wald-und-Wiesen-Schule in Surnova ist der höchste Bildungsgrad, den man dort bekommen kann. Danach durften wir für ein paar Jahre Großstadtluft in der zivilisierten Welt schnuppern, mehr war mir nicht vergönnt.« Er zwinkert mir zu. »Für Chris war das ohnehin nichts. Er hat sich die meiste Zeit in unserem Wohnheimzimmer verkrochen, und ich hatte schon ein echt schlechtes Gewissen, dass er meinetwegen mit an die Uni gegangen ist, sodass ich nach dem Tod meines Großvaters nicht lange überlegen musste, ob ich mir das hier«, er gestikuliert nach draußen durchs Fenster, wo es bis auf das hin und wieder durch die Baumkronen blitzende Mondlicht nichts zu sehen gibt, »auch für die nächsten Jahre geben will.«
Chris scheint sich nicht daran zu stören, dass über ihn statt mit ihm geredet wird. Er blickt stumm durch die Frontscheibe und sitzt so regungslos, dass ich es mit dem schlechten Gewissen zu tun bekomme. Dass ich ihre Dynamik störe, ist nicht schwer herzuleiten, wenn man auch nur einen Funken Empathie besitzt.
»Hm«, mache ich daher nur ausweichend, um das Gespräch auslaufen zu lassen. Ich nehme meine Hände vor die Lippen und puste hinein. Es ist in dem Transporter beinahe kälter als draußen. Die Heizung funktioniert eindeutig nicht, und so alt und rostig, wie der Wagen ist, überrascht mich das auch nicht. Nicht dass ich mich beschweren will. Ich bin trotz des unangenehmen Gefühls, mich zwischen etwas gedrängt zu haben, wo ich offensichtlich nicht hingehöre, trotzdem froh, dass die beiden mich mitnehmen. Sehr froh. Aber ich habe auch nichts dagegen, den Rest des Weges das stille Mäuschen zu spielen, damit zumindest Chris meine Anwesenheit ausblenden kann.
»Sorry«, murmelt Adrian mit einem Seitenblick auf mich. »Chris mag es kalt, und ich habe mich daran gewöhnt, in seiner Gegenwart immer zwei Schichten mehr anzuziehen. Babe? Ist es okay, wenn ich …«
Er streckt gerade die Hand nach einem Regler an der Armatur aus, da gibt Chris ein ablehnendes Schnauben von sich.
»Das muss nicht sein«, sage ich rasch, als Chris sich schon aufsetzt. Der Stoff seiner Jacke knistert, bevor das Ratschen des Reißverschlusses verrät, was er vorhat.
»Hier«, gibt er unter einem Grunzen von sich und reicht mir seine Jacke.
»Oh, nein, das ist nicht nötig«, sage ich hastig, doch bereue es sofort, als mich sein eisiger Blick trifft. Chris’ dunkle Augen verweilen eine Sekunde auf meinen, bevor er den Blick von mir reißt und mir die Jacke in schnellen und überraschend sanften Bewegungen über dem Schoß ausbreitet. Es ist so kalt in dem Wagen, dass allein der kurze Austausch gereicht hat, um all seine Körperwärme aus dem Stoff zu vertreiben, und so fühlt es sich an, als würde er mir eine Jacke überlegen, die schon einige Stunden in der Kälte gelegen hat.
»Mir ist sowieso viel zu warm, und ich ertrage den Gestank der alten Heizung nicht«, erklärt er und rückt so weit von mir ab, wie es der schmale Sitz möglich macht. »Kein Thema.«
Viel zu warm, natürlich. Er will nur, dass ich die Klappe halte.
Also schiebe ich meine Hände unter den kalten Stoff und bleibe stumm, habe die Rechnung aber ohne Adrian gemacht.
»Und du?«, fragt er. »Was treibt dich ausgerechnet nach Surnova? Du musst natürlich nichts erzählen, wenn es dir zu persönlich ist, aber ich bin neugierig, und die Fahrt dauert noch eine Weile.«
Da es verdammt unhöflich ist, nicht zu antworten, setze ich mich aufrechter hin und wende mich Adrian zu. »Ich studiere auch – zu Hause in Philly –, nehme aber gerade ein Urlaubssemester, unter anderem, um herauszufinden, welche Hauptfächer ich wählen will. Psychologie ist ganz okay, aber ich glaube, meine Leidenschaft ist es nicht.« Das ist zwar nicht wirklich die Antwort auf seine Frage, aber vielleicht gibt er sich ja damit zufrieden.
»So ging es mir mit BWL.« Adrian seufzt schwer. »Ich habe es nur gewählt, damit ich mit dem Abschluss gut genug vorbereitet bin, um den Hof nicht sofort in den Ruin zu treiben, aber wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich lieber etwas studiert, was mir wirklich Spaß macht.« Er nickt über meinen Kopf hinweg zu Chris. »So wie er. Ich war immer neidisch, wie enthusiastisch er in seinen Geschichtsbüchern versinken kann. Gleichzeitig ist all der langweilige Kram aber nichts für mich. Glücklicher Kerl, da drüben.« Seine Stimme wird warm, und über seine Augen legt sich ein zarter Schleier, der das helle Blau weich schimmern lässt. »Er ist mit so wenig zufriedenzustellen.«
»Du bist nicht wenig«, grätscht Chris ihm hart in den Satz, was Adrian ein Grinsen hervorlockt.
Da er nichts darauf sagt, liegt der Ball anscheinend in meinem Feld. Ich räuspere mich, da ich erneut das Gefühl habe, mich zwischen etwas zu drängen, wo kein Platz für mich ist.
»Was hättest du studiert, wenn der Hof nicht wäre?«
Adrians Grinsen verschwindet, und er kratzt sich am Kinn, während er nachdenklich mit der Nase wackelt. »Das ist die Preisfrage. Meine Interessen sind so breit gefächert, dass ich mich nicht festlegen konnte, bis ich es musste. BWL war die sichere Wahl, aber …«
»Du kannst dir immer noch überlegen, was du machen willst«, kommt es wieder von rechts. »Wir haben alle Zeit der Welt. Du kannst den Hof verkaufen, und wir können überallhin, wo du willst.«
»Wir werden nicht jünger«, gibt Adrian mit einem resignierten Ton in der Stimme zurück und zieht die Schultern hoch. »Ich sehe mich nicht mit Anfang dreißig ein neues Studium aufnehmen. Aber wie auch immer, was treibt dich denn nun ausgerechnet nach Surnova?« Mist, das Ablenkungsmanöver hat wohl nicht gezogen. »Gibt es nicht auch in der Nähe von Philly abgelegene Orte, an denen man sich auf sich selbst fokussieren kann?« Er zwinkert mir zu. »Wo es aber wenigstens Taxis gibt?«
Sein spielerischer Ton bringt mich zum Lachen, und ich stoße ihn genauso locker mit der Schulter an.
Chris zeigt keine Reaktion auf meinen kleinen Vorstoß, was ich als positives Zeichen sehe. Vielleicht ist er wirklich nur zurückhaltend und hegt keinen persönlichen Groll gegen mich.
»Witzbold. Aber ja, das ist nicht der einzige Grund, warum ich ausgerechnet nach Surnova will. Ich …« Ich zögere, sehe aber letztlich keinen Grund, warum ich nicht erzählen sollte, warum ich hier bin. Es ist ja nicht so, dass es ein Geheimnis ist, und mit etwas Glück können die Jungs mir sogar weiterhelfen. Dörfer wie Surnova sind doch bekannt für ihren Tratsch und die Verbundenheit unter den Bewohnern. »Ich versuche, etwas über meine Herkunft zu erfahren. Ich wurde in Surnova geboren.«
Für diese Aussage ernte ich einen hohen Laut von Adrian, während er passend dazu die Augen aufreißt, bevor er sich wieder auf die immer enger werdende Straße konzentriert. »Was? Ernsthaft? Du bist also eine von uns?«
»Ja, aber ich wurde schon mit zwei Wochen in die USA gebracht. Ich weiß nicht, wie und von wem, aber genau das ist der Grund meiner Reise. Ich will versuchen, etwas über meine leiblichen Eltern herauszufinden.«
»Dann ist Chris definitiv dein Mann.« Er trommelt grinsend auf dem Lenkrad herum. »Er kann dir blitzschnell jede einzelne Aufzeichnung heraussuchen, in der du etwas über deine Familie erfahren kannst oder die dir sonst hilfreich sein kann. Nicht wahr, Babe? Du wirst Xara doch helfen?«
Chris brummt und nickt, sagt aber nichts weiter dazu.
»Wo wirst du wohnen?«, fragt Adrian, und ich höre den vorsichtigen Unterton in seiner Stimme. Ich kann ihm nicht verdenken, skeptisch zu sein, schließlich hat er mein »Es gibt hier keine Taxis, sondern nur Kutschen«-Drama hautnah mitbekommen. Ich habe mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was meine Vorbereitung angeht. Dabei war die verdammt akribisch.
»Keine Sorge, ich weiß, dass es in Surnova keine Hotels gibt. Ich habe mich online auf eine Anzeige einer Dame gemeldet, die etwas Unterstützung mit ihrem Anwesen braucht. Ein wenig Haushalt gegen Kost und Logis ist perfekt für das, was ich vorhabe.«
»Klingt gut. Hast du eine Adresse? Wir können dich dort absetzen.«
»Ja, klar. Sekunde.« Nur ungern ziehe ich meine Hand aus der wohligen Wärme, die sich mittlerweile unter Chris’ Jacke gesammelt hat, und taste nach meinem Handy in meiner Tasche. Dabei entgeht mir Chris’ plötzliche Aufmerksamkeit nicht, genauso wenig wie sein Blick auf das Display, als ich den Ordner mit den gespeicherten Unterlagen aufrufe. Okay, doch nur scheu.
Der Ordner lädt und lädt und bleibt leer.
»Das gibt es doch nicht«, murmle ich und klicke mit immer schneller schlagendem Herzen erneut auf den Button. Der Ordner öffnet sich ein weiteres Mal, aber das Ergebnis bleibt dasselbe.
»Wieder das Netz?«, fragt Adrian vorsichtig, als würde er meine innere Anspannung spüren.
»Das habe ich schon aufgegeben«, murre ich mit einem Blick auf den nicht vorhandenen Daten-Balken. »Aber die Mails und Unterlagen, die ich gespeichert habe, laden auch nicht.«
»Hast du sie offline gespeichert?«, fragt er mit einer steilen Falte in der Stirn. Ich kann ihm nicht übel nehmen, dass er langsam anfängt, mich als dummes Blondchen abzustempeln. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich langsam selbst anfangen, an meiner Intelligenz zu zweifeln.
Doch ich habe genau diesen Fall in Betracht gezogen und ihn vermeiden wollen, indem ich allen Netzausfällen zuvorkomme.
»Ich habe mich mehrfach versichert, dass die Unterlagen lokal gespeichert sind, weil ich mit dem schlechten Netz gerechnet habe«, erwidere ich und atme tief ein, um mich zu beruhigen, während ich in meinem Kopf nach Details krame, die mir weiterhelfen könnten.
»Die Straße fängt mit F an«, sage ich. »Fermo … Fermi … und dann irgendwas mit Campus?« Ich lache hilflos. »Gott, das ist so peinlich. Ich habe wirklich …«
»Fermă Pădurea și Câmpul«, unterbricht Chris mich in einem tiefen Ton, der mir einen Gänsehautschauer über den Nacken jagt.
»Ja! In meinen Ohren klang das zwar ganz anders, aber ja! Ich glaube, das ist die Adresse! Kennst du die Besitzerin?«
Er hebt seine dunklen Brauen und tauscht über meinen Kopf einen irgendwie seltsamen Blick mit Adrian.
Doch bevor ich nachhaken kann, räuspert Adrian sich. »Das ist keine Adresse, sondern der Name vom Hof – der von meiner Grandma.« Ich habe die Information noch nicht verdaut, da schüttelt er mit angestrengt zusammengekniffenen Brauen den Kopf. »Aber sie hat ganz bestimmt niemanden eingestellt. Schon gar nicht über das Internet.«
Kapitel 4
Juraj
Nächster.« Gelangweilt hebe ich die Hand und mache eine knappe Geste. Gleich drei Diener jagen auf mein Zeichen hin los und entsorgen die menschliche Hülle, die nach meinem Verhör noch übrig ist. Leises Wispern dringt durch den Saal und wird von schweren, ungleichmäßigen Stiefelschritten übertönt. Sie ächzen unter dem Gewicht des Mannes.
Die Taviani schrecken vor nichts zurück, auch nicht davor, solch niedere und schlecht ernährte Menschen in ihren Clan aufzunehmen. Es dauert Monate, wenn nicht Jahre, bis sich ein derart heruntergewirtschafteter Körper erholt hat, auch mit italienischem Billigblut in den Adern.
Blut macht überraschend wenig vom Gesamtgewicht eines Menschen aus. Ich schätze, bei seinen einhundert Kilogramm sind es großzügig gerechnet nur acht Liter, die nun als dunkelrote, schmierige Lache auf dem hellen Steinboden zurückbleiben. Acht Liter stinkendes Blut, die ungeachtet ihrer dreckigen Quelle auf unsere Jünglinge trotzdem ihren Reiz haben.
»Sir.« Einer der Diener tritt vor. Sein Oberkörper hebt und senkt sich unter seinen hastigen, angestrengten Atemzügen. Seine helle Stimme wackelt, ist durchzogen von Furcht und etwas anderem. Ungestilltem Hunger, der zu diesem frühen Zeitpunkt der Verwandlung auch vor einem Taviani nicht haltmacht.
Er zuckt zusammen, als ich ihm meinen Blick zuwende, doch er ist tapfer und hält ihn, auch wenn sein gesamter Körper vor Verlangen bebt. Er ist jung, und die Blutlache hinter ihm eine Verlockung, die nicht viele Kleinkinder so gut überstehen wie er. Niederes Blut hin oder her. Kleinkinder natürlich nicht im Sinne von echten Kindern. Die Edrivs sind mein Aufgabengebiet, meine Verantwortung, meine Babys, auch wenn sie in menschlichen Jahren längst erwachsen sind. Aber in den Jahren der Unsterblichkeit gemessen, sind sie eben einfach noch Frischlinge.
Es ist das erste Verhör, dem er beiwohnt, und dafür macht er sich gut. Sagen werde ich ihm das aber sicher nicht. Durch Lob drehen die Kleinen gerne auf, und ich mache mir meine Arbeit nicht schwerer, als sie schon ist.
»Sir«, wiederholt er und mahlt mit den Kiefern, als könnte er so verhindern, dass seine Fangzähne durch sein Fleisch brechen. »Ich weiß nicht, ob ich … es ist schwer.« Ein weiterer, sichtbarer Schauer schüttelt seinen Körper, und er schlingt seine Arme in der schwarzen Kutte um seinen Oberkörper, als könnte er sich so davon abhalten, der Versuchung zu erliegen.
»Den Hunger zu kontrollieren ist nicht schwer«, widerspreche ich seinen Worten laut. »Du musst es lediglich wollen. Sei stärker.«
Sein Versuch, dem Hunger entgegenzuwirken, hält nur wenige Sekunden. Seine Nasenflügel weiten sich, als er die metallischen Geruchspartikel aufnimmt, die durch den Raum schwirren. Er erbleicht, als würde er noch einmal sterben. Seine Augen lodern rot auf, und seine spitzen Eckzähne schießen hervor. Er bleckt sie, doch dann krümmt er sich bereits und fällt auf den Boden. Sein Geist kämpft, sein Körper verliert. Seine Fingernägel brechen, als er über den steinernen Boden kratzt, um der Versuchung zu widerstehen. Das schrille Geräusch löst einen Schauer auf meinem Nacken aus. Immer diese dramatischen Babys.
»Wage es nicht!« Meine Stimme schallt durch den großen Saal und hallt von den hohen Wänden wider. Die Fackeln werfen flackernde Schatten auf den Boden und lassen das Blut im Schein des Feuers glitzern. Es ist eine Einladung, der er nicht länger widerstehen kann, da hilft auch meine Drohung nicht.
Er winselt vor Schmerz und krabbelt zu der Lache, obwohl sich sein Körper sichtlich sträubt. Immer wieder bäumt er sich auf, er zischt vor Schmerz, den der Hunger in ihm auslöst.
Ich respektiere den Versuch, den er unternimmt, daher bleibe ich mit verschränkten Armen stehen und hindere ihn nicht daran, an sich selbst zu scheitern. Andere würden zu diesem Zeitpunkt schon längst sinnlich stöhnend das Blut vom Boden aufschlürfen. Ich denke, morgen wird er noch ein wenig länger durchhalten. Vale lernt erstaunlich schnell.
Etwas abseits stehen zwei weitere junge Diener, die zwar auch beide noch Kleinkinder sind, aber schon deutlich mehr Erfahrung darin haben, sich nicht der ersten Verlockung hinzugeben, die sich ihnen bietet. Dennoch blinzeln beide sehr angestrengt und starren hoch zur Decke, um nicht ebenfalls auf die Knie zu fallen und über den Boden zu kriechen, um an den roten Saft zu gelangen.
»Juraj«, winselt Vale mit einem letzten Rest von Widerstand in der Stimme, bevor mir das hastige Schlurfen und Schlucken verraten, dass er gegen den Hunger verloren hat.
So gierig, wie er sich auf die Lache stürzt, könnte man meinen, dass Dorian uns nicht gut versorgt, doch das ist nicht der Fall. Der gesamte Keller des Anwesens ist eine reine Vorratskammer; gut gefüllt mit allem, was man braucht. Blutgruppe A, B, AB und O, positiv und negativ, gekühlt und konserviert oder frisch von der pulsierenden Ader. Sogar tierisches Blut ist vorhanden, auch wenn das eine absolute Geschmacksverirrung ist, wenn man mich fragt. Aber wie auch immer, für jede noch so ausgefallene Zunge ist ausreichend vorrätig. Und der Speiseplan der Kleinkinder wurde speziell auf ihre körperlichen Begierden angepasst: Sie bekommen allein am Morgen drei Mahlzeiten aufgetischt und haben jederzeit die Möglichkeit, sich einen kleinen Snack zu gönnen, um das Verlangen in Schach zu halten. Aber unsere Arbeit ist herausfordernd, und es dauert naturgemäß eine Weile, bis der Hunger kontrollierbar ist.
Insgeheim kommt es mir zugute, dass die Kleinkinder die Drecksarbeit übernehmen. Als Dorians engster Vertrauter und höchster Diener ist es meine Aufgabe, den Laden am Laufen zu halten. Ich bin dafür verantwortlich, dass alles seinen Gang geht und Dorian ungestört dem nachgehen kann, was er seit Jahrhunderten macht. Und wohin sonst mit dem Abfall, der mir nur das gesamte Anwesen mit seinem Gestank verpestet, wenn nicht in die Venen der Edrivs?
Statt also einzugreifen, warte ich, bis der Kleine mit einem letzten, befriedigten Grunzen aufblickt. Seine Augen sind vom Rausch gezeichnet, leuchten dunkelrot im Halbdunkel des Saals, während sie unruhig von links nach rechts zucken.
Ich gebe ihm noch ein paar Sekunden, um sich selbst zu sortieren, dann trete ich näher.
Er stinkt nach dem fremden, niederen Blut, und so halte ich einen gewissen Sicherheitsabstand. Im Gegensatz zu den frisch verwandelten Edrivs, die noch keinen Geschmack entwickelt haben, löst unreines Blut in mir nur Übelkeit aus. »Satt?«
Vale blinzelt, dann legt sich die Wildheit in seinen Augen, und er zieht die Schultern an seine Ohren, als würde er auf seine Strafe warten. Aber ich bin nicht Dorian und lasse den Kleinkindern solche Anfangsschwierigkeiten durchgehen. Bestrafungen beschleunigen den Prozess nicht, sondern sorgen nur für mehr Probleme, die ich am Ende lösen muss. Und ich habe genug andere Dinge zu tun.
»E-es tut mir leid, Sir«, wimmert er und streicht sich mit dem Handrücken über die blutigen Lippen. Ein dunkles, hungriges Grollen löst sich aus seiner Brust, was prompt in ein leidendes Brummen übergeht.
Nein, der Arme macht sich selbst genug Vorwürfe, da braucht es keine Belehrungen von mir. Doch eine Bewegung in meinem Augenwinkel lässt mich instinktiv vortreten.
»Steh auf.«
»J-ja, aber natürlich, Sir.« Er kommt schwankend auf die Beine, gerade in dem Moment, in dem ich einen Lufthauch hinter mir spüre.
»Wer ist das?« Dorians Stimme ist scharf, schneidend und so leise, dass ihn wohl kaum jemand im Saal verstehen kann. Niemand außer ich. »Er stinkt. Was macht er hier, und warum lebt er?«
In der nächsten Sekunde wickeln sich seine langen Finger um den Hals des Jungen, der in menschlicher Rechnung gerade volljährig geworden ist. Dorians Siegelringe schneiden in die bleiche Haut, der prominente, rote Diamant seines Eherings fängt das flackernde Kerzenlicht von den Wänden ein und wirft es zurück.
»Zu wem gehört er?«
»B-bitte, E-Euer Gnaden, ich … ich habe nicht … ich wollte nicht …«
»Zu welchem Clan gehört er?«, wiederholt Dorian ungeduldig. »Bădescus?«
Wie immer spricht Dorian nicht mit demjenigen, den er in seinem Griff gefangen hält, sondern über ihn. Er sieht ihn nicht einmal an, sondern bohrt seinen harten Blick tief in meinen, wartet auf meine Antwort.
Es hat eine Zeit gegeben, da war das anders, und er hat erst etwas getan, bevor er gefragt hat. Natürlich war ich derjenige, der das Elend dann beseitigen musste.
Ich bin froh, dass unsere Dynamik mittlerweile eine andere ist und er wenigstens manchmal auf mich hört.
»Er ist ein Baby, Dorian«, sage ich mit ebenfalls gesenkter Stimme. »Lass ihn los. Er gehört nicht zu den Bădescus, er ist einer von uns.«
Ich kann gar nicht so schnell blinzeln, wie Dorian von ihm ablässt und Abstand zwischen sich und den Jungen bringt.
Dieser starrt mit aufgerissenen, wieder deutlich abgekühlten Pupillen, die in einem sanften Rosaton mit der Dunkelheit verschmelzen, in die Richtung, in der Dorian nun auf seinem Thron sitzt und wartet.
»Geh«, knurre ich und gebe Vale einen auffordernden Stoß in den unteren Rücken, damit er Dorians Geduld nicht weiter strapaziert. »Geh in den Keller und lass dir von den Wächtern Zugang zu einem Spender geben. Du stinkst wirklich abartig. Du kannst von Glück reden, dass Dorian dir nicht den Kopf abgerissen hat, Kleiner.«
Er stolpert vor und zieht die Schultern nach oben, als könnte er sich so vor diesem Szenario schützen. »A-aber natürlich, Sir. Ich … es tut mir leid. Ich werde mich bessern.«





























